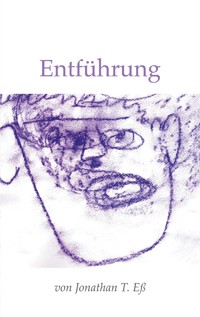
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Text ist sehr mutig und bewegend. Er dürfte vielen Betroffenen das Gefühl geben, nicht alleine zu sein, alle anderen/weiteren Leser wird er auf besondere Art ergreifen und sensibilisieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Wenn es anders wäre
Prolog – Choclait Chips
Drehbleistift mit Perlmutt
Deutschstunde
Licht
Irland
Ein Erwachsener und zwei Kinder
Der See
Maikäfer
Salatsauce
Vaterverwechslung
Kampf
Epilog – Finger
Danksagung
VORWORT
Dieses Buch ist vor allem für mich, um einen Umgang mit dem zu finden, was damals passierte. Es ist ein Schritt, um die Erinnerungen zur Erinnerung werden zu lassen und als das zurückzulassen. Dieses Buch ist eine Therapie – meine Therapie. Aber es ist noch mehr:
Es ist der Versuch, einen Ausdruck für etwas zu finden, für das es weder Gesprächspartner noch Verständnis gibt. Es ist die Beschreibung einer modernen Entführung und wie es dazu kam. Es ist Verständnis und Trost vor allem für mich aber auch für alle anderen, die Übergriffe erdulden mussten, ohne sich wehren zu können. Es ist eine Stellungnahme gegen das Unverständnis und gegen die Ausgrenzung, die all jene erfahren, die mit den Folgen solcher Erfahrungen von den anderen allein gelassen werden. Allein gelassen, weil die anderen es nicht verstehen können und weil sie davor Angst haben – verständlicherweise.
Aber dieses Buch ist noch mehr. Es ist der Versuch, die Gefühle zu beschreiben, die eine Entführung entstehen lassen, die sie dann hinterlässt und deren Gemenge es schwierig machen, mit anderen Menschen zu interagieren und zusammenzuleben – „Nein“ sagen zu können, Grenzen zu ziehen, Nähe zuzulassen und Distanz herzustellen. Aber auch Freude, Wut, Ärger, Zorn und Trauer angemessen zum Ausdruck bringen zu können. Denn es sind vor allem diese Gefühle, die noch vor der Aussprache eines Wortes darüber entscheiden, ob etwas möglich ist oder nicht und ob etwas passt. Nach einer Entführung oder einem heftigen Übergriff sind die Voraussetzungen dafür anders als bei jenen Menschen, die das Glück hatten, von so einer Erfahrung nicht betroffen zu sein.
Und hier rum geht es, um Betroffenheit und um den Mut, das auch zu sagen. Es geht darum zu erklären, wie Mobbing und Ausgrenzung in der Schule und in den Sportvereinen die Grundlage dafür legen, dass Übergriffe entstehen können. Es geht darum, dass die Institutionen – vermutlich auch aus eigener Betroffenheit – versagen und es geht um die Tatsache, dass Vaterlosigkeit für einen heranwachsenden Jungen aber auch für Mädchen sehr gefährlich ist, weil Vaterlosigkeit Schutzlosigkeit bedeutet und jene anlockt, die sich etwas Verbotenes holen wollen, was sie sonst niemals bekommen könnten – Pädophile.
Am Ende bleibt die Debatte über Opfer und Täter, die meiner Ansicht nach unzureichend und verstörend ist. In der MeToo-Bewegung sind es Frauen, die von Männern bedrängt und ausgenutzt wurden – und an der Oberfläche ist es scheinbar einfach, weil die Männer die Täter sind und die Frauen die Opfer. Dann ist scheinbar alles klar und der Täter kommt bestenfalls in den Knast und die Frau bekommt Schadensersatz. Aber so einfach ist das nicht. Zum einen, weil es sehr schwierig ist einen Übergriff nachzuweisen, so dass am Ende Gerechtigkeit entsteht. Die Auseinandersetzung mit Polizei, Staatsanwaltschaft usw. ist meist noch einmal genauso schlimm wie der Übergriff an sich – wenn nicht sogar noch schlimmer. Hinzu kommen die Verdrehungen, die dazu führen, dass die Täter sich mit der Einstellung entziehen, dass es der andere ja so gewollt habe und womöglich noch selbst daran schuld sei. Und am Ende entspricht es auch der Unwahrheit, dass Männer stets Täter sind und Frauen die Opfer. Es geht auch umgekehrt und das wird bisher aus meiner Sicht nicht ausreichend berücksichtigt.
Männern steht es genauso zu, zu sich zu stehen und nachträglich Verständnis und Gerechtigkeit für sich zu verlangen und auch um Hilfe zu bitten. Männern, die Opfer wurden, werden vor allem von Frauen mit demselben Schicksal nicht verstanden, weil das in der MeToo-Debatte bisher nicht vorkommt und weil es nicht ins Klischee der Gesellschaft passt, in der wir heute leben. Für Männer ist es viel schwerer, zu ihren Gefühlen zu stehen, wenn sie durch einen Übergriff durch einen Mann oder durch eine Frau verletzt wurden. Denn wir wurden von anderen Glaubenssätzen geprägt als Frauen. „Hart wie Krupp-Stahl“ – das war der Spruch für unsere Väter. Aber der Spruch „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“ ist zwar moderner aber deswegen genauso schlimm, weil er uns verbietet, zu unserem Schmerz und unseren Gefühlen auch zu stehen und das macht auf Dauer krank.
Ich habe viel zu lange geschwiegen, aber damit ist jetzt Schluss ...
Jonathan T. Eß
Chiemsee im Sommer 2022
Wenn es anders wäre
wenn es alles anders wäre
wäre der Krieg nie gewesen
wenn es alles anders wäre
hättest Du diese Zeilen nie gelesen
wenn es alles anders wäre
dann wären die Bomben nie gefallen
die bösen Stimmen wären verhallen
und nie auf D(m)einer Welt gewesen
wenn es alles anders wäre
wäre der Garten voller Blumenduft
und Leichtigkeit läge in der Luft
und Frieden – so wie es wäre
wenn es alles anders wäre
dann wäre ich nicht Dein Kind
wir wären nicht die, die wir heute sind
sondern Menschen mit anderem Erbe
so wie es ist, ist der Garten entzweit
es gedeiht Unkraut – verdrängt Heiterkeit
Es zieht dunkler Schatten über das Licht
Krieg und Flucht stören das Gleichgewicht
aber es ist so und nicht anders
und Du wirst es lesen
und ich bin immer Dein Sohn gewesen
Du warst der Vater und ich das Kind
wir sind die – und nur die – die wir heute sind
der Schmerz und das Elend sind unsere Begleiter
und machen uns schwer, sie bring uns nicht weiter
der Garten ist öde – kein Licht und Frust
die Blumen vertrocknet krepiert ohne Lust
jetzt bin ich der – der ich eben bin
kenn Deinen Bomben entleerten Sinn
trage ihn in mir und fühle vergebens
das war doch nicht der Sinn unseres Lebens
neben Krieg, Asche und Hass
schau was Du mir alles gegeben hast
Du warst ein Junge hast mit mir gespielt
hast Blumen gesät und Ernte erzielt
zusammen sind wir früh morgens im See
geschwommen
und haben die Last von der Schulter genommen
damit bist Du mein Vater gewesen
und wirst meine Zeilen irgendwann lesen
und was mich am aller meisten bewegt
Du hast sie in mich hinein gelegt
trotz Bomben, Flucht, Fluch und all diesem Schmerz
bin ich am Leben – es schlägt mein Herz
bald kommt der Tod, das ist gewiss
mir graut davor wie ich Dich dann vermiss
manchmal wünscht ich, Du hättest alles anders
gemacht
doch dann hätte ich diese Zeilen niemals zustande
gebracht
es ist gut wie es ist und wie es war
Du bist mein Vater und immer da
Jonathan T. Eß
Prolog – Choclait Chips
„Sie können mich Jonathan nennen.“
„Okay, Jonathan. Sie wissen, dass wir hier einen Rahmen und ein Thema brauchen. Bitte nur eines sonst verzetteln wir uns.“
„Ja, das kann ich verstehen. Ich neige dazu, thematisch zu springen, weil es über die lange Zeit zu viel geworden ist.“
„Das ist verständlich, dass Sie das tun. Aber wir können die Sachen nur zusammen sortieren und nach einer Lösung suchen, wenn wir uns auf eine konzentrieren. Was ist heute ihr Anliegen?“
„Ich möchte über eine zurückliegende Demütigung sprechen, die vielleicht für sich genommen nur eine Kleinigkeit war. Sie ist mir aufgefallen, weil Sie mir gestern eine neue Maske geben wollten und ich sagte: „nur, wenn es eine frische ist“. Das war sehr misstrauisch von mir. Natürlich würden Sie mir genauso wenig eine benutzte Maske anbieten, wie Sie mir ein benutztes Taschentuch geben würden. Dann haben Sie schmunzelnd in dem Mülleimer da nachgesehen, ob da noch eine Maske für mich ist. Sie haben ihn symbolisch ein Stück vorgezogen und mir dann aus der Schachtel eine frische Maske gegeben. Der Mülleimer hat mir aber gezeigt, dass meine Bemerkung der Situation nicht angemessen war und dass es mein Misstrauen war, das zunächst den Mülleimer und dann erst eine frische Maske hervorgeholt hat.“
„Das war mir so gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo Sie es sagen“.
„Gut, dann möchte ich Ihnen erzählen, aus welcher Situation dieses Misstrauen hervorgegangen ist. Es ist von früher. Als Beispiel möchte ich es mit einer Erinnerung versuchen, die wohl jetzt an die 30 Jahre alt ist. Kennen Sie Choclait Chips?“
„Ja, da gab es mal eine Werbung im TV, in der die so herumflogen und aus der Luft gegriffen wurden. Wie alt waren Sie damals“?
„Vielleicht 14.“
„Was ist passiert?“
Ich schließe die Augen. „Es war in der kurzen Pause in der 9. Schulklasse. Es war der Raum mit der grünen Tür. Sie stand offen. Die Lehrerin war raus gegangen. Es war laut. Ich saß für mich allein. Es war zu der Zeit, als die anderen Jungs in meinem Alter einen Kopf größer waren und ihre Gesichtszüge kantig wurden. Links waren die Fenster und der Blick fiel auf ein Vordach, auf dem Kieselsteine lagen. Der Klassenraum war im ersten Stock. Hinten saßen die Mädchen und rechts hatten sich die Jungs aus der Klassenclique zusammengerottet. Sie saßen auf den Tischen und es war eine rivalisierende und auftrumpfende Gruppe. Das wäre ja noch okay gewesen. Aber es waren auch einfach Angeber und sie hackten in den Pausen auf den Außenseitern und Schwächeren herum. Ohne dass die Lehrer es sahen und ohne dass das, was man heute Mobbing nennt, von der Schule verhindert worden wäre. Ich gehörte nicht zu dieser Gruppe. Thorsten war ein verschlagener Junge. Er hatte ein Fuchsgesicht, abstehende Ohren und ich wusste, dass er hinterhältig war. An dem Tag in dieser Pause knisterte er mit einer Packung Chocolait Chips herum. Eine sechseckige Pappverpackung mit knisternder Plastikfolie darin. Die anderen Jungs guckten gespannt. Thorsten guckte sich freudig um. Ich bemerkte seinen Blick und freute mich über seine einladende Haltung und er kam einen Schritt auf mich zu. Ob ich wohl doch zu der Clique dazu gehören durfte – nur einen Augenblick? Nur für die kurze Pause? Er bot mir Choclait Chips an und irgendwie wusste ich, dass Thorsten verschlagen war. Aber meine Freude und mein Wunsch dazuzugehören waren größer als mein Misstrauen und dann ging alles ganz schnell. Ich griff in die Pappschachtel. Die Plastikfolie raschelte und meine Finger erreichten etwas, das mich überraschte und nicht zu dem passte, was ich erwartet hatte. Ich nahm davon, schloss die Hand und steckte es in den Mund. Es ging so schnell und ich war so überrascht von der Niederträchtigkeit dieser List. In meinem Mund biss ich auf Hundekuchen. In der Packung waren keine Choclait Chips, sondern Frolic Hundekuchen. Die Jungs lachten alle und ich ging zum Mülleimer, um alles auszuspucken. Thorsten freute sich über meine Niederlage und die anderen beglückwünschten ihn. Ich schwieg und ignorierte das Theater, ging auf meinen Platz, behielt die Tränen, die Wut und den Zorn für mich.“
Das war eine Demütigung und ich spürte die Wut von damals in mir aufsteigen und gleichzeitig die Tränen. Da öffnete ich die Augen. Die Wut lag über der Trauer und ich verbiss die Tränen. Mich trifft ein milder Blick der Co-Therapeutin – einer Krankenschwester für Gefühle. Ein Blick, der mich in den Arm nimmt, in dem tiefes Verständnis liegt und der verrät „... Ich würde das gerne für Dich erledigen, aber das geht nicht. Das musst Du selbst machen.“
„Ja, das war eine Demütigung. Das stimmt. Aber was wollen Sie jetzt damit machen. Wollen Sie das so lassen? Sie haben seitdem nie wieder Choclait Chips gegessen – stimmt‘s?“
„Ja, genau, nie wieder. Ich würde gerne meine Gefühle dazu zulassen können und die emotionale Welle durchlassen, damit es danach besser ist und Platz für etwas Neues entsteht.“
„Was hindert Sie daran?“
„Vor allem die innere Bewertung, dass ich den Schmerz nicht zeigen darf – nicht zeigen kann.“
„Aber Sie wissen doch, dass das nicht stimmt.“
„Trotzdem ist es fürchterlich schwer diese innere Barriere fallen zu lassen und dem Schmerz dieser Demütigung Ausdruck zu geben.“
„Das ist wohl so. Sie können es aber wieder lernen. Wie hätten Sie sich diese Situation gewünscht und was hätten Sie damals gebraucht? Sie haben heute selbst die Macht ihrer Erinnerung einen anderen Ausdruck zu geben.“
„Oh, keine Ahnung, wie soll denn das gehen?“
„Wir können das einmal zusammen versuchen. Sie schließen die Augen und stellen sich diese Situation erneut vor. Aber Sie verändern sie durch Ihre Wünsche und Vorstellungen.“
„Okay, das ist einen Versuch wert. Keine Ahnung, wohin es führt, aber ich versuche es.“
„Stellen Sie sich die Situation noch einmal vor ...“
Und ich schließe die Augen. „Da war der Klassenraum, die kurze Pause, die Lautstärke, die Mädchen und die Jungsclique. Thorsten kommt mit der Packung Choclait Chips auf mich zu und ich greife hinein. Aber dieses Mal wende ich das Blatt. Ich sehe den Hundekuchen in meiner Hand und schleudere ihn vor Thorsten auf den Fußboden, sodass er in mehrere Stücke zerspringt und durch den Raum fliegt. „Dafür kannst Du Dir einen anderen Idioten suchen. Der fiese Trick funktioniert bei mir nicht!“ schnauze ich Thorsten an. Ich drehe mich um und verlasse die Klasse. Die Mädchen applaudieren und eine Mädchenstimme ruft mir hinterher: „Super – dem hast Du es jetzt richtig gegeben. Das war längst fällig.“
„Sehr gut haben Sie das gemacht!“
Ich spüre, wie die Gedanken mein Gefühl beim Kragen packen und aus der Niederlage ein Erfolg wird.
„Machen Sie es noch einmal.“
Jedes Mal werden die Gedanken lebhafter, bis ich Thorsten die ganze Packung aus der Hand schlage und die Frolic-Ringe quer durch den Klassenraum fliegen – bis sich Thorsten unter dem Applaus der Mädchen eine schallende Ohrfeige einfängt, bis ich meine Augen öffne, die Tränen in den Augenwinkeln spüre und die Lippe bebt. Und ich setzte mich ganz aufrecht.
„Sehr gut machen Sie das. Sie dürfen es zulassen.“
Dann klingelt das Telefon. „Da ist die Margit im Patientengespräch.“ Die Co-Therapeutin verlässt den Raum mit dem Telefon am Ohr und die Tür schließt sich. Ich bleibe zurück und die Gefühle schwanken hin und her. Dann kommen sie als Welle auf mich zu und ich lasse sie. Ich lasse die Tränen kurz durch und die Trauer, die kurz aufheult. Dann ist es nach nicht mal 30 Sekunden wieder vorbei. Die Türe öffnet sich und in dem Blick, den ich bemerke, liegt ein unausgesprochenes „Na? Schön, dass Du es geschafft hast!“ und sie sagt mit einem Lächeln: „Wollen Sie Ihr Gefühl noch etwas genießen?“. Ich schäme mich ein bisschen – aber wofür? Die alte Situation war jetzt eine andere und ich hatte etwas von damals gespürt, was ich mir 30 Jahre nicht erlaubt hatte.
„Das haben Sie gut gemacht!“
Perplex erhebe ich mich – weil ich in diesem banalen Zimmer, auf der Station eines Krankenhauses durch die Zeit gereist war und in meinem Inneren etwas geändert hatte, was mir zuvor wie eine unüberwindbare Mauer vorgekommen war.
„Das können wir gerne auch mit anderen Erinnerungen machen.“
„Ja, vielen Dank.“ Ich war erschöpft.
„Ach ja und essen Sie Choclait Chips und wenn Sie das machen, hätte ich auch gerne welche.“
Drehbleistift mit Perlmutt
Am Drehbleistift schimmert grünlich das Perlmutt und die goldene Klammer. Eine Erinnerung an meinen Vater drängt sich aus der Vergangenheit, wie er da saß nach den ersten Gesprächen, 9 Jahre nach dem letzten GAU unseres Miteinanders – Vater und Sohn – Nähe und Distanz. Immer wieder gab es Kontaktabbrüche, wenn es nicht so lief, wie er es wollte. Damals ging es nochmal um die Frage, wer für wen eigentlich verantwortlich war, um den Unterhalt von damals und um den Unterhaltstitel, den er nie anerkannt hat. Vor 9 Jahren wollte er Geld. Er wollte, dass ich seine Bahnfahrten bezahle – für ihn aufkomme. Er wollte die Verantwortung verdrehen – ich sagte ihm „nein“ und er kam nie wieder und brach den Kontakt ab. Ich schickte ihm zwei Mal den Gerichtsvollzieher. Genützt hat das nichts.
9 Jahre später nach einer sehr frühen Anfahrt klopfte ich um 9 Uhr am Sonntag an seine Tür in Österreich. „Du spinnst wohl!“ – begrüßte er mich. „Um diese Zeit schlafe ich. Komm in einer halben Stunde wieder.“ – Und schlug mir die Tür vor der Nase zu. Was folgte, war wieder eine Verdrehung der Verantwortung, denn er sprach sich mit meiner älteren Schwester ab. Er rief sie in Norddeutschland an und fragte, was er machen solle. Der Vater, der nicht weiß, was er tun soll, fragt sein ältestes Kind. Womöglich war der, der da fragte, innerlich selbst noch ein Kind – äußerlich inzwischen 79 Jahre und lungenkrank.
An diesem Tag gingen wir auf einen der Berggipfel in der Nähe und sprachen miteinander. Er mit Walking Stöcken und mobilem Sauerstoff mit Nasenbrille und ich ganz langsam und als Beobachter von uns beiden. Ich gab ihm Verständnis und Respekt für seinen Weg und er erzählte von sich als er 5 Jahre alt war, von den Fliegern, den Bomben, der Flucht, den Vergewaltigungen. Von dem Keller in Ellrich, in dem er mit 7 Jahren mit seiner Mutter die Nacht verbrachte, weil sie von Russen an der Grenze erwischt wurden. Dort hat er sich eingenässt. Er erzählte von seiner Angst vor den russischen „Tellermützen“ der Offiziere – als er sie in den 1990ern auf den Bahnhöfen wiedersah, als die Russen aus Deutschland abzogen. Er sprach über seinen Vater, der vor Leningrad von einer Mine verletzt wurde und blind war.
An dem Tag behielt ich das Lenkrad meines Autos in der Hand. Ich hatte ein Navigationssystem und fand den Weg auch ohne ihn. Ich hatte mein eigenes Geld für mein Mittagessen, ich war nicht mehr auf ihn angewiesen und beobachtete uns beide – wir waren fünf: Er 79 mit einem fünfjährigen inneren Kind und ich mit meinen beiden inneren Kindern – sie saßen auf dem Rücksitz. Meine inneren Kinder kannte ich damals noch nicht und ich wusste auch noch nicht, wie alt sie waren. Ich war der Vater für uns beide an dem Tag und empfand ein Gefühl der Vergebung. Er hatte sein Leben so gut gemacht, wie er es eben konnte. Er war in den 1980ern mein Vater – so gut er es eben konnte. Seine Last war enorm. Am Abend erzählte er von seiner Erkrankung der Lunge, von der Zeit, die ihm noch blieb und dass er auf keinen Fall in einem Altenheim leben wollte. Er beharrte auf seiner Selbstständigkeit und





























