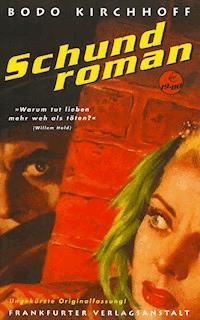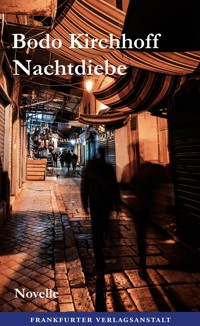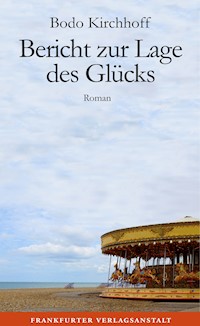7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Daniel Deserno, 39, bis vor kurzem Investmentbanker, ist Patient in der Kurklinik Waldhaus, unter lauter Prominentenleichen mit Depressionen. Freundin Selma aus der Kulturstiftung der Bank hat ihm nach einem Streit unter dem Weihnachtsbaum mit dem eben ausgepackten Edelkorkenzieher seinen Porsche ruiniert, wie das männlichste Teil unter Daniels Kollegen hieß. Und in der teuren Kurklinik hängt er den Zeiten ungehemmter Sex- und Geldvermehrung nach, bis eine neue, junge Patientin auftaucht: die mit einem Buch über ihre Hämorrhoiden soviel Erfolg hatte, dass sie darüber schwermütig wurde. Daniel und die Neue kommen sich rasch näher. Dann aber kündigen Selma und auch noch Daniels altlinke Mutter ihren Besuch an, weil im Waldhaus ein berühmter Autor aus seinem Goethe-Roman liest. Und im Zuge dieser Lesung über Johanns Nummer mit seiner Sponsorin Anna Amalia kommt Daniels Porschewrack zu einem nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg, während ringsherum die Finanzwelt einstürzt. In seinem neuen Schundroman verschränkt Kirchhoff vier verrückte Liebesgeschichten mit dem Kollaps eines verrückten Systems, brandaktuell - und doch zeitlos wie das Liebesverlangen des Helden: ein aberwitziger Kommentar zu den Krisen in der Welt des Geldes und der Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Bodo Kirchhoff
Erinnerungen anmeinen Porsche
Roman
| Hoffmann und Campe |
1. Auflage 2009
Copyright © 2009 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
www.hoca.de
ISBN 978-3-455-40214-8
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg
www.kreutzfeldt.de
Erinnerungen anmeinen Porsche
Für alle Ursels dieser Welt
1
Regel Nummer eins: Wer ein Buch schreiben will, muss Zeit und Geld haben und wenigstens einen guten Grund. Zeit hatte ich genug unter all den Prominentenleichen im Waldhaus, ebenso Geld, ob in Übersee oder hier, und mein Grund lag auf der Hand, wenn ich an mir heruntersah; dazu kam die Weltlage in diesem Herbst, womit ich das allgemeine Finanzchaos meine. Fehlte noch der Anstoß, um aus Notizen ein Buch zu machen, und da reichte es, dass gleich zwei ungebremste Frauen am selben Wochenende in der Kurklinik auftauchen wollten: die Frau, ohne die es keinerlei Grund gäbe, überhaupt nachzudenken, und meine liebe Ursel, die mich zur Welt gebracht hat.
Wie immer, wenn sie Ideen hatte, rief sie am späteren Abend an, meine rauchende, nachtmenschige, irgendwie immer noch linke Mutter – ab und zu sollte man sich diesen nicht mehr zu steigernden Verwandtschaftsgrad schriftlich vor Augen führen –, und kaum hatte sie ihren Besuch angekündigt und nebenbei nach meinem Befinden gefragt, kam der übliche Schwall zur Lage der Dinge aus Sicht ihrer Alters-WG. Dein Kapitalismus ist am Ende, rief sie, es gibt nur noch Schulden, die ganze Welt ist verschuldet, wie soll das weitergehen? Kein Wunder, wenn bei uns die Sozis mit Kommunisten paktieren, nur kann ich leider keine Frau wählen, die anderen den Mund verbietet: Isch-Basta heißt die bei mir nur – am Anfang vom Ende steht immer der Größenwahn! Etwas mehr Bescheidenheit, Dannymann, und du wärst nie in dieser Klinik gelandet und könntest nach wie vor Dinge tun, auf die Männer so stolz sind! Hier holte Ursel zum ersten Mal Luft, und hier hole auch ich Luft: für einen Rückblick – auch wenn Rückblicke nicht bei allen beliebt seien, wie mir ein schreiberfahrener Mitpatient zu bedenken gab; nur sollte sich einer, der’s ernst meint, nicht gleich bei allen beliebt machen wollen: Regel Nummer zwei für mein Gefühl.
2
Am Anfang war bekanntlich das Wort, nicht der Größenwahn, der kam erst nach der Schöpfung, und Worte stehen auch oft am Beginn von Karrieren, Omerta etwa bei der Mafialaufbahn oder Ruhm bei einer Filmkarriere. Und auch in meinem Fall kam das Wort nicht von Gott, sondern aus Amerika und hieß einfach hedge, in unserer Sprache Hecke oder Winkel, und das Hedging war die durch Hecken gesicherte, jeden Winkel nutzende große Geldvermehrung. Kurz: Ich war Investmentbanker, einer mit Turboperformance und Porsche RS, und meine Mutter dachte, ich würde Baumschulen in Afrika finanzieren und C-Klasse fahren. Und dann passierte das mit dem Korkenzieher und meinem GT, aber fangen wir bei A an. Ich heiße Daniel und sollte Daniela heißen, meine Männlichkeit war also von vornherein durch ein A belastet, und das auch bald laut und deutlich, gefolgt von einem O, was bei den alten Griechen ja das Z war und damit ganz hinten stand.
Ah, da kommt sie! und Oh, verdammt! soll nämlich ein Chor aus fünf Frauen bei meinem termingerechten Ausscheiden aus der rein weiblichen Sphäre durcheinander- gerufen haben, und demnach wäre ich nicht nur als unerwarteter Junge, sondern auch im Zustand sichtbarer Erregung zur Welt gekommen, das alles im Rahmen einer Frankfurter WG-Geburt, Oktober neunzehnhundertsiebzig. Mit von der Partie: meine Mutter Ursel und die drei anderen Frauen der Wohngemeinschaft, Bea, Doro, Ingeborg, sowie im Hintergrund der sogenannte Erzeuger, also mein Vater, ein junger Brillenträger namens Gunther, und an vorderster Front die parteiische Hebamme von der Roten Hilfe. Auch sie hatte mit einem Mädchen gerechnet, soll aber nur den Kopf geschüttelt haben, während es von Gunther hieß, er habe vor Enttäuschung geweint. Gunther war der Einzige, der kochen konnte in der WG, doch seine größte Tat war das Anzünden einer öffentlichen Telefonzelle, an der es eigentlich gar nichts zu brennen gab, und trotzdem konnte Ursel ihm danach einreden, er sei Terrorist, er werde gesucht, damit er bei ihr untertauche, als verstecktes, kochendes Würstchen. Und keine neun Monate später erblickte ich das Licht der Welt, angeblich mit Tönen, als hätte ich an meinem Zustand schon Vergnügen gehabt, wovon gar nicht die Rede sein konnte.
Dieses Vergnügen kam erst mit siebzehn und währte einundzwanzig Jahre, womit ich sagen will, dass meine beste Zeit vorbei ist, nachdem mir eine Freundin – Head of Department bei der Kulturstiftung der Bank, der ich gedient habe – das dafür entscheidende Teil mit ei- nem Korkenzieher aus Italien ruiniert hat, und das auch noch an Heiligabend. Überall war Blut, selbst auf den Hirten vor der Krippe, und nach einem Noteingriff und stationärer Behandlung auf der Urologie – von einem Pfleger, Robin, mit ermunternder Lektüre versorgt, den Bekenntnissen einer jungen Hämorrhoidenpatientin – konnte ich am Tag der Entlassung plötzlich nicht mehr gehen. Die Beine knickten einfach weg wie bei einer Marionette, und eine Schwester schob mich im Rollstuhl von Abteilung zu Abteilung, bis am Ende, in der Psychiatrie, ein keineswegs zerstreuter Professor von spontan reaktiver Gangstörung im Rahmen einer personalen Gesamtkrise sprach.
Und so landete ich schließlich, mit Hilfe von Ursels Energie und meinem Depot auf den Caymans, in der für Gesamtkrisen angeblich besten Umgebung, nämlich der hotelartigen Privatklinik Waldhaus, in einer Suite für Behinderte mit Blick auf den südlichen Schwarzwald, sogar vom Bett aus, und hinab auf die ferne Rheinebene, wenn ich mich auf den Balkon rollte; neben den therapeutischen Maßnahmen sollte auch die Landschaft zur Heilung beitragen, mit dem erklärten Ziel, den eigenen traurigen Zustand anzunehmen, wenn möglich als Freund – ich meine hier den Zustand meines Porsches, wie das Teil dort unten in dem Department (corporate financing), das ich nach Kräften bereichert habe, genannt wurde.
Aber welcher Mann, der es gewohnt ist, in vier Sekunden auf hundert zu sein, will schon ein Wrack als Freund? Und überhaupt: Ich wollte bereits mit zwölf eine Freundin, und am liebsten wäre mir Romy Schneider gewesen, was mit dem Auftauchen alter Zeitschriften infolge einer polizeilichen WG-Durchsuchung zu tun hatte, nachdem Ursel genau zweihundert Meter unterhalb meiner späteren Wirkungsstätte vom Staatsschutz fotografiert worden war: als Aktivistin im sogenannten Frankfurter Häuserkampf. Zu dem wenigen, was der Polizeitrupp unbeachtet gelassen hatte, gehörten die Bravo-Hefte und andere Illustrierte aus Ursels Jugend, und ich stieß auf ein ganzes Heft aus Anlass des dritten und abschließenden Sissi-Films und verliebte mich in das süße Gesicht der Schneider, das war das eine. Und das andere vollzog sich dann, ironischerweise, vor dem durchtriebenen Gesicht von Liz Taylor in einem Bericht über den Film Giganten mit dem saumäßigen Schauspieler James Dean, der auf einmal das viele Öl findet: links die Taylor mit ihrer spitzen Brust unter einer engen weißen Bluse und rechts der abgerissene Typ mit dem emporschießenden schwarzen Strahl. Und kaum war von meiner Seite, mit Blick auf die Taylor, getan, was getan werden musste, gingen die Gedanken – auch in späteren Beziehungen stets das Problem – zu dem Ölfund beziehungsweise sprudelnden Reichtum. Und in den ersten Waldhausmonaten mit viel Zeit zum Nachdenken erkannte ich in diesem Bild – der Ölstrahl und sein Einfluss auf das Glück – einen der Gründe dafür, dass ich bis zu der Heiligabendsache zu denen gehört hatte, die durch Termingeschäfte mit dem Ölpreis spielten, während ich mir weiter den Kopf darüber zerbrach, wie ein Korkenzieher von Alessi so sehr von seinem eigentlichen Ziel, dem Korken einer Flasche Tignanello, zur Feier des Abends von mir mitgebracht, hatte abweichen können.
Und über all dem Nachdenken war der Winter zu Ende gegangen und Frühling und Sommer verstrichen, und ich war immer noch an den Rollstuhl gefesselt, ohne die angestrebte Freundschaft geschlossen zu haben; die Heilung hatte bis zum Herbst keinerlei Fortschritte gemacht, auch wenn ich mir in manchen Nächten schon vorstellte, Bett und Rollstuhl zu verlassen, um ein Leben in der Karibik zu führen. Erst in der zweiten Septemberhälfte, während außerhalb des Kurparks die Geldwelt aus den Fugen geriet, kam mit einem Mal Bewegung in das Ganze: kaum auszudenken, wenn man bis dahin nur im Einerlei der Tage eines Waldhauspatienten von morgens bis abends auf ein Wunder gewartet hatte.
3
Der Kuralltag in dem festungsartigen Haus mit eigenem Park begann, entgegen allen üblichen Gepflogenheiten in Einrichtungen dieser Art, erst um acht Uhr dreißig mit dem Geräusch eines Staubsaugers auf dem Flur – in der Bank für mich höchstens ein Zeichen, schlafen zu gehen, wenn nämlich die rumänische Putzkolonne morgens um fünf in meine Abteilung kam und ich immer noch am Bildschirm saß, neben mir die Pizzareste der Nacht. Nie war ich dagegen von Staubsaugerlärm geweckt worden, schon gar nicht in der Kindheit, weil keine meiner WG- Tanten auch nur auf die Idee gekommen wäre, Staub zu saugen.
Ich war jedenfalls immer schon wach, wenn mir die kleine Kim – die ich Kim I nenne, um nicht den Überblick zu verlieren – das Frühstück brachte. Kim I hatte stramme weiße Beine, die unter ihrem Kittel aufleuchteten, wenn sie sich nach einem Knopf oder Geldstück bückte, von mir schon nachts auf dem Boden platziert, und obwohl mein Trick längst durchschaut war, hob sie die Dinge weiter auf und reichte sie mir mit einem Lächeln, für das ich inzwischen so dankbar war wie für strahlende Pobacken in früherer Zeit, auch wenn mich diese Zeit mehr als alles andere beschäftigte: angeblich eine kindliche Fixierung, wenn ich Frau Dr. Schmauch, meiner Gesprächstherapeutin, folgte. Und ihr folgte ich nur allzu gern, weil sie eine Stimme hatte wie Romy Schneider, weich und verlangend, wie in Das Mädchen und der Kommissar, dem Film, den Ursel nach Aufkommen der Videorekorder immer wieder heimlich gesehen hatte in ihrer Frauen-WG, mit mir an der Seite; eine Stimme, die es völlig unmöglich machte, dem, was die Schmauch sagte, zu widersprechen. Die Gedanken waren einfach woanders, sie waren bei ihren halblangen wippenden Haaren, wenn sie zur Tür hereinkam, und den von engen Pullovern bedeckten Hüften, bei ihrem Mund, der eher schmal war und doch etwas Volles hatte, sozusagen das volle Programm versprach, und ihren erwachsenen Händen, die sie gern im Schoß hatte, aber nicht ausruhend, eher sprungbereit: als könnten sie jederzeit auch bei mir landen. Und genau dahin wander- ten die Gedanken im Laufe jeder Sitzung mit Frau Dr. Schmauch: zu ihren Händen in meinem Schoß, etwas weiblich Warmem, wie ich es zuletzt mit meiner fast großen Liebe erlebt hatte, in der Woche, als das Barrel Rohöl die Hundertdreißigdollarmarke nahm und mir ein Bonus winkte, für den viele ein Leben lang schuften müssten. Und hier wäre die Gelegenheit, das Thema zu wechseln und von Geld und Autos zu reden, also auf meine innigsten Beziehungen zu kommen, aber die Schmauch riet einem bei jeder Gelegenheit, auch dem Peinlichsten die Stirn zu bieten; also bleibe ich noch bei dem Drang, meinen Porsche einem weiblichen Wesen anzuvertrauen: dem Drang, der immer noch da ist, trotz Korkenzieherattacke – von der ich im Übrigen wollte, sie hätte mir auch die Wünsche verstümmelt.
Schon seit den ersten Tagen in dieser Suite – einer der bescheideneren im Waldhaus, das man sich als diskretes, leicht verblichenes Schloss vorstellen muss, still auf bewaldeter Anhöhe – hatte mich zum Beispiel der Mund von Kim II beschäftigt. Sie war für die Reinigung der Räumlichkeiten zuständig, und die Art, wie sie nach dem Frühstück, also dem Auftritt der kleinen Kim I, das Parkett wischte – etwas gelangweilt, aber auch konzentriert, konzentriert auf mich, der ich vom Bett aus zusah –, weckte meinen ganzen unversehrten Drang. Kim II konnte etwas Englisch, und hätte mich nur ein kaputtes Bein an den Rollstuhl gefesselt, wäre es sicher ausreichend gewesen, um sich mit ihr über das Wetter oder die Bedingungen ihrer Arbeit, wenn nicht über koreanisches Investment zu unterhalten, also ihr Vertrauen zu gewinnen, mit dem Ziel, sie nach einigen Tagen um ein wenig praktische Anteilnahme zu bitten. Aber ich litt an kaputtem Schwellkörper, um im Bild zu bleiben, einem, der beim geringsten Anwachsen, ja oft schon bei dem Gedanken daran, mit Koliken und einem inneren Glühen antwortete.
You better today?, fragte Kim II in einer Verschnaufpause gern, noch vor dem Bett kniend, und ich sah auf ihren wirklich erstaunlichen Mund, erstaunlich, weil er so harmlos hübsch war, mit blassen, aber großen Lippen, die obere wie mit dem Zirkel gezogen, die untere etwas hingeworfen, eine strenge und eine schlampige Lippe, dazwischen die weißesten Zähne und gelegentlich eine verlegene Zungenspitze, wie nach ihrer Frage. No, erwiderte ich dann immer wahrheitsgemäß, und sie setzte ihr Gewische fort, während ich die Decke zurückschlug, mehr aus alter Gewohnheit in Gegenwart einer Frau als in der Hoffnung, ich könnte Kim II damit erweichen. Wie in sich verkrümelt lag dann mein Porschewrack als hellbeiges Würstchen da, kaum aus der Behaarung ragend, die ich nicht mehr entfernt hatte, für wen auch; etwas Lebloses ging von ihm aus, ein Anblick, auf den meine badische Krankengymnastin gern mit einem Seufzer reagierte.
Sie hieß Marlies und war offenbar glücklich verheiratet, jedenfalls erzählte sie bei jeder Gelegenheit von ihrem Mann, den Kindern und einem weißen Pudel, während die kräftigen Hände, von mir privat bezahlt, alles taten, um mich aus dem Rollstuhl zu kriegen, das hieß, meine schon dünn gewordenen Beine nicht noch mehr verkümmern zu lassen, sondern im Gegenteil: sie wieder in Schwung zu bringen. Nur wollte ich in den ersten Waldhausmonaten gar nicht in Schwung gebracht werden; wenn es etwas gab, woran ich noch Halt fand, dann war es die Unbeweglichkeit. Ich hatte Milliarden um den Globus bewegt, meine Pupillen waren nie zur Ruhe gekommen, jetzt wollte ich nur noch traumlos schla- fen – oder ins Nichts flüchten, wie Frau Dr. Schmauch mein Bestreben schon in der zweiten Sitzung gedeutet hatte. Sie ist recht intelligent und sieht noch dazu gut aus, bis hin zu den Waden und Fesseln, auf die ich Wert lege, eine insgesamt furchteinflößende Mischung aus Köpfchen und anderem, wie bei der Frau, die mir am Ende zum Verhängnis wurde. Und wenn die Schmauch nach unseren Gesprächen in der Suite noch mit den Fingernägeln leicht zerstreut über ein Buch auf meinem Nachttisch strich, so war auch das nicht ohne.
Die ganzen Monate über lag dort zuoberst das schmale Buch eines lebenden Philosophen, der darin einen letzten Gottesbeweis führt – besonders in den toten Stunden des Tages die beste Lektüre für jemanden, der den Ölpreis und damit den Wert der ganzen Welt in die Höhe getrieben hatte, schon um zu erfahren, wer noch über ihm stehen könnte. Ich mochte übrigens diese toten Stunden, sie waren wie ein Teil von mir oder bestätigten mein lebloses Dasein; die erste begann mit dem Abgang von Kim II stets mit den Worten You will be better tomorrow und endete mit der Visite von Professor Cordua, zuständig für alle körperlichen Beschwerden und außerdem Leiter und Gesellschafter des Waldhauses, ein Mann, der mir seit meiner Einlieferung Anfang März einmal pro Woche das Leben vergällt hat, als würden durch seine Hand all die faulen Zahlenströme, die ich je auf den Weg gebracht hatte, zu mir zurückkehren, glühend durch meine Harnröhre.
4
Ansonsten hatte ich den Monat März lesend verbracht, wie das die Bettlägerigen oder Verzweifelten ja oft tun, sonst gäbe es längst keine Bücher mehr für diese Sorte Menschen. Ich las Die Leiden des jungen Werthers, der Waldhausbibliothek entnommen, der Titel hatte mich angesprochen, und Goethe schien mir der richtige Mann für ein Buch, das es mit dem Hämorrhoidenbestseller aufnehmen konnte. Nur war dann das Leiden bei Goethe kaum zu vergleichen mit dem der jungen Autorin oder mit meinem Leiden, höchstens in seiner Ursache, nämlich der Liebe: die mir nach wie vor ein Rätsel war. Andererseits hätte der Ausruf Es kann nicht, es kann nicht so bleiben! auch mein Ausruf sein können. Und dann fielen einem wie mir auch die zwei Ökonomien auf, die Goethe gegeneinandergestellt hat: auf der einen Seite Werther, der Liebende, der alles vergeudet, ohne irgendetwas, schon gar nicht seine Zeit, in Rechnung zu stellen, auf der anderen Seite Albert, der Ehemensch, der sich sein Glück kleinkrämerisch einteilt; was fehlte, war der Weg, mit dem man Erfolg hat, das gemanagte Risiko. Alles in allem also kein Ratgeber, aber ich kam damit über den März.
Und den Februar, um das hier auch gleich zu sagen, also die erste Zeit nach der stationären Behandlung, verbrachte ich in Ursels Alters-WG mit Fahrstuhl und Balkonblick auf die Straßenecke, an der sie im Häuserkampf unseren späteren Außenminister vor dem Schlimmsten bewahrt haben soll, sodass es in ihren Kreisen schon hieß, nicht Gunther, sondern er sei mein Erzeuger – ein absurder Gedanke, wenn man mein Hybrid-Financial-Product-Gesicht betrachtet (spitze Nase, blaue Augen, unbestimmtes Lächeln). Auf jeden Fall war ich zur weiteren Pflege vorübergehend in der Luxus-WG, in die ich Ursel eingekauft hatte; sie lebt dort mit zweien aus der alten Nordend-Bande, pensioniert nach dreißig Jahren Familienberatung, und diese beiden, Bea und Doro, schwankend zwischen alter Zuneigung zu Dannymann, wie mich Ursel ja heute noch nennt, und stiller Sympathie für die Korkenziehertäterin (fürchte ich), wurden nicht müde, beim abendlichen Rotwein die Umstände meiner Geburt zu wiederholen, als könnte die so frühe Erregung ein Trost für den vorzeitigen Wegfall jeder späteren sein. Allerdings steckte mir Doro dann noch ein Büchlein zu, nachdem ich mehrmals vom Hämorrhoidenhit der jungen Helen erzählt hatte, wie die Autorin und deren Hauptfigur heißt – ich sollte das im Waldhaus bei Gelegenheit lesen, sagte sie hinter vorgehaltener Hand zum Abschied: eine Erzählung, die das Wesentliche aus dem Helen-Ding schon enthalte, nur wahrer und knapper. Bis Ende September lag sie dann aber unter dem Letzten Gottesbeweis auf meinem Nachttisch herum, diese kleine Erzählung mit dem Titel Der Mann im Flur, von einer Französin, wen wundert’s.
Ein Grund dafür waren auch die regelmäßigen Lesungen im Kaminfoyer des Waldhauses: man bekam dort automatisch eine Dosis an Schwerem, wozu also auch noch vor dem Schlafengehen sich mit Lektüre belasten? Die Lesungen fanden zweimal im Monat statt, immer an Sonntagen, wenn die allgemeine Bedrückung am spürbarsten war, ob im Speisesaal oder in dem kleinen eigenen Kurpark. Es waren Nachmittagsveranstaltungen, um die ärgsten Stunden des Sonntags aufzufangen, die zwischen drei und fünf, und folglich war jeder Platz im Kaminfoyer besetzt, und es wimmelte von bekannten Gesichtern, eine Situation, die für die Autoren recht schmeichelhaft war und dem Waldhaus sicher eine Handhabe bot, die Honorare zu drücken. Auf diese Weise konnte man sich die erste Garde leisten, wie etwa den einzigen Autor (laut Selma), der es nur mit dem hat, was Menschen des Nachts beschäftigt und was sie lieber verschweigen. Er las im August, an einem windlosen glühenden Sonntag, und erlitt danach einen kleinen Zusammenbruch auf der Sonnenterrasse, für mein Gefühl inszeniert, um ein paar Tage in der schönen Umgebung herauszuschlagen, und daraus wurden dann Wochen. Eine Patientin, die schon während der Lesung ständig applaudiert hatte, nahm ihn in ihre Suite; sie war mal Sportlerin des Jahres gewesen und schlich wie keine andere einsam durch die Flure, bis zu dieser Lesung. Auf jeden Fall wurde der Nachtseitenautor, wie ich ihn nenne, mit Hilfe der verliebten Exsportlerin – ich glaube, Tennis und immer noch niedlich, nur eben depressiv – selbst ein Waldhauspatient, was allein durch die Behandlungskosten schon über seinen Verhältnissen lag. Er brauchte Geld, das sah man, jedenfalls sah es einer wie ich, und auf meine Frage, ob er mich in Sachen Schreiben gegen Honorar hin und wieder beraten könnte, kam sofort ein Meinetwegen, trotz seines Rufs, ein arroganter Hund zu sein.
Und die Übrigen, die im Waldhaus auftraten, bekamen alle naselang Preise und lebten noch dazu von der Kulturstiftung, wie der Autor, der am ersten Novembersonntag im Kaminfoyer lesen sollte. An jeder Ecke hing schon sein Foto, ein Mann mit hoher Babystirn und Fliege, den sogar ein bekannter Kritiker einführen würde, beide Namen standen auf dem Plakat – Ludger Truchseß liest aus seinem Goethe-Roman, Einführung Dr. Humbert. Aber es hatte auch schon ein leibhaftiger äthiopischer Prinz im Waldhaus gelesen, aus seinem Buch über Manieren, ein nicht sehr angebrachtes Thema an diesem Ort.
5
Die Dauerpatienten im hotelartigen Waldhaus, mich vielleicht ausgenommen, wussten natürlich genau, was Manieren sind; sie hatten sie mit der Muttermilch aufgesogen und klammerten sich, während der Mahlzeiten oder danach im Kaminfoyer, geradezu an Förmlichkeiten, als ließe sich der Krankheitsverlauf damit güns- tig beeinflussen: Purer Unsinn! Denn die Mehrzahl der Patienten litt ja am NPK-Syndrom, einer noch kaum erforschten, erst mit Beginn des neuen Jahrhunderts vor allem in unseren Breiten aufgetauchten Krankheit – von den einen etwas leger Prominentenklimakterium oder Promiklatsche genannt und von anderen, wie der Schmauch, Narzisstische Persönlichkeitskrise oder eben NPK-Syndrom, auf jeden Fall verbunden mit manisch-depressiven Phasen und Wahnvorstellungen infolge verblassender Prominenz oder, bei Patienten wie mir, des verlorenen GT-Appeals.
Und so hatte man es ständig mit irgendwie bekannten Gesichtern zu tun, von früheren Moderatorinnen, die immer noch Talkrunden suchten, über junge Models, die alles schon hinter sich hatten, bis hin zu Exfußballgrößen, die vor sich hin murmelten, oder eben der Sportlerin des Jahres sowieso, jetzt am Bademantelzipfel eines hochstaplerischen Mitpatienten und düsteren Autors. Es war eine schillernde Ansammlung, schillernd wie altes Fleisch, und ein normaler, nur vermögender, nicht aber prominenter Patient stand in der Versuchung, bei Angehörigen und Freunden mit all den Namen Eindruck zu schinden. Und doch drang kaum etwas nach außen, wie in meiner alten Abteilung, dazu reichten einige Unterschriften in Gegenwart stiller Juristen am ersten Waldhaustag; man beließ es bei Andeutungen: nicht leicht für einen, der schreibt.
Aber auch Andeutungen machen den besonderen Charakter des Waldhauses schon deutlich, ich beschränke mich auf wenige. Neben zwei Altvorständen meiner Bank, die die Globalisierung verschlafen hatten, aber Abend für Abend im Kaminfoyer über Fusionen sprachen, wäre noch ein greiser Riese im Rollstuhl zu erwähnen, der mir gegenüber – vielleicht nur, weil ich auch im Rollstuhl saß – immer mit nuschelnder Stimme erklärte, er habe die deutsche Wiedervereinigung bewirkt, allerdings auf meine Frage, ob er der Altkanzler Kohl sei, nur hartnäckig den Kopf schüttelte; möglicherweise war er dessen Doppelgänger a. D., auch schon vom NPK-Syndrom befallen. Und um den ersten Eindruck abzurunden, greife ich noch den latinohaften Barmann im Kaminfoyer heraus, Paolo, einen früheren Patienten, der den Status gewechselt hat und mir gleich beim Mixen eines Drinks bekannt vorkam, ich konnte ihn nur nicht einordnen, bis mir ein anderer Exvorstand, der bedauernswerte Mann, der seinen Namen auf jeder Klowand findet, einen Tipp gab: Das sei doch der feine Pinkel, der mal alle in seiner Sendung zur Sau gemacht habe, Tja, ja, so geht’s dann. Kurzum: Verflossene des großen Publikums, der Millionen vor dem Fernseher, bilde- ten die Mehrheit unter den knapp hundert Waldhauspatienten, davon die Hälfte weiblich, und alle bis auf den Autor noch vermögend genug, um den Tagessatz von eintausendachthundert Euro hinblättern zu können, Diskretion inbegriffen.
6
Doch von sich selbst kann man erzählen, hier endet jede Diskretion, und die Erinnerung fängt an. Regel Nummer drei: Schreiben heißt sich erinnern, ohne Rücksicht auf Verluste (also das Gegenteil von hedging); wer von sich erzählen will und zugleich ein guter Mensch sein möchte, wird nie ein gutes Buch zustande bringen, Punkt.
Ich bin jedenfalls kein guter Mensch, ich meine, keiner, der zum Beispiel den Wald mag, den ich von meiner Suite aus im Blick hatte, oder sich für bedrohte Arten starkmachen würde. Wald und Wiesen sind mir so gleichgültig wie Kröten oder Buckelwale und überhaupt alles Umweltliche bis hin zum Klima – das wir im Übrigen so wenig verstehen wie die Schwankungen der Weltwirtschaft. Was wir verstehen, sind nur die Folgen unseres sogenannten Klimawandels, in meinem Fall höchst positive: in Form immer längerer Sommer und immer kürzerer Röcke. Bis zu der Heiligabendattacke bestand meine Umwelt aus hellen Bildschirmen und blonden Beinen, und die einzige bedrohte Art, für die ich mich eingesetzt hätte, wären Pornomodelle gewesen. Diese Frauen haben es ja weit schwerer, als man sich vorstellt, wenn man nur daran denkt, dass sie bei alldem noch eine gewisse schauspielerische Leistung erbringen müssen, damit Begierde, Hingabe und Raserei auf den Betrachter überspringen; aber auch der männliche Part dürfte kein Zuckerschlecken sein, wobei sicher die rückwärtige Nummer – in meiner Abteilung gern auch die Auspuffnummer genannt – der schwierigste Teil ist, was ja auch der Hämorrhoidenrenner, der mir die Zeit in der Urologie verkürzt hatte, eindrucksvoll bestätigt – sicher einer der geheimen Gründe, warum diesem Buch, neben dem Verkaufserfolg, breiteste Anerkennung zuteilwurde, sogar auf den Kulturseiten meiner Leib- und Magenzeitung, zu denen ich normalerweise gar nicht vorstoße, wenn Wirtschafts- und Automobilteil gelesen sind.
Und selbst beim ersten Telefonat mit meiner fast großen Liebe nach ihrer Attacke, einem Anruf am Krankenbett – meine Anwälte (Morton, Cliffort, Weidenfels), hatten von direkten Kontakten abgeraten –, ging es um dieses Buch. Die schöne, gescheite Selma, deren Namen ich ändern wollte, um ihn nicht ständig verwenden zu müssen, aber mir fiel kein besserer ein, Selma also, die Leiterin der Kulturstiftung, sprach von einer Nobilitierung des Analen, als wollte sie vom Gemeinen ihres Anschlags auf das Genitale ablenken – ihr tue die Verfasserin fast leid, sagte sie, was mich nur entgegnen ließ, ob es nicht angebrachter sei, dass ich ihr wenigstens etwas leid- tue, Ende des Gesprächs. Auf jeden Fall war es für einen wie mich überraschend, ein solches Buch als Beitrag zum Feminismus gefeiert zu sehen, und aufgrund meiner hoffnungslosen Lage, zwischen den Beinen nichts als Mull, fühlte ich mich der nonnenhaften Autorin – ich sah sie im Fernsehen –, dieser jungen Schwester Helen, die für mich gleich eine fromme Helene war, zu Dank verpflichtet, war es doch jetzt möglich, über alles Mögliche auch noch möglichst offen zu reden, wenn man’s schon nicht mehr tun konnte.
Meine erste Auspuffnummer – um mit dem Heikelsten anzufangen –, die erste, auf die ein neuerdings zu Ehren gekommener weit gröberer Ausdruck zutrifft, spielte sich mit einer Kieferorthopädin ab, die mir die Weisheitszähne entfernt hatte, kein so leichter Eingriff, aber schon dabei bewies sie Geschick und Nerven. Einige Wochen nach der Behandlung traf ich sie dann zufällig im Urlaub wieder, solo in einer tunesischen Hotel- anlage, und wir wandelten die bereits vorhandene zahnärztliche Nähe zügig in eine private um. Unser erster Verkehr hielt sich noch im Rahmen des Üblichen, auch wenn dabei schon ein Füllfederhalter von Montblanc, mit dem sie sonst Briefe schrieb, seine neue Bestimmung fand, und beim zweiten Mal geschah es: Plötzlich bestrich sie meinen Porsche mit Tiroler Nussöl, was ihn sofort auf Touren brachte, und hielt mir auch schon den Allerwertesten hin, und ich glitt so leicht und ohne jede Scham in diese meist verunglimpfte Öffnung, dass ich fast geweint hätte vor Freude – geweint, um das ganz klar zu sagen, weil ich mit Haut und Haaren oder Leib und Seele und nicht nur GT-mäßig oder sexuell im Arsch war und nicht am Arsch, so wie in meiner Suite im Waldhaus, speziell nach Professor Corduas Visite.
Im und am: Die ganze feine Genauigkeit unserer Sprache (die wir Analysten und Investment Player dem Englischen geopfert haben) zeigt sich hier in zwei unscheinbaren Präpositionen, die doch Welten voneinander trennen, durch einen einzigen Buchstaben im Grunde, eine winzige Lautverschiebung – damals zu meinen Gunsten; bliebe nur die Frage, warum aus mir und der Kieferorthopädin nach unserem Tunesienurlaub nichts geworden ist. Ich weiß es nicht. Und hätte ich die richtige Antwort, wäre ich vielleicht auch nie im Waldhaus gelandet. Fest steht nur: Sie wandte sich einem anderen zu, Museumsleiter in Berlin, ich sah sein Foto im Internet, ein stattlicher Beau (wie der Klinikprofessor); zwei, drei Briefe erreichten mich noch, mit dem Montblanc geschrieben, ein Abschied in Raten, und am Ende empfahl sie mir ein Buch, eine platonische Liebesgeschichte, Die Sirene, von einem Italiener, Lampedusa, wie die Insel, auf der die Schwarzen stranden. Ich habe es gelesen, aber wieder vergessen. Dafür weiß ich noch, dass meine freimütige Kieferspezialistin nach Berlin gezogen ist, so viel darf man sagen, weil es dort sicher mehrere ihrer Sorte gibt (und wer eine besonders qualifizierte sucht, kann sich gern an mich wenden).
7
Professor Cordua, ich habe es schon angedeutet, war ein Schönling, einer wie der Winnetou, der seit Jahrzehnten unsere Nationalspieler auf dem Fußballfeld innerhalb von Sekunden wiederaufrichtet, während der Waldhaus- Chefarzt auch nach Monaten das GT-Wrack seines Patienten Deserno – es wird Zeit für meinen klangvollen Nachnamen – nicht einmal ansatzweise hatte heilen oder gar aufrichten können; schon ein leichter porsche erectus verursachte Schmerzen, die nicht einmal die Idee eines Vergnügens zuließen. Corduas Methoden hatten nur den Erfolg, sich mir einzubrennen wie die Korkenzieherattacke oder dieser ganze Heiligabend in Selmas weihnachtlich duftender Wohnung. Nun, Herr Deserno, rief er schon beim Betreten der Suite, wie geht es heute?
Nicht anders als gestern, hieß dann die Antwort, worauf der Schönling die Bettdecke zurückschlug, während eine Krankenschwester, die ihm stets auf dem Fuß folgte (Kim III), schon ein Paar Handschuhe bereithielt, dünn wie Kondome. Dieses Paar ließ er sich von ihr überstreifen, dann tastete er meine Kuppe ab, die immer noch einem Fleischstück glich, wie man es auf afrikanischen Märkten findet, fliegenumschwirrt, und hätte es solche Fliegen im Waldhaus gegeben, wäre mein Gebilde dort unten ihr natürliches Ziel gewesen. Ob das wehtue, fragte er und drückte auf die Zone mit den ärgsten Vernarbungen in der Harnröhre, den sogenannten Strikturen, die sich gefährlich verengen konnten. Ja, sagte ich, und er sprach vom Bougieren, das die Dinge verbessere, und meinte damit das Einführen von Metallstäbchen, die das Gewebe dehnten, eine Prozedur, die zur Gänze an den Ausgangspunkt meines Leidens erinnerte, aber für Seelisches war Cordua nicht zuständig. Schließlich ließ er sich die Handschuhe wieder abstreifen und kam zum nächsten, weniger intimen Bereich, meinen recht dünn gewordenen Beinen, denen seiner Meinung nach nur die Bewegung fehlte. Jetzt stehen Sie einfach mal auf, Herr Deserno, und gehen Sie durchs Zimmer, rief er gern, und ich verkniff mir jedes Mal, ihn daran zu erinnern, dass er lediglich Chefarzt war und nicht Gottes Sohn. Er tastete dann auch die Beine ab, und man konnte förmlich sehen, wie der verantwortliche Mediziner des Waldhauses und der Gesellschafter desselben miteinander rangen angesichts eines Patienten, der seinen Aufenthalt offenbar unbefristet verlängern wollte. Am Ende noch ein matter Händedruck, und schon war Professor Cordua wieder verschwunden, und die zweite tote Stunde des Tages begann, bevor am späteren Vormittag Marlies, die Krankengymnastin, ihren Auftritt hatte.
Es war die Stunde des Grübelns über mein Leben, in dem vieles vorbestimmt zu sein schien – die frühe Besessenheit von dem kleinen Ding, das so nach oben ging wie das Logo einer Bank, meine beruflichen Ambitionen und der gewisse Größenwahn, ohne den man kaum rund um die Uhr vor Bildschirmen säße, um immer komplexere, sich jedem Verständnis entziehende Papiere in Umlauf zu bringen. All diese Dinge waren für mich klar, nur der Ort, von dem die Bestimmungen ausgingen, blieb im Dunkeln, je nachdem, ob man nun an Gott glaubte oder an den Zufall oder an Rating-Agenturen. Ich dachte aber auch über die Liebe nach, warum sie so schwierig ist oder so schwierig für mich. Denn ich bin ja kein Albert, sondern viel eher ein Werther, einer, der seine Gefühle und vielleicht auch Talente verschwendet und der immer ganz bei der Sache war, auch wenn die Sache stank. Sie stank wie manches in meiner alten Abteilung, die in der Etage darüber, also in der Kulturstiftung, nur Schweineabteilung