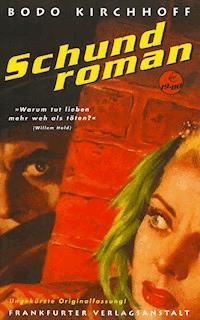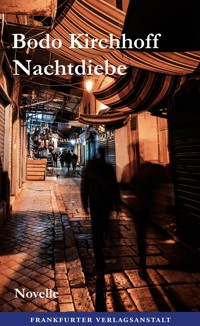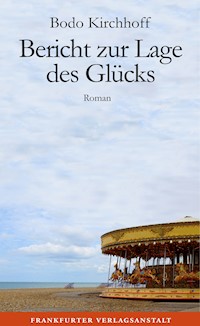Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer bin ich, wenn ich begehre? Und welche Grenzen überschreite ich dabei? Kardinalfragen für Viktor Haberland seit einem Vorfall am Ende der Schulzeit mit Tizia, seiner Partnerin bei den Proben des Sommernachtstraums. Damals kam es zu einer außerordentlichen Lehrerkonferenz, und nur ein alter, einzelgängerischer Lehrer machte sich für den Jungen stark. Inzwischen ist Haberland Anfang dreißig und bereitet für ein deutsches Kulturinstitut in Lissabon einen Abend unter dem Thema "Das traurige Ich" vor. Auftreten soll unter anderem ein Hirnforscher mit seiner Neurologie der Romantik und eine Schauspielerin, die Gedichte vorträgt. Auf entsprechende Anfragen meldet sich zu seiner Überraschung Tizia, eben das Mädchen von einst, jetzt am Theater, ohne zu wissen, wer sie da engagieren will. Viktor liest zum ersten Mal die Aufzeichnungen der Gespräche, die sein alter Lehrer damals mit ihm geführt hat. Und bevor es zu dem Aufeinandertreffen von Tizia und Viktor in Lissabon kommt, versteht Viktor, wer er sein kann im Begehren des anderen. Bodo Kirchhoff ist mit "Wo das Meer beginnt" ein meisterhaft erzählter Roman mit fabelhaften Nebengeschichten und großartigen Erzählsträngen gelungen: ein Roman über Liebe und Eros, über die Spannung zwischen Körper und Sprache, über Situationen der Grenzüberschreitung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2004
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Bodo Kirchhoff
Wo das Meerbeginnt
Roman
Frankfurter Verlagsanstalt
1. Auflage 2004
© Frankfurter Verlagsanstalt GmbH,
Frankfurt am Main 2004
Alle Rechte vorbehalten
Schutzumschlag- und Einbandgestaltung:
Bertsch & Holst, Frankfurt am Main
Herstellung: Thomas Pradel, Frankfurt am Main
eISBN: 978-3-627-02115-3
– 1 –
»Was ist mit dir, was denkst du? Du denkst, ich hätte keine Phantasie, ich könnte mir nicht vorstellen, was an dem Abend zwischen dir und dem Mädchen war, aber ich kann es mir vorstellen, und wie ich das kann«, sagte mein alter Lehrer, kaum saßen wir uns zum ersten Mal bei einer Kanne lakritzeschwarzem Kaffee gegenüber, ich noch beurlaubt und er krank geschrieben. Das war für mein Gefühl gestern, in diesem März, dem März, als Bagdad vor Berlin oder Beckham in den Nachrichten kam.
»Denn ich kenne das Mädchen, und ich kenne dich, Haberland, und ich weiß, was ein Schulkeller ist und wie man sich fühlt nach einer Theaterprobe, Sommernachtstraum, doch es würde auch schon der Name des Mädchens genügen, um es mir vorstellen zu können. Ihre Mutter, alleinerziehende Ärztin mit Bildungsallüren, hatte sich, inspiriert durch einen Roman, für Tizia entschieden, was die Tochter zwingen sollte, apart zu sein, so wie dein vielbeschäftigter Vater – ein einziges Mal besuchte er meine Sprechstunde, um nach deinen Fortschritten im Deutschen zu fragen – dich mit nichts als einem Wort dazu verdammt hat, als Mann aufzutreten. Stil, sagte er, das sei sein Appell an dich, und so trafen zwei Verdammte aufeinander, die eine mit dem Willen, alles Aparte abzuwerfen, der andere mit dem Vorsatz, endlich mit eigenem Stil aufzutrumpfen. Oh, ich kann es mir sogar lebhaft vorstellen, wie dieses Mädchen, das gar kein Mädchen mehr war, wenn auch noch lang keine Frau, nach der Theaterprobe – sie die Thisbe, du der Pyramus, die Szene mit der symbolischen Wand und dem Loch – dir in den Keller gefolgt ist oder gar vor dir herging, Hände im Nacken, und mit dem Fuß die Tür zum Heizraum aufstieß …
Wenig später brennt dort beiderseits einer Luftmatratze je eine Kerze, und ein klassischer Plattenspieler mit alter Platte, Schuleigentum, liefert dazu die Musik, auf die wir noch kommen. Und wie gesteuert von dieser Musik knöpft sich Tizia das Hemd auf, das sie als Thisbe getragen hat, und läßt es sich über die Schultern fallen, und übrigbleiben – alles andere verschwindet für dich – zwei überraschend volle Brüste, die über dem Herzen etwas schwerer und beide mit einer Gänsehaut, wahrlich apart, als führten sie ein Eigenleben. Deine Augen sind noch ganz darauf gerichtet, da hat sich Tizia schon die Hose, in der sich anderntags ein Riß finden soll, über die Schenkel gestreift, wobei sie ihre Beine anzieht und sich, bewußt oder unbewußt, nach hinten rollt auf der Luftmatratze, während du vor ihr in die Knie gehst, als gäbe es etwas anzubeten, die Hände am Knäuel ihrer Hose wie an einem Rettungsreif, wenn du den Vergleich gestattest. Du hast gezerrt an dem Knäuel, keine Frage, sonst wäre es kaum zu dem Riß gekommen, der allerdings nicht groß war, nur ein Stück offene Naht: Also war es vielleicht noch ihr Wille, nehme ich an, sich in der Weise ausziehen zu lassen. Doch dann muß etwas geschehen sein, das sich über ihren Willen hinwegsetzte oder ihn brach, etwas, das mehr von dir ausging als von ihr, auch wenn es nicht allein deinem Willen gefolgt sein muß, jedenfalls nicht deinem freien. Aber wie dem auch sei, Haberland – es hat zu jener Reihe schwer einzuordnender Schreie geführt, die unseren Hausmeister, den bekanntermaßen ängstlichen Zimballa, veranlaßt haben, hilfesuchend im Delphi, also um die Ecke, anzurufen, wo wir alle vor einem schwerverdaulichen griechischen Essen saßen, als könnte eine erwachsene Frau und Rektorin nicht auch allein sechsundfünfzig werden.
Als uns Zimballas Anruf erreichte, gut eine Stunde nach Ende der Probe, und das heißt, eine knappe Stunde nach Erscheinen der Kressnitz beim Griechen – als Leiterin der Theatergruppe durfte sie später kommen –, bedankte sich die Cordes gerade für unsere Teilnahme an ihrer Feier, die sie im selben Atemzug für beendet erklärte. Im Hölderlin, wie sie sich ausdrückte, passiere etwas Schlimmes, und schon bei dieser Einleitung ließ jeder Messer und Gabel sinken, erleichtert, wie mir schien. Ersticktes Schreien im Keller, sagte die Jubilarin mit einem Griff nach den Blumen, für die jeder gespendet hatte, und kurz danach platzten wir mit Zimballas Hilfe bei euch herein, wie dir sicher noch gut oder weniger gut in Erinnerung sein wird. Kollege Blum, der seinen Lammspieß einfach mitgenommen hatte, war der erste in der ruckartig geöffneten Tür; ich sah zunächst nur auf ihn, der mit seinen neugemachten Zähnen noch einen Fleischbrocken vom Holzstäbchen zog, während die Augen schon auf den Boden gerichtet waren, und folgte dann seinem Blick, bedrängt durch unsere sonst so gebremste Kristine, ich meine die Kressnitz, die sich wohl irgendwie verantwortlich fühlte für das Geschehen im Raum und, unter Einsatz des Kollegen Graf, der ja auch privat nie über den Sportlehrer hinauskommt, an mir vorbeizugelangen versuchte und mich nun vollends gegen Blums Rücken schob, wodurch meine Sicht auf die Dinge fast gänzlich versperrt war. Ich sah nur ein Stück Luftmatratze und zwei leicht behaarte Waden sowie eine der beiden flackernden Kerzen und in deren Lichtschein einen Fuß mit lackierten Nägeln, welcher seitlich der Matratze ein Stück frei in der Luft hing, geradezu pendelnd über einem geknüllten Taschentuch, als sei er mit einer Schnur an der Decke befestigt. Und im nächsten Moment gingen schon die Kerzen aus, zuerst die meinen Blicken entzogene, dann die andere, durch Pusten. Das geknüllte Taschentuch aber geriet in Bewegung und rutschte wie ein Blatt im Wind an Blums Mailänder Slippern vorbei – er hatte ihre Herkunft erwähnt – und landete genau vor meinen Schnürschuhen aus dem Kaufhof, während die Cordes zum Lichtschalter griff und es eine Sekunde lang hell wurde, viel zu hell, um etwas zu sehen, bevor jemand ihre Hand förmlich wegschlug und das Licht wieder löschte, zu deinem Vorteil, Haberland. Es war Blum, der wieder für Dunkelheit sorgte, kein anderer hätte so entschieden dazwischengehen können; es erstaunt mich immer wieder, was sich die Frauen von ihm alles bieten lassen, nicht nur die Cordes, mit der er verreist war, auch die Kressnitz, an deren Hals vorbei er zum Lichtschalter gelangt hat, wo seine Hand stur verharrte, während sie den Kopf etwas schräg legte, um sich an seinem Arm zu reiben, so mein Eindruck. Leo Blum behielt auch weiter die Hand auf dem Schalter, was mit seiner Herkunft zu tun haben mochte, der ewigen Sorge, von fremder Seite bestimmt zu werden, hier jedoch, in der Gegenwart, nur alle anderen beschränkte. Er versperrte sowohl der Cordes den Weg als auch ihrer Stellvertreterin, unserer niemals krankfeiernden Frau Kahle-Zenk, beide mehr als sonst geschminkt, die Jubilarin noch mit ihren elf Rosen im Arm, Quersumme aus sechsundfünfzig, Pirsichs Idee. Es konnte nun keiner mehr nachrücken, und nach dem Aufflammen des Lichts, das jeden geblendet hatte, war in den Raum selbst noch weniger hineinzusehen als vorher. Ich sah nur meine Schuhe und das Taschentuch und bückte mich schnell danach und steckte es ein, eins dieser Dinge, die man besser nicht zu erklären versucht, verrückt wie die ganze Geschichte dort unten, ich meine nicht eure, ich meine unsere, die der alarmierten Lehrer, in den Augen nichts als Neugier und in den Händen das herübergerettete Essen, eine jener Geschichten, die sich mit allen Mitteln ihrem wahren Ernst widersetzen. Doch wir waren beim Licht, das jetzt nur noch aus dem Kellergang in den Raum fiel, aus dem Zimballa Musik und Schreie gehört hatte, ein Licht, das mehr auf die Gesichter der Betrachter fiel als den Gegenstand der Betrachtung, höchstens noch in Türnähe auf einen schmalen roten Gürtel, vermutlich hastig aus einer Hose gezogen und von Pirsich, durch kurzes In-die-Hocke-Gehen, aufgehoben, womit es nun zwei Trophäen dieses Abends gab, Gürtel und Taschentuch. Und an dieser Stelle hatte ich eigentlich genug und wollte schon kehrtmachen, auch weil es ja nichts mehr zu sehen gab, nur noch die Endzeitblicke zwischen Blum und der Cordes, aber da drängten mich die beiden letzten aus der Runde beim Griechen, die erst jetzt in den Kellergang kamen, wieder zurück, nämlich unsere Stubenrauchs, bei sich, in Folie gewickelt, ihr angebrochenes Essen, Calamares mit Auberginenbrei und Zaziki. Heide Stubenrauch trug das silbrige Päckchen, das den gesamten Gang, ungleich mehr und ungleich schneller als etwa Blums Lammspieß, mit einem Aroma von griechischer Küche erfüllte, während Holger Stubenrauch mit wehender Siebzigerjahrekönigspudelfrisur und eingesackter Weinflasche, Retsina, sowie dem Ruf nach der Polizei heraneilte, und beide wollten sie von mir, der ich immer noch hinter Leo Blum stand, wissen, was sich in dem Raum, der ja nun völlig im Dunkeln lag, abspiele oder abgespielt habe …
Da seien wohl zwei drin, die nach der Theaterprobe noch etwas vorgehabt hätten, sagte ich, worauf auch schon dein Name fiel, und zwar aus dem Mund von Pirsich, das Stichwort für die Stubenrauch. Sie legte die Calamares samt Beilagen auf einen Feuerlöscher und schritt mit den Worten, dann habe die Tizia da drinnen geschrien, Richtung Tür, genau zu dem Zeitpunkt, als Blum sich umdrehte und mit beiden Armen die Kressnitz und den Sportlehrer Graf in den Gang zurückschob, mehr die Kressnitz, wie mir schien, eine Hand unter ihrer Achsel, worauf sie schon wieder den Kopf etwas schräg legte, als sei dort noch immer sein Arm, während Blum weiter Druck machte. Ich unterstützte ihn jetzt nach Kräften, und in gewisser Weise kam auch Unterstützung von dir oder euch, die ihr dort irgendwo im Dunkeln gelegen habt, ohne Mucks, womöglich noch verbunden in der Umarmung – das klären wir später. Blum hatte euch, wie gesagt, abgeschirmt, bis auf die Beine, und auch Graf und unsere gute Kristine, ich meine, die Kressnitz, dürften wenig gesehen haben in der Sekunde, als das Licht im Raum brannte; Pirsich, die Cordes und Kollegin Zenk wohl noch weniger, während die Stubenrauchs, nachdem Blum die Tür hinter sich zugezogen hatte, ganz auf seine und meine Aussage angewiesen waren, wobei man mir, obwohl nur Zeuge in zweiter Reihe, das sicherste oder sachlichste Urteil zuzutrauen schien. Nicht nur die Stubenrauchs, auch die Cordes und ihre Stellvertreterin wollten von mir wissen, ob er, also du, Haberland, sie, das heißt die Jentsch, nämlich Tizia, da drin, dem Schrei entsprechend, vergewaltigt habe und ob man nicht unverzüglich eingreifen müsse. Nein, müsse man nicht, sagte ich, als Holger Stubenrauch, hinter seiner Frau hervortretend, mit dem Ellbogen das eingewickelte Essen von dem Feuerlöscher stieß und die Folie auf dem Beton platzte. Das Zaziki mischte sich mit dem Auberginenbrei, während die Calamaresringe herauspurzelten und den Staub des Bodens wie eine zweite, feinere Panierschicht annahmen, begleitet vom Fluchen der Stubenrauchs, denen ihr verlorenes Essen Momente lang näher war als das, was sich, möglicherweise, immer noch hinter der Tür zutrug. Niemand hatte ja wirklich etwas gesehen, auch Blum, der jetzt mit dem Rücken zur Tür stand und von Pirsich, flüsternd, befragt wurde, gab nur an, daß die zwei da gelegen hätten, irgendwie, und das Licht von ihm gelöscht worden sei aus Gründen des Anstands, er also gar nichts sagen könne, aber auch gar nichts sagen wolle. Ersteres war auf jeden Fall gelogen, wenn ich nur an den pendelnden Fuß mit den lackierten Zehennägeln dachte, oder es entsprach allein der Tatsache seiner Eitelkeit, denn Leo Blum ist eigentlich Brillenträger, trägt aber fast nie eine Brille und scheut sich auch vor Kontaktlinsen, wie überhaupt vor zu engem Kontakt, nur vor Affären nicht, eine sogar – man weiß nicht, wie und warum – mit der Cordes, ich habe es schon angedeutet. Denkbar wäre also auch, daß er dich in Schutz genommen hat, Haberland, schon mit der geistesgegenwärtigen Verdunklung, aus Sympathie oder Komplizentum, während ich von Anfang an bereit war, in deinen leicht behaarten Waden und dem pendelnden Fuß und dem Taschentuch nur einen Ausdruck von unbeholfener Liebe zu sehen. Und allein deshalb habe ich nichts von dem Fuß erzählt, solange wir alle in dem Gang herumstanden, um die verstreuten, mit Staub panierten Calamares und das verspritzte Auberginenbreizaziki, und im Flüsterton berieten, was nun zu tun oder zu lassen sei, in Anbetracht deiner Volljährigkeit und Tizias Jugend und der unklaren Schreie, die Zimballa alarmiert und das Ganze in Gang gesetzt hatten. Hilferufe, wie die Stubenrauch meinte, auch wenn das Wort Hilfe nicht ausdrücklich gefallen sei, also wohl eher Laute der Verzweiflung, wenn nicht Panik – die von Blum vertretene Ansicht –, unter Umständen aber auch der Lust, dachte ich, eine Möglichkeit, die bisher noch keiner in Erwägung gezogen hatte, und mir schien der Zeitpunkt nicht ungünstig, da jetzt alle im Essen herumtraten, sie wenigstens anzuschneiden. Ob da nicht nur zwei ihren Spaß gehabt und auf den Putz gehauen hätten, sagte ich mehr vor mich hin als in die Runde, aber bis auf die Kressnitz fielen sofort alle über mich her, sogar der fortschrittliche Pirsich. Spaß und Putz, das seien ja wohl kaum die richtigen Worte, rief er, und mein Einwand, für diese Dinge gebe es sowieso nur Wörter, ging vollkommen unter. Typisch Branzger, sagte die Stubenrauch, während sich Graf und Blum, ich glaube erstmals, zusammentaten zu einem ausgerechnet der, das mir galt, mit der ungewollten Folge eines Blicks unserer Kunsterzieherin und Theaterleiterin: Die Kressnitz sah mich an, eine Hand vor dem Mund, darunter ein Lächeln, und ich zeigte der Stubenrauch einen Vogel. Daraufhin drohte die ganze Situation zu kippen, weg von dir, hin zu mir, bis die Cordes, die nicht umhinkonnte, zwischendurch an ihren elf Rosen zu riechen, dem Amt als Rektorin gerecht zu werden versuchte, indem sie alle zu sich bat – sie stand am Feuerlöscher – und eine kurze Rede hielt, die zweite an dem Abend, eine Rede, die immer noch lang genug war, daß jeder mindestens einmal auf einen Calamaresring trat. Im Moment könne man gar nichts tun, sagte sie, nur durch die Tür rufen, daß dies sofort zu beenden sei und sich beide morgen zu melden hätten. Und schon gar nicht könne man ins Delphi zurückkehren … Über den letzten Punkt herrschte sogleich Einigkeit, während es über den ersten zu einem Streit zwischen Holger Stubenrauch und Leo Blum kam. Stubenrauch wollte das Mädchen befreien, wie er sagte; Blum wollte euch beiden Gelegenheit geben, sich selbst aus der Affäre zu ziehen, und die übrigen hatten alle Mühe, die Streitenden und damit die ganze Gruppe nach und nach von der Tür zu eurem Nest zu entfernen, hin zu der Treppe, die ins Foyer des Hölderlin führt, wo man schließlich auch ankam und über den nächsten Schritt debattierte, Verständigung der Eltern, ja oder nein, während mir das Taschentuch in meinem Mantel einfiel und ich es hervorzog, als sei es mein eigenes, das zu benutzen mir freistand. Doch ich schneuzte mich nicht, ich roch nur daran, ein unbezwingbares Interesse am Wahren, und glaube mir, Haberland, es fällt mir nicht leicht, das zu sagen: Dem Tuch entströmte ein Geruch, der eher zu deiner als ihrer Entlastung beitrug, was mir schlagartig klarmachte, welchem Gesetz du am Ende dort unten gehorcht hast, dem der Vernunft – ob aus freien Stücken oder nicht, das spielt keine Rolle –, wie mir auch schlagartig klar war, daß ich diese Erkenntnis besser für mich behielte, jedenfalls nicht in den Kreis einbringen könnte, der da noch ratlos im Foyer stand, die Herren mit Schlips wegen der Feier, die Damen mit Modeschmuck und frischer Tönung. Ein kostümiertes Lehrerfähnlein, das sich nur darauf einigen konnte, nach Anhörung von dir und dem Mädchen, vorgesehen für den nächsten Tag, gegebenenfalls eine Konferenz anzusetzen, um möglichst rasch die Empfehlung für deinen Verbleib oder Nichtverbleib am Hölderlin auszusprechen, was ja dann auch geschehen ist, keine Woche nach dem Vorfall …«
– 2 –
Und in Wahrheit ist das alles Jahre her, zwölf, um genau zu sein, und auch damals kam Bagdad vor Berlin in den Nachrichten, nicht aber Beckham, der noch im Hinterhof bolzte. Es war die Zeit von Desert Storm, nämlich des Golfkriegs, als ich schon morgens vor dem Fernseher saß und mein alter Lehrer der einzige war, der mich mehr als alle Marschflugkörper und Nachtaufnahmen interessiert hat, ja sogar mehr als Tizia und ihr Körper, der letztlich auch ein Flugkörper war, hin zu mir und wieder weg. Und viele meiner Gedanken drehen sich noch heute um seine Person, wenn überhaupt von meinen Gedanken die Rede sein kann; sie stellen sich einfach ein, in Wellen, eine wiederkehrende Flut, die mich fortreißt wie das Verlangen nach Tizia, als gehörte ich gar nicht mir selbst, ja unterläge, von Welle zu Welle, nur ihrer Zeit und nicht meiner, so wie das Land, auch wenn die Uhren dort schlagen, dem Meer erliegt, das alle Zeit der Welt hat. Wo also bin ich, wenn ich begehre, wessen Zeit gilt?
Die Abende bei lakritzeschwarzem Kaffee in den Wochen meiner Beurlaubung aufgrund des Vorfalls im Hölderlin, anfänglich auch die Wochen des Golfkriegs, sind mir so nah, als lägen höchstens Monate dazwischen, und manches erscheint daher stimmiger vor dem Hintergrund des jüngsten Kriegs, mit all den Parallelen für unsereins vor dem Fernseher und einem genealogischen Coup, der diesen Zeitsprung erleichtert: dem von Vater und Sohn im selben Amt, als drücke die Zeit ein Auge zu: bei Amerikas Präsidenten, wenn die Familien reich genug sind, und bei Bürgern des alten Europas, wenn ihr Inneres schwer genug wiegt. Und mit der Macht läuft es ja auch ähnlich wie mit dem Erzählen, man kommt nicht gleich dort an, trotz Reichtum und Einfluß, man muß schon Stationen einlegen, bei der Nationalgarde und auf dem Campus von Yale, als Ölvertreter oder Gouverneur von Texas, bis man der halben Welt etwas vormachen kann, um danach Krieg zu führen; oder einen verschwindenden Teil der Welt für seine Geschichte gewinnt.
Meine Stationen waren natürlich weniger spektakulär, haben aber auch weniger Jahre beansprucht. Nach dem Abitur Ersatzdienst, wie damals üblich, dann einige Reisen von der eher unüblichen Sorte, fast schon die Qualifikation für meine jetzige Tätigkeit, davor ein Studium, Politik und Benachbartes in Berlin, mit Praktika an Goethe-Instituten, zuletzt in Frankfurt, meiner Heimatstadt, mit Aussicht auf eine Laufbahn im weltweiten Netz unserer Kulturbotschaften, auch wenn man im Auswärtigen Amt dieses Wort nicht gern hört. Mein Schwerpunkt war von Beginn an politische Bildung, mein eigentliches Pfund aber ein Vater, auf den ich noch komme, damals Landes-minister, und mein Fürsprecher wurde dadurch kein geringerer als jener Präsident aller Institute, der selbst etwas von Goethe hatte, nicht dem Dichter, aber dem Fürsten, lange Kulturdezernent in dessen Geburtsstadt, angeblich der Erfinder dieses Amtes. Mit seiner Hilfe kam ich nach Lissabon, meinem Wunschziel, ein Assistenzposten am hiesigen Institut, die vorerst letzte Station und somit der Ort, an dem ich dies schreibe, auf einem Gerät, das dem deutschen Steuerzahler gehört, einer der drei Vorteile des Postens. Die beiden anderen Vorteile sind die Umgebung, also Lissabon, und die Zeit, die mir bleibt.
Meine Tätigkeit ist eine mehr organisatorische als lehrende, ich sorge für den glatten Ablauf aller Abendveranstaltungen, ob Lesung, Diskussion oder Filmvorführung, und kann in der Regel über die Vormittage verfügen. Und diese hellsten Stunden des Tages nutze ich – meist im Büro, selten in den zwei Zimmern, die ich bewohne –, um für das damals Geschehene genau die Worte zu finden, die den zwar verschwindendsten, aber dafür lesegewohnten Teil der Welt auf meine Seite ziehen könnten, wobei auch diese Arbeit wieder drei Vorteile hat. Erstens steht vieles, was ich erzählen will, bereits da, in Form von Notizen meines alten Lehrers, angelegt nach jedem unserer Gespräche (siehe Kapitel eins), ja, ich habe den Verdacht, daß manche der Gespräche eher vorhandenen Notizen gefolgt sind, statt umgekehrt, was ein Beleg meiner früheren Hörigkeit wäre. Zweitens erleichtert mich die Arbeit; jede von Branzgers Notizen, alle geschrieben in winziger, aber lesbarer Schrift, wandert nach ihrer Verwendung – Eingabe in mein Gerät einschließlich meiner Sicht der Dinge – ins Feuer, ohne daß ich mich schlecht fühle, im Gegenteil, womit ich schon bei Punkt drei bin: Die Arbeit richtet mich auf. Denn mein alter, langjähriger Lehrer (Deutsch und Latein, plus Philosophiekurs) hat mich benutzt; er zog mich nicht, er stieß mich in eine Geschichte, die nicht meine war, und allein der Stoßende ist bekanntlich frei, der Fallende fällt nur, er kann nicht anders. Nun aber falle ich zurück, angestoßen von mir selber, und die einzige Bremse bei diesem Rückfall ist die Zeit, die ich an mich ziehe. Jede Geschichte, glaube ich, hat ihren unantastbaren Ernst – für den hat er gesorgt – und ihre spielerische Seite, für die sorge ich oder versuche es, wie ich auch versuche, den Veranstaltungen am hiesigen Institut, je schwerer mir die Thematik erscheint, eine um so leichtere Seite zu geben, und sei’s nur durch Blumen oder eine bestimmte Musik, wenn sich der Vortragssaal füllt.
Seit Anfang des Jahres – jetzt haben wir September, der schönste Monat in dieser Stadt – bereite ich, auch unter dem Gesichtspunkt des Leichten, einen Abend mit dem Titel Das traurige Ich vor. Von portugiesischer Seite werden eine junge Sängerin und ein junger Romanautor das unvermeidliche Thema fado und saudade, also wehmütiges Erinnern, durch Lieder und Texte nahebringen, und von deutscher Seite erwarten wir einen renommierten Hirnforscher, der die neuronalen Grundlagen romantischer Gefühle vorstellt und daraus Schlüsse für die Freiheit des Ichs zieht. Wenn ich seinen letzten Aufsatz richtig verstanden habe, hält er das Gefühl der Traurigkeit für einen bestimmten Molekularzustand auf Basis chemischer Verbindungen wie etwa Acetylcholin, das heißt, für eine gutgläubige Selbsttäuschung, gekoppelt an Erinnerungen, die in Prioneneiweißen verschlüsselt sind, eine Auffassung, die mir einerseits entgegenkommt, weil sie gewissermaßen eine untätige oder faule Seele unterstellt, die faule Seele, die ich oft auch bin und die mir andererseits zutiefst widerstrebt, weil meine Erinnerungen überwiegend wehmütig sind. Hätte dieser Mann recht, bekäme unser berühmtes Ich weiß nicht, was soll es bedeuten – das eine nicht ganz so junge deutsche Schauspielerin neben weiteren Gedichten auf meine Anregung hin lesen wird – einen ganz neuen Sinn: daß man es nämlich durchaus wissen könne, wenn man sich nur auf der Höhe der Hirnforschung befände. Und weil ich mich nicht dort befinde, habe ich auf Heine und Hölderlin und diese Schauspielerin und zuletzt auch auf mich gesetzt, ein Effekt meiner langen Vorbereitung dieses Abends, nicht der einzige. Denn im Zuge dieser Vorbereitung – Frau Dr. Weil, die hiesige Leiterin, hat mir zum ersten Mal, vom Thema abgesehen, auch inhaltlich freie Hand gelassen – haben sich zwei Dinge ergeben, ohne die ich nie angefangen hätte, all das zu erzählen.
Je mehr ich über Traurigkeit und den Stand der Hirnforschung las, um mich einzuarbeiten, desto trauriger wurde ich, oder anders gesagt: desto mehr meiner wehmütigen Erinnerung an eine Klassenfahrt nach Lissabon und meine Geschichte mit Tizia und Dr. Branzger kehrte zurück, verbunden mit dem Wunsch oder Willen, aus dieser Erinnerung und den Notizen meines alten Lehrers, die seit damals in einer Tüte von Schade&Füllgrabe, heute Tengelmann, aufbewahrt waren, etwas zu machen, das jeden widerlegt, der uns nur als gefangene Zuschauer des eigenes Körpers sieht. Und zweitens suchte ich nach einer Schauspielerin, die mir den Heine und Hölderlin vortragen sollte, gratis am besten wegen des knappen Budgets, nur für Flug und Hotel, also kein Star, und dennoch erfahren, eher dreißig als zwanzig. Und als auf meine entsprechenden Anfragen bei deutschen Bühnen die ersten Antwortfaxe kamen, sah ich den Namen Tizia Jentsch, Staatstheater Saarbrücken – einer der Augenblicke, die wir gern umwerfend nennen, zu Recht. Ich hatte seit damals nichts mehr von Tizia gehört, schon gar nicht, daß sie Schauspielerin geworden war, auch wenn sie mit mir die Szene aus dem Sommernachtstraum geprobt hatte, und doch war ich sicher, daß sie Heine und Hölderlin so gut wie jede andere vortragen könnte, das heißt, ich wollte sie engagieren, also hier haben oder überhaupt haben, und überzeugte unsere Leiterin davon, daß nicht ich, sondern sie die Kandidatin anrufen müßte, was sie noch am selben Tag getan hat, mit Erfolg. Und gegen dieses Wollen, füge ich ausdrücklich hinzu, war beim besten Willen nichts zu wollen, der Hirnforscher hätte seine Freude daran.
Nur wenige Tage darauf – Mitte Februar, es war kalt und feucht in Lissabon – hatte ich dann Branzgers Notizen in der welken Plastiktüte vom Grund eines Umzugskartons voll altem Zeug geholt und in meiner sowohl elektrisch wie auch ofenbeheizten Zweizimmerwohnung am unteren, geraden Ende der Rua da Atalaia – einer Straße, von der noch zu reden sein wird – mit der Arbeit begonnen, angefangen mit dem Abend, als die Geburtstagsrunde der Cordes im Keller des Hölderlin aufgetaucht war, vor dem Raum, in dem ich mit Tizia lag, auf einer Luftmatratze, links und rechts die erwähnten Kerzen, und die Tür erst aufging und dann wieder zu … Fast atemlos hatte mein alter Lehrer das alles erzählt, und so schien er es später auch festgehalten zu haben, in einem Zug, einschließlich meines ersten Einwands: Bisher sei das ja nur die Story einer geplatzten Feier zum Vorteil der Gäste gewesen und nichts über das, was sich zwischen Tizia und mir abgespielt habe, also fehle da wohl doch Phantasie. Worauf der krankgeschriebene Dr. Branzger – für viele auch nur Der Doktor, weil er der einzige am Hölderlin mit diesem Titel war und überhaupt seine Person nur wenig Persönliches durchblicken ließ – die Augen geschlossen und den Gürtel um einen abgewetzten Hausmantel enger gezogen hatte, zum Zeichen, daß er gleich mit einem Vortrag käme; aber derartige Feinheiten sind mir erst nach und nach aufgegangen.
– 3 –
»Wer etwas erzählt, Haberland, sollte sich fragen, für wen er das tut und warum und wer noch aus ihm spricht, außer er selbst, und ob er es nicht auch anders erzählen könnte, als es geschieht. Was mich nun betrifft: Ich erzähle dir etwas, einem beurlaubten Schüler, damit du regelmäßig hierherkommst und am Ende mehr von mir hältst als am Anfang. Und wenn ich das tue, sprechen alle aus mir, die ich je geliebt habe und liebe, die übrigen murmeln nur im Hintergrund. Schließlich Punkt vier: Ich könnte schon anders, wenn nicht gerade du mein Zuhörer wärst. Und jetzt zum Allgemeinen: Wer etwas erzählen will, muß einen Berg versetzen. Erst trägt man ihn nach und nach ab und lernt dabei alles kennen, was später in der Geschichte vorkommen soll, dann richtet man ihn unter noch ungleich größerer Mühe anstelle der Wirklichkeit wieder auf. Und das nicht in der Reihenfolge, in der man ihn abgetragen hat, da hätte man sich die Plackerei sparen können, sondern nach den Gesetzen der Schönheit; und wenn ich von Schönheit rede, meine ich damit weder, daß es an jeder Stelle gut klingt und dazu noch gut endet, noch daß man alles verstehen muß oder durch Tricks bei der Stange gehalten wird. Ich meine damit eine eher verborgene Schönheit, die sich erst im Bogen des Ganzen zeigt, aber so weit sind wir noch lange nicht; wir stehen noch am Anfang, und nun trink erst mal den Kaffee …«
Gemeint war eine Tasse des überaus schwarzen, selbstgemahlenen Bohnenkaffees, die erste von vielen in Branzgers Wohnung – für mich zu diesem Zeitpunkt nur ein Tisch mit unseren zwei Stühlen, mehr antik als bequem, ein Mobiliar, das ich nicht weiter beachtet hatte, denn meine Aufmerksamkeit hatte damals ganz woanders gelegen, bei einem Stoß von Blättern in der Mitte des Tisches, dem Protokoll der erwähnten Konferenz, auf das mein alter Lehrer mit dem Finger zeigte. Nicht alles im Leben sollte auf Papier hinauslaufen, aber das Wichtigste schon, sagte er und kam dann auf das Datum des Protokolls (das ich in meinem Sinne verändert habe), es sei identisch mit dem Kriegsbeginn im Irak. »Was sich aber am Abend dieses Tages, als über Bagdad der Teufel los war, im Konferenzraum des Hölderlin abgespielt hat, hält das Protokoll höchstens in Umrissen fest. Alles andere will erzählt sein.«
Der Doktor beugte sich über den Tisch, rund und aus altem Holz, und hielt seine Tasse, als sei er bereit, ihren schwarzen Inhalt komplett auf das weiße Papier laufen zu lassen, doch dann kam es ganz anders. Er zeigte mir die erste Seite, schön gegliedert und sauber gedruckt, unverkennbar das Werk von Pirsich, versehen allerdings mit Bemerkungen in Branzgers winziger Schrift. »Ich habe mir auch eigene Notizen gemacht und sie hier übertragen«, sagte er. »Meine Geschichte von dieser Lehrernacht wäre also, wenn ich noch die Erinnerung hinzuziehe, annähernd vollständig. Da bleibt dann nur die Überlegung, warum ich mir derartig viel Arbeit machen soll …« Er setzte die Tasse ab und sah mich abwartend an, bis ich ihn fragte, was der Preis dafür sei, der Preis für seine Arbeit, und er eine Hand vor den Mund nahm, wie es die Kressnitz tat, wenn sie ihr Lächeln versteckte.
»Der Preis? Ich erzähle dir, mit Hilfe dieser Unterlagen und der Erinnerung, was in der Konferenz über dich gesagt wurde, und du erzählst mir, nur mit Hilfe der Erinnerung, was an dem Abend nach der Theaterprobe zwischen dem Mädchen und dir wirklich passiert ist. Meine Geschichte aus dem Besprechungsraum, Haberland, gegen deine Geschichte aus dem Keller. Wir können heute noch damit anfangen oder erst beim nächsten Mal, es ist mir egal. Ich bin krank geschrieben, ich habe Zeit, und soweit ich weiß, ist deine Hauptbeschäftigung im Moment das Nichtstun. Aber man kann eine Beurlaubung auch besser nutzen; immerhin bist du meiner Einladung hierher gefolgt …«
»Dann fangen wir heute an.«
Und mit einem Gut oder Bestens, jedenfalls einem Ausdruck seiner Zufriedenheit, der damals keinerlei Mißtrauen in mir erregt hatte, war seine Hand über den Tisch gekommen, als Faust, die er zweimal gegen meine Hand stieß, während er schon zu reden anhob.
– 4 –
»Die Konferenz über deinen Fall – für die meisten längst geklärt: als Fall von Gewalt – begann damit, daß wir alle im Besprechungsraum froren wegen der ungewöhnlichen Kälte an diesem Tag und auf Klopfgeräusche aus den Heizrohren hörten, verursacht durch Zimballa. Unser Hausmeister drosch im Keller gegen eine rostige Schraube, weil die Heizung wieder einmal nicht lief, ja nahm den Schaden geradezu persönlich, wie es seine Art ist, und keuchte wohl so etwas wie, Schraube, dich krieg ich herum!, während zwei Stockwerke über ihm die gute Cordes in ihrem Rektorinnenlammfellmantel den Raum betrat. Sie nahm am Kopfende Platz, gegenüber ihrer Stellvertreterin, der ewig gesunden Kahle-Zenk, bei euch Schülern, wie du weißt, eher bekannt unter dem Kürzel Ka-Zett, natürlich ungerecht, was die Person betrifft. Aber zurück zur Cordes, sie führte also den Vorsitz, diese stattliche und doch im Innersten eher kleine Person, und links von ihr klappte Pirsich sein neues Schreibgerät auf, sicher im Inneren stattlicher als von außen und doch ungeeignet, sein halbgeheimes Projekt, einen Lehrerroman, voranzubringen; er wird an ihm scheitern, keine Frage, wie auch schon, Jahre zuvor, an einer Doktorarbeit über Sexualerziehung, worauf er seinen Namen einfach um einen Buchstaben mit Punkt erweitert hat und als Rolf C. Pirsich dennoch oder erst recht dieses Spezialgebiet unterrichtet. Und so saß er der Cordes nicht nur als Protokollführer zur Seite, sondern wohl auch als Fachmann für das Geschlechtliche. Ihm vis-à-vis, und das heißt, auf der anderen Seite der Cordes, also rechts von ihr, saß Leo Blum. Er trug an dem Tag seinen gefütterten Trenchcoat, der mehr noch als seine italienischen Schuhe das Gerücht um Nebeneinkünfte nährt – bin ich zu schnell?«
»Nein.«
»Und der Kaffee? Ist er gut?«
Es schien ihm wichtig zu sein, wie ich seinen Kaffee fand, und ich trank einen Schluck, obwohl ich gar kein Kaffeefreund bin, schon gar nicht der eines solchen Höllengebräus, und sah dabei zu einem kleinen Sofa in Nähe des Fensters, einem Möbel, das sicher geeigneter war, einer längeren Geschichte zu folgen, als mein Stuhl ohne Armlehne, aber da fuhr der Doktor schon fort.
»Kein Gerücht«, sagte er, »ist dagegen Blums gehabte Affäre mit der Cordes, die bei ihm nur einen traurigen Blick auf sie hinterlassen hat, einen Blick wie beim Thema Israel, für Blum ja seit langem Ziel einer Klassenfahrt, die er immer wieder verschiebt, während er die Sache mit der Cordes auch zum schlechtesten Zeitpunkt durchgezogen hatte, wenige Monate nach dem Tod ihres Mannes. Blum ist ja gerade mal fünfzig, wirkt aber älter – wozu auch das Mantelfutter beiträgt, es gibt ihm den Anschein einer bedrohten Art –, und in diesem Mantel befand er sich in krassem Gegensatz zu seinem Nachbarn, dem einzigen mit bloßen Armen im Raum, nämlich dem Sportlehrer Graf, immerzu und von keinem bemerkt in der Form seines Lebens, doch selbst für dieses Stück Tragik zu dumm. Sein Kapital sind gewisse Muskeln und eine Tätowierung am Hintern, von der die ganze Schule weiß, seit er bei einem Fitneßheftwettbewerb, Deutschlands schönster Lehrer, auf Platz drei kam – ich erwähne das hier nur der Vollständigkeit halber –, mit einem Foto ohne Badehose, schräg von hinten, was seinem Namen, wie du weißt, eine nette Vorsilbe eingebracht hat. Und ausgerechnet er saß zwischen Blum und, pikanter noch, der Kressnitz, die ihm im Lehrerzimmer schon ausdrücklich verboten hatte, sie mit Kristine anzureden oder gar zu duzen, eine reizvolle Maßnahme, wie ich finde. Sie ist übrigens mit keinem per du, jedenfalls nicht in Gegenwart anderer, eine Frau, die kaum über dreißig ist, aber schon Umgangsformen einer Mitvierzigerin hat! Und für eine Kunsterzieherin, die auch noch Musik unterrichtet und eine Theater-AG leitet, mehr als passabel aussieht, wenn ich das sagen darf. Jahrelang hatten wir auf diesem Posten nur Frauen, die sich von Nüssen und Tee ernährt haben und mit einem Bein in der Psychiatrie standen, während die Kressnitz in der großen Pause sogar ein Wurstbrot ißt, ohne der Typ einer Wurstesserin zu sein, und auch nicht auf Kunst und Theater macht, obwohl es ihr stünde: als hellhäutige, immer sehr angezogene, hochgeschlossene Person, die nur gern ihre Fesseln zeigt und ihre Ohren. Und so stellt man sich mit Hilfe des Wenigen, das man sieht, immerzu das Viele vor, das man nicht sieht – angeblich auch ihr Stil beim Inszenieren, du kannst mich verbessern. Wie dem auch sei: Sie hatte seit Monaten Szenen aus dem Sommernachtstraum geprobt und dich für eine der schönsten besetzt, zusammen mit dem Mädchen Tizia, eine Szene, die an dem fraglichen Abend sogar aufgezeichnet worden ist, mit der Videokamera der Schule, und das Band hatte die Kressnitz bei sich, um es im geeigneten Moment vorzuführen. Es lag schon auf dem Tisch, als die Cordes ihre Einleitung machte, und sie hatte uns kaum begrüßt, da fragte Blum nach der Heizung, von Pirsich in Stichworten festgehalten wie jeder Einwurf, aber auch bestimmte Äußerlichkeiten, etwa daß die Kressnitz in einer Garderobe wie für ein geistliches Konzert erschienen sei oder ihr Nachbar zur Rechten – und das war ich – offenbar an fiebriger Erkältung leide, Kollege Branzger, mit Taschentuch, hustend, was ich nur bestätigen kann. Es ging mir dreckig an diesem eisigen Freitag, ich hatte die Krankschreibung schon in der Tasche, ja wäre fast im Bett geblieben, und all die verlorenen Worte auf dieser Konferenz hätte das Schicksal der meisten verlorenen Worte ereilt, nämlich nie zu einer Geschichte zu werden. Noch Kaffee?«
Es war seine Standardfrage an den ersten Abenden, Noch Kaffee?, und von meiner Seite fast immer eine erhobene, verneinend hin- und herbewegte Hand, und an diesem ersten Abend kam er noch damit, daß jede Tasse Kaffee ein Tribut an das beredte Wesen der Frauen sei, in unseren Breiten, ebenso das Ausholen zu einer Geschichte, jedes Es-war-einmal: ein Tribut an die Frauen. Und ob ich es mit dieser Art Verbeugung jetzt einmal versuchen wollte, nicht gleich mit der ganzen Geschichte, aber dem Anfang, »Wie wär’s?«
»Bitte«, sagte ich, »es begann auf der Klassenfahrt. Israel war mal wieder ins Wasser gefallen, und so mußte es wenigstens mehr sein als Paris oder Rom, und man entschied sich für Lissabon. Sie selbst waren dabei …«
»Eine unvergeßliche Woche, Haberland. Mit wem hast du das Zimmer geteilt?«
»In der lausigen Pension? Mit Hoederer.«
»Und eure Themen, nachts? Die jungen Damen?«
»Wir sprachen nur einmal über die Kressnitz.«
Der Doktor strich sich über die Lippen, dann hob er den Finger. »Ich denke, das reicht«, sagte er, »sonst verlieren wir den Faden. Ich saß, wie gesagt, mit Husten und Fieber am Tisch, um die Schultern meinen alten Kamelhaarmantel und vor dem Mund ein Taschentuch, was nichts daran ändern konnte, daß sich die Bakterien gerecht auf meine Nachbarinnen verteilten, zur Linken auf die Kressnitz – die mich beschäftigt, wie du gemerkt haben wirst – und zur Rechten auf die Zenk, die mich immerhin nicht zum Wechseln der Straßenseite veranlaßt, was ich weder von der Stubenrauch und schon gar nicht von der Cordes sagen könnte …«
»Aber die Cordes hat doch was.«
»Wenn man nur ihren geschlossenen Mund betrachtet, ja. Ich habe aber nichts dagegen, daß Frauen den Mund auch öffnen, und zwar zum Sprechen. Und Cornelia Cordes, um das gleich abzuschließen, zählt zu den Frauen, die größten Wert auf weibliche Wirkung legen, sich jedoch den üblichen Folgen entziehen, indem sie mit viel Gefühl das Klima vergiften – was auch zu ihrem Kürzel unter den Schülern geführt haben mag, Tse-Tse, dem Klang der Initialen angelehnt und in jedem Fall gerechter als Ka-Zett, auch wenn die Kahle-Zenk jeden Morgen mit einem Familienbus, satellitengesteuert wie die Bomben auf Bagdad, am Hölderlin vorfährt und direkt neben der Cordes parkt. Natürlich wäre sie selbst gern Rektorin und hat auch gute Aussichten, aber noch saß sie gewissermaßen am Fußende, mit mir als Nachbarn zur Linken und dem einzigen offiziellen Paar in der Runde rechts von ihr, nämlich den Stubenrauchs, er in alarmierend gelbem Anorak, bei sich einen Rucksack, der Königspudel Holger mit grauem Lockenbusch, eine Frisur, die ich schon vor zwanzig Jahren verabscheut habe. Und sie mit kurzem Henna-Haar und einer Reihe von Accessoires, um den Anorak wettzumachen, nehme ich an, die rostrote Heide; und vor beiden auf dem Tisch eine Thermoskanne mit Bechern. Sein Fach ist die Geographie, wie du weißt, dazu der Politikkurs, wo es auf alle Probleme der dritten Welt eine Antwort gibt, speziell auf die afrikanischen, aufgrund seiner Reisen in den Kongo et cetera, zusammen mit Heide, deren Fotos aus Busch und Urwald unsere Flure um den letzten wilhelminischen Charme gebracht haben, was allerdings nur auf ihren Mann zurückfiel, mit der trefflich schmerzenden Verkürzung seines Namens, an die er sich gewöhnt hat, Kongo-Holger; so wie er nicht vom afrikanischen Elend loskommt, kann Heide sich nicht vom Henna und auch nicht von ihm befreien. Ihr Fach ist ja Englisch, die Sprache des Weltpolizisten, aber viel wichtiger ist ihr die Supervisionsgruppe, die sie ins Leben gerufen hat. Kollegen, die von sich selbst nicht genug kriegen können, treffen sich dort einmal pro Woche zur Aussprache unter ihrer Regie; nie geht es ohne Tränen ab, wie man hört. Und natürlich war ihr Platz während der Konferenz an Holgers Seite, oder umgekehrt, seiner an ihrer, wie sie auch immer in der großen Pause aus einer gemeinsamen Brotdose das zweite Frühstück einnehmen, aus einem Freßnapf, Haberland, man mag das glauben oder nicht …«
Und soweit ich weiß, war von meiner Seite ein Ausdruck der Ungläubigkeit gekommen, obwohl der Pausennapf der Stubenrauchs quasi Allgemeingut war, sonst hätte Branzger kaum in einer Demonstration reagiert, die ich noch vor mir sehe in ihrer traurigen Komik. Er spielte auf einmal, wie die Stubenrauchs aus ihrem Napf aßen, wobei er sich Mühe gab, der Sache gerecht zu werden, indem er nicht übertrieb, ja, er zeigte sogar noch, wie sie die Pausenhappen kauten, nämlich bewußt, eher die Augen als den Mund bewegend. Und auch seine Augen hatten sich bewegt, als verfolgten sie das Geschehen im Gaumen, Augen wie die von Paul Newman, ebenso blau und ebenso alt, wenn man an den Film denkt, wo er den Lebenslänglichen spielt, der einen Schlaganfall vortäuscht, um freizukommen (während Branzger, denke ich, ein Leben lang den Mann vorgetäuscht hat, der nur sich selber begehrt, um seine Freiheit zu wahren).
Der Doktor beschloß die Vorführung mit einem knappen Lächeln, und sein Blick verlor sich irgendwo über meinem Haar, bevor er leise fortfuhr. »Neun Personen saßen also um den Tisch, als die Cordes ihren Lammfellmantel auszog, obschon es immer noch kühl war, und die Konferenz über dich eröffnete. Der Schüler Viktor Haberland, neunzehn, stehe im dringenden Verdacht, die noch nicht volljährige Tizia Jentsch nach einer abendlichen Theaterprobe im Keller der Schule vergewaltigt zu haben, begann sie. Die Anwesenden, um ein Haar Zeugen des Vorfalls, hätten am nächsten Tag, vertreten durch die Schulleitung und einen Vertrauenslehrer, Herrn Blum, mit den Betroffenen geredet, und der Beschuldigte habe erklärt, von seiner Seite sei keinerlei Gewalt im Spiel gewesen, worauf Tizias Mutter, Frau Dr. Jentsch, bekannt als engagierte Ärztin, bereits am folgenden Morgen an-hand einer schriftlichen Aussage der Tochter, in der gleich mehrfach das Wort Vergewaltigung vorgekommen sei, darauf bestanden habe, daß Haberland, wenn auch Sohn eines Politikers, die Schule verlassen müsse, anderenfalls mobilisiere sie sowohl den Beirat als auch die Medien. Ein Kontakt mit dem Vater des Beschuldigten, derzeit in China, habe nicht hergestellt werden können, sagte die Cordes, und Haberlands Mutter habe die Dinge nur zur Kenntnis genommen, während mit der Dame Jentsch kaum zu reden gewesen sei, und das zu einem Zeitpunkt, als der Beirat bereits Wind davon bekommen habe, so daß man nun von zwei Seiten unter Druck stehe und in der Konferenz auf jeden Fall ein Beschluß über Haberlands Zukunft gefaßt werden müsse, Punkt. Das waren ihre Worte, gemäß Protokoll. Keine so unfaire Darstellung des Sachverhalts, oder was denkst du? Wenn ich davon ausgehe, daß du denken kannst …«
– 5 –
Einer der Lieblingssprüche der neueren Hirnforschung, der im übrigen schon ein Spruch meiner Schulzeit war, lautet: Wenn du denkst, daß du denkst, dann denkst du nur, daß du denkst. Im Grunde ein Wortspiel, aber ohne den Pfiff des Bonmots, eher etwas in der Art von Fischers Fritz, an dem wir uns die Zunge oder in diesem Fall den Verstand abbrechen sollen, und beides war mir damals passiert (denke ich), während es heute, bei meiner Vorbereitung auf den deutsch-portugiesischen Abend unter dem Titel Das traurige Ich – inzwischen soll ich auch die anschließende Diskussion leiten –, eher drohend vor mir steht.
Meine Zunge war in Gegenwart von Dr. Branzger so gut wie gelähmt oder eben abgebrochen, jedenfalls was die ersten Abende anging, und mein Verstand hatte sich darauf beschränkt, ihm zu folgen, wobei mir immerhin klar wurde, daß die Geschichte von der Konferenz über mich nur aus seinem Mund interessant war, so wie unsere Träume erst Bedeutung erlangen, wenn wir sie wiedergeben. Und vermutlich war das auch der wahre Grund meiner Besuche bei ihm: daß er mir etwas erzählt hat. Und auch wenn ich mich heute – vor mir den Stoß seiner Notizen und all die Artikel zur Vorbestimmtheit des Denkens, neben dem Fax aus Saarbrücken, die Schauspielerin Jentsch betreffend – frage, ob ich anders gekonnt hätte, als mich immer wieder von ihm einnehmen zu lassen, bis zum bitteren Ende, gibt es darauf nach wie vor keine vernünftige Antwort, nur die Antwort: offenbar nicht. Und ich konnte wohl auch nicht anders, als auf Tizia zu fliegen, mit allen Folgen für sie und für mich, so, wie ich immer wieder auf gewisse Frauen fliege, ohne wirklich bei ihnen zu landen; und wenn die Ursachen dafür bei den Molekülen liegen, warum nicht. Denn wie es aussieht, scheint es ihnen keineswegs gleichgültig zu sein, wie sie gelagert sind, oder käme es sonst, wieder und wieder, zu der Hinwendung an eine bestimmte Mundform und Haarfarbe à la Tizia, oder jede leuchtende Wade? Keiner könne anders, als er ist, sagt einer der Oberhirnforscher, und ich sage: meinetwegen.
Die Besuche bei Dr. Branzger mögen für mich die bestmögliche Verhaltensoption gewesen sein, gestützt auf eine Unzahl von Variablen, zu der ich auch das Elternhaus rechne, auf das ich gleich komme; und von mir aus und im nachhinein sollen all diese Optionen ruhig einem Wettbewerb verschiedenster Erregungsmuster entspringen, ohne den höheren Schiedsrichter meines Ichs, doch Branzgers Notizen und Nachträge, die vor mir liegen, tun das mit Sicherheit nicht. Sie sind nicht Folge einer maximalen Kohärenz aller Variablen, die seine und meine Geschichte betreffen, sondern bringen diesen größtmöglichen Zusammenhang überhaupt erst hervor, als Fiktion, wie die Hirnforschung ein wenig geringschätzig meint, ich sage: als Geschichte, eine Geschichte, die ich nach Kräften zu meiner mache, nicht nur durch die zeitliche Nähe. Ich erlaube mir auch auszusprechen, was ich damals nur gedacht habe oder nicht einmal das, seine Fiktion also fortzusetzen und mit mir selbst zu durchdringen, in der Weise wie mich Branzger, mein alter Lehrer, durchdrungen hatte; und auf sein Schlußwort an unserem ersten Abend, Oder was denkst du?, wenn ich davon ausgehe, daß du denken kannst, antworte ich erst heute mit einer gewissen Freiheit, nicht ihm gegenüber, sondern mir.