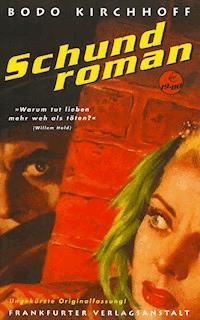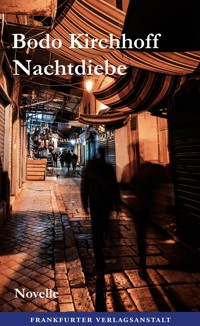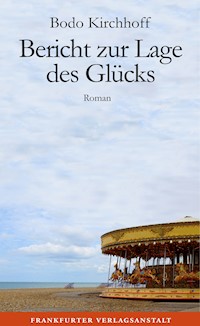Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was ist ein Freund, was bedeutet es, einen Freund zu haben seit Schultagen, einen besten Freund, mit dem man Reisen plant, träumt, sich über Bücher austauscht, die ersten Liebeserfahrungen teilt, später Pläne fürs Leben schmiedet, den man dann im Erwachsenwerden immer mehr aus den Augen verliert, mit dem man nur dann und wann telefoniert, ein Freund aus alten Tagen, der irgendwann seine Arbeit aufgibt, dann schließlich auch seine bürgerliche Existenz, der immer melancholischer wird, krank, und unversehens, gerade 58-jährig stirbt? Bodo Kirchhoff erzählt in Eros und Asche von seiner lebenslangen Freundschaft zu einem tragisch Begabten, der es am Ende vorzog, sich mit all seinem Wissen und all seiner Anziehung einzuschließen. Er erzählt von frühen Höhepunkten und Krisen, die bis in die Gegenwart reichen, und dem Sterben des Freundes zu einem Zeitpunkt, als die alte Intensität noch einmal Auftrieb bekam, inmitten einer eigenen intensiven Phase. Und so wurde aus einer Chronik der laufenden Erinnerungen auch eine Chronik des laufenden Geschehens, mit dem Ergebnis eines großen Freundschaftsromans, der zwei Leben ebenso bewegend verbindet, wie zwei Zeiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2007
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Bodo Kirchhoff
EROS UND ASCHE
Ein Freundschaftsroman
1. Auflage 2007
© Frankfurter Verlagsanstalt GmbH,
Frankfurt am Main 2007
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung und Umschlagsgestaltung:
Laura J Gerlach, Frankfurt am Main
eISBN: 978-3-6270-2143-6
Michael Päselt gewidmet
1
Ich hätte mehr auf mich hören sollen, auf mein Bangen um ihn in diesen Minuten, die so wenig von letzten Minuten hatten, statt zu glauben, es würde einfach immer so weitergehen mit unserer lebenslangen ungeklärten Freundschaft. M.s plötzliches Erzählen von dem versteckten See, auf dem zu rudern für ihn wohl noch einmal das Glück war – wir telefonierten spät abends, ich sah auf meinen völlig unversteckten italienischen Lago –, hatte nämlich etwas Erschütterndes, wie das Erzählen von einem Garten, der verschlossenen Kindern das Herz öffnet, weiter als je danach. Und ihn, der schon immer für sich war, hatten Stille und Schönheit dieses Sees geöffnet, die Farben im Ton der Ufer, flaschen- und salbeigrün, sagte er, je nach Wald oder Schilf, und der Geruch von Harz, wo Bäume bis ans Wasser reichten, oder nach Moder, wo Äste und Laub im Flachen trieben. Er klang süchtig nach der Reinheit eines Sommermorgens, dem leisen Klatschen der Ruderblätter, von dem er sprach, oder der frühen, über Kiefern und Birken schießenden Sonne. Sein versteckter See schien das letzte, für ihn erreichbare Stück Welt zu sein, das ihn noch staunen ließ, obwohl er dort alles kannte, aber nichts davon in sich zerpflückt hat, wie er es sonst mit allem und jedem tat; und so war es die richtige Umgebung, um dort das Leben zu lassen, oder, wie es auch heißt, den Geist auszuhauchen – animam efflare, schon damals in Lateinstunden nur allzu gern von ihm aufgegriffen.
Unsere erste Begegnung war an einem offenen Fenster, dritter Stock, ich hatte etwas kühn auf der Kante gesessen, schon im Schlafanzug, und zum Sportplatz hinter dem Schlossheim geschaut, zu dieser Stunde am Anreisetag nach den Osterferien – einst der Beginn des Schuljahrs –, im letzten Licht, und er kam zur Tür herein. Mit der einen Hand trug er seinen Koffer, in der anderen hielt er Zigaretten und Feuerzeug, schlecht verborgen, weil die Hand zu schmal war; dafür hatte sein Blick etwas, das einen Fünfzehnjährigen schon wie den Mann auf verlorenem Posten aussehen lässt, wenn er nicht einen Gegenstand der Überheblichkeit mit sich führt, ein Buch, eine Kamera, eine Brille oder eben Zigaretten und Feuerzeug. Und nur Sekunden später – er hatte fast das Fenster erreicht, ohne etwas zu sagen – tauchte auch noch ein handliches Tonbandgerät auf, seinerzeit sensationell, wie nebenbei aus dem Koffer geholt und vor mir auf das Fensterbrett gestellt, während er für die Verspätung – eigentlich sollten alle Neuen bis zum Abendessen da sein – Worte fand, die damals nicht von dieser Welt waren: Zu viel Verkehr. Dann gab er mir die schmale Rechte, den Daumen angelegt, um meinem Druck auszuweichen, in der anderen Hand nun offen die Zigaretten, und mit einer kurzen geübten Bewegung ließ er eine einzige Zigarette zur Hälfte aus der Schachtel schnellen, ohne die anderen mitzuziehen. Willst du? fragte er und hielt mir die Zigarette mit ihrer Spitze vor die Lippen, damit ich mich unmittelbar, als sei’s eine Übung fürs Küssen, bediene. Gleichzeitig nannte er Vor- und Nachnamen, als wollte er mit mir ein Geschäft abschließen, und brachte mich dazu, auch meinen vollen Namen zu nennen, bevor er den Überheblichkeitsgegenstand Nummer eins aufschnappen ließ und erst mir und dann sich hinter schützender Hand Feuer gab. Beide standen wir jetzt am Fenster, weit hinaus gebeugt, so konnte man den Rauch ins Freie blasen und die Zigaretten jederzeit in den Hof fallen lassen. Zwischen uns, genauer gesagt, seiner Hüfte und meiner – er trug nagelneue, nur über den Schenkeln schon bearbeitete Levis und ein weißes, offenes Hemd, das den Flaum auf seiner Brust zeigte –, war nur das Tonband, auf dem er etwas Bestimmtes suchte, die passende Begleitung für unser verbotenes Tun. Und als schließlich ein italienisches Lied kam, das ich noch nie gehört hatte – die alte Partisanenhymne Bella ciao –, fragte er mit Blick aus dem Fenster, ob ich schon einmal in Ravello gewesen sei. Nein, sagte ich, und er zeigte mir, beim langsamen Ausblasen des Rauchs, im Ansatz schon das Lächeln, das er sich bis zum Ende bewahrt hat, um die Welt auf Abstand zu halten. Und der Junge, der mir wieder nah wird, wenn ich heute von diesem Abend erzähle, machte sich Gedanken, was das Lächeln wohl bedeuten könnte, ohne zu ahnen, dass es auch gar nichts bedeuten kann und nur deshalb hinter den Rauchspiralen erscheint, weil einer dazu imstande ist, so fein seinen Mund in die Breite zu ziehen, mit Zigarette zwischen den Lippen. Ach, sagte er schließlich, ich käme da schon noch mal hin. Dann bat er mich, ihm die Funktion des Klappbetts zu erklären.
Und M.s letzte Worte, Worte am Telefon, bevor seine Verflüchtigung an mir vorbeiging, waren mehr ein Aufruf als eine Bitte: Pack unsere Dinge in einen Roman. Und halt die Ohren steif – eine Formel, die er schon immer bei Abschieden gebraucht hatte, um den Gegenwind anzudeuten, der für ihn das Leben selbst war. Seine Ohren und auch alles Übrige sind bald darauf zu Staub geworden, nur der Aufruf blieb bestehen; und unsere Dinge, das waren die einer Freundschaft von absurder Tiefe, bis in die Blutgefäße des Denkens, absurd, weil das spätere Leben diese Zeit überschrieben hat, auch wenn die alten Buchstaben noch bei jeder Gelegenheit durchscheinen. Ein Roman müsste das sorgfältig trennen, für den Übriggebliebenen eine Arbeit, bei der er nur das Beste versuchen kann und das vorläufig auch nur von Hand, nach einer Augenoperation, die jeden Bildschirm zur Sonne macht. Ein Schreiben in verdunkelter Wohnung, ohne recht zu sehen, was da aufs Papier kommt – klar ist nur, worum es geht, um eine lang zurückliegende, unerledigte Liebe. Also geht es nicht weniger um das Heute, um eine Chronik der laufenden Erinnerungen entlang des laufenden Geschehens. Erst vor kurzem nahm mich nach einer Lesung ein Mann beiseite und kam gleich auf M. – sie seien Kollegen gewesen, im alten Klinikum Steglitz (jetzt Benjamin Franklin), Abteilung Neurochirurgie. Und ich erfuhr, dass M. in Zigarettenpausen gern meine Postkarten von sonstwo gezeigt hatte, die Grüße seines Schriftstellerfreundes. Eine ebenso gute wie schmerzliche Neuigkeit, eingeklemmt zwischen vollendeter Vergangenheit und unvollkommener Gegenwart, wie dieses Buch.
Als vorige Woche – in der Woche nach Ostern – ein Päckchen aus Berlin mit einigen von M.s Lieblingsbüchern und einer meiner alten Karten als Vorhut oder Probesendung in Frankfurt eintraf, kam ich gerade mit einem Verband über dem linken Auge aus dem Krankenhaus Höchst, Abteilung Mikrochirurgie. Es war schon der zweite Eingriff an diesem Auge, nach einer ganzen Augenöffnung vor einigen Jahren, um eine abgelöste Netzhaut anzulegen, und auch auf das andere ist kein Verlass mehr – M. hatte meine Augen früher, aus seinem Instinkt für Schwächen, mit Vergnügen heruntergemacht, etwa nach Trinknächten, wenn ich in unserem Zweierzimmer wie blind war vor Übelkeit, während er schon eine rauchte und sein Tonband lief. Vierzig Jahre später, bei einem unserer letzten Telefonate – er im Krankenhaus, als Patient, ich an meinem See –, hat er das Urteil revidiert, aufgrund eines Zeitungsfotos, das den Autor ohne Brille in günstigem Licht zeigt: mit zwei Augen, die nichts taugen – und sein Lachen auf diese Selbsteinschätzung hin war nur noch ein raues Keuchen, bis er wieder Luft hatte und von Bastardaugen sprach. Tatsächlich taugen sie momentan kaum zum Lesen meiner alten Karte (aus Paraguay), da jedes Licht zu viel ist. Bleibt nur ein Blick auf die zugesandten Bücher, vier Ausgaben von Hölderlins Hyperion, zwei Fassungen von Jüngers Abenteuerlichem Herzen und eine Erstausgabe von Benn-Gedichten, das alles, ohne dass ich darum gebeten hätte. M.s Gefährtin seiner letzten zwanzig Jahre wusste um unsere ruhelos ruhende Freundschaft, die ihren Grund nur in dem Scheinprivileg hatte, dass wir gemeinsam jung waren und nebeneinander den Geist und das Lieben entdeckt haben, all das sehr früh, zerstörerisch früh, heilbar erst Spät im Jahre, wie es bei Benn heißt, in einer Strophe mit M.s doppeltem Ausrufezeichen am Rand. »Spät im Jahre, tief im Schweigen / dem, der ganz sich selbst gehört, / werden Blicke niedersteigen, /neue, Blicke, unzerstört.«
2
Mehrmals in der Woche jetzt mein Trommeln mit den Fäusten gegen die Schlafzimmerwand, die auch Schlafzimmerwand der Nachbarwohnung ist, seit einigen Monaten von einem Unternehmen für Sprachreisen im Haus für ausländische Schüler und Schülerinnen angemietet, mit der Folge nächtlicher Feiern bei jeder Gelegenheit. Gut ein Dutzend junge Leute, Mexikanerinnen, Spanier, Koreaner und das Lauteste, was Italien zu bieten hat, amüsieren sich nebenan nach Kräften, bis ich trommle oder in den Flur trete und in drei Sprachen erst um Ruhe bitte, dann um Ruhe brülle und einer von ihnen den Kopf zur Tür hinausstreckt, um den Alten im Hausmantel zu beruhigen; und heute Nacht ist es besonders schlimm, dazu noch ohne jede Möglichkeit, M. davon zu erzählen. Seit unserer räumlichen Trennung, jeder noch das Leben vor sich, gab es mehr Telefonate als Begegnungen, aber nicht sehr viel mehr. Es konnte auch vorkommen, dass wir ein Jahr nichts voneinander hörten, bis völlig unerwartet ein Anruf kam. Zwischen Berlin und Frankfurt lagen Welten, die Welten zwischen dem Schlaflosen eines gewollten Exils und dem Wachhaltenden eines Schreiblebens mit Familie im Hintergrund; und für M.s Gefährtin blieb der Frankfurter Freund ein Phantom, dem sie die Todesnachricht, weil sie ihn anders nicht erreicht hatte, auf die Mailbox sprach.
Schon das weiße Papier blendet, die Augen lassen den Benutzer zusehends im Stich. Als Spätfolge der Netzhautablösung ergab sich, um Jahre verfrüht, ein grauer Star, und der Eingriff (Katarakt-Operation) war nicht das versprochene Kinderspiel. Das Gewebe erwies sich als sehr weich, der Linsensack wurde schließlich mit einer gewissen Ungeduld, da andere vor der OP-Schleuse bereits auf den Eingriff warteten, herausgerissen, ausländische Schwestern – Korea, Balkan, lebensfrohe Stimmen – gaben der Operateurin Empfehlungen für das Annähen der Kunstlinse, und eine Anästhesistin spritzte ein so beruhigendes Mittel, dass es schon wieder beunruhigend war. Ein grünlicher Raum voller Frauen, alle bemüht um das Augenlicht des abgedeckten männlichen Patienten. Und das vorläufige Resultat: einer, der nicht mehr vor dem Bildschirm arbeiten kann. Daher der Rückgriff auf die Handschrift und ein Notizbuch, wie sonst nur beim Unterwegssein, erstmals erprobt auf einer der wenigen Reisen mit M. – mehr waren es nur in Träumen, da haben wir alle möglichen Orte besucht, Pamplona, wenn sie dort die Stiere loslassen, oder Segesta, wo wir allein zwischen den Säulen saßen, um uns die verbrannte Erde Siziliens; wir waren auf dem Ätna und sind durch Tanger gelaufen, wir haben in Bolivien Che Guevara gesehen, in Träumen, die nach M.s Tod einfach ausblieben.
Und eine der wenigen Reisen, die nichts mit meinem Schlaf zu tun hatten, verdient diesen Namen eigentlich gar nicht und war doch eine Reise, als hätten wir unerforschte Regionen durchquert. Nach dem Abitur verbrachten wir im Spätsommer achtundsechzig einen Monat auf Teneriffa und unternahmen in dieser Zeit auch eine wirkliche Bergbesteigung, nämlich die des Pico del Teide, der sogar dem unerschrockenen Humboldt einiges abverlangt hatte. Fast ohne Proviant waren wir in leichtester Kleidung und nur mit Turnschuhen an den Füßen in Höhe der Lavafelder aufgebrochen und hatten uns, nach kurzer Rast in einer Hütte, morgens um drei bei Dunkelheit und Kälte einer spanischen Gruppe angeschlossen. Wir stolperten mehr bergauf, als dass wir gingen oder gar marschierten, bald abgeschlagen von den Spaniern, immer nur einem gewaltigen schwarzen Dreieck im Meer der Sterne entgegen, der Bergkuppe. Wir verfluchten einander und stießen uns gegenseitig Meter für Meter vorwärts, jeder sah im anderen den Anstifter zu diesem Ausflug, den wir dennoch zusammen bestehen wollten. Die letzten zweihundert Höhenmeter, einen Sandkegel hinauf, haben wir uns gegenseitig gezogen, in eisiger und schon etwas dünner Luft, und schließlich hat M. den Sonnenaufgang über dem Meer fotografiert, und wir rauchten noch eine (nur physikalisch waren es zwei), bevor es wieder hinunter ging, ein schweigsamer Abstieg. Erst abends im Hotelzimmer machte er mir eine Szene, weil ihm alles wehtat und die Nase lief, und ich konterte mit Husten und Schüttelfrost und gab die Vorwürfe zurück, worauf wir zwei ganze Tage im Bett verbrachten, jeder mit seinen Büchern, ohne ein Wort zu reden. »Wir schweigen mal wieder«, steht im Notizbuch dieser Reise unter dem Datum achter September. »Er liest seinen Trotzki und ein Buch von Jünger, Afrikanische Spiele, und unterstreicht dauernd was, ich lese meinen Genet, Tagebuch eines Diebes. Sein Schnupfen ist längst in Ordnung, aber er bleibt im Bett, raucht und blättert und sagt kein Wort.« Und der zehnte September beginnt mit den Sätzen: »Blauer Himmel, und schon beim Frühstück nähern sich zwei Pfauen. M. nennt den schöneren Marcello und fordert mich auf, dem anderen auch einen Namen zu geben, und ich nenne ihn James. Wir reden wieder.« Unser Hotel hieß Taoro und lag in einem Park mit exotischen Tieren, ein feines altes Haus, längst abgerissen. M.s wohlhabender Vater hatte die Reise für zwei Personen gebucht – die eine Person bekam alles geschenkt, die andere musste sich das Geld dafür auf dem Bau verdienen.
Oft war es der Anblick von etwas Schönem, der uns wieder reden ließ, oder auch nur ein Wort, das dafür stand und M. aus der Reserve holte; und manchmal kam beides zusammen, wie in dem Namen Ravello, der schon bei unserer ersten Zigarette gefallen war. Diese Ortschaft, hoch und steil über der Küste von Amalfi, eine Reihe alter Villen und kleiner Hotels mit Sicht auf das Meer wie auf einen herabgeholten Himmel, zählt bekanntlich zum Schönsten, was das an Schönheit reiche Italien zu bieten hat; Ehepaare, die sich noch bei der Fahrt auf gewundener Straße angeschrien haben, sitzen nach der Ankunft stumm auf ihrer Terrasse, überwältigt von etwas Drittem. Und die zwei Schulfreunde saßen einige Jahre nach Teneriffa nachts auf dem Dach einer Pension und wagten es nur flüsternd, einen Streit, der sie schon seit Tagen beschäftigte, fortzusetzen. Der eine – der auf keinen Fall vorhatte, im Leben zu scheitern – sagte zum anderen – dem es letztlich nur ums Scheitern ging –, es sei idiotisch, Medizin zu studieren, wenn man sich für andere Dinge weit mehr interessiere. Werde Journalist, flüsterte ich (in meiner Erinnerung), Fotoreporter in Vietnam oder Südamerika, mach gute Bilder, zeig das Leben, retten können es auch andere. Und M., mit Zigarette im Mund, ohne sie anzustecken, sah nur aufs schimmernde Meer hinunter und stieß in kleinen Schüben Luft aus der Nase, anstelle eines Lachens; und mehr denn je erschien er mir als einer, der auch ganz ohne Licht in jeder beliebigen Richtung seinen Schatten wirft.
Heute, beim wöchentlichen Einkauf, landeten Zigaretten im Korb, die unveränderten Roth-Händle (unverändert bis auf den neuen Sterbehinweis), und nun riecht der Käufer an ihnen, um etwas vom Aroma dieser Jahre aufzunehmen; ich rauche noch keine, das hat Zeit, im Moment genügt der Tabakkrümel auf der Zunge und das Haften des Papiers an der Unterlippe, wenn man zu lange zögert mit dem Anzünden. M. hatte immer Reval geraucht, aber gelegentlich auch meine Roth-Händle, vor allem in der Zeit, als wir unsere Köpfe am dichtesten zusammengesteckt hatten: für das erste und einzige Exemplar einer Schülerzeitung mit dem Bildungsnamen Hermes (heute würde man wohl an Mode denken), ein dem Gott der Diebe gewidmetes Blatt, das sich immer noch sehen lassen könnte. M. hat sich dort, keine drei Jahre nach dem Mauerbau, für zwei deutsche, mit ihren verschiedenen Gesellschaftsformen wetteifernde Staaten ausgesprochen, für einen gegenseitigen Respekt, der die deutsche Wiedervereinigung überflüssig machte – ein Gedanke, den ihm die geflüchteten Ostlehrer an der Schule noch jahrelang heimgezahlt haben. Und der damals schon schreibende Freund hat sich in einem Artikel für die nicht bevormundete Liebe ins Zeug gelegt, ohne erfahren zu haben, was Liebe ist; diese Erfahrung kam erst nach den Worten, ebenfalls wetteifernd, und in jeder Phase begleitet von den Zigaretten, in deren Päckchen immer ein Zehnpfennigstück lag, um das Günstige des Preises hervorzuheben und damit auch irgendwie, wenn man ein Roth-Händle-Raucher war, das Erschwingliche der Liebe.
Die beiden Freunde gingen in der Schülerzeitungszeit mit den Töchtern eines katholischen Apothekerpaars, das sich geweigert hat, die neue Pille zu verteilen, den Mädchen aber erlaubte, mit uns in den Osterferien nach Rom zu fahren, sofern wir dort in einem Kloster Quartier beziehen würden. Und so wohnten wir mit zwei weniger frommen Schwestern bei den ganz frommen Schwestern auf dem Gianicolo, Via Fratelli Bandiera dodici, und tauschten des Nachts, internatsgeschult, hinter dem Rücken der betenden Nonnen, die Kammern. Die Betten waren schmal, die Räume waren kalt, unsere Erfahrungen beschränkten sich auf Bücher und Berichte; die befleckten Laken versuchten wir eigenhändig zu waschen und brachten sie später, noch nass und in unsere Mäntel geschlagen, zu einer Wäscherei, wo man sie nicht annehmen wollte. Daraufhin kauften wir neue Laken, die aber den Klosterlaken nicht glichen, und nannten es den Nonnen gegenüber eine Spende, il dono. Wir dachten, damit seien alle Probleme erledigt, nur fingen sie ein paar Wochen später erst an, und unsere Bergbesteigung Nummer eins fand dann in der Ebene statt: als Canossafahrt zu dem Apothekerpaar, um die Schwangerschaft einer der Töchter zu gestehen, als hätten wir sie gemeinsam verursacht. Der Erzeuger hockte mit wippendem Knie da und rauchte, und sein Freund hatte schon damals die Worte zu finden, gegenüber einem Paar, das kerzengerade auf seinem Sofa saß, zu Füßen des Mannes ein Dackel. Ich hatte vorher nur kurz angerufen und gesagt, wir müssten sie sprechen, und sie waren von der Apotheke nach Hause geeilt. Nun rechneten sie aus ihrer Sicht mit dem Schlimmsten – dem Schulversagen einer der Töchter oder gar beider –, das wir beauftragt wären, schonend beizubringen. Doch die Hände sprachen eine andere Sprache, besonders die der Mutter mit weißen Knöcheln, aber auch die ihres Mannes, der pausenlos den Hund kraulte, bis ich die Dinge endlich in einem einzigen Satz vorbrachte und die Hand im Hundefell erst innehielt, um sich dann hineinzukrampfen oder festzuhalten an dem schon betagten Dackel, für den ja (wie für jedes Haustier) galt, dass der einzige Schmerz, den er einem je zufügen kann, sein Tod ist, während die jüngere der Töchter gerade mit neuem Leben diesem Schmerz zugefügt hatte, mehr aber noch der Überbringer der Nachricht, der klar auf der Verursacherseite stand. Es tue uns sehr leid, sagte ich abschließend, dann folgte ein entsetzliches Schweigen und irgendwann der Satz, wir sollten jetzt gehen. Und so ging es per Anhalter wieder zurück zum Bodensee, und es gab nur noch ein paar meiner Roth-Händle, weil alle Revals geraucht waren; die letzte teilten wir, filmreif, auf der Sitzbank eines LKW der Firma Schiesser eingeklemmt neben dem Fahrer – und im Augenblick steigt er mir gerade wieder in die Nase, dieser alte, würzige Tabakgeruch nach etwas unfassbar Jungem.
3
Der Sohn hat einen neuen Laptop, viel besser als der seines Vaters, und er hat sich auch gleich ein neues Spiel besorgt, Gothic 3, ein Spiel, für das man ein ganzes Handbuch benötigt, um am Ende als eine Art Ritter gegen Monster und Ritter zweiter Klasse mit Erfolg in die Schlacht ziehen zu können; seitdem er sich mit Gothic 3 befasst, haben wir nur wenige Sätze gewechselt. Das Spiel lässt ihn nicht los, wie zuvor schon andere Spiele, etwa Counterstrike Source, die Blutversion. Der Sohn ist achtzehn und macht im nächsten Jahr Abitur, sein Abitur wird viel besser als das des Vaters, trotz Gothic 3, das er mit einem Freund oft bis tief in die Nacht spielt. Und er weiß auch auf seine Weise mehr, als wir damals wussten, es bedeutet ihm nur weniger; irgendetwas macht er in seinem jungen Leben also richtig, richtiger als sein Vater in diesen Jahren, auch wenn der oft glaubt, der Sohn würde mit solchen Kindereien vor dem Bildschirm alles falsch machen. M. lebte im selben Alter auf andere Weise in den Tag; seine Zukunft, das war die bevorstehende Nacht, das nächste Päckchen Zigaretten, die nächste Seite in einem Buch. Er war schon mit siebzehn ein Geistesvagabund, ein Verführer, der auch sich selbst verführt hat, ein Herrenloser – zu seinen Leibund Magenbüchern, die auch meine Leib- und Magenbücher wurden, zählten Malapartes Die Haut (das der Sohn gerade liest, beglückend für den Vater) und Joseph Roths Radetzkymarsch und sein Stummer Prophet, Romane, die vom Verlust aller Wurzeln und Bindungen handeln, aber auch, wie bei Malaparte in Gestalt des Colonel Hamilton, von der Suche nach einer Wurzel im Humanismus.
Herrenlos – das Wort, das auf beide Freunde zutrifft, auch wenn der eine Familie und eine gewisse Bekanntheit hat, und der andere lange Zeit Angestellter war; es bleibt etwas Asoziales trotz dieser Bindungen, mehr Treue zu sich selbst als gegenüber dem anderen. Bei unserem vorletzten Gespräch sagte M. auf einmal – er hatte gegen Mittag angerufen, um mir für Büchersendungen zu danken, in die Klinik, in der er mit einem Lungenemphysem seinem Ende noch einmal ausgewichen war –, eigentlich würde er mich gern sehen, am liebsten gleich. Er war noch nicht wieder ganz bei Stimme, alles klang leiser und weicher als sonst – und überhaupt hätte er mich gern öfter gesehen, sagte er noch, und ich gab dieses Gefühl zurück, und beide mussten wir damit fertig werden, dass wir wohl etwas versäumt hatten und schon wieder im Begriff waren zu versäumen. Denn ich hätte mich ja in den nächsten Zug setzen können, und er hätte mich vier Stunden später abgeholt, und wir wären in seinem Auto, einem kleinen verwahrlosten Japaner, eine Nacht durch Berlin gefahren und hätten morgens noch im Bahnhof Zoo gefrühstückt. Aber wir haben es bei der Idee von dieser Nacht belassen (und die letzte Gelegenheit ausgeschlagen, uns noch einmal zu sehen); wir haben über unsere seltsamen Wünsche gelacht und aufgelegt.
Das zweite Päckchen oder Paket, das M.s Gefährtin – mir fällt kein besseres Wort für sie ein – aus dem Nachlass für mich zusammengestellt hat, liegt geöffnet auf dem Boden. Neben weiteren Büchern, alten Rilke-, Fontane- und Heine-Ausgaben mit feinen Anstreichungen (Bleistift), findet sich eine Mappe mit Fotos von M., aufgenommen von der Gefährtin. Man sieht ihn, wie H. in einem formlosen Brief erläutert, einen Tag vor seinem Ende im Ruderkahn auf dem See, ernst bis in die Haarspitzen, und eine Stunde nach dem Tod vor einer Waldhütte auf dem Boden, schon mit einem Tuch bedeckt, nur die nackten weißen Füße stehen hervor. Und in dem zweiten Päckchen fand sich auch eine von H. zusammengestellte Liste aller gebundenen Bücher, die er hinterlassen hat, neben Tausenden von Taschenbüchern und dreißig Kartons mit Kunst- und Fotobänden, und der Empfänger fängt auf Vorschlag der Absenderin damit an, seine kleinen Kreuze an den Rand der mehrseitigen Liste zu machen, als sollte damit der Tod des Freundes noch einmal und gleich vielfach bestätigt werden. Und nach einigen Kreuzen will ich diese Bestätigung auch nicht fortsetzen, die Verwalterin der Bücher soll die Auswahl treffen, sie weiß genug über das Phantom aus Frankfurt, sonst hätte sie keine so gute Zusammenstellung alter und neuester Fotos von M. geschickt, alle mit dem Blick, der mir schon bei unserer ersten Zigarette am Fenster unnötiges Kopfzerbrechen bereitet hatte. Ein oft unbeteiligter oder gegenläufiger Blick, wenn er gelächelt hat mitsamt seinem Schnurrbart: nahezu lebenslanger Tribut an den Vater. Und über dieser Bürste seine pfeilförmige Nase, passend zu den angeschrägten Augen in der Farbe von Harz; darüber eine breite Stirn, die mit den Jahren immer höher wurde. M.s Haar war früher dunkel und kraus, am Ende waren es nur noch krause weiße Reste, um so dichter dafür der Bart; seit Mitte Dreißig kam er vom Unrasiertsein immer weniger los. Als sein Bart noch schwarz war, glich er den Abenteurern in John-Huston-Filmen (und Männer, die auf Verwegenes standen, liebten ihn, wie ich hörte); später, mit weißem Gestrüpp an den Wangen, hatte er etwas von einem Astronomen, der die Sternwarte kaum noch verlässt. Aber sein Aussehen war für ihn nie ein Freibrief zur Flachheit, im Gegenteil; erst die böse-gescheite Art, damit umzugehen, sicherte ihm die Vorteile daraus. Er fiel auf, ohne aufzufallen, er musste sich nie in Szene setzen, sein Dünkel hatte auch mit dieser Wirkung zu tun, ebenso der Argwohn gegenüber jeglichem Lob. Der Blick in den Spiegel konnte ihn aufrichten, aber nie letzte Zweifel ausräumen, ob er das auch wirklich sei. Und so hat er bis heute mein Freundesschema geprägt – gute Figur, wacher Verstand.
Die eigene Ungeduld ist so groß, dass sich kaum ein Wort lesbar zu Ende schreiben lässt, meine Gedanken sind flinker als die Hand; dazu die vielen schwebenden Punkte aus der Tiefe des Auges – und dann und wann kein weißer Elefant, aber eine Art grauer Flugzeugträger, der durchs Bild zieht. Der Schreibende sieht nur, was er gerade schreibt, und auch das noch verschwommen, nachmittags auf einer im Erdboden verankerten Bank, gestiftet von der Allianz-Versicherung, einer Sitzgelegenheit am Schweizer Platz, Frankfurt, Sachsenhausen. Die neue Linse – künstliches Teil Nummer zwei im Auge, nach einem Silikonpfropfen, der die Netzhaut andrückt – kann sich leider nicht mehr an die alte gestützte Netzhaut anpassen, und das gesündere Auge will nicht die Gesamtarbeit verrichten, ganz zu schweigen von einem Hirn, das sich gegen das Neue instinktiv auflehnt. Die Kunstlinse ist gleichsam der Fremde im Auge, und das Hirn antwortet derzeit schon nach zwei Stunden Schreiben mit Kopfweh. Die Tabletten liegen bereit, sie liegen gleich neben dem kleinen silbrigen Stick, der alles enthält, woran der Autor im Moment nicht arbeiten kann; er ist kleiner und leichter als die Tablettenschachtel und könnte ein Lebenswerk aufnehmen oder in sich verschwinden lassen, und um dem irgendwie Rechnung zu tragen, hat der Besitzer ein Stück Papier mit der E-Mail-Adresse seiner Frau auf die Oberseite geklebt.
Auf dem Rückweg in die Schreibwohnung von weitem Herr N., beliebter junger Lehrer an dem Gymnasium, das unsere Kinder besuchen, doch für den Vater zeichnet ihn etwas ganz anderes aus, eine schon gespenstische Ähnlichkeit mit M., als der im selben Alter war. Wie vom Marasmus seiner letzten Jahre reingewaschen, kommt M. als Herr N. auf mich zu, nur das Freundliche des Blicks stört den Eindruck; der Doppelgänger befindet sich ganz auf der Seite des Lebens, auf der M. nur Gast war. Und unvergesslich, wie Herr N., noch ehe er als Lehrer am Schiller-Gymnasium offiziell in Erscheinung getreten war, zum ersten Mal auf mich zukam, vor meinem Wohnhaus, und ich augenblicklich annahm, M. sei wahnsinnig geworden und gehe, ohne zu grüßen, dort auf und ab. Ich rief seinen Namen, zweimal sogar, aber der Angerufene reagierte nicht, er schaute bloß leicht erschrocken (weil er den Rufenden als Autor kannte, wie ich später erfuhr) und hielt wohl mich für den Wahnsinnigen, träumend am helllichten Tag. Und nun geht Herr N. nach kurzem Hallo – wir haben nie über den Vorfall gesprochen – wahrscheinlich zu seiner Schule, während der Autor die Begegnung in einem Vokabelheft, das ihm lieber ist als jedes Notizbuch, noch im Stehen festhält.
Und in der folgenden Nacht ein tatsächlicher Traum, so zwingend deutlich, wie nur Glücks- oder Albträume sein können, in beiden Fällen das Erwachen halb Enttäuschung, halb Erlösung. M. lebte wieder, er war nicht tot, er lief mir in einem Ort am Meer über den Weg, und ich wollte von meinen Notizen erzählen, dem Versuch eines Buchs über ihn und mich oder über uns beide, doch er hatte keine Zeit dafür, er musste weiter, und ich begriff, dass mein Buch jetzt keinen Sinn mehr hatte; den hatte es nur, als er tot war. Also freute ich mich auch nicht, ihn noch am Leben zu wissen und dennoch suchte ich ihn überall in dem Ort und fand ihn endlich am Strand, er saß da und rauchte eine, mit sich allein, deshalb hatte er keine Zeit gehabt, und ich erwähnte mit ein paar Worten das Buch über ihn und uns beide, ein Buch, das auch in der Gegenwart spiele, während er schon aufstand und langsam davonging, sich aber noch einmal umdrehte. Er fuhr durch seine Haare, die voll und dunkel waren, und entschuldigte sich für die Rückkehr ins Leben. Und dann schlug er mir vor, diese Rückkehr in das Buch aufzunehmen – erst sei er tot, und ich könnte darüber schreiben, und im letzten Drittel tauche er wieder auf, dadurch würde es auch ein Roman. Dieses Wort sagte er mit dem üblichen Lächeln, ohne Beteiligung der Augen, die neue Zigarette in der Hand, und als er sie ansteckte in einer Kehrtwendung, um sich dann rasch zu entfernen auf dem Strand voller Seetang, wollte ich ihm den Traum erzählen, wie wir es früher manchmal getan hatten, in unserem Zweierzimmer, doch war er schon zu weit weg, in seiner alten Lederjacke mit dem hohen Kragen, und mir kam der Gedanke – bereits als Teil meines Aufwachens –, dass man nicht von Dingen reden kann, die noch andauern, schon gar nicht, wenn man selbst in den Dingen steckt, und ich folglich sitzen bliebe auf dieser Geschichte.
Das gegenseitige Erzählen von Träumen ist eine typische Zwischenbeschäftigung von Liebenden oder sehr zugetanen Freunden; der, der zuhört, nimmt ein Stück weit am Wahn des anderen teil, um ihm letztlich beim Erwachen zu helfen. Wenn M. am Telefon mit einem Traum von uns beiden herausgerückt war, rückte auch ich mit einem Traum dieser Sorte heraus, und wir machten uns lustig über die Bilder, die jeder für sich – ich bestimmt – nicht lustig fand. Mit Deutungen hielt man sich zurück, und wenn, dann waren sie simpler Art (wir waren uns schon früh darin einig, dass den niederen Motiven mehr zu trauen sei als den höheren, die gab es allenfalls im Angesicht des Todes, bei unseren Helden aus Befreiungskriegen). Der eine glaubte sich in der Psychoanalyse auszukennen, der andere in der Neurologie, wir misstrauten einander; mein Ziel war das Verstehen, seins das Entlarven. Am Ende unserer Nacht von Ravello hatten wir auf dem Dach der Pension, mit Blick auf ein graublaues Meer in der Tiefe, gefroren und gegähnt, aber keiner wollte sich die Blöße geben, schlafen zu gehen. M. lag in einem Liegestuhl und rauchte, und ich saß auf der Brüstung, etwas kühn wie auf der Kante des offenen Fensters zehn Jahre zuvor, und las im ersten Licht in einem Buch über Semantik, das ich auf dieser Reise stets griffbereit hatte. Und als alle Zigaretten aufgeraucht waren, sagte M. plötzlich, die Neurologie werde die Semantik überflüssig machen! Damit stand er auf, um irgendwo im Ort Zigaretten zu holen, und ich tat, als würde ich weiterlesen, folgte ihm aber nach einer Minute. Auf der Straße war er dann schon verschwunden, ich fing an, ihn zu suchen, und fand ihn in der ersten Café-Bar, die geöffnet hatte. Er trank im Stehen einen Doppio, die Zigarette in der Hand, die auch die Tasse hielt, und kaum hatte ich mich zu ihm gestellt, erzählte er von einem ihm bekannten Neurologieprofessor, Privatdozent auch für Philosophie und Kunstgeschichte, der offenbar dem Sinnlosen des Lebens gleichwohl einen Sinn gegeben hat, und den es selbst, als Mensch aus Fleisch und Blut, vermutlich gar nicht gab. Denn weder nannte M. einen Namen, noch einen Ort; und er war auch später nie mehr auf diese Figur zurückgekommen. Aber an dem Sommermorgen in der kleinen Bar von Ravello hatte er seinen Helden beschrieben.
4
Eine Arbeitswohnung, nachts; seit bald einem halben Menschenleben das Schlafen und Schreiben in zwei Räumen plus Küche, neunter Stock, in einem eher häßlichen Klotz in der Gartenstraße. Und doch gibt es dort, auf der rückwärtigen Seite, die Wohnungen mit dem schönsten Blick auf Frankfurt, vom Dom über die Hochhäuser bis zum Messeturm; links vor der Fensterfront der Schreibsessel (für bessere Zeiten, den Laptop auf den Knien), rechts davor ein alter Tisch. Und auf dem Tisch ein handgeschriebener, nicht abgeschickter Brief an M. aus der Ravello-Zeit, bis heute in einer Lade verwahrt, neben den Tagebuchheften aus der Schulzeit. Manche Worte lassen sich nur raten, die Schrift wäre eine Zumutung an die Freundschaft gewesen, ebenso der Inhalt; denn es geht da um eine geplatzte Urlaubsreise nach Griechenland, die über Ravello geführt hatte. Der Brief ist eine Antwort auf den Streit über das richtige Studium oder richtige Leben, der am Ende ein Streit über Schreiben oder Handeln war, in einer Zeit, die M. nicht des Schreibens für wert hielt, jedenfalls nicht in unseren Breiten. Egal, was man dort schreibe, sagte er – der Brief zitiert das –, man bleibe klein, weil alles um einen klein sei, auch Leute, die über das Geschriebene befinden würden. Und dann hatte er über diejenigen hergezogen, die als Autoren noch von einer großen Zeit profitiert hätten, jetzt aber wie die Maden im Speck lebten, und ihre frühere Schärfe zum Theater machten. Er ließ nicht einen deutschsprachigen Autor der damaligen Gegenwart, Anfang der Siebziger, gelten, und grub auch einem heimlich Schreibenden damit das Wasser ab. Die Antwort konnte nur schriftlich erfolgen, als Brief von neun Seiten, und blieb dann doch im Rucksack, nachdem wir uns auf Korfu, gleich nach Ankunft der Fähre aus Brindisi, getrennt hatten (der eine fuhr in seinem roten Volvo mit der Schwester des Freundes weiter, der Briefeschreiber setzte per Bus mit seiner Begleiterin die Reise fort). Eine formulierte, aber nie erteilte Antwort über das Schreiben in kleiner Zeit, denkbar nur durch Rücksichtslossein gegenüber sich selbst und allen, die einem nahe seien. »Vom Eigentlichen als dem Unmöglichen erzählen, ist auch ein Handeln«, steht da; und zuletzt ein Satz, der uns wieder zusammenbringen sollte nach dem nächtlichen Streit: »Die wahren Schweine sind die Schicksalsschwindler, die Leute mit der falschen Tiefe!«
Vielleicht war es das weit unter uns liegende mattschwarze Meer, darauf die Lichtpunkte von Fischerbooten wie flüchtige Sternzeichen, das den Streit auf dem Dach in eine falsche Höhe getrieben hatte, die Höhe, in der einem jeder Gedanke wichtig erscheint, und je weiter die Nacht vorrückt, umso wichtiger; und am Ende war alles in den Wind gesprochen. Bei einem seiner wenigen Anrufe von einem Krankenhausbett aus kam ich noch einmal auf diese Nacht zurück, und er konnte oder wollte sich daran nicht erinnern. Statt dessen zitierte er den zentralen Satz aus dem Roman Wo das Meer beginnt und bewies einmal mehr sein Talent zum Lesen, »Das Verlangen ist der Ort, an dem wir uns ruinieren, die Spielbank der Seele.« Er wollte wissen, wie sehr oder unheilbar auch ich mich ruiniert hätte, das Unheilbare war der entscheidende Punkt, und ich sagte, meine frühen Erzählungen seien ein Ausdruck dieses Unheilbaren, und ruiniert hätten sie den Ruf des Autors, aber das ließ er nicht gelten: einer, der am Ende mit diesem Ruf und von diesem Ruf leben könne, sei ja nicht ruiniert, meinte er, und irgendwie waren wir damit doch bei der Nacht von Ravello. Ich erinnerte ihn zum zweiten Mal an den Streit auf dem Dach, für nichts und wieder nichts im Rückblick, und er sagte, ihm sei damals schon klar gewesen, dass die Neurologie den Menschen nicht retten werde, aber besser, der Arzt, der nichts ausrichten kann, als der Retter, der so tut – ein Ethos des Scheiterns. Und dann wechselte er scheinbar das Thema und kam auf einen Hundehalter, mit dem er in letzter Zeit öfter in einem Stehcafé geredet habe: philosophischer Kopf, der nur für die Schublade oder Festplatte schreibe, verschroben, brillant, von unberechenbarer Freundlichkeit (Letzteres wie er selbst). M. klang schon etwas müde, das Sprechen strengte ihn an, aber er schwärmte von diesem getarnten Schopenhauer mit Hund, einem alten Spaniel, so, wie er morgens in Ravello von seinem Neurophilosophen geschwärmt hatte, und mir wurde klar – oder wird es mir erst jetzt im Zuge des Schreibens klar? –, was ich an ihm geliebt habe und immer noch liebe. Er gehörte zu den wenigen, die ihr Leben vollständig auf eigene Art leben und es auch vollständig so erzählen.
Kauf eines teuren Augenvitamins, Lutein, Tipp einer schwermütigen Frau, die mir gelegentlich auf der Straße begegnet, früher Fotografin (sie hat vor vielen Jahren das Autorenfoto für ein Buch gemacht, ein Foto, das neben dem Inhalt, der Geschichte eines Journalisten und eines jungen Soldaten, zu Missverständnissen über die Sexualität des Autors geführt hatte). Und in der nahen Familienwohnung, Morgenstern-Straße, wird gleich eine der Vitaminkapseln mit Wasser geschluckt; der Sohn spielt in seinem Zimmer Gothic 3, ist aber ansprechbar, und wir reden über ein Skript, an dem er sitzt. Er macht Filme mit seinen Freunden, es geht darin blutig zu, die Intelligenz liegt in den Bildern, nicht in der Geschichte; nebenbei lernt er für eine Arbeit über die Weimarer Republik und geht auch noch das Abendprogramm im Bezahlfernsehen durch, ob da ein Film für uns dabei wäre. Oder bist du schon blind?, fragt er beim Abschießen eines Ritters zweiter Klasse, eine Frage, die auch M. hätte stellen können (leider haben sich Freund und Sohn nie kennengelernt, ein unverzeihliches Versäumnis). Und wieder einmal ein Anlauf des Vaters, von M. zu erzählen, und einmal mehr das müde bis schroffe Abwinken.
Je mehr und klarer man die Abwesenheit des anderen ausspricht, je öfter und deutlicher man dessen Fehlen beklagt und sich mit dem Abwesenden befasst, desto mehr bringt man die weibliche Seite in sich zum Vorschein. Der sehnende Mann ist der verwandelte Mann, auf eine für Außenstehende unter Umständen unheimliche Weise feminisiert, als Teil einer Eucharistie, bei der Brot und Wein zu Erinnerungen an den Freundesleib werden. Und ein Vater, der sich so verhält, vom Freund erzählen möchte, macht sich verdächtig, jedenfalls für einen Sohn, der es nicht gewohnt ist, Romane zu lesen, die ja immer, wenn sie uns weiterbringen, eine Beschwörung des Abwesenden sind, ein Sieg des Weiblichen (mit den Mitteln des Männlichen: das Buch in Angriff nehmen, durchstehen, dafür trommeln usw.).
In der Wohnung neben meiner wieder der Lärm von den Schülern des sogenannten Sprachcafés im Haus; im Flur ein Kommen und Gehen, das der Nachbar spät abends durch den Spion verfolgt. Die fremden Jungs haben alle etwas Träges, Überfüttertes, besonders die Chinesen, während die Mädchen aus Spanien oder Osteuropa vor Neugier auf alles Deutsche – zu dem nur nicht ihr Nachbar zählt – geradezu brennen. Wieder einmal muss ich die Tür öffnen und als mürrischer Alter in drei Sprachen Ruhe brüllen. Und eine der jungen Frauen antwortet auf russisch, nicht eben freundlich im Ton, um dann in der Sprache, deretwegen sie hier ist, etwas ganz anderes zu sagen: Tut mir leid – aber was, kann man sich fragen. Tut es ihr leid, den Nachbarn geweckt zu haben oder am Schlaf zu hindern? Oder tut es ihr leid, wie er da als Typ im gestreiften Bademantel, das graue Haar zerzaust, barfuß im Flur steht und womöglich nicht nur seine Ruhe will, sondern auch oder lieber noch einen Anteil am Leben in der Sprachschülerwohnung? Tut es ihr am Ende also eher leid, auch einen solchen Wunsch geweckt zu haben?