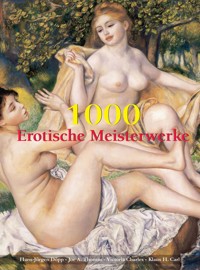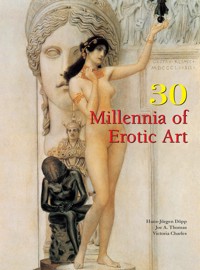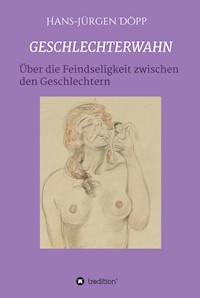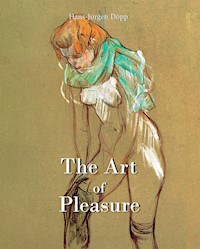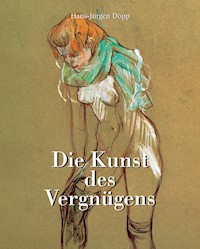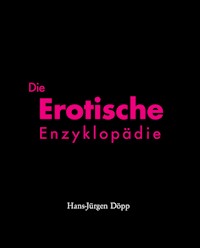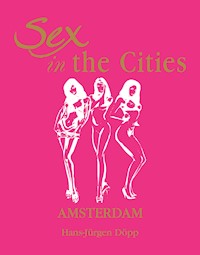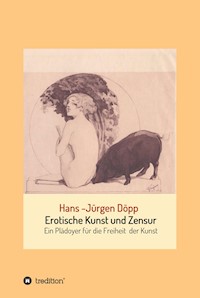
8,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Über Jahrhunderte war es die kirchliche und weltliche Obrigkeit, die die Freiheit des Geistes zu reglementieren versuchte. Und weil Erotik und erotische Kunst stets auch vom Geist der Freiheit durchweht sind, wurde auch die Kunst zum Gegenstand der Observation und Repression. Hans-Jürgen Döpp skizziert den Verlauf der Zensur in der neueren europäischen Geschichte bis zur Gegenwart und stellt für die heutige Situation einen atmosphärischen Wandel fest: Anstelle einer "Zensur von oben" scheint heute eine "Zensur von unten" zu rücken, die zuweilen genauso ignorant und inkompetent ist, wie die historisch praktizierte. Maßstab wird die jeweils subjektive Befindlichkeit, ja: Idiosynkrasie. Eine Anmaßung selbsternannter Hüter der "Political Correctness", die, forciert durch die digitalen Medien, über die "richtige Gesinnung" wachen. In einem weiteren Essay verfolgt er das Verhältnis von Erotischer Kunst und dem Verlangen nach Freiheit durch die Epochen der Europäischen Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 53
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hans-Jürgen Döpp
Erotische Kunst und Zensur
Heinrich Kley, Das Recht auf Erotik,1911
Hans-Jürgen Döpp
Erotische Kunst und Zensur
- Ein Plädoyer für die Freiheit der Kunst –
Impressum:
© edition venusberg, Dezember 2020
Hans-Jürgen Döpp, Frankfurt am Main
ISBN:
978-3-347-21777-5 (Paperback)
978-3-347-21778-2 (Hardcover)
978-3-347-21779-9 (e-Book)
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44,22359 Hamburg
Hans-Jürgen Döpp
Erotische Kunst und Zensur
- Ein Plädoyer für die Freiheit der Kunst! –
Zutrauen veredelt den Menschen,ewige Vormundschaft hemmt sein Reifen.
Freiherr vom Stein
Nichts Schöneres, als seine Genüsse zu teilen! Darum publiziere ich seit wenigen Jahren Bildfolgen aus meiner umfangreichen Sammlung Erotischer Kunst, auch in der aufklärerischen Absicht, diese vom Flair des Geheimen und Verbotenen, das sie in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft seit Jahrhunderten umkleidete, zu befreien. Die sexualliberale Entwicklung in den letzten Jahrzehnten begünstigte solche Veröffentlichungen. Dabei eröffnet die Möglichkeit von books-on-demand ein verlagsunabhängiges Self-Publishing, das angeblich die verlegerische Freiheit eines Autoren erweitere.
Doch diese Freiheit scheint sich in letzter Zeit zu verändern. Zunehmend wurden von einem Verlag, mit dem ich lange und gerne zusammenarbeitete, Manuskripte mit nachfolgender Begründung abgelehnt:
„Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihr eingereichtes Manuskript aufgrund seines Inhaltes den Grundsätzen unseres Unternehmens bzw. unserer Vertriebspartner widerspricht und wir es deshalb nicht in den Handel bringen möchten“. Näheres erfuhr ich nicht.
Ich muss nicht betonen, dass es sich bei all diesen Büchern nicht um „Pornographie“, sondern um Werke der Kunst handelte.
Ich wechselte zu einer anderen Firma – und geriet vom Wasser in die Traufe! Auf meiner website www.venusberg.de , auf der ich diese Bücher bewerbe, befindet sich ein Bestell-link direkt zum Verlag. Nun stelle ich fest, dass von Seiten des Verlages die meisten Titelbilder samt Vorschau und informativem Kurztext aus Gründen des Jugendschutzes gelöscht wurden! Man müsste also „blind“ bestellen, und das tut wohl keiner.
Paradox ist das Verhalten dieses Verlages insofern, als er die Bücher zwar druckte, ihre Verbreitung aber behindert. Wieviel konsequenter ist der erstgenannte Verlag, der sie erst gar nicht druckt!
Mit dem Jugendschutzgesetz versuchte man schon in den 50er- und 60er-Jahren die Freiheit der Kunst zu unterdrücken. Heute aber dominiert nach juristischem Urteil der Kunstvorbehalt dieses Gesetz. Also nur eine vorgebliche Begründung? Bedenkt man den für junge Menschen heute möglichen freien Zugang zur Pornographie, kann man solche Begründungen nur als Hohn bezeichnen. Böte die Kunst doch gerade eine Möglichkeit, den Geschmack zu kultivieren!
So stellt sich die Verlagsseite im Internet dar:
Sind es Bücher mit rassistischen, gewaltverherrlichenden oder pädophilen Themen? Nein, es sind kultur- und kunstgeschichtliche Bändchen, die sich u.a. bekannten Künstlern wie Michel Fingesten, Martina Kügler, Fritz Erler und Karl Kunz widmen. Bücher zu Themen der Erotischen Kunst. Keiner der Titel wirkt „aufreizend“. Kein Gerichtsprozess verlangte ihr Verbot, keine Behörde setzte sie auf den „Index“. Das Jugendschutzgesetz, mit dem man hier argumentiert, wird von den Gerichten heute, bezogen auf die „Freiheit der Kunst“, nur noch sehr zurückhaltend angewandt. In den letzten Jahrzehnten einer kulturellen Liberalisierung hat die Kunst tatsächlich einen größeren Freiraum errungen.
Drei der oben zensierten Bücher – hier unbedeckt:
Sie sollen die Jugend gefährden?!
Was hat sich an der kulturellen Atmosphäre geändert, dass heute nicht nur die – keineswegs „pornographischen“ - Titelbilder dieser Bücher, sondern auch die auf den Inhalt hinweisenden Texte - vorgeblich als Jugendschutzmaßnahme - unterdrückt werden?
Ein weiteres Problem ergibt sich bei der Listung eines neu erscheinenden Buches bei Anbietern und in Presseportalen: ein Filter blockiert aus Titeln und Stichwörtern automatisch alles heraus, was das Wort „Erotik“ enthält. Der Begriff ist zum Unwort geworden!
Anstelle einer „Zensur von oben“ scheint heute eine „Zensur von unten“ zu rücken, die zuweilen genauso ignorant und inkompetent ist, wie die historisch praktizierte.
Zur Geschichte der Zensur
Blicken wir zurück im Zorn:
Über Jahrhunderte war es die kirchliche und weltliche Obrigkeit, die die Freiheit des Geistes zu reglementieren, zu ersticken versuchte. Und weil Erotik und erotische Kunst stets auch vom Geist der Freiheit durchweht sind, wurde auch die Kunst zum Gegenstand der Observation und Repression. In der Zeit zwischen 1970 und 1990 entwickelte sich, auch angestoßen von der 68er-Bewegung, eine sexualliberale Einstellung, die eine Vielzahl von „freien“, schönen Büchern auf diesem Gebiet zur Folge hatte. Diese Zeiten sind vorüber, und das Gesicht von Eros scheint sich zunehmend zu verdüstern.
Seit jeher war Wissen den Mächtigen gefährlich, weshalb seine Verbreitung und Aneignung kontrolliert und bevormundet wurden. Insofern auch im Wissen um Sexualität und Erotik eine rebellische Kraft wirkt, musste auch dieser Bereich einer Zensur unterworfen werden.
Der mächtigste Zensor in der europäischen Geschichte war die römisch-katholische Kirche.1 Die erste zusammenfassende Liste verbotener Bücher wurde 1564 auf dem Konzil von Trient von den Kirchenvätern herausgegeben. Sie wurde unter dem Namen Index Librorum Prohibitorum bekannt. Ihm wohnte der Grundgedanke inne, dass Pornographie nicht per se strafbar sein solle, sondern nur, falls sie mit Kritik an bestehenden Autoritäten verbunden ist. Neben unautorisierten Bibelübersetzungen und den Apokryphen zählten auch „häretische“ Bücher wie Immanuel Kants „Kritik der reinen Vernunft“, René Descartes’ „Meditationes“, Voltaires „Candide“ sowie alles von und über Kopernikus zum gefährlichen Gedankengut, da sie die Wahrheit des katholischen Glaubens in Frage stellten. Die letzte Ausgabe des Index erschien 1948; sie enthielt Bücher mit erotischen bzw. fast erotischen Szenen. Auch Romane wie die von Balzac, Stendhal und Zola fielen der Zensur zum Opfer.
Bücherverbrennung - klerikal
Nach dem Verfall der Rechtsprechung der katholischen Kirchengerichte wurde die Kontrolle auf dem Wege der gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungspflicht durch die Regierungen bzw. die Krone ausgeübt. Nun waren gewöhnliche Gerichte gezwungen, sich mit der Bekämpfung obszöner Literatur zu befassen. Doch fanden Verurteilungen lange Zeit weiterhin eher wegen des antiklerikalen denn des pornographischen Charakters statt.
Man gewinnt den Eindruck, dass Erotische Kunst den Charakter eines Indikators hat: Wo sie gefährdet ist, ist es um die Freiheit des Geistes generell schlecht bestellt.
Zur Situation in England:
Mit Erstarkung der bürgerlichen Gesellschaft formierten sich, insbesondere in England, zahlreiche „Gesellschaften zur Unterdrückung des Lasters“. Die Herausgeber pornographischer Erzeugnisse wurden vor allem dann unter Anklage gestellt, wenn die Werke gleichzeitig mit dem pornographischen einen aufrührerischen oder gotteslästerlichen Inhalt aufwiesen. Ein Buch wie Fanny Hill z.B. konnte noch frei verbreitet werden. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts änderte sich die öffentliche Haltung. Das 18. Jahrhundert war auch eine Hochzeit der Zensur, deren Kriterien sich seit dem Absolutismus mit seinen Hauptkriterien wie Staatsräson, Schutz der guten Sitten und der Religion um den erzieherischen Aspekt des Jugendschutzes erweiterte. 1787 leitete der Monarch George III selbst durch eine Proklamation gegen das Laster die Änderung ein. Die 1857 erlassene Obscene Publication