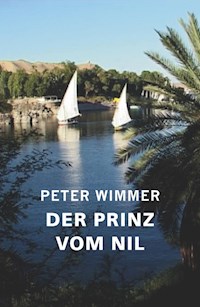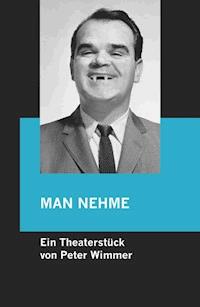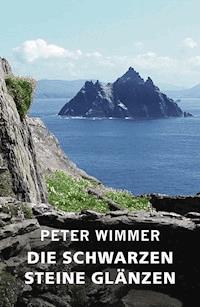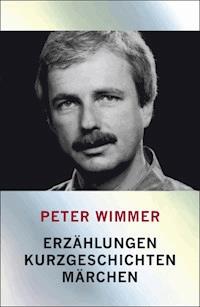
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
INHALT: Achmed Omara Ali - Der Prinz vom Nil / Der Fischer / Der Blaue Mann / Bed and Breakfast / Die Mönchsinsel / Kein guter Tag / More Guinness / Ein besonderes Mädchen / So wie jemand es tut, wenn er friert / Du bist es / Das Wüstenschiff / Der Zitronenbaum / Die ungeheuerliche Geschichte vom ungeheuer ungeheuerlichen Ungeheuer / Der Regenwurm / Wie ein Stück von mir / Jeden Morgen / Benni / Mein Strom / Wind / Lang und steinig der Weg / Viola + Bo, Lovestory im Orchestergraben / In dieser Sommernacht / Es geschah in Connemara / Das Märchen vom frierenden Vulkan
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PETER WIMMER
ERZÄHLUNGEN
KURZGESCHICHTEN
MÄRCHEN
Die Rechte liegen beim Autor und Verlag
Wimmer Visuelle Kommunikation
Am Lichterkopf 25
D-56112 Lahnstein
Telefon 02621/62625
www.wimmer-kommunikation.de
Ich schreibe Erzählungen, Kurzgeschichten, Märchen, Theaterstücke und Besonderheiten die sich nur schwer zuordnen lassen. Eine Zusammenfassung bieten die E-Books „Peter Wimmer, Erzählungen, Kurzgeschichten, Märchen“ und „Peter Wimmer, Theaterstücke für einen bis vier Darsteller.“
Unter dem Reihentitel “Kulturreisen individuell” erstelle ich filmische Reisedokumentationen. Dabei folge ich mit meiner Kamera den Spuren der Menschheitsgeschichte, so wie ich sie in den besuchten Reiseländern antreffe. Ich dokumentiere herausragende Kulturstätten und Landschaften, einfühlsam, sachlich, informativ.
“Schönheit, Anmut und große Architektur im alten Ägypten” das ist der Reihentitel einer 14-teiligen filmischen Dokumentation über das reiche Erbe der pharaonischen Kultur am Nil. Schauplätze sind die großen Pyramiden, Göttertempel, Totentempel, Museen und prächtig ausgestatteten Gräber in Kairo, Giseh, Sakkara, Medum, Tel el Amarna, Abydos, Dendera, Luxor, Edfu, Kom Ombo, Assuan, Philae und Abu Simbel. Die DVD „ÄGYPTEN – Highlights der pharaonischen Kultur“ vermittelt einen Eindruck dessen was die großen Schauplätze und Museen entlang des blauen Nils dem kulturinteressierten Reisenden bieten.
Die DVD „Highlights der Megalithkultur in Westeuropa“ zeigt kulturhistorisch bedeutende Monumente unserer Vorfahren, Kultstätten und Museen in der Bretagne, auf Malta, Gozo und Korsika, in England, Irland, Schottland, auf den Hebriden und auf den Orkneyinseln.
INHALT:
Achmed Omara Ali - Der Prinz vom Nil
Der Fischer
Der Blaue Mann
Bed and Breakfast
Die Mönchsinsel
Kein guter Tag
More Guinness
Ein besonderes Mädchen
So wie jemand es tut, wenn er friert
Du bist es
Das Wüstenschiff
Der Zitronenbaum
Die ungeheuerliche Geschichte vom ungeheuer ungeheuerlichen Ungeheuer
Der Regenwurm
Wie ein Stück von mir
Jeden Morgen
Benni oder Aber morgen mache ich alles anders, ganz anders
Mein Strom
Wind
Lang und steinig der Weg
Viola + Bo, Lovestory im Orchestergraben
In dieser Sommernacht
Es geschah in Connemara
Das Märchen vom frierenden Vulkan
Achmed Omara Ali - Der Prinz vom Nil
VORWORT
Die Geschichte von Achmed Omara Ali entstand unmittelbar nach meiner dritten Ägyptenreise. Ich kehrte am Donnerstagabend, dem 5. März 1992, von einem einwöchigen Urlaub aus Luxor zurück. Am nächsten Morgen wachte ich auf, mit all den Bildern im Kopf, den Bauch voller Erlebnisse. Ich musste etwas schreiben, es drängte mich danach. Dass daraus ein kleines Buch entstehen sollte, das ahnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht.
Aus einigen Zeilen Reisenachbetrachtung erwuchs die Geschichte von Achmed, dem Fellachenjungen. Ich wollte nicht über ihn schreiben. Plötzlich war er da, in meinen Aufzeichnungen. Ich schrieb und schrieb, folgte nur meinen Gedanken.
Nach etwa einer Stunde habe ich zum ersten Male innegehalten und betrachtet, was vor mir lag. Es war mir als hätte ich einen Menschen ins Leben gerufen mit meinen Zeilen, einen Menschen für den ich mich nun verantwortlich fühlte.
Plötzlich existierte Achmed. Er lebte dort, wo ich mich noch vor zwei Tagen befand. Natürlich war es der Achmed den ich dort kennen gelernt hatte, der Achmed der mich so lieb begleitete, am Rande des Nils.
Ich war unsicher ob ich weiter schreiben sollte. Ich wusste nicht wohin es führt. Ich habe für eine kurze Zeit ausgesetzt. Mehrmals las ich was ich bis dahin geschrieben hatte. Dann war es klar. Ich musste fortfahren. Noch war mein Achmed ein kleines Kind. Nun musste ich ihn auch wachsen lassen. Das war ich meinem Achmed schuldig. Außerdem war ich selbst sehr neugierig, zu erfahren, wie sich sein Leben weiter gestaltete.
Ich konnte nicht mehr aufhören. Die Bilder entwickelten sich so schnell in meinem Kopf, dass ich Mühe hatte ihnen zu folgen. Ich war Chronist in diesen Stunden, habe niedergeschrieben was mir vor Augen kam. Nichts ist geplant, konzipiert, konstruiert. So wie im richtigen Leben entwickelte sich das eine aus dem anderen.
Ich wusste, während ich über heute schrieb, nicht wie es morgen weitergeht. So ist die Geschichte von Achmed mit einigen Unterbrechungen am 6. und 7. März 1992 niedergeschrieben worden. Ich habe damit keine Absicht verfolgt, sondern nur einem inneren Drang entsprochen. Ich habe schnell und flüchtig geschrieben, eher skizzenhaft. So ist es auch geblieben, ein Dokument des Augenblicks.
Im Nachhinein denke ich, dass ich damit vielleicht etwas dazu beitragen kann, die Kluft zwischen so extrem verschiedenen Lebensräumen und Lebensarten wie Ägypten und der Welt die uns prägt im Bewusstsein der an Ägyptens Kultur interessierten Reisenden zu reduzieren.
Ich habe drei Reisen in dieses Land gebraucht, um mich nicht mehr belästigt zu fühlen von den Ägyptern, die als Souvenirhändler und Anbieter von Dienstleistungen auf den Touristen oft beängstigend wirken. Aber, das ist mir schon bei der ersten Reise klar geworden, die Ägypter denen der Tourist an den Kulturstätten und im Umkreis der Hotels begegnet, das sind nicht die Ägypter"
Ägypten ist nicht nur ein Land mit faszinierenden Zeugnissen einer uralten Hochkultur, Ägypten hat wie alle nordafrikanischen Länder auch hinsichtlich seiner Menschen viel zu bieten. Aber um wirklichen Ägyptern zu begegnen muss man sich etwas fortbewegen von den Kulturstätten, nicht weit, oft nur ein paar hundert Meter.
Der Reisende wird, wenn er sich für den Lebensraum der Ägypter von heute interessiert, Bilder und Lebensweisen vorfinden, wie sie im ältesten Buch der Welt beschrieben sind. Doch dies erscheint mir sehr wichtig: Die Menschen die dort in einer für uns unbegreiflichen Einfachheit aber auch beneidenswerten Zufriedenheit leben haben ein Recht auf den Erhalt ihres Lebensraums und ihrer Traditionen. Es ist ein Lebensraum in dem alles nach uralten Regeln abläuft.
Gerade die traditionellen Wurzeln sind es die in diesem Land fünfzig Millionen Menschen davon leben lassen was das Wasser des Nils ermöglicht. Fünfzig Millionen Menschen leben ohne Krankenversicherung,Arbeitslosenunterstützung und Altersversorgung, meist in Großfamilien, in einem Land in dem es so gut wie nie regnet, in einem Land welches zu 97 Prozent aus Wüste besteht.
Jeder Eindringling, und das sind wir alle die wir in solche Länder reisen, sollte sich bewusst sein welche Verantwortung er als Mensch mit Bildung und Wissen um globale Zusammenhänge und Abhängigkeiten diesen Menschen gegenüber hat.
Respekt und Achtung vor der uralten Tradition, ein hohes Maß an Bescheidenheit und Zurückhaltung, dassollten die hervorstechenden Eigenschaften des Touristen sein.
Es sind nicht die Fotomotive die den Wert einer Ägyptenreise ausmachen, sondern die Bilder und Eindrücke die man in sich selbst aufnimmt. Daraus können sich Erkenntnisse entwickeln, die das eigene Leben positiv beeinflussen.
Donnerstag, 5. März 1992, 13.30 Uhr, im Flugzeug
Mein Gott, wie groß ist der Kontrast in der Lebensweise der Ägypter und den Menschen der westlichen Welt noch heute, trotz der uralten Hochkultur und des blühenden Tourismus. Ich möchte mit niemandem tauschen in diesem Land.
Freitag, 6. März 1992, 7.00 Uhr, in meinem Bett
Das stimmt. Dennoch, meine Welt, die mich nun wieder umgibt, muss auch verkraftet werden. Wahrscheinlich wäre Achmed, der Junge aus Theben-West, nach vierWochen Germany todunglücklich, zumal, wenn er all das tun müsste, was junge Menschen seines Alters hier täglich tun.
Ich habe bei meinen bisherigen Reisen recht ausgiebig das Leben der Ägypter am Rande des Nils studieren können. Die Entwicklung des Landes und des Lebensraums der Menschen hat sich seit meiner ersten Reise nach Ägypten vor zwölf Jahren sprunghaft verändert. Allerdings nur im städtischen unddaran anschließenden Bereich.
In den Dörfern, durch die ich mit Achmed noch vor wenigen Tagengeritten bin, steht die Zeit still, zumindest für diejenigen, die auch tagsüber dort leben, für Frauen und Kinder. An den einzelnen Altersstufen kann man ihren Lebenszyklus unabhängig vom Geschlecht deutlich erkennen. Er steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Doch es gibt Ausnahmen, zum Beispiel Achmed.
In seinem Lebensraum ist dieser Junge, kaum auf die Welt gekommen, das Familienglück, der Erstgeborene, der Prinz. Unglaublich, mit welcher Fürsorge sich die junge Mutter um den kleinen Pascha kümmert. Kein Wunder, dass daraus ein ziemlich frecher, sehr selbstbewusster Knabe wird. Man sieht es ihm an, er weiß sich auf der Sonnenseite des Lebens.
Es ist für jedes Kind in Ägypten von entscheidender Bedeutung, ob die Eltern arm sind oder ob sie ihm eine Schulausbildung finanzieren können. Achmeds Familie kann das nicht. So muss er schon früh mit aufs Feld hinaus, wie beinahe alle Kinder in seinem Dorf. Dort merkt er bald was es heißt ein Mann zu sein.
Doch Achmed lernt schnell. Er ist fleißig und ehrgeizig. Gerade acht Jahre alt kennt er sich auch schon gut aus in seiner Dorfgemeinschaft und in der von zwei Nachbardörfern. Er kennt die Hierarchien, hat sich an ihnen gemessen, dabei seine eigene Bedeutung und Wertigkeit erfahren. Er weiß aber auch was man tun muss um weiterzukommen. Er hat schon viel vom Leben gelernt. Das Leben ist seine Schule. Er ist der Herr auf seiner Ebene.
Er ist schon Herr über Tiere, über kleinere und schwächere, über weniger clevere Kinder in seinem Dorf. Sein Selbstbewusstsein ist ungebrochen. Wenn er es zu weit treibt zieht ihn der Vater, der meist erst abends wenn es schon dunkel ist nach Hause kommt, an den Ohren. Das tut weh, macht ihm aber auch klar, dass das der Weg ist, sein Ziel. Der Stärkere, der Überlegenere hat das Sagen. Das sind seine Vorbilder.
Immer öfter überschreitet er die Grenzen seiner Machtebene, bevor er sich traut den Kopf hinauszustrecken aus der dörflichen Rangordnung, die ihm arge Fesseln anlegt, die ihm zu klein und unbedeutend erscheint.
In der Familie ist er mit seinen mittlerweile zwölf Jahren schon erwachsen, schon als Mann integriert. Er weiß aber seit langem da gibt es noch etwas anderes, eine andere Welt, noch undurchschaubar für ihn, noch grau im Nebel, etwas beängstigend, die Welt außerhalb der Dorfgemeinschaft, außerhalb des ländlichen Lebensraums, die Welt der Asphaltstraßen, der Autos, Motorräder, der Lichter, der großen Häuser, der Fremden, die so ganz anders aussehen und reden, Menschen, die immer eine Fotokamera umhängen haben, hindurchschauen, irgendwo draufdrücken und dann stolz und zufrieden lächeln.
Die Welt außerhalb seines Dorfs zieht ihn an. Er lernt Autofahren mit einem Nachbau aus Bambusrohr und Draht. Wichtig ist das Lenkrad, das gibt die Richtung vor. Daran muss man drehen. Auf einem Fahrrad hat er schon Versuche und Fortschritte machen können. Auf einem Motorrad ist er mitgefahren. Das war sein bisher größtes Erlebnis. Fest angeklammert hat er sich an den älteren, der es besaß, der in der Stadt Luxor sein Geld verdient und schon ganz schön reich geworden ist.
Man sieht es auch an der Kleidung, an der tollen Lederjacke, die der ältere immer trägt. "Made in Italy, original fashionware" steht auf einem ovalen Abzeichen an seiner Brust. Das ist die wirkliche Welt, die neue, die moderne. Und er hat auch immer Zigaretten bei sich, der ältere, immer. Und richtige Schuhe hat er an. Und was der alles erzählt, wenn er mit Gleichaltrigen zusammen ist. Ganz still ist unser kleiner Fellachenjunge dann. Er staunt und lernt. Das sind die wirklichen Ziele des Lebens. Er wusste schon immer, dass das, was sich im Dorf abspielt, nicht das Leben sein kann. Da kennt er ja schon alles.
Nun hält er sich immer öfter dort auf wo die verkehren die in der Stadt arbeiten, die mit den Autos und Motorrädern fahren, an der großen Straßenkreuzung, am Bewässerungskanal. Er hört zu. Er lernt. Immer öfter kommt er erst im Dunkeln zur Familie zurück. Alle schimpfen mit ihm, besonders die Mutter. Seltsam, der Vater schweigt. Er geht ihm sogar ein wenig aus dem Weg.
Mit den Wochen und Monaten wird auch die Mutter ruhiger. Er bringt nun schon einmal etwas mit, wenn er abends nach Hause kommt. Er gibt es freiwillig ab, ein paar Eier, Obst, etwas Geld, einige Zigaretten. Es macht ihn stolz. Er möchte der Familie zeigen was in ihm steckt. Je mehr er mitbringt an den Abenden desto mehr respektiert die Familie seine neue Lebensweise.
Er geht jetzt regelmäßig dorthin wo in einem fort Geldscheine den Besitzer wechseln, wo die Männer beisammensitzen und erzählen, Tee trinken, Wasserpfeife rauchen, zu Gruppen laut gestikulierend sich mit traditionellen Brettspielen die Zeit vertreiben.
Wo das Geld herkommt, wer es als Wertobjekt erfunden hat, wer es herstellt, das weiß er nicht. Das liegt immer noch im grauen Nebel seines Erfolgswegs. Aber er hat schon viel erreicht. Er wird akzeptiert, hier, wo das wirkliche Leben abläuft, hier, wo jeder Schuhe trägt und jeder immer Zigaretten hat. Hier, wo Autos und Motorräder selbstverständlich sind. Man kann sogar mitfahren, wenn man Geld hat. Und er hat Geld. Er verdient ja schon.
Er hilft wo er kann, spült Gläser und Geschirr, freut sich über jeden kleinen Auftrag. Er lernt sehr viel dabei und bekommt für alles was er tutGeld. Ein tolles Leben. Du tust etwas und bekommst sofort Geld dafür. Ja, hier stimmt die Welt. Achmed spürt hier lässt es sich aushalten.
Er glaubt nun, dass es die Fremden sein müssen, die das Geld machen, die mit den Kameras. Sie haben davon soviel in ihren Taschen und verteilen es großzügig überall. Sie bezahlen sogar das Doppelte für alles und lächeln noch dabei.
Den Wert der Geldscheine kennt er schon genau. Immer wieder tauscht er zehn schmutzige kleine gegen einen großen um. Die großen hat er eng zusammengerollt in seiner Hosentasche, fest verschlossen mit einem Gummiband. Seine Hosentasche ist sein Geheimfach geworden. Nur er weiß welche Schätze darin sind.
Aber es gibt noch soviel was man besitzen kann, wenn man sehr fleißig ist. Er hat alles was das Leben schön macht schon gesehen. Er war sogar schon einmal auf der anderen Nilseite, in der Stadt Luxor. Er hat die goldglitzernden Fassaden der Hotels, die goldverzierten Pferdekutschen und die Hotelangestellten in ihren bunten, wunderschönen Kleidern gesehen, auch die ernst schauenden Manager in den schwarzen Anzügen. Wie Götter wirkten sie auf ihn.
Er war auch in den Souks. Doch das Geschrei, die Enge, die hastenden Menschen haben ihm Angst gemacht. Er hat viele wundeschöne Sachen gesehen die er kaufen kann, für die Papierscheine, die er in seinem Geheimfach hat. Ihm ist aber auch klar geworden wie viele Papierscheine gebraucht werden um all das kaufen zu können was sein Herz begehrt.
Etwas still und verwirrt ist er wieder hinübergefahren zu dem Nilufer wo er geboren ist, in die Welt die er besser kennt, die er mit seinen vierzehn Jahren überschauen kann. Nun weiß er aber es gibt viele Welten, beängstigend viele.
Dort drüben, am anderen Nilufer, hinter der Stadt, da landen ja auch die großen Flugzeuge. Wo kommen die bloß her und wer hat die gemacht? Wieso können die überhaupt fliegen? Dass damit die Fremden kommen das weiß er. Mister heißen sie und Madam. Bonbons und Bakschisch verteilen sie, wenn sie gut gelaunt sind.
Ihn zieht es nun dorthin, wo diese Menschen ankommen, mit der Nilfähre. Aber hier ist die Hölle los. Eine unübersichtliche, sehr beängstigende Welt für Achmed. Weggescheucht wird er von anderen Jungen, überall. Dabei sind die nicht älter als er. Doch Achmed hat kämpfen gelernt. Er spürt hier geht es um mehr als um Bonbons und Bakschisch. So schnell gibt er nicht auf. Was die anderen können kann er auch.
Er versucht sich nützlich zu machen. Doch alles ist so neu, so anders. Er fühlt, dass das was er bisher gelernt hat, ihm hier nicht hilft. So schaut er nur zu.
Er sitzt auf einem kleinen Erdhügel neben der Anlegestelle der großen Fahrzeugfähre. Hier lässt man ihn in Ruhe. Auf der anderen Nilseite, links und rechts vom großen Tempel, funkeln die Fassaden der Hotels, in denen die Fremden wohnen. Das Geklapper der bunt herausgeputzten, goldverzierten Pferdedroschken, das unendliche Gehupe der Taxis und das Gebrumme der großen weißen Schiffe, die drüben in Reihen am Ufer liegen, dringen zu ihm herüber.
Große blaue Autobusse kommen mit der Fähre an dieses Ufer. Wohin fahren sie? Er sieht die Fremden durch die Fenster. Er beobachtet sie neugierig. Einige wenige lächeln ihn an und winken. Er lächelt verlegen zurück. Er hört aber auch die harten Worte der Taxifahrer, wie sie streiten, wenn es um Fahrgäste geht. Er sieht auch die vielen bepackten Gestalten, Männer und Frauen mit großen Kisten aus Bambusrohr und Bündeln, Alte, Kranke... All das gibt ihm Rätsel auf.
Aber hier an der Anlegestelle der Fähre gibt es auch einige denen es besser geht als den meisten. Es sind die Händler mit den Karren und Klappläden. Sie bieten Erfrischungen an, kleine Speisen, Obst, aber auch Zigaretten, Zeitungen, Sonnenbrillen, Uhren, Kämme, Sandalen, Hüte und vieles mehr. Die haben es geschafft. Sie sind wohl schon sehr reich. Sie sitzen nur da und warten bis jemand kommt und etwas kauft.
Es gibt auch Fremde, die alleine oder in Gruppen ohne Auto hier herüberkommen. Er hört von seinen Landsleuten Begriffe wie english, german, french... Er hört, wie seine Landsleute in anderen Sprachen mit ihnen sprechen. Er fühlt sich plötzlich ganz klein und dumm.
Wieso können die Dinge die er nicht kann? Achmed sitzt da, merkt nicht wie es dunkel wird. Immer mehr Frauen und Männer kommen vom anderen Nilufer herüber. Sie hasten, eilen, als wenn sie an einem Wettlauf teilnähmen. Junge Burschen springen schon an Land, wenn die Fähre noch ein großes Stück davon entfernt ist. Andere springen schon hinauf.
Immer, wenn die Fähre angelegt hat, ertönt ein großes Geschrei. Taxifahrer und Händler bieten ihre Dienste und Waren an. Junge Männer springen in Sammeltaxis, hinten in den offenen Aufbau, manchmal noch während der Fahrt. Geldscheine wechseln schnell hin und her. Achmed brummt der Kopf. Er fühlt sich überflüssig in dieser Welt, nicht dazu gehörend, dabei ist er nur eine Stunde Fußweg entfernt vom Lebensraum den er gut kennt.
Plötzlich strahlt ihn jemand an. Ein Junge in blauer Schulkleidung steht mit seinem Fahrrad vor dem Hügel. Es ist Muhamad Muchami aus seinem Dorf. Achmed hat als kleiner Bub oft mit ihm und anderen gespielt. Viele Streiche haben sie gemeinsam ausgeheckt und durchgeführt.
Muhamad winkt und ruft: "Möchtest du mit? Steig auf." Er zeigt dabei auf den Gepäckträger. Achmed ist noch immer ziemlich benommen von dem Treiben um ihn herum. Er stammelt so etwas wie "danke". Nun sitzt er schweigsam hinter dem Freund. Er hat Muhamad schon lange aus den Augen verloren. Der geht regelmäßig in Luxor zur Schule. Seine Eltern zahlen dafür.
Achmed arbeitet noch heute ohne Schuhe im Zuckerrohrfeld. Eine harte Arbeit. Er trägt was man ihm auf die Schulter lädt schwankend eine Holzleiter hinauf und stapelt es auf den Eisenbahnwaggon. Ein Pfund fünfzig bekommt er pro Tag und das Essen dazu. Muhamad dagegen hat richtige schwarze Schuhe und eine schöne blaue Schuluniform, sogar ein Fahrrad. Wie soll sich Achmed da fühlen an diesem Abend, hinter Muhamad sitzend, die nackten Füße weit weggestreckt, damit sie nicht in die Speichen geraten.
Er geht, nachdem er sich von Muhamad verabschiedet hat, nicht direkt nach Hause. Irgendwie möchte er seiner Familie heute nicht gegenübertreten. Er fühlt sich so schlecht wie er sich noch nie gefühlt hat.
Er sitzt noch lange auf dem Bahndamm, der am Zuckerrohrfeld vor dem Haus seiner Familie entlangführt und schaut zum Sternenhimmel empor. Ihm wird von Tag zu Tag deutlicher wie groß die Welt ist und wie klein der Lebensraum den er in seinen Strukturen erkennt. Ob die Fremden mit den Flugzeugen von diesen Sternen da oben kommen? Vielleicht wird auf jedem dieser vielen Sterne eine andere Sprache gesprochen. Vielleicht hat aber auch jeder dieser Sterne einen eigenen Nil und eigene Zuckerrohrfelder.
Erst lange nachdem die Lichter in seinem Haus ausgegangen sind schleicht er sich hinein. Die beiden kleineren Geschwister, die mit ihm in einem Raum schlafen, haben ihn nicht kommen gehört. Er liegt noch eine ganze Weile wach. Er sieht die Bilder des Tages am Nil vor sich und wundert sich darüber, dass er gar keinen Hunger hat, obwohl er seit dem Morgen nichts mehr gegessen hat. Er spürt, dass diese Nacht eine Wende in seinem Leben bedeutet und dass morgen nichts mehr so ist wie es war.
Schon bevor der erste Hahn kräht ist Achmed draußen. Etwas Brot vom Abend und etwas Käse hat er in seiner Tasche. Der Nil und die Anlegestelle des Fährbootes ziehen ihn an. Er weiß nicht was er dort soll, womit er sich dort nützlich machen kann. Und dennoch, er kann an nichts anderes mehr denken.
Der Nil ist die Lebensader Ägyptens, diesen Spruch hat er oft gehört. Wieso soll er nicht auch für ihn, den fleißigen Achmed, die Lebensader sein? Er ist gesund. Er fühlt sich jung und stark. Er beschließt am Nil sein Glück zu suchen.
Die Sonne geht auf über dem Häusermeer von Luxor. Achmed sitzt kauend auf einem Hügel an der Anlegestelle der Fähre, ein Platz den ihm gestern niemand streitig gemacht hat. Schon lange vor Sonnenaufgang hat er das Erwachen der Stadt gehört und den Muezzin.
Er ist nicht allein am Fährhafen. Einige die hier ihr Geld verdienen haben auch hier geschlafen, in Decken eingehüllt oder unter Kartons vergraben. Die beiden Fähren liegen noch ruhig da, jede an einem Ufer. Wie spät es ist weiß Achmed nicht. Er hat keine Uhr, kann auch keine lesen. Die Stunden des Tages waren in ihrer genauen Einteilung nie von Bedeutung für ihn.
Zwei große Schiffe lösen sich am jenseitigen Ufer aus der Gemeinschaft der anderen. Sie drehen auf dem Strom und fahren an ihm vorbei in Richtung Assuan. Von Assuan im Süden des Landes hat Achmed schon gehört, durch den großen Staudamm der dort gebaut wurde, der seitdem dafür sorgt, dass für die Felder rechts und links des großen Stroms immer genügend Wasser vorhanden ist.
Achmed empfindet die hell beleuchteten weißen Luxus-Hotelschiffe wie schwimmende Trauminseln. So stellt er sich das Paradies vor. Seine Augen begleiten die beiden Schiffe. Visionen sind in seinem Kopf. Er stellt sich vor wie die schwimmenden Inseln innen aussehen. Es erscheint ihm, dem Fellachenjungen von der Westbank in Luxor, als allerhöchstes Lebensziel Steuermann eines solchen großen Schiffes zu sein.
Und er spürt plötzlich wie sich etwas in ihm verändert, wie sein Ehrgeiz aufflammt, das, was ihn bisher ausmachte. So beschließt er nun, während das Leben auf beiden Seiten des Nils erwacht, sich nicht einschüchtern zu lassen von Dingen die er nicht versteht. Er wird sie verstehen lernen. Schließlich hat er bisher erreicht was er erreichen wollte.
Noch den ganzen Vormittag über sitzt er fast reglos da und studiert. Was um ihn herum abläuft ist seine Schule, er selbst sein Lehrmeister. Am Nachmittag ist er kaum mehr zu halten. Er möchte etwas tun. Doch alle Dienste sind vergeben. Nirgends sieht er einen Ansatzpunkt für sich selbst. Er steht ziemlich ratlos am Ufer, unmittelbar neben der Anlegestelle.
Am späten Nachmittag kommen die Schüler aus der Stadt. Sie machen wieder ihre Mutproben, springen schon von größerer Entfernung an Land und manchmal sogar wieder aufs Boot.
Nun ist Achmed nicht mehr zu halten. Das kann er auch. Er springt. Mit Erfolg. Immer wieder. Immer mutiger. Am Abend ist keiner mehr besser als er. Nur der Fährmann kann seinen Künsten nicht die ihnen gebührende Anerkennung abgewinnen. Er schimpft und versucht Achmed festzuhalten. Aber Achmed ist schneller oder mischt sich geschickt unter die Menschenmenge an Bord. Später lernt er dann zu springen wenn der Fährmann beschäftigt, ist in seinem Steuerhaus. Die anderen Jungs lernen Achmed nun kennen. Achmed spürt Wohlwollen und auch etwas Anerkennung in den Blicken, obwohl die meisten Schuhe tragen und er nicht.
In dieser Nacht schläft Achmed sehr gut. Es hat sich viel verändert. Achmed ist ein anderer geworden. Er glaubt seine Eltern und seine Geschwister müssten das merken, sie müssten ihm ansehen zu welch großen Leistungen er fähig ist und dass er noch viel erreichen wird, Dinge an die seine Familienmitglieder noch nicht einmal denken, weil sie sie gar nicht kennen.
An den darauf folgenden Tagen macht Achmed große Fortschritte am Fährhafen. Er hat sich mit dem Fährmann angefreundet, macht sich nützlich auf dem Schiff wo er es kann. Er hilft den Touristen Fahrräder an und von Bord zu hieven. Während der Überfahrt bewacht er die Räder. Die Touristen schmunzeln. Hier und da bekommt er etwas dafür. Bonbons, Kaugummi... Einer drückt ihm sogar eine Pfundnote in die Hand. Achmed glaubt sein Herz zerspringt vor Freude. Es spornt ihn an. Er hilft den Männern und Frauen, trägt Kisten und Bündel, hilft Alten und Kranken beim Ein- und Aussteigen.
Viele mögen Achmed nun und winken schon wenn sie ihn sehen. "Hallo, Achmed" rufen sie, so als wären sie froh ihn zu kennen.
Am Abend gibt Achmed etwas ab von dem was er erhalten hat, an den Fährmann. Schließlich hat er die Fähre als seinen Arbeitsplatz entdeckt, den er auch oft hart verteidigen muss. Er hat sogar schon einige Male beim Ab- und Anlegen an den Leinen ausgeholfen. Achmed ist eben mehr als ein Fellachenkind. Achmed ist ehrgeizig. Das Leben ist seine Schule.
Es gibt so viel zu tun. Die Tage, Wochen und Monate vergehen wie im Flug. Von den Touristen lernt er während der Überfahrt einige Worte in deren Sprache. Er lernt englisch, deutsch, französisch, italienisch und japanisch zu unterscheiden. Er hört nur einige Sätze und weiß woher die Fremden kommen. Wo diese Länder liegen, dass weiß er aber immer noch nicht.
Abends, beim Nachhausegehen, stellt er sich den großen Stern über ihm als England vor, den daneben als Italien und den ganz großen hellen als Deutschland. Aus Deutschland kommen besonders viele. Beinahe so viele kommen aus Japan. Aber die Japaner sind wesentlich kleiner, scheinen von einem kleineren Stern zu kommen.
Achmed ist nun bekannt in seinem Dorf als ein fleißiger junger Mann mit gutem Einkommen. Kaum sechzehn Jahre alt trägt er schon richtige Schuhe. Noch nicht einmal sein Vater oder der Bürgermeister haben Schuhe wie er. Achmed trägt aber immer noch das braune, traditionelle Gewand der Fellachen. Das möchte er nicht ändern. Er genießt es wenn man zu ihm aufblickt, in seinem Dorf.
Er geht jetzt nicht mehr zur Feldarbeit. Dafür hat er zuviel zu tun, an der Fähre. Außerdem kann er dort gar nicht fehlen. Ein anderer würde sofort seinen guten Arbeitsplatz in Beschlag nehmen. Einen Teil von dem was er verdient gibt er zu Hause ab. Wenn es ein besonders guter Tag war bringt er Lebensmittel mit, manchmal sogar Fleisch oder Fisch. Er hat nun auch immer Tabak dabei. Er raucht Wasserpfeife, wo immer er eine erwischt und ein paar Minuten Zeit dazu hat.
Sein Geheimfach, die Hosentasche, reicht nicht mehr aus für seinen wachsenden Schatz. Obwohl er nun oft am Fährhafen isst und mit dem Sammeltaxi nach Hause fährt hat er schon einhundertfünfundsiebzig Pfund gespart. Den größten Teil davon hat er in einer Flasche an einem geheimen Ort vergraben. Manchmal trinkt er am Abend, bevor er sich zum Schlafen legt, noch ein Bier, ein Stella, bei Mhand dem Kaufmann, illegal natürlich, in der kleinen Hütte hinter dem Hof.
Achmed ist, für alle sichtbar, ein Mann geworden. Er kennt viele Worte in vielen Sprachen. Er ist sehr beliebt bei den Touristen, besonders bei den Touristinnen. Achmed Casanova hat ihn eine genannt, und so nennt er sich jetzt, ohne zu wissen, was es bedeutet. Die Touristen schätzen seine nichtorientalische Art. Achmed wirkt, im Gegensatz zu den meisten hier an der Anlegestelle, still und bescheiden. Er kann schon Gespräche mit den Touristen führen, in deren Sprache.
Er hat viele neue Freunde gefunden, außerhalb des Dorfs. Leute die wie er den Lebensunterhalt am Fährhafen verdienen. Er weiß nun auch weshalb die vielen Fremden aus der schönen Stadt Luxor an dieses Nilufer herüberkommen. Er kennt die pharaonischen Tempel auf dieser Flussseite. Er hat sie schon alle gesehen. Von den prunkvoll ausgeschmückten Gräbern im Wüstengebirge hat er gehört, betreten darf er sie nicht.
Eine neue interessante Welt tut sich vor ihm auf. Es gibt junge Männer die sich den fremden Besuchern als Führer anbieten. Einen kennt er recht gut. Dieser muss bald zum Militärdienst. Achmed schließt sich ihm an, wo er nur kann. Er lernt viel von ihm, so auch die Namen der Gräber und Tempel und wie man sie am besten erreicht. Er lernt viel über das alte Theben, über seine Vorfahren und deren Hinterlassenschaft.
Die Jahre vergehen ohne besondere Ereignisse. Achmed wird bald achtzehn. Dann muss er auch zum Militär. Er hat darüber sehr schlechte Dinge gehört, von denen, die dabei waren. Aber er hat durch den Kontakt mit den Touristen erfahren wie wichtig Bildung ist. Beim Militär kann er eine Schule besuchen.
An einem Februarmorgen ist es dann soweit. Achmed nimmt Abschied von der Familie und vom Dorf. Schweren Herzens steigt er in den großen Militärlastwagen der die jungen Männer der Gegend abholt. Er ist sehr traurig, besonders weil er seit ein paar Wochen Fatima aus dem Nachbardorf gern sieht. Sie ist so wie er sich seine Frau vorstellt, aber leider sehr scheu.
Sie lebt sehr zurückgezogen in ihrer Familie. Achmed hat sie bei einer Hochzeitsfeier zum ersten Mal gesehen. Sie trug ein rotes Gewand. Sie hat ihn auch angesehen, dann aber schnell den Blick gesenkt und das Kopftuch vorn zusammengehalten. Aber was Achmed vorher sah war so, dass er seitdem nachts unruhig schläft und oft lange wach liegt. Er hat versucht sie zu treffen, ohne Erfolg.
Auch seine gute Position auf der Fähre muss er nun aufgeben, den Schutz der Familie und alle Freunde verlassen, für dreieinhalb Jahre. Wenn er die Grundschule besucht hätte müsste er nur zweieinhalb Jahre und mit höherer Schulbildung sogar nur ein Jahr zum Militär.
Außerdem hat er schon einen gewissen Lebensstandard erarbeitet, der nun schwinden wird. Er verfügte mittlerweile über etwa sechzig Pfund im Monat. Das ist mehr als das was sein Vater als Landarbeiter verdient. Beim Militär wird er nur fünf Pfund im Monat erhalten. Der einzige Trost ist die Schule. Er möchte lesen und schreiben lernen, damit er den Führerschein machen kann, für Motorrad und Auto. Er vermutet, dass der Steuermann auf dem großen weißen Nilschiff ebenfalls lesen und schreiben können muss.
Mit den Gedanken an seine Karriere als Steuermann, er, Achmed, in weißer Uniform hinter einem riesigen Steuerrad, viel größer als das auf der Fähre, tröstet er sich auf der Fahrt zur Kaserne in Quena, einer Stadt auf der rechten Nilseite, nördlich von Luxor.
Vor der Nilfähre umfängt ihn noch einmal ein großes Hallo. Alle die ihn kennen kommen zum Militärwagen, drücken ihm die Hände und wünschen viel Glück. Achmed ist gerührt. Ihm wird bewusst wie viele Freunde er nun schon hat. Der Fährmann lässt die Schiffsirene ertönen, fast während der ganzen Überfahrt. Kurz bevor der große Lastwagen von Bord rollt reicht ihm der Fährmann noch zwei Packungen Zigaretten. Er hat Tränen in den Augen. Achmed auch. Der Abschied von seiner Fähre, von seinem Nil, fällt viel schwerer als der Abschied von der Familie und vom Dorf.
Jetzt, auf der Fahrt durch die breiten Straßen von Luxor sieht er nichts von allem was er früher bestaunt hat. Er hört auch den Lärm und den Muezzin nicht. Er kauert, in sich zusammengesunken, auf der schmalen Holzbank. Seine Augen sehen andere Bilder. Sein bisheriges Leben zieht an ihm vorüber. Er sieht die anderen jungen Männer um ihn herum nicht. Er hört ihre Scherze nicht. Achmed ist eben anders. Und dennoch muss er nun tun was alle jungen Männer seines Alters tun müssen.
Die Kaserne ist außerhalb der Stadt, am Rand der Wüste, weit hinter den grünen Feldern und Gärten. Der Militärwagen rumpelt durch das große Tor, eine riesige Staubfahne hinter sich herziehend. Eine neue andere Welt hat sie verschluckt, die jungen Männer aus Theben-West.
Nun ist Achmed nicht mehr der sensible, einfühlsame, gescheite, fleißige und erfolgreiche Achmed von der Westbank. Er ist wie alle hier und bekommt die an sich schon kurzen Haare noch kürzer geschoren. Er muss das traditionelle Gewand der Fellachen und sein weißes Kopftuch mit der grauen alle gleichmachenden Uniform tauschen. Die Unterkunft ist schlechter als in den einfachsten Häusern seines Dorfs. Der Drill ist grausam für einen der anders ist als die meisten.
Achmed hält das nur aus weil er an die Schule denkt und an die Bilder vom Nil, an sein Dorf, seine Familie, seine Freunde und an Fatima. Ob sie noch frei ist wenn er zurückkommt? Doch Geld zum Heiraten hätte er sowieso nicht. Drei- bis viertausend Pfund sind als Brautgeschenk üblich. Das ist unbezahlbar für einen der wenig hat.
Dreihundert Pfund konnte er bis heute sparen. Darauf ist er stolz. Dafür hätte er sich, wenn er nicht zum Militär gekommen wäre, einen Esel gekauft. Einen guten, jungen, kräftigen. Damit hätte er Touristen führen können, zu den Kulturstätten und... Fünf Pfund im Monat, der Sold reicht nicht einmal für Tabak. Eine harte Zeit.
Achmed hat im ersten Jahr nicht viel Zeit zum Nachdenken und zum Traurigsein. Die Militärausbildung fordert einen ganzen Mann. Und eine Blöße will er sich nicht geben. Die sollen nicht von Achmed dem schwächlichen Fellachenjungen aus Luxor erzählen können. Das würde ihm Schande bringen, in seinem Dorf.
Zweimal bekommt Achmed für jeweils drei Tage Urlaub. Er fühlt sich unwohl in der Uniform. An der Fähre haben sie ihn kaum erkannt. Alle sagen er habe sich sehr verändert. Fatima hat er nur ganz kurz gesehen, bei der Feldarbeit. Er hat sich nicht getraut sie anzusprechen. Sie hat ihn vielleicht auch nicht erkannt, in seiner Uniform.
In seinem Haus hat sich einiges verändert. Seine jüngeren Geschwister werden immer frecher. Die älteste Schwester hat geheiratet. Sie erwartet schon bald ihr erstes Kind. Sein jüngerer Bruder geht zur Schule, vom Geld das die Familie als Brautgeschenk erhalten hat. Achmed schläft nicht mehr gut, im Haus seiner Familie. Er fühlt sich fremd, nicht mehr hierher gehörend.
Der Vater ist krank. Das Atmen fällt ihm schwer, auch hat er Schmerzen in Händen und Beinen, wohl von der harten Arbeit in den feuchten Reisfeldern. Die Mutter und die beiden anderen Schwestern müssen die Arbeit des Vaters übernehmen. Achmed fühlt sich hilflos und schwach, wie damals am ersten Tag an der Nilfähre. Sein Ziel, Steuermann eines großen Luxusschiffes zu werden, scheint ihm nun unerreichbar.
Nach einem Jahr militärischer Ausbildung kommt Achmed nach Kairo. Dort besucht er die Militärschule. Er wollte nicht nach Kairo. Von den Bewohnern der riesigen Stadt hat er nichts Gutes gehört. So weit weg von zu Hause scheint ihm nun zerstört was ihn mit den Wurzeln seiner Kindheit und mit dem ihm vertrauten Lebensraum verband.
Der Nil bei Kairo ist nicht mehr sein Nil. Wenn er, auf dem offenen Militärlastwagen sitzend, dem Lärm und Gestank des Kairoer Straßenverkehrs ausgesetzt die verkommenen Hausfassaden und die zerlumpten Gestalten am Straßenrand sieht, bekommt er schweißnasse Hände und einen dumpfen Druck im Magen.
Er versteht nicht wovon die vielen Menschen in der Großstadt leben, weil doch nichts wächst in diesem Häusermeer. Er weiß nur, dass er hier nicht leben könnte. Die Kaserne in Kairo ist wesentlich größer als die in Quena, dafür aber mitten in der Wüste, in der Nähe einer erst vor wenigen Jahren erbauten Stadt, mit hohen Häusern, Fabriken und Grünanlagen.
Den eigentlichen Militärdienst leistet er am Suezkanal. Dort muss er an militärischen Einrichtungen und für militärische Zwecke wichtigen Straßenkreuzungen Wache stehen. Auf der Fahrt nach Kairo, entlang des Nils, hat Achmed viel gesehen von seinem Land, auch dass die Menschen im grünen Uferbereich überall in gleicher Form leben wie die Familien in seinem Dorf.
In der Militärschule tut sich Achmed schwer. Nie lernen gelernt fällt ihm, dem beinahe Zwanzigjährigen, das Lernen schwer. Besonders das Lesen und das Schreiben. Rechnen liegt ihm eher, auch Fremdsprachen. Der Englischunterricht macht ihm Spaß. So vergehen für Achmed die Monate in der Wüste und am Suezkanal mit dem zähen Versuch etwas Bildung in seinen Kopf zu bekommen.
Bei militärischen Übungen und beim Sport ist Achmed gut. Das verschafft ihm die Möglichkeit, sich für das letzte Militärjahr an den Assuanstaudamm, ganz in den Süden des Landes, versetzen zu lassen. Hier hat er etwas Abwechslung und hin und wieder einen Kontakt mit Touristen. Dabei kann er sein Englisch ausprobieren und festigen. Auch der Sold, die Verpflegung und die Unterkunft sind besser.
Der Assuanstaudamm ist das wichtigste militärisch zu schützende Objekt Ägyptens. Die Zerstörung des Staudammes würde eine Katastrophe für das ganze Land bedeuten. Die Flutwelle wäre in Kairo noch sechzig Meter hoch. Nichts würde stehen bleiben am Ufer des Nils und im Delta, kein Haus, kein Baum, nichts. Das wurde ihm immer wieder sehr eindrucksvoll vermittelt. Somit glaubt er nun eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, in den letzten Monaten seines Soldatenlebens.
Das Wachestehen am Staudamm ist langweilig für den ehrgeizigen Fellachensohn aus Theben-West. Achmed kann sich kaum mehr vorstellen, wie es in seinem Dorf und an der Nilfähre bei Luxor aussieht. Er weiß nicht ob sie, an die er viele Stunden des Tages denkt, auf ihn wartet, ob sie noch an ihn denkt, ob sie wahrgenommen hat weshalb er den gemeinsamen Lebensraum verlassen musste. Ob sie überhaupt ...
Im August des folgenden Jahres ist es dann soweit. Achmed wird vom Militär entlassen. Er ist zweiundzwanzig Jahre alt. Mit dem Zug fährt er bis Luxor. Mit leuchtenden Augen steigt er aus. Sein Herz klopft bis zum Hals. Den Bahnhof von Luxor hat er noch nie gesehen.
Achmed sieht anders aus als vor dreieinhalb Jahren. Nicht mehr wie ein Fellachenjunge. Schwere ausgediente hohe Militärschuhe an den Füßen, eine abgetragene graue Militärhose mit breitem Gürtel, ein buntes Hemd, eine Militärkappe mit Schirm auf dem Kopf, ein Bündel auf dem Rücken, mit dem wenigen was er besitzt, so stapft er durch die Straßen von Luxor. Das bunte Hemd ist sein ganzer Stolz. Master of study steht in großen blauen Buchstaben auf seinem Rücken.
Er kann es kaum erwarten, die Fähre, den Fährmann und sein Nilufer wiederzusehen. Mehr als zwei Jahre war er nicht mehr zu Hause. Ein Brief hat ihn in Assuan erreicht. Der Vater ist gestorben. Er hat lange an seiner Krankheit gelitten. Der Bruder ist in der Ausbildung, bei der Touristenpolizei. Zwei weitere Schwestern sind verheiratet und erwarten Kinder.
Es ist Nachmittag, die Straßen von Luxor sind erfüllt vom geschäftigen Treiben der Händler. Autos, Eselskarren, Kutschen, Mopeds, Fahrräder, viele hastende und lärmende Menschen bestimmen das Straßenbild. Verlockende Gerüche dringen aus dem Souk. Der Muezzin ruft zum Gebet.
Achmed sieht auch Touristen, etwas verloren und scheu wirken sie, junge Frauen in kurzen Röcken oder Shorts, mit Schmuck behangene grell geschminkte ältere Frauen, Männer mit großen Schirmmützen und großen Kameras.
Alte fensterlose Busse drängen sich schwankend durch das Verkehrsgewühl und große blaue vollbesetzte Touristenbusse. Niemand beachtet Achmed. Er spürt, er ist wieder ganz am Anfang, obwohl er nur wenige Kilometer von hier entfernt geboren ist. Alles wirkt fremd um ihn herum. Alles ängstigt ihn.
Einzig vertraut erscheint ihm nun der Luxortempel, der imposante Säulensaal, der hohe Pylon mit den riesigen den Pharao darstellenden Wächterfiguren im Eingangsbereich. Er hat ihn oft vom andern Ufer aus gesehen und versucht zu ergründen wie er errichtet wurde und wie lange es wohl gedauert hat.
In strahlendem Himmelblau schimmert die von weißen Felukensegeln durchbrochene Wasserfläche. Mit Tränen in den Augen hat er den breiten Strom verlassen, vor dreieinhalb Jahren. Mit Tränen in den Augen geht er nun auf seine Lebensader zu.
Den Lärm der hektischen Touristenstadt nimmt er nicht mehr war. Er achtet nicht auf die schimpfenden Fahrer der Autos und Motorräder, die ihm ausweichen oder vor ihm bremsen müssen. Er sieht nur seinen Nil und auf der anderen Seite seinen Lebensraum, seine Wurzeln, sein Zuhause.
Das Wüstengebirge hinter dem fruchtbaren grünen Bereich, in dem auch sein Dorf liegt, schimmert rotbraun, flimmert verschwommen zum Horizont ausfließend im Dunst des heißen Tages.
Er achtet nur auf die ihm vertrauten Geräusche, die vom anderen Ufer sanft herüber wehen. Dort liegen die beiden Fähren, rechts die für Personen, links die größere für Fahrzeuge, die er gut kennt. Achmed ist wie betäubt. Er steht reglos da. Er kann es kaum fassen. Er hat es geschafft. Er ist zurückgekehrt zu dem, was ihm so viel bedeutet.
Er geht zur Anlegestelle. Dort stehen schon viele Männer, sitzen schon viele Frauen mit Kindern und großen Bündeln. Für Achmed ein lieb gewonnenes, wohltuendes Bild. Neugierige Augen treffen ihn. Die Frauen tuscheln, junge Mädchen in farbenfrohen Kleidern schauen scheu mit großen Augen, senken schnell den Blick. Sie kichern miteinander.
Achmets Blick ruht auf dem Uferbereich von Theben-West. Nur verschwommen nimmt er war was ihn umgibt. Mehrmals muss der Kassierer ihn ansprechen. Fünfundzwanzig Piaster kostet die Überfahrt. Er sieht sein Dorf vor sich, sein Haus, seine Mutter, die Geschwister, die Felder und Fatima. Ob sie noch bei den Eltern wohnt? Wahrscheinlich ist sie schon verheiratet.
Jetzt erst, wo die Schiffssirene die Ankunft ankündigt, registriert er, dass die Fähre schon mitten auf dem Fluss ist. Von Bord dringen heitere Geräusche herüber. Jugendliche musizieren, singen, tanzen.
Der sich dem Ufer zuneigende breite Ausleger der Fähre kann die Ankommenden kaum fassen. Die Achmed umgebenden Schar der Wartenden macht nur widerwillig Platz.
Wie damals springen junge Burschen schon vor dem Anlegen herunter. Alles schiebt. Alles drängt. Kinder weinen, Frauen hüllen ängstlich Babys in Decken und drücken sie fest an sich. Alte haben Probleme, den Höhenunterschied vom Landeblech der Fähre zum Ponton zu überwinden. Eine Frau fällt hin. Achmed hilft ihr auf und begleitet sie ein Stück durch die Menge, zu den Stufen am Ufer.
Die Wartenden drängen hinein, während die Ankommenden noch Probleme haben an Land zu kommen. Motorräder werden gestartet. Junge Männer fahren rücksichtslos durch die Menge.
Fahrräder, Kisten, allerlei Gegenstände und Kinder werden an Bord getragten. Ein hagerer Mann schleppt ein riesiges mit Sand und Staub überzogenes Fernsehgerät auf dem Rücken. Achmed hilft ihm beim Einsteigen und beim Absetzen des Gerätes.
Nun spürt er es deutlich. Es hat ihn wieder wie ein Blitz durchzuckt. Am Ufer noch fühlte er sich verloren und fremd. Doch nun, umgeben von vertrauten Bildern und Geräuschen, mitten auf dem Fluss, vom feinen Vibrieren des stählernen Schiffskörpers durchwoben, dem hart pochenden Motorgeräusch aus dem Bauch des alten Fährbootes ausgeliefert, weiß er wo er hingehört.
Seine Augen wandern durch die Menschenmenge. Ob er jemanden kennt? Ob ihn jemand erkennt? Doch er sieht nur unbekannte Gesichter, jedoch Menschen denen er sich verwandt fühlt. Es ist ihm sogar für einen Augenblick so als wäre er gar nicht weggewesen.
Den Fährmann kann er von hier aus nicht sehen. Achmed drängt durch die Menge in Richtung Treppe, die nach oben zum Steuerhaus führt. Eine Frauengruppe sitzt mitten im Boot auf der Erde. Einige drücken ihre Kinder fest an sich.
Eine ganz junge Frau herzt mit ihrem kleinen Söhnchen, noch ein Baby, doch so wie er einmal, der Prinz. Die Schwester, vielleicht zwei Jahre älter, schmiegt sich an die Beine der Mutter. Sie schaut mit großen ängstlichen und zugleich neugierigen Augen zu den beiden Touristen auf, die vor ihr stehen.
Die junge Mutter gibt dem mittlerweile ungeduldig weinenden Jungen die Brust. Eine starke, gesunde Frauenbrust. Der Kleine saugt gierig. Man hört ihn schmatzen. Nun deckt die Mutter ihr schwarzes Gewand über das hungrige Kind.
Die Touristin lächelt gerührt. Ihr Mann zückt ein wenig verlegen die Kamera. Er schaut kurz durch und es macht klick und schnell noch einmal klick. Er wirkt stolz und erleichtert.
Die junge Mutter hat es wahrgenommen. Sie gestikuliert, verlangt Bakschisch. Der Mann errötet. Seiner Frau ist das peinlich. Sie fordert ihn auf etwas zu geben. Er tastet nach seinem Portemonnaie. Mit spitzen Fingern zieht er eine Pfundnote heraus. Seine Frau reicht dem kleinen Mädchen das Geld. Die dunklen Augen leuchten aufgeregt. Kleine schlanke Finger umschließen den Geldschein wie ein Schraubstock.
Die Mutter schimpft. Sie versucht, dem Mädchen das Geld abzunehmen. Doch die kleine weigert sich. Die Mutter wendet Gewalt an, setzt das Baby vor sich auf die Erde um beide Hände freizuhaben. Sie biegt die Finger des sich immer noch wehrenden Mädchens auf. Sie schimpft, das Mädchen windet sich und weint.
Der Junge weint auch und macht dabei Pipi. Ein kleiner Bach ergießt sich auf den Boden der Fähre. Die beiden Touristen weichen verlegen, jedoch auch verständnisvoll lächelnd, zurück.
Die Mutter hat den mittlerweile total zerknitterten Geldschein in der Hand. Sie gibt dem Mädchen eins hinter die Ohren. Der Junge weint lauter. Er hat Hunger. Er ballt die kleinen Fäuste. Die Mutter glättet den Geldschein sorgsam, wickelt ihn in das Ende ihres Kopftuches und schützt ihn durch einen Knoten.
Ihre starken jungen Arme greifen nach dem nun wild schreienden Prinz. Sie rückt etwas zur Seite, schüttelt die Nässe von ihrem Gewand, schimpft mit dem Baby und dem Mädchen. Ein dicker Kuss auf die feuchten Augen und auf die hungrigen Lippen, schon verschwindet er, der Pascha, wieder unter ihrem Gewand. Man hört ihn wieder zufrieden schmatzen.
Ruhe ist eingetreten. Auch die beiden Touristen sind erleichtert, man sieht es deutlich.
Achmed drückt sich an ihnen vorbei, steigt die Treppe zum oberen Deck hinauf. Er geht etwas benommen auf das Steuerhaus zu. Doch er spürt schon von weitem, das ist nicht sein Freund. Das ist ein anderer älterer Mann. Achmed kennt ihn nicht.
Das linke Nilufer ist nun ganz nah. Die Motoren im Bauch des Schiffs und die Sirene heulen auf. Der Fährmann reißt in wilden Bewegungen, mehrmals die Richtung wechselnd, am großen Steuerrad. An Land drängen sich die Wartenden Schulter an Schulter, wie eine undurchdringliche Wand. Stimmen und Zurufe fliegen hin und her.
Was folgt ist allen hier seit Generationen vertraut. Achmed steht auf dem oberen Deck. Er genießt diese Minuten als seien sie die wichtigsten seines Lebens. Er lächelt als hätte er alle Zeit der Welt, als wolle er gar nicht ankommen, zuhause, in seinem Dorf.
Als letzter geht er sehr gelassen von Bord, vorbei an den schreienden Taxifahrern und Händlern. Niemand schaut ihn an. Er fühlt sich auch hier, ebenso wie am anderen Ufer, als würde er gar nicht existieren. Er nimmt nichts mehr wahr um sich herum. Sein Bündel auf dem Rücken geht er mit verklärtem Blick an Händlern und Buden vorüber.
Er betritt die Asphaltstraße, die geradewegs zum Wüstengebirge führt. Mit festem Schritt, die Augen in die Ferne gerichtet, lässt er die wenigen Häuser am Nilufer hinter sich. Er nimmt nicht die Abkürzung durch die Felder, die er früher immer gegangen ist. Nein, er folgt der Asphaltstraße. Er will nicht abkürzen. Dafür war er zu lange weg von zu Hause. Nun, wo er dem Lebensraum seiner Kindheit so nahe ist, möchte er noch genießen, genießen was in ihm abläuft.
Er hat auch ein wenig Angst vor möglichen Enttäuschungen, Angst vor den Veränderungen in seiner Familie. Wird er sich noch einfügen können? Wird man ihn überhaupt noch aufnehmen wollen, wo er doch so anders ist als alle, die hier leben? Passt er, Achmed Omara Ali, überhaupt noch hierher? Kann er hier noch leben und wovon? Aber wo soll er sonst hin?
An den Memnonkolossen biegt er nach links in den Weg entlang des hohen Bahndammes, der zu seinem Dorf führt. Es ist Abendstimmung. Die Felder stehen gut in Frucht. Die Bohnenpflanzen sind groß, grün und kräftig. Die Sonne steht noch über den Gräbern der Königinnen. Sie wird aber in den nächsten Minuten dahinter versinken. Achmed kennt diese Stimmung sehr gut.
Einige Jungs mit Fahrrädern kommen ihm entgegen, laut scherzend und lachend. Sie kennen ihn nicht, er kennt sie auch nicht. Sie beachten ihn kaum.
Ein alter Mann mit einem Esel biegt vom Feld her kommend auf seinen Weg ein. Achmed erinnert sich an ihn. Der Mann gehört zu seinem Dorf. Achmed strahlt, grüßt freundlich, als würde er einem alten Freund gegenübertreten. So empfindet er diese Begegnung auch. Doch der Mann nickt nur kurz, grüßt zurück und schon ist er mit dem Esel an ihm vorüber.
Achmed steht am Straßenrand. Dunkle Gedanken kommen in ihm auf. Will man ihn nicht mehr aufnehmen, oder hat er sich auch äußerlich so verändert, dass man ihn nicht mehr erkennt?
Verwirrt geht er weiter, aber jetzt ganz langsam. Er bleibt stehen, schaut an sich herunter, die alten Militärschuhe, die graue abgetragene Hose, dazu das bunte Hemd. So sah der Achmed nicht aus, der vor mehr als drei Jahren das Dorf verließ. Ein Fremder kommt zurück, nicht Achmed, der Fellachenjunge, den alle kannten und mochten.
Er reist an den Schnüren, die seinen Sack umschließen. Er öffnet ihn, kramt darin herum. Ganz unten, total zerknittert, da ist sie, seine Gallabiyya, das Gewand der Fellachen, das er getragen hat, als man ihn abholte. Er hält es zitternd in der Hand. Tränen rollen über seine Wangen, tropfen auf den braunen Stoff.
Und während der runde Sonnenball über den Gräbern der Pharaonen versinkt reißt sich Achmed seine Militärmütze vom Kopf. In einem weiten Bogen fliegt sie ins Bohnenfeld. Mit zitternden Händen öffnet er die schrecklichen Schnürstiefel, schlüpft in seine Gallabiyya, die ihm so vertraut ist, kramt in dem großen Sack, fischt ein paar ausgetretene Gummisandalen heraus. Nun fühlt er sich besser. Er atmet schwer, aber seine Augen strahlen glücklich. Er wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und hat es plötzlich ganz eilig nach Hause zu kommen.
Er läuft sogar. Nun sieht er das Dorf, sieht Lichter hinter Lehmmauern, hört Tiere und Menschen. Er fliegt an den ersten Häusern vorbei. Einige Frauen und Kinder schauen erstaunt. Da ist sein Haus. Seine Mutter sammelt gerade die runden Brote ein, die in Tonschalen der Sonne des Tages ausgesetzt nun zum Backen bereit sind. Achmed ruft ihr zu und winkt.
Und wieder rollen ihm Tränen über die Wangen. Mit einem Aufschrei schließt ihn die Mutter fest und freudig in die immer noch kräftigen Arme. Achmed fühlt sich wie das Baby auf der Fähre. Und schon sind sie umringt von einer aufgeregten Kinderschar. Alle zerren an ihm und an der Mutter.
Achmed muss zweimal hinschauen um die Gesichter zu erkennen, wegen der Tränen in seinen Augen, aber auch weil alle so groß geworden sind. Er sieht auch kleinere, wohl die Kinder seiner verheirateten Schwestern.
Achmed muss sich auf die Erde setzen um alle Liebkosungen und Küsse entgegenzunehmen. Da sieht er die Beine seines Bruders vor sich. Tatsächlich, einPolizist ist aus ihm geworden. Doch unverkennbar sein kleiner Bruder. Ganz schön groß und erwachsen ist er, ein richtig stattlicher Mann. Seine beiden Schwestern kommen strahlend auf ihn zu, drücken und küssen ihn.
So hat er sich das Nachhausekommen vorgestellt. Wie lange war er eigentlich weg? So viel hat sich verändert. Doch das aus kleinen Lehmziegeln gebaute Haus scheint noch so wie er es kennt.
Es ist ein schöner warmer Abend. Immer mehr Nachbarn und Kinder drängen sich durch die Tür. Achmed ist sehr gerührt. Er bekommt sogar kleine Geschenke. Die Frauen bringen Lebensmittel. Es wird ein richtiges Fest. In dieser Nacht schläft er im Freien, auf der Erde. Er möchte die Gewohnheiten der Großfamilie nicht durcheinander bringen. Man hat ja nicht mit ihm gerechnet.
Die Sterne über Theben-West, die er sehr genau kennt, decken ihn zu. Noch lange kreisen seine Augen über den wunderbaren Nachthimmel. Bilder aus Kindertagen kommen in ihm hoch. Da ist der Stern von dem die Engländer kommen, dort der große, das ist wohl Deutschland und der ... Mit diesen Gedanken schläft Achmed ein.
Sehr tief und lange hat er geschlafen. Beim Erwachen spürt er ein neues Lebensgefühl in sich. Er empfindet eine ungeheure Kraft. Dankbar nimmt er am Frühstück teil. Bohnen und Gemüsebällchen, dazu das wunderbare von der Mutter gebackene Brot.
Den ersten Tag wieder im Dorf macht er Besuche bei den Nachbarn. Er hat so viel zu erzählen. Überall hört man ihm mit leuchtenden Augen zu. Immer ist Achmed umringt von einer Kinderschar. Manche begleiten ihn sogar von Haus zu Haus. Und überall wird Achmed bewirtet. Sein Abwehren hilft nichts. Er bekommt das Beste was im Haus ist.
Die alten Männer hören verständnisvoll nickend zu, wenn er erzählt was er erlebt hat. Er schildert seine Erfahrungen in Kairo, der Riesenstadt, er spricht vom Suezkanal, vom Assuanstaudamm und von dem was er gesehen hat bei seinen Fahrten entlang des Nils. Die Kinder hängen an seinen Lippen. Für sie ist Achmed, der so viel von der Welt kennt, ein bedeutender Mann.
Die Tage vergehen im Familien- und Freundeskreis, bis Achmed müde ist vom Erzählen. Auch erwacht in ihm eine Neugierde. Wie geht sein Leben nun weiter? Irgendetwas Sinnvolles muss er schließlich tun. Auf den Feldern ist zurzeit wenig Arbeit. Dahin zieht es ihn auch nicht.
Er möchte wissen was aus Fatima geworden ist. Bisher hat er nur gehört, dass man sie lange nicht gesehen hat. Es zieht ihn zum Nil, zur Fähre, seinem früheren Arbeitsplatz. Er weiß, er muss sich wieder alles neu erarbeiten, sich um neue Freundschaften bemühen.
Er steckt sich einige kleine Geschenke für alte Freunde in die Tasche und geht los, zuerst zum Nachbardorf. Fatima kann er nirgends entdecken. Er fragt nach ihr, hört die widersprüchlichsten Antworten. Aber eines haben alle gemeinsam, Fatima lebt nicht mehr in ihrem Dorf. Sie hat entweder eine Stelle in einem Hotel auf der anderen Nilseite angenommen oder besucht dorteine spezielle Schule.
Fatimas Familie nach ihr zu fragen, das traut er sich nicht. Was soll er auch sagen, weshalb er sich nach ihr erkundigt? Er kennt sie ja kaum und ihn kennt man hier auch nicht.
Nun schreitet Achmed am breiten Bewässerungskanal entlang in Richtung Asphaltstraße und von dort zum Nilufer. Die ersten Touristenbusse und die ersten Touristen auf Fahrrädern kommen ihm entgegen. Er grüßt alle sehr freundlich. Doch kaum jemand grüßt zurück.
Bilder kommen ihm vor Augen. Wie lange ist das her, zehn Jahre? Oder war das gestern, als er sich zum ersten Mal von seinem Dorf wegbewegte, über diese Straße, zum Nil? Ähnlich hat er sich damals gefühlt. Wieder ist es ihm zu eng geworden in seinem Dorf. Schon nach wenigen Tagen hat er gespürt er gehört da nicht hin. Er ist anders als die, die dort leben und damit zufrieden sind dort zu leben.
Wieso eigentlich? Darüber denkt er seit Jahren nach. Was ist es was ihn dort so erdrückt, was ihn hinauszieht, dorthin wo viele Autos sind, Lärm und Menschen, wo die Fremden an Land gehen um die alten Kulturgüter seines Landes zu sehen?
Wieso geht er jetzt hier diese Asphaltstraße entlang, die für Autos und Motorräder gemacht ist, Dinge die er nicht besitzt? Wieso zieht es ihn dorthin wo Menschen sind deren Herkunft er nicht kennt, Menschen die ihn kaum ansehen, so als würde er, Achmed, gar nicht existieren? Aber er existiert doch. Im Dorf und in der Familie schätzt man ihn.
Wieso geht er hier allein entlang? Die Fremden sind fast immer zu zweit oder in Gruppen. Wieso schnattern und lachen die Fremden in einem fort? Was ist es, worüber sie lachen? Vielleicht sogar über ihn, weil er so einfach gekleidet ist, weil man ihm ansieht, dass er der Sohn eines armen Landarbeiters ist, weil er keine Schulbildung hat, nicht ihre Sprachen versteht? Wieso ist er, Achmed, so ernst? Aber worüber soll er lachen? Das Leben ist hart.
Wie soll er, Achmed, jemals eine Frau bekommen, die er sich mit seinen fast zweiundzwanzig Jahren so sehr wünscht? Die tollsten Geschichten über Frauen, ganz geheimnisvolle und kaum glaubhafte Dinge hat er beim Militär gehört. Ganze Nächte hat er wachgelegen. Das ist es was Achmed durch den Kopf geht, während er auf den Fährhafen zuschreitet.
Da ist sie nun, die Welt die ihn anzieht. Heute sieht er alles klarer als bei seiner Ankunft vor einer Woche. Im Grunde hat sich wenig verändert. Die Zahl der Händler und Buden ist größer geworden. Die Fähre ist noch voller. Es gibt nun sogar zwei Restaurants für Touristen an diesem Nilufer, in der Nähe der Anlegestelle.
Eine Gruppe Jugendlicher in blauer Schulkleidung auf Fahrrädern zieht lärmend an ihm vorüber. Er muss zur Seite springen. Wieso sind die so rücksichtslos zu ihm, obwohl er doch wesentlich älter ist?
Zwei große blaue Busse, vollbesetzt mit Touristen, schwanken über die holprige, staubige, unbefestigte Straße. Landsleute hasten zielstrebig an ihm vorüber. Wo die nur alle hinwollen? Achmed fühlt sich ähnlich verwirrt wie vor zehn Jahren. Er sucht nach bekannten Gesichtern. Nun erkennt er einige Händler. Sie erinnern sich aber offensichtlich nicht an ihn. Jedenfalls zeigen sie keine Reaktion, obwohl er sie sehr freundlich grüßt.
Da ist noch etwas was Achmed wiedererkennt, den kleinen Hügel neben der Autofähre. Auf ihm hat er schon einmal Schutz gesucht. Und so kommt es, dass Achmed an diesem Sommervormittag, wie vor zehn Jahren, dort oben sitzt. Doch er ist größer geworden, älter, erfahrener. Er hat viel erlebt. Ist er aber auch klüger geworden?
Im Moment empfindet Achmed das jedenfalls nicht. Er fühlt sich so hilflos und verlassen wie damals. Und weil er nichts Besseres weiß, macht er genau das was er damals auch gemacht hat, nämlich nichts. Er sitzt nur da, in Gedanken versunken und beobachtet. Dabei streifen seine Augen das jenseitige Ufer.
Die Hotelfassaden haben sich nicht verändert. Doch, ganz rechts, neben dem Luxortempel, ist ein neues Hotel hinzugekommen. Es ist sehr groß, wirkt aber bei weitem nicht so schmuck und anziehend wie die alten mit den goldfarbigen Schriften an der Fassade.
Gold ist für Achmed die interessanteste Farbe die er kennt. Er weiß aus Gesprächen mit anderen wie wertvoll Gold ist. Weiß empfindet Achmed als zweitschönste Farbe. Es sind deshalb auch die großen weißen Hotelschiffe an der anderen Nilseite die nun wieder seinen Blick fesseln.
Er erinnert sich daran wie es ihn vor zehn Jahren hier auf diesem Hügel durchzuckte. Er spürt noch wie die Energie in ihm erwachte bei der Vorstellung einmal Steuermann eines solchen Luxusschiffes zu sein. Und so erhofft er sich nun wieder einen solchen Energieblitz.
Doch der bleibt aus. So sehr er sich auch bemüht sich ähnlich schöne Bilder vor Augen zu führen und sich ähnlich tolle Lebensziele auszudenken wie damals, heute scheint alles anders. Ist es wirklich so anders, oder scheint es ihm nur so? Achmed philosophiert über sich und die Welt, ohne zu wissen, dass es Philosophen gibt.
Gegen Mittag geschieht etwas, was ihn jäh aus seinen Gedanken reißt. Der Fährmann hat Probleme mit dem Anlegen. Er läuft aufgeregt hin und her. Ein Drahtseil, mit dem die Fähre vorn am Poller festgemacht wurde, ist gerissen. Und nun bemüht sich der Fährmann das große Schiff an Land zu halten. Mal steht er am Ufer und versucht das Seil zu reparieren, mal am Steuerrad, wenn die Fähre abzutreiben droht.