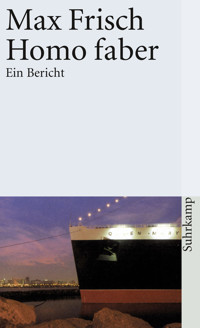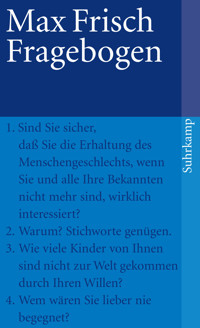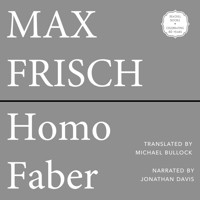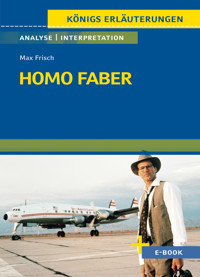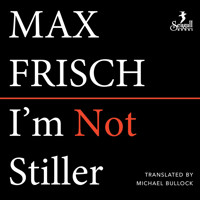15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich probiere Geschichten an wie Kleider!« heißt es einmal im Roman Mein Name sei Gantenbein, und in der Tat, in seinen beiden Tagebüchern 1946-1949 und 1966-1971 sowie in den Romanen wie etwa Stiller oder Mein Name sei Gantenbein verstecken sich in sich abgeschlossene Erzählungen und Geschichten, die von der großen erzählerischen Brillanz Max Frischs zeugen. Kein anderer zeitgenössischer Schriftsteller stellt derart ehrlich wie hintergründig die Frage nach der Identität des Menschen des 20. Jahrhunderts.
»Wovon erzählt Frisch? Von der Liebe, also von der Vergänglichkeit; vom Tod, also von der Angst vor dem Tod. Da es die Liebe immer noch gibt und da man den Tod noch immer nicht abgeschafft hat, bleibt nichts anderes übrig, als zu diesen Fragen zurückzukehren.«
Marcel Reich-Ranicki
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Max Frisch
Erzählungen
Zusammengestellt von Peter von Matt
Suhrkamp
Inhalt
Bin oder Die Reise nach Peking
Der andorranische Jude
Burleske
Schinz. Skizze
Die Geschichte von Isidor
Das Märchen von Rip van Winkle
Als Cowboy in Texas
Eine Mulattin namens Florence
Zürich-Transit. Skizze eines Films
Der Goldschmied
Der Traum des Apothekers von Locarno
Skizze eines Unglücks
Glück
Statik
Ein Mann, Botschafter einer Großmacht …
Editorische Notiz
Text- und Copyrightnachweise
Bin oder Die Reise nach Peking
Es ist im Ernst nicht anzunehmen, daß es Leute gibt, die Bin, unseren Freund, nicht kennen. Es wäre denn ein albernes Mißverständnis; wir reden aneinander vorbei, indem sie ihm einfach einen anderen Namen geben … Ein Marschall, der zu den namhaften dieses gräßlichen Krieges gehört, hatte einmal sein Quartier in einem alten Bauernhaus; er saß am Dämmerrand eines Lampenschirmes, allein, er arbeitete am Krieg, der für den kommenden Tag einen Überfall verlangte. Es mochte gegen Mitternacht sein, als er den Überfall im reinen hatte; er löschte die Lampe, ließ die fremde Nacht durch das offene Fenster und sah, halb schon zur Türe unterwegs, wo ihn seine versammelten Offiziere erwarteten – sah, daß draußen einer am Fenstersims lehnte. Der Marschall blieb stehen, seine Befehle in der Hand, seine Karten, seinen Überfall. Offenbar stand der andere, der Fremde, schon lange da, eine Pfeife im Mund, auf die Ellbogen seiner vertragenen Joppe gestützt. Er stand wie ein Nachbar, der gelegentlich, wenn es Abend wird, an unser Fenster tritt und eine Weile plaudert, ein Einheimischer. Allein es gab in dieser Gegend und zu der Zeit, als dies geschah, durchaus keine Einheimischen mehr, die so umhergehen konnten; es war ja Krieg. Es gab die Soldaten, die eigenen, die feindlichen, und was allenfalls sonst noch lebte, das arbeitete in Lagern. Einen Augenblick – der namhafte Marschall ertappte sich über einem Augenblick persönlichen Schreckens – hatte er an einen Attentäter gedacht. Wir haben vergessen, es gab auch noch die Partisanen. Auf jeden Fall hatte die Wache ihn nicht gestellt. Indessen erwies sich der Unvermutete in keiner Weise als ein Täter, er kratzte nur das Moos vom Fenstersims, indem er seinen Fingern zuschaute, tat, als gäbe es nichts Dringenderes in dieser Stunde. Nach einer Weile, als sich das Auge an das Dunkel gewöhnt hatte und man sich besser erkannte, redete er sogar mit dem Marschall. Oh, nichts Unerhörtes! Er redete in der Muttersprache unseres immerhin betroffenen Marschalls; es hätte auch jede andere Muttersprache sein können. Nachdem er die erloschene Pfeife an seinen Absatz geklopft, blickte er abermals in die offene Nacht hinaus, und der Mond saß ihm wie eine gelbe Katze auf der Schulter; er blickte einfach hinaus: die Grillen, die reifenden Felder, die Liebenden, die Vögel im finstern Gezweig, die schlafenden Rehe … denn der Marschall war auch ein leidenschaftlicher Jäger–Offenbar aus bloßer Wut auf die Wache, die versagt hatte, schellte er plötzlich. Licht, Lärm, Leute! Natürlich umsonst. Sogar ein Schuß fiel einsam in die offene Nacht unter Sternen. Dann wieder war alles beim alten: die Stille, die Grillen, die Sterne, die Schritte der Wache. Aber gefunden hatten sie nichts, auch als der Morgen graute, nicht einen toten Partisanen, nicht einmal Spuren von Blut. (Der Marschall hingegen, der zu den namhaften dieses gräßlichen Krieges gehörte, ist seither schon lange gefallen.)
Soviel über Bin.
Es war ein Abend im März. Wir hatten in der ledernen Nische eines Kaffeehauses gesessen wie all die Abende, wenn man vom Geschäft kommt, einen Kirsch trinkt, eine Zeitung liest. Auf einmal, nach Jahren des Wartens, sieht man sich von der Frage betroffen, was wir an diesem Ort eigentlich erwarten. Mindestens die Hälfte des Lebens ist nun vorüber, und insgeheim fangen wir an, uns vor dem Jüngling zu schämen, dessen Erwartungen sich nicht erfüllen. Das ist natürlich kein Zustand. Ich winkte dem Kellner, zahlte und ging. Den Mantel, den er mir halten wollte, nahm ich auf den Arm, ebenso die Rolle –
Draußen war es ein unsäglicher Abend.
Ich ging. Ich ging in der Richtung einer Sehnsucht, die weiter nicht nennenswert ist, da sie doch, wir wissen es und lächeln, alljährlich wiederkommt, eine Sache der Jahreszeit, ein märzliches Heimweh nach neuen Menschen, denen man selber noch einmal neu wäre, so, daß es sich auf eine wohlige Weise lohnte zu reden, zu denken über viele Dinge, ja, sich zu begeistern, Heimweh nach ersten langen Gesprächen mit einer fremden Frau. Oh, so hinauszuwandern in eine Nacht, um keine Grenzen bekümmert! Wir werden schon keine, die in uns liegt, je überspringen …
Natürlich traf ich niemanden. Ich schlenderte. Oder es konnte auch sein, daß ich stehenblieb, etwa vor einem Schaufenster. Frauen anzusprechen ist eine besondere Gabe; man hat sie oder hat sie nicht. Schön fand ich es dennoch, draußen der abendliche Perlmuttersee, das Spröde der Luft, das Laue eines solchen Abends im März, das sonderbar Offene und Blaue, das Laute eines klimpernden Klaviers, das sich unter der gläsernen Glocke einer himmlischen Stille verfing, lächerlich, ergreifend lächerlich oder feierlich, zum Weinen feierlich und geschmacklos, schlagerhaft, selig. Dennoch schlenderte ich weiter, traurig an Gärten vorbei, die ich nicht haben wollte. Eine Köchin führte den Hund ihrer Herrschaft spazieren, er schnupperte an allen Ecken, und da und dort lag noch ein letzter Schattenschnee, ein Häuflein von verstaubtem Winter. Die Vögel piepsten aus der Dämmerung. Und die Köchin entschwand in ein Gartentor.
Später stapfte ich durch Wald.
Später war auch der Mond aufgegangen, wie ein Gong aus Messing hing er über dem Schilf eines unerwarteten und nie gekannten Riedes, über dem Quaken der Frösche, und ich war, so wollte mir scheinen, durchaus nicht lange gegangen, als ich unversehens vor der chinesischen Mauer stand.
»Bin«, sagte ich, »das ist doch sonderbar,– das muß eine Täuschung sein –«
Bin lächelte.
Der Gedanke, daß ich zum Nachtessen erwartet würde, war das erste, was der unglaubliche Anblick mir eingab, und auch für lange das einzige, was außer Zweifel stand. Bin lächelte. Er rauchte aus seiner Pfeife wie eh, seine Ellbogen auf die chinesische Mauer gestützt, die anzusehen war, wie man sie von Bildern eben kennt, eine steinerne Schlange, die sich weit in ein weites, ein wüstes und hügelwogendes Land zog, und manchmal, während wir redeten, kratzte er mit dem Daumen das Moos von der Mauer, Moos, Sand, Gebröckel von verwittertem Stein, Staub der Jahrtausende. Er weiß es gar nicht, daß er das tut, glaube ich. Dann wieder bläst er es weg, fährt mit dem Ärmel darüber – Ich hatte Bin nach dem weiteren Weg gefragt.
»Es kommt darauf an«, sagte er, »wohin du willst.«
Nicht einmal das wußte ich …
Es war eine Art von Fußweg, der jenseits hinunterführte, immer wieder einmal im Gestrüpp versickerte; man mußte ordentlich aufpassen, daß man nicht über Wurzeln stolperte, das Mondlicht rieselte in einer gläsernen Quelle nebenher … Einmal fragte Bin, wie es denn ginge? was wir so trieben? Ich hatte die Rolle unter dem Arm, Zeichen des Alltags; ich zuckte die Achseln und sagte:
»Nicht eben viel.«
Man arbeitet, man ißt, man verdient.
»Drüben ist immer noch Krieg«, sagte ich später, »niemand weiß, wann er aufhören wird, und wie?« Wir redeten lang über den Krieg –
So unerhört anders und fremd, wie man vermuten möchte, war die Landschaft auch wieder nicht. In den einsamen Bergen des Karstes hatten wir ähnliches schon einmal erlebt. Wir gingen am Rand einer steilen Schlucht, unter uns rauschten die Wasser einer Tiefe, die man nicht sah, und wir sahen auch nicht, ob wir eigentlich weiterkamen auf diesem steinernen Gestirn, das wir kaum noch für unsere liebe Erde halten konnten, so groß und ohne Zeit, ohne Pflanzen, ohne Dorf, so einsam und grausam und ohne Verhältnis zum Menschen lag es da, eine Wüste aus Kalk, ein Meer von versteinerten Wogen. Im Schatten der Wolken, die über uns zogen, silbern und schäumig wie ein Gestade der spielenden Götter, lag alles noch härter und toter, ein Gebirge von Schlacken, wir gingen und gingen – plötzlich, nie werde ich es vergessen, standen wir am Ende der Schlucht: vor uns ein fremdes und liebliches Tal, ein See voll blühender Seerosen, nichts anderes, ein Wunder von blühendem See …
Das gibt es.
In den einsamen Bergen des Karstes hatten wir all dies schon einmal erlebt … Bin konnte es hinter seiner schelmischen Pfeife nicht mehr verbergen, daß ihn das Erstaunen, das mich auch diesmal wieder stehen ließ, ein wenig freute..
»Ja«, sagte er, »das ist es nun.«
»Peking?«
»Das ist es nun …«
Wir blickten hinab in den Frühling, wir blickten in eine Weite voll sanfter und gelassener Hügel, voll lieblicher Bäume, voll Straßen und Sonne, Bäche glitzerten in silbernen Schleifen, fernhin die Städte der Menschen, Dächer, Brükken, Buchten voll kräuselnder Bläue, Türme, Vögel darüber, die kreisen –
Nach einer Weile fragte Bin:
»Gehen wir?«
Noch einmal dachte ich an das Abendessen.
»Sobald wir in Peking sind«, sagte ich später im Gehen, »werde ich Rapunzel, meiner Frau, eine Karte schreiben! eine Karte mit all diesen Dächern und Türmen und Brükken und Segeln darauf, mit blühendem Lotos, mit blauen Vögeln darüber, die kreisen.«
Ich sah es, das Unverhoffte, mit bestürzendem Glück: weit konnte es nach Peking nicht sein, eine Stunde vielleicht oder zwei oder drei …
Seither sind Jahre vergangen.
Das einzige, was immer wieder stört, das ist natürlich die Rolle unter dem Arm. Zwar schwer ist sie nicht. Man schlenkert sie. Man hält sie bald so oder so. Dann wieder, leicht, wie sie ist, klemmt man sie einfach unter den Arm. Was mich stört, das ist anderes. Irgendwo in Peking, sagt man sich, wirst du sie liegen lassen! Man kennt sich wenigstens in seinen Mißgeschicken. Und dann, wenn man sie eines alltäglichen Tages wieder braucht, werde ich mich bestenfalls erinnern, wo ich sie zuletzt in den Händen gehalten, und eben diese leeren Hände betrachten … denn niemals werde ich wieder dahin gelangen … Was man in solchen Augenblicken erlebt, das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Wunder, Gott verzeih mir, aber darüber täusche ich mich nicht, sooft ich an eine Schleife unseres Weges komme und wieder hinunterschaue auf die blinkenden Dächer von Peking, die Türme, die uralten, die Menschlein in ihren gelben und flachen Hüten, Wasserträger, die in den wirren Gassen umherstehen und schwatzen, ihr tägliches Joch auf den Schultern, dahinter die Buchten mit kräuselndem Silber, mit Brücken und Segeln, mit blühendem Lotos, mit blauen Vögeln darüber, die kreisen …
Eine Rolle, die man in Peking stehen ließe, wäre für immer verloren. Kein Stift kann sie uns holen. Ich hielt sie auch diesmal, daß sie mir fast in den Händen zerknüllte. Ohne sie, glaube ich immer, wäre ich selig gewesen.
Der erste, der uns jenseits der chinesischen Mauer begegnete, war ein kleines Männlein aus braunem Sandstein. Mit verflochtenen Beinen hockte es da, lächelte mit beinahe geschlossenen Lidern, und obschon ich nicht allzu genau weiß, worin ein Heiliger besteht, sagte ich sofort zu Bin:
»Sieh da! ein Heiliger.«
Bin nickte. Er nahm es platterdings an, man wüßte, was ein Heiliger ist, und nickte, wie wenn man sagen würde: Sieh da, ein Regenbogen! Hierzulande gab es viele Heilige, mag sein, bei uns aber gibt es keine … Das einzige, was mir bisher an Heiligen begegnete, ist eine freundliche Leihgabe, die zu Hause auf der tannenen Truhe steht, ein kleiner Buddha, genauer gesprochen, ein Lokeshvara, auch er mit verflochtenen Beinen, mit jener steinernen Geduld und einer heimlichen Milde und immer wieder mit einem befremdenden, bald mütterlichen, bald geisterhaften Lächeln, unerschütterlich, noch wo ihm die Arme zerschmettert sind. –
»Wenn sie so dasitzen«, fragte ich Bin, »was machen sie eigentlich?«
(Oh, diese westliche Frage!)
Bin sagte:
»Sie sitzen so da – zum Beispiel, wenn die Sonne untergeht über den violetten Hügeln der Wüste, und schauen die Sonne, nichts weiter. Sie schauen. Sie denken nichts anderes als eben die Sonne, so sehr, so innig, so ganz und gar, daß sie die Sonne noch immer und immer sehen, wenn jene, die wir die wirkliche nennen, lange schon untergegangen ist. Sie sitzen so da: sie können sie jederzeit wieder aufgehen lassen.«
Wir gingen weiter.
Da ich, wie vielleicht auch der Leser, nicht eigentlich wußte, was ich nun glauben oder auch nur denken sollte, die Arbeit des Heiligen betreffend, lag es mir nahe, ein wenig zu pfeifen, auf eine verlegene Weise bereit, mich andern Dingen hinzuwenden. Oft blickte ich zurück, ob man die chinesische Mauer noch immer sähe, oder ich knüpfte wieder einmal meine Schuhnestel, oder ich knickte einen Zweig, steckte eine Blüte in den Mund …
Ja, hier war es schon Frühling.
Manchmal bleibt Bin wieder stehen, pflückt Beeren unter einem Wegsaum hervor, und natürlich hätte man auch lebhafte Lust darauf, allein ich sehe sie nie – immer erst dann, wenn Bin sie bereits in der Hand hat. Es überzeugt mich, daß es so sein muß. Bin ist mir stets um eine Gnade voraus, und dennoch, oder gerade darum, schlendere ich unsäglich gerne mit Bin.
Eines Mittags, als ich erwachte, war es schon Sommer, und wir lagen an einem Fluß, einem Strom. Der Himmel war grau oder weißlich, und die Sonne, hinter Wolken verschimmelt, flimmerte nur matt und verhalten über dem unerhört breiten, immerzu murmelnden und gurgelnden Ziehen der braunen Wellen. So lagen wir lang, und in den Stauden ringsum, in den endlosen Wäldern rauschte der Wind. Es toste. Dann wieder, plötzlich, verebbte es, so daß man meinte, das Wasser würde nun lauter. Näher und heller, muntrer, lauter plauderte es um das Schweigen der Steine.
»Bin«, sagte ich, »ich habe dir immer einmal schreiben wollen. Ach, in den letzten Jahren ist so vieles geschehen … Das heißt«, fuhr ich fort, »eigentlich ist mir, als wäre überhaupt nichts geschehen.«
Bin schwieg.
Ich höre eine Libelle wie damals, da wir die Schule schwänzten, in den Wiesen lagen, Halme um uns. Ich höre den Wind, der in den Wipfeln spielt, ganz droben, ganz ferne von hier, wo es heiß ist und schwül und still, als schlafe die Luft.
Nur die Erde, die ich unter den offenen flachen Händen fühle, nur die Erde ist mulmig und freundlich und feucht … Wenn ich nicht weiß, wo in meinem Leben ich bin, wann ich bin, lege ich mich am besten auf den Rücken, die Hände unter den Nacken: man spürt seine Schwere. Droben das leichte und lichte und lautlose Ziehen der Wolken, Sonne darüber, sie als einziges bleibt, eine glimmende Insel im fliehenden Strom der Gewölke. Und doch, auf einmal, wird es Abend, und auch sie ist gesunken.
»Bin«, sagte ich, »zuzeiten umflattert mich die Erinnerung an Dinge, die man erlebt haben muß–wie könnte man sich sonst erinnern! – eine Art von Glück, blau, nüchtern, rauschlos, ein Glück der morgendlichen Frühe, Erinnerung an ein götterhaftes oder kindliches Jungsein. Aber ich weiß nicht, wo es war.«
Bin lächelte.
»Ich kenne das«, meinte er. »Man hat das. Man dichtet es immer in seine Jugend zurück, was jetzt, da wir es für Erinnerung halten, Gegenwart ist: jetzt, in diesem Atemzug, und zum erstenmal –«
»Jetzt?«
»Glück!« meinte er nach einer Weile. »Es machte mich immer so hilflos, im Augenblick wußte ich nie, was anfangen, ich trieb durch die Gassen, ich landete bei Frauen, ich ging und besoff mich. Vor Glück! Verkleidet aber – im Gewande der Erinnerung, im Schleier der Wehmut, im Glanze des Verlorenen – erschreckt es uns weniger.«
So lagen wir lange und plauderten.
Der Abend war schön. Auf einmal war der Abend über den violetten Bergen so schön, so lauter und golden, so heiter, daß ich mich nicht erinnere, einen schöneren schon erlebt zu haben, nicht einmal einen gleichen.
Bin lachte:
»Das ist die Jugend!«
»Was?«
»Wenn man sich nicht erinnert, daß man ein Schöneres schon einmal erlebt hat, nicht einmal ein Gleiches –.«
Ich hatte mich auf die Ellbogen gestützt, um über den Fluß hinauszuschauen, und sah, was mich nicht gleichgültig ließ: ich sah die Ruhe, die bleibende Ruhe der fließenden Wellen, sah, daß die Ufer es sind, welche gleiten, die Steine am Ufer, sie stehen nicht, sie fahren wie spitze Schiffe, die sich durch die Wellen pflügen, und fahren stromaufwärts. Mit der ganzen rauschenden und kräuselnden Schleppe ihres Wellenkleides fahren sie stromaufwärts. Und die Bäume, die knorrigen, die abendliche Wiese mit den weidenden Büffeln, das Moos, wo wir liegen und rasten, sie fahren stromaufwärts – und endlich, da ich all dies gewahrte und faßte, schreckte ich auf, sprang auf die Füße.
»Bin!« rief ich, »Bin?«
Er streichelte drüben einen Büffel …
»Bin«, sagte ich, »ich glaube, es treibt uns ab. Indem wir meinen, wir bleiben am Ort, indem wir rasten und reden und weilen, treibt es uns ab –«
Bin lächelte.
»Ja«, sagte er wie aus alter Erfahrung …
Die schwarzen Büffel – in der Ferne das offene Meer, und hier, wo wir auf unserem Floße fuhren, war es eine Ebene mit endlosem Schilf, eine Wildnis mit Tümpeln und Büschen darin, mit Mücken, mit sirrenden Libellen und blühenden Seerosen – vor allem aber die schwarzen Büffel, die in den braunen Tümpeln lagen oder standen und uns anglotzten, unberechenbar in ihrer sturen Ruhe und Gewalt: auch das hatte ich schon einmal erlebt.
Wir glitten vorbei –
Zuzeiten ist mir, der Strom würde breiter und breiter, stiller auch wie reifendes Alter. Einmal müssen wir ans Meer kommen … Störche steigen empor aus dem Schilf, rauschen über unsere Köpfe und fliegen fortan in die Weite des dämmernden Abends. Und hinter uns, immer wieder, erhebt sich ein Mond, schwebt über den Wellen seiner silbernen Spiegelung. Nahe und groß, lautlos glotzt er über das klingelnde Röhricht.
Einmal müssen wir ans Meer kommen.
Wir kamen nun an den Ort, wo die Felsen aus dem Wasser steigen, bleich wie Kreide, und das Wasser grün, das spiegelnde Kloster darin, und wo der Mönch in seiner winzig kleinen Barke stand und fischte –
Es war an einem Freitag.
»Fürwahr«, sagte ich zu Bin, »er ist es!«
»Wer?«
»Ich kenne ihn an seinem lahmen Arm, an seinem schwarzen Bart. Er trägt die schwarze Kutte, die schwarze Röhre eines griechischen Popen; aber seine Füße, du wirst sehen, sie sind in Lumpen gewickelt, und es ist das Tuch von Storen, wie man sie auf noblen Fremdenschiffen hat!… Das ist der Mönch, der mir Oliven gab, lange ist’s her, und dem ich nie geschrieben habe.«
Als wir näher traten, schlug mir das Herz in den Hals. O Engel, dachte ich, laß jenen Morgen noch einmal geschehen, jenen Morgen mit den Oliven!… Es war ein Freitag, fügte ich für den Engel noch einmal hinzu, und der Engel, der ja von altersher gern in der Nähe von Fischern und Hirten weilt, mußte mich wirklich erhört haben, der Fischer hatte den Fremdling bereits bemerkt –
»Sooft«, sagte ich zu Bin, »habe ich später an ihn denken müssen, aber geschrieben, wie gesagt, habe ich ihm nie.«
Er läßt seine Netze zurück, um sich des Fremdlings anzunehmen, und stochert seine kleine und auch schiefe Barke ans Ufer. Erst rührend, dann komisch und auf die Dauer schon ärgerlich ist seine Sorge, ich könnte frieren. Denn es ist die Stunde des ersten Morgengrauens. Er kann nicht verstehen, was ein Fremdling an diesem einsamen Orte sucht; es fehlt uns die gemeinsame Sprache, damit ich mich erklären könnte, und auch dann wäre es schwer. So will er mir immerfort seine schmutzige Kutte geben, damit ich nicht friere, und das einzige, was ich sonst noch begreife: Trank und Speise wolle er mir geben. Eigentlich habe ich ein ganz anderes Ziel. Aber wenn ich den Kopf schüttle, so kränke ich ihn, und schließlich sage ich mir: Die Tempel, die heiligen, stehen jeden Tag, aber nicht an jedem Tag begegnet uns ein Mensch. So trotte ich denn hinter ihm her, halb dankbar, halb ärgerlich. Nun führt er mich wieder zurück, schaut alle paar Schritte, ob ich auch folge; es geht über Felsen hinauf. Er hat ein Liebeslächeln, wie wir es hinter Männernnicht kennen, nicht glauben ohne gemeinen Verdacht. Später sitzen wir vor seinem Kloster, denn er ist der einzige Mönch in diesen zerfallenen Mauern; die Sonne geht auf, und noch einmal, wie einst, kauen wir die ranzigen Oliven, die ihm so sichtbar munden. Es sind seine Leckerbissen; wer möchte den Kopf schütteln vor soviel Güte? Wir reden nichts, wir sitzen an der Mauer und kauen, und die Sonne steigt höher und höher, und noch einmal, wie einst, zeigt er mir die Bilder, die er in seiner Kutte verborgen hat, das verblichene Lichtbild von seiner Frau oder Braut, einer jungen und breiten Bäuerin; das andre: die schwarze Nonne, bleich, ungreifbar, byzantinisch. Er war im letzten Krieg verschollen, so vermute ich; seine Braut, treu noch im Schmerz, ging ins Kloster, und als er nach Jahren zurückkehrte, da konnte sie nicht mehr zu ihm, wollte auch nicht mehr. So ging auch er ins Kloster; man gab ihm dieses Gemäuer. Einfache Geschichte … Immer mehr Oliven mußte ich essen.
»Wer weiß«, sagte ich zu Bin, »vielleicht hat der neue Krieg ihn getötet. Bomber sind gekommen, die er sich heute überhaupt nicht vorstellen kann, Granaten, die teurer sind als seine ganze Habe, jede einzelne von ihnen. Oder er ist einfach verhungert. Sie haben seine Ziege gebraucht, zum Beispiel, und eine Granate schlug ins Wasser, nachher schwammen die Fische obenauf mit silbrigen Bäuchen. Man kann sich auch denken, wie er da droben als Partisan kämpft, eines Tages ertappt wird und erschossen, wenn er Glück hat, oder wie eine Vogelscheuche erhängt. Mitsamt seinem unwahrscheinlichen Liebeslächeln. Wer kann es wissen! Da sitzen wir an der einsamen Morgensonne, und vielleicht ist er heute ein Gefangener, arbeitet in einem grauen Lager, in einem Land, das es für ihn gar nicht gibt.«
Erst im Augenblick, da ich wieder aufbrechen will und ihm danke, verrät es ein Zufall, daß er Französisch kann, nicht viel, und auf einmal ist es möglich, daß wir sprechen. Fast ist es schade um unser Schweigen. Er ist Russe. Er hat Rußland seit dem letzten Krieg nicht mehr betreten; von Vater und Mutter, von Brüdern und Schwestern und Freunden weiß er nichts, keine Ahnung. Mit den Jahrzehnten, nur so viel weiß er, werden sie jedenfalls sterben. So lebt er einsam in diesem Gemäuer, und mehr, als ich vermuten konnte, erfahre ich auch aus seinen Worten nicht. Eine Zeitlang reiste er mit den Donkosaken, mit jenem Chor, der in den Weltstädten sang. Er erzählte es, während wir in den dunklen und feuchten Gewölben seines Klosters stehen; mit einer Kerze, die er vom Altar genommen, zeigt er mir die alten Fresken. Sie müssen wirklich sehr alt sein; sie zeigen ein Jüngstes Gericht, und wir sehen nicht allein Christus, auch Nestor, einen griechischen Poseidon mit Dreizack, die munter dabei sind. Hier unterhalten wir uns lange, und noch einmal, als ich ihn am Tor verlasse, schwöre ich im stillen, daß ich ihm später, wenn ich wieder zu Hause bin, schreiben werde … Ich schwöre es mir, während ich nachher unter dem braunen Tempel sitze, glücklich über die verzögernde Begegnung, stolz, daß ich nun endlich am Ziel bin. Ich weiß, wie schön es wäre, wenn nicht der Magenmich quälte, die Oliven, die einfach ranzig waren. Und wieder ist es im Augenblick, da ich das antike Theater betrachte, seine schwindelnden Stufen – es kommt: ich knie in die staubigen Disteln, erbreche, daß mir für eine Weile fast Sehen und Hören vergehen. Dann wische ich mich mit dem Taschentuch.
»Siehst du«, sagte ich zu Bin, »genau so war es auch damals.«
»Und das ist alles?« fragte lächelnd der Engel, der nun ebenfalls daneben stand, eher enttäuscht über die Szene, über den Aufwand an heiligen Stätten und das Ergebnis.
»Ja«, nickte ich, »das ist alles.«
»Und das hast du noch einmal erleben wollen, dafür noch einmal deine Zeit gegeben, die kurz und kürzer wird?«
»Ja.«
Bin blickte den Engel an.
»Sehen Sie«, sagte er und zuckte die Achseln, »wir haben so Erinnerungen, wir Menschen. Sie halten uns immer wieder auf; all die Jahre denkt man an irgendeinen Morgen, einen Freitag, einen Morgen mit Oliven … Sie müssen das verstehen.«
Ja, die Jugend ist schön.
Man war noch ein Jüngling … Auf einmal stand sie in der flachen Brandung einer Bucht, ihre Waden im tintenblauen Wasser. Vögel über den Felsen, Wind in den Pinien. Eine Weile blickte ich ihr zu, betroffen, beglückt, vielleicht auch ein wenig enttäuscht; all die Jahre hatte ich noch nie eine Frau gesehen, und dann, auf einmal, stand sie in einer namenlosen Bucht. Oft hielt sie ihre Hände aufs Wasser, so, als stützte sie sich, schritt wie eine Seiltänzerin gegen die schäumigen Wellen. Man hörte, wie sie auf dem Sande des flachen Ufers verklatschten. Ich wußte nicht, ob sie mich bemerkt hatte; ich ließ mich von Fels zu Fels, da und dort konnte man sich an Sträuchern halten, Disteln waren auch dabei, ich blutete, in weißen Fahnen wirbelte der Staub. Dann teilte ich die letzten Agaven: ein Sprung – bis über die Knöchel stand ich im heißen Sand, in einem weichen und trockenen Glühen, es war ein Gehen wie in bösen Träumen; um nichts in der Welt hätte man schneller laufen können. Endlich aber, als ich um den letzten Felsen trat, ebenso schüchtern wie neugierig, stand niemand mehr draußen in der grünen Brandung. Die Bucht war leer. Indessen entdeckte ich eine große eiserne Tonne, die hier auf dem einsamen Strand lag, Gott weiß woher, wieso, wozu. Sie schimmerte rostig; meerwärts war sie offen. Aber man mußte über die Knie ins Wasser, wenn man hineinwollte, und das wollte ich natürlich. Schon draußen hörte man, wie das Meer mit seinen Wellen hineinlallte, gegen die Wandungen platschte. Ich zweifelte nicht daran, daß die nackte Frau nur in dieser Tonne sein konnte, und mir schlug natürlich, jung wie ich war, das Herz in den Hals, als ich endlich vor der runden Öffnung stand. Hinter mir rauschte das offene Meer; es tönte wie eine Muschel am Ohr, wo man das eigene Blut hört. Man mußte sich dukken, wenn man in die rostige Tonne eintreten wollte; es war wohl ein Tank für Benzin, stammte von einem Schiff. Und vor mir war es nun dunkel, so daß man, eben noch von der Sonne und tausend Wellen geblendet, kaum etwas sehen konnte. Wie ein gefangenes Tier stand sie zuhinterst in ihrem Versteck, blickte gegen die grüne Helle, gegen den ebenso frechen wie verdutzten Eindringling. Ihr Haar war schwarz wie Pech, offen, naß, so daß es glänzte; sie grinste mit weißen Zähnen. Auch sie stand im lallenden Wasser, barfuß. Ihre Arme, ihre Schultern waren bloß, glänzend vor Nässe, sonst hatte sie ihr Kleid bereits wieder umgenommen, ein lumpiges und fetziges Zeug, so gut es in der Angst und Eile gelungen war … Natürlich fand ich es schade, jedesmal, sooft ich jene rostige Tonne, die nun einmal am Strande der Erinnerung liegt, auch in späteren Jahren wieder betrat. Man weiß, wie es war, und dennoch kann man es nicht lassen, jedesmal wieder hineinzugucken –
Bin wartete drüben an der Straße, als wäre nichts geschehen. Es war ja auch nichts geschehen. Er hockte auf einem Meilenstein, futterte Beeren aus der kleinen Schüssel seiner hohlen Hand, und es war Morgen, die Sonne stand wie eine goldene Garbe über dem braunen Land.
Ich sagte:
»Hast du den Adler gesehen – vorhin?«
Bin, wortlos, schüttete sich den letzten Segen in den Mund, indem er nach Bubenart unter den Handrücken schlug, so daß ihm die Beeren in den offenen Gaumen flogen; dann klatschte er sich die Hände, erhob sich und sagte:
»Gehen wir?«
Noch immer habe ich Rapunzel, meiner Frau, keine Karte geschrieben … Gewiß: noch sind wir auch nicht in Peking.
Einmal sitzen wir in einer Pinte am Gassenrand.
»Es ist komisch«, sagte ich –
»Was?«
»Wenn wir nicht wissen, wie die Dinge des Lebens zusammenhängen, so sagen wir immer: zuerst, dann, später. Der Ort im Kalender! Ein anderes wäre natürlich der Ort in unserem Herzen, und dort können Dinge, die Jahrtausende auseinanderliegen, zusammengehören, sich gar am nächsten sein, während vielleicht ein Gestern und Heute, ja sogar die Ereignisse eines gleichen Atemzuges einander nie begegnen. Jeder weiß das. Jeder erfährt das. Ein ganzes Weltall von Leere ist zwischen ihnen. Man müßte erzählen können, so wie man wirklich erlebt.«
»Und wie erlebt man?«
»Du hast es selber gesagt: daß Dinge, die wir für Erinnerung halten, Gegenwart sind. Ich hatte noch nie darüber gedacht, ich fühlte nur öfter und öfter, daß die Zeit, die unser Erleben nach Stunden erfaßt, nicht stimmt; sie ist eine ordnende Täuschung des Verstandes, ein zwanghaftes Bild, dem durchaus keine seelische Wirklichkeit entspricht. Wer es wüßte, wie die Träume ineinander wurzeln, auseinander wachsen!«
»Was, meinst du, hätte er gewonnen?«
»Er hätte noch viel zu erzählen, denke ich, fast alles –«
Wir saßen in einer Pinte am Gassenrand, wie gesagt … Noch war das nicht Peking, wir fanden die Häuser aus der Nähe so klein, so winzig und spielzeughaft, daß man sich an der Dachtraufe, was es in diesen Landen allerdings nicht gibt, hätte halten können und Mühe hatte, sie ernst zu nehmen.
»Hergott«, murrte Bin, »ihr Lebenden mit eurem Ernst ohne Maßstab!…«
Ein Mädchen brachte uns Wein.
Wie anders ist die Luft hier! Sie tönt. Sie tönt wie ein Spinett, so drahtig, so kindlich spröde, und die Töne laufen auf gläsernen Stelzen; ein Windstoß scherbelt sie weg – dann, hinten herum, kichert es wie Mädchenlachen.
»Trinken wir!« meinte Bin.
»Die Zeit ist ein sonderbar Ding!« sagte ich. »Einmal habe ich eine Liebe verloren. Lange ist’s her. Aber es hört nicht auf, daß ich sie verloren habe.«
»Was ist denn Schlimmes dabei?«
»Schlimm?« versetzte ich, besann mich und nahm einen Schluck. »Seit ich eine von ihnen verloren habe, dünkt es mich, ich liebe sie alle. Ich möchte sie immer noch einmal verlieren, verstehst du? Maja hieß sie, ein liebes Mädchen. Lange ist’s her! Aber es hört nicht auf, daß ich sie verloren habe –«
Trinken wir!
Ein wenig reute mich stets die Zeit. Ich hatte in der Folge dieser inneren Unrast auch schon ein zweites, drittes oder viertes Glas gekippt, während Bin noch immer über seinem ersten saß. Vielleicht war es eine Spelunke, wo wir uns befanden. Goldfische schwammen in einemgrünen Glas, und wenn man mit dem Finger daran klopfte, schossen sie weg; dann wieder schwebten sie über einem winzigen Urwald, schnauften mit ihren lautlosen Kiemen, ließen hin und wieder ein Bläschen an die Oberfläche steigen, eine Perle, die einen Augenblick auf dem Wasser schwamm und dann verging. So verbrachten sie den Tag. Manchmal zuckten sie auch mit dem Schwanz, der so dünn war, daß das Licht ihn durchschimmerte, und stießen in die Tiefe, wo es Sand und leere Muscheln gab, oder sie drückten wieder ihre roten Nasen ans Glas und schauten sich die Leute an. Diese hockten auf einer Art von Matten, hielten ihre langen irdenen Pfeifen am Mund und träumten in die bläuliche Dämmerung, lächelnd, oder sie schauten auch ihrerseits wieder den Goldfischen zu. Sicher war das eine Spelunke.
Mit dem Witz eines Mannes, der seine paar Bücher gelesen, vermutete ich sofort das Falsche; es waren nicht Päpste, nicht einmal Pfarrer, die wir an diesem dämmerigen Orte ertappten, keine Biedermänner und Staatsräte, nicht einmal Lehrer, die hier, jenseits der chinesischen Mauer, ihrem unterdrückten Triebe frönten … Ich kannte nur einen, und ich kannte ihn als Jüngling, der sich rühmen durfte, daß er noch nie einen solchen Ort betreten hatte. Nunmehr ein Mann, der seinen Bart hatte wie graue Flechten an einer Bergföhre, saß er drüben in der Nische; er schien im Gespräch mit dem Heiligen, den wir schon einmal getroffen hatten. Der Heilige aus braunem Sandstein, der eben das Mädchen namens Pfirsichblüte auf den Knien trug, lächelte wie immer und sagte: »Da haben Sie nicht wohl getan, mein Freund. Da haben Sie nicht wohl getan.«
Das Mädchen namens Pfirsichblüte lachte ebenfalls, legte ihre schmalen und duftenden Hände in den Schoß und ließ sich die Glocke ihres kupfernen Haares in den Nacken hängen. Natürlich war das eine Kurtisane.
»Ich verstehe nicht«, sagte unser Freund, »ich verstehe nicht: Ihr nennt es einen Tempel, ich aber sehe an allen Wänden die unverschämtesten Bilder der Unzucht, die Lokkung der Sinne –«
»Warum nicht?«
Die Pfirsichblüte lachte.
»Es ist ein Tempel für die Dummen«, sagte der Heilige mit dem Lächeln, »aus der Erde sind wir gemacht. Wie aber, wennwir die irdische Dummheit nicht leben, sondern aufsparen und aufsparen, wie wollen Sie denn jemals ein Weiser werden? Wer seine Erde nicht dem Feuer gibt, das sie verbrennt, wie sollte jemals ein Geist aus ihm werden? Passen Sie auf, mein Freund: Sie sterben als Erde.«
So redete der Heilige, wie wir ihn nun einmal nannten, und wieder scherzte er mit dem Mädchen namens Pfirsichblüte, das eine Kurtisane war und nackt auf seinen Knien saß. »Mir scheint«, sagte ich zu Bin, »das ist ein merkwürdiger Ort. Kennst du den Mann, der in der Nische hinter uns sitzt?«
»Hinter uns –«
»Aber schau nicht hin. Es ist Anastasius Holder, der Maler, der vor kurzem gestorben ist …«
Ich hatte ihn einmal in einer Berghütte getroffen. Er stand am Hüttenherd, damals, zerquetschte die Suppenwürfel zwischen den Fingern, als ich ihn plötzlich erkannte, und schon hatte ich mich erheben wollen, ihn zu begrüßen. Gott weiß, warum ich es damals nicht tat. Einen Augenblick zögerte ich, dann wurde es immer heikler, bewußter. Hemmungen, Zweifel! Ich hätte ja sagen können: Herr Holder, ich nehme es wenigstens an, daß Sie es sind, Sie haben einmal ein kleines Aquarell gemacht, das hat mir über die Maßen gefallen; vielleicht freut es Sie, das zu hören –
Und da er mich anblicken würde:
Später habe ich es sogar gekauft, das einzige übrigens, was ich je von einem Lebenden gekauft habe. Nämlich: es hatte einen Knick bekommen in der Mappe, wo es auflag, ich bekam es für dreißig Franken. Heute noch hängt es in meiner Bude, denken Sie, es ist mir noch immer nicht verleidet!
Anastasius Holder, so dürfen wir annehmen, hätte darüber seine Suppe nicht anbrennen lassen; ein wenig hätte es ihn gefreut, ein wenig geärgert, ein wenig hätte er gelacht, und dann, glaube ich, hätten wir über den Neuschnee geplaudert und zusammen verzehrt, was jeder in seinem Rucksack hatte. Er hätte natürlich bald gemerkt, daß ich nichts von Malerei verstehe. Ein anderes ist die Mitfreude, wenn wir vor einem Bilde stehen und etwa sagen: Ja, so habe ich es auch schon erlebt! Wir loben, aber wir loben die Schöpfung schlechthin, nicht ihn, sondern die Wolken am wirklichen Himmel, das Leben in den eigenen Adern, das Meer, die Frauen, den lieben Gott. Das ist die Mitfreude, vielleicht das Beste, was einem Künstler begegnen kann. Denn da erst, wo wir so Unmittelbares nicht empfinden, rühmen wir ihn selber, seine Art, die Farbe aufzutragen …
Indessen geschah überhaupt nichts, damals in der Berghütte, denn ich brachte es nicht über mich, ihn anzusprechen, ungewiß, wie er es aufnehmenmöchte, und weil man immer Angst hat, es könnte peinlich sein. Nichts zu sagen, das war sichrer. Und so saß man denn da, jeder gabelte in seiner Büchse herum, und Holder, der das Aquarell gemalt hat, brockte Brot in seine dampfende Suppe, schmatzte, daß ich in der Folge nichts anderes mehr hören oder denken konnte. Am folgenden Tag schneite es. Auch Holder blieb den ganzen Tag in der Hütte, einmal redeten wir über das Wetter, er spaltete Holz, ich holte das Wasser am Gletscher. Er war, aus der sogenannten Nähe gesehen, ein ziemlich grober Mensch, der sich mit dem Handrücken schneuzte, und ein wenig schämte ich mich vor ihm selber über sein zartes, innig verträumtes, beinahe frommes und kindliches Aquarell; ich glaubte es ihm immer weniger. Er roch aus dem Mund. Fast aus Teufelei sagte ich einmal, als wir an den Pfosten der offenen Türe lehnten und die abendlichen Wolken sich röteten: Das sollte man malen! Es war Kitsch, und ich blickte nun Holder von der Seite an. Er stocherte mit einem Span zwischen den Zähnen. Malen? sagte er, indem er ausspuckte: Berge und Weiber sind da, damit man sie genießt, Malen ist sowieso ein Blödsinn! Am anderen Tag war er aufgebrochen, obschon der Nebel nicht nachlassen wollte, und unweit der Hütte, wie ich später aus der Zeitung erfuhr, zu Tode gestürzt.
Seither habe ich ihn natürlich nie wieder gesehen … Jetzt, als ich mich endlich erhebe und auf ihn zutrete, fühle ich eine Erregung, eine Schwäche in den Knien, als gehe es um das Ungeheuerste; ich sage ihm, was ich ihm schon damals, zu Lebzeiten, hätte sagen können:
»Ich habe eine Skizze von Ihnen sehr gern, ein Aquarell, nichts Großes –«
Holder sitzt in der Nische, so, als höre er nichts, obschon ich es mehr als einmal sage, jedesmal lauter; er sieht den stummen Fischlein zu, die an der grünen Scheibe schweben, mit ihren Kiemen atmen.
»Er ist tot«, sagt Bin.
»Ich weiß.«
»Er hört dich nicht.«
»Warum hören sich denn alle andern?«
Holder hockte so grenzenlos allein an diesem Ort; ich habe ihn immer für ziemlich berühmt gehalten, Anastasius Holder, und wäre es auch nur, weil ich seinen Namen auf einem Plakat gesehen habe.
»Wahrscheinlich sind es Freunde gewesen«, sagte Bin, »darum hören sie einander – die haben sich schon im Leben drüben gehört.«
Ich kniete vor Holder.
»Komm jetzt!« sagte Bin.
Ich redete zu Holder:
»Deine Bestattung, verehrter Freund, war scheußlich. Wir waren gekommen, in Trauer erschrocken, wir sahen einen Sarg und wußten nicht, was wir tun sollten. Überhaupt nichts. Wir waren nur Zuhörer, verstehst du, Zaungäste, wir standen da und blickten uns um, zu sehen, wer alles gekommenwäre, die meisten in schwarz, und ein Pfarrer, der gerade das Amt hatte, hielt einen Vortrag, einen möglichst passenden Vortrag, einen sehr menschlichen Vortrag. Man konnte ihn gut finden oder nicht. Es waren Meinungen eines Menschen, unserem Urteil unterworfen. Und nachher haben sie dich verbrannt, aber es gab keine Flamme, die zum Himmel schlug. Sie machten es mit bloßer Hitze, unsichtbar und sauber, ganz ohne Rauch, und auch dazu konnten wir nichts handeln, nichts tun, nichts beitragen. Unsere Trauer war an diesem Ort, der eine Kirche vorstellte, überflüssig. Ich sehe noch das hilflose Muster an der Decke, das ich die ganze Zeit ansah, während ich dachte: Unter Negern wäre das anders, ganz zu schweigen von alten Griechen, von Chinesen! Unter wirklichen Menschen, unter schöpferischen Völkern wäre das anders –«
Später, als wir die sonderbare Spelunke mit Kurtisanen und Goldfischen, mit Heiligen und Toten verlassen wollten, erschien noch ein ganzes Rudel von Matrosen. Die Nähe des Meeres! Ich sagte mir, das sei nicht verwunderlich. Sie setzten sich rittlings über die Sessel, laut, jugendlich, übermütig, tranken über die Lehne, und andere tanzten, bald war es ein tolles Gewimmel. Der Heilige lächelte wie immer. Man hat ihn nie anders gesehen. Schon weil er aus Stein ist.
»Bin«, flüsterte ich, »ich glaube, das ist sie.«
»Wer so?«
Ich konnte meinen Blick nicht wieder von ihr lösen. Ihre liebe Gestalt, ihre wirbelnden Füße, ihr seliges Lachen. Sie tanzte mit fliegendem Haar, jung, ganz erstaunlich jung; sie flog wie ein Kreisel. Und bald war es das einzige Paar, das noch tanzte. Denn alle schauten zu, so herrlich konnten sie es, die beiden. Der blaue Matrose, lang wie er war, mußte auf eine possierliche Weise sich ducken, um sie mit Anstand halten zu können; so klein war sie, so jung. Sein Bändel flog in der Luft, und zwischen den beiden war Raum, um den sie tanzten, das Mädchen mit flatterndem Röcklein, aber sie blickte den Matrosen nicht an, sie kreiselte und tanzte und wirbelte wie eine Bacchantin; auf ihrem Antlitz – mitten im Taumel und Lärm, denn der Matrose stampfte nun mit seinem Stiefel, und alle anderen sangen mit erhobenen Bechern – lag eine kindliche, eine trunkene, eine strahlende Ruhe.
»Nun glaube ich wirklich«, sagte ich abermals, »das ist sie!«
»Aber wer denn?«
»Maja –«
Ohne von ihr wegzublicken, indem ich redete, erzählte ich die Geschichte, die keine war. Oh, es war mehr! Es war das erstemal. Ich suche sie seit Jahr und Tag, und solange ein Gedächtnis in mir lebt, und einst, wenn ich auf dem Totenbett liege –
»Herr«, sagte sie, trat auf mich zu, und die Matrosen brüllten vor Lachen, denn ich wurde wohl rot, »warum sehen der Herr mich so an?«
Ich hörte mich sagen:
»Weil du wohl schön bist.«
»So tanzen wir!«
Sie hatte recht. Und wir tanzten, und es wurde mir, als hätte ich noch nie eine Mädchenhand in der meinen gespürt, noch nie geküßt. Was für ein Reich lag also noch vor mir! Ich hielt sie gar weit von mir. Um nicht zu küssen. Es mußte ein Schauer sein, ein Anfang, ein Ende, ein Meer von Wonne, ja, ich hatte füglich Angst, mir käme das Heulen, wenn ich sie küßte, und nachher würde ich hinausgehen und mich erhängen. Weil es das nie wieder gab. Sie tanzte wie vorher; ihr Kleidchen stieg wie eine Scheibe um sie, flog, alles flog und alles drehte, auf ihrem Antlitz aber lag eine strahlende Ruhe. Ich glaube, die Musik war lange schon zu Ende; ich aber stand noch immer … Ja, denke ich, das ist ihre Wange. Das ist der Flaum ihrer Schläfe. Ich sah auch die kindliche Feuchte ihrer Lippen. Ihre Augen! sie waren wie ein früher Morgen, man ging wie in die Stille eines Waldes hinein. Ihre Zähne, denke ich, man möchte sie noch einmal haben, um in einen saftenden Apfel zu beißen, so daß es knallt, und nachher sterben … Endlich, wie am Ärmel gezupft von meinem eigenen Verstande, verbeugte ich mich, sagte Dank, und auch sie machte einen höflichen Knicks, und die Matrosen lachten.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: