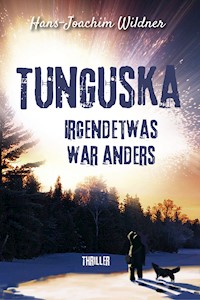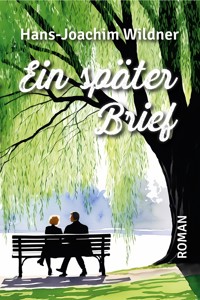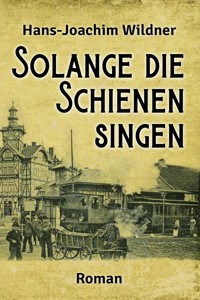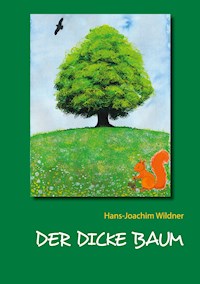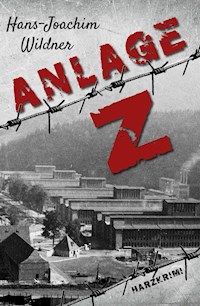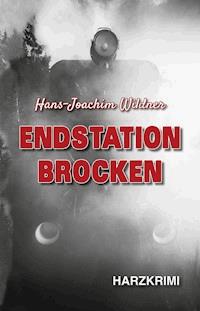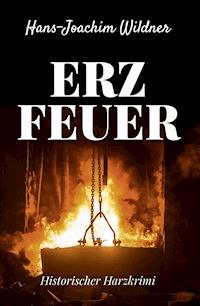
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elektronik-Praktiker
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Nacht des 18. Oktober 1833 verschwindet auf der Königshütte der Ofenmeister Hans Röger. Seine Leiche wird in einem Wasserradschacht gefunden. Er wurde grausam ermordet. Der geistig zurückgebliebene Otto Wiegand gerät in Verdacht und wird in eine Irrenanstalt eingewiesen. Die Familie steht vor dem Abgrund. Ottos Bruder Karl ist Bergmann in der Knollengrube. Er ist begabt und träumt davon, als Kunstmeister auf der Königshütte zu arbeiten. Als er sich in Johanna, die Tochter des Ermordeten verliebt, gerät seine Welt aus den Fugen. Johanna ist durch den Tod ihres Vaters mittellos und muss Lauterberg verlassen. Als Karls kleine Schwester Clara an Lungenentzündung erkrankt, geht er nach Clausthal, um eine Heilerin um Hilfe zu bitten. Zufällig läuft ihm dort Johanna über den Weg. Als sie ihm von einem weiteren Mord und einem verschollenen Familienerbe erzählt, wird Karl sofort klar: Sie soll das nächste Opfer sein. Er muss sie beschützen, aber zu Hause ringt seine Schwester mit dem Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erzfeuer
Historischer Harzkrimi
Copyright © 2018 by Hans-Joachim Wildner
ePub Edition, Version 1.0, 08/2018
ISBN 978-3-947167-23-4
ABBILDUNGSNACHWEISE:
Umschlag © shestakov15 | # 91530748 | depositphotos.com
Fotos Königshütte/Knollengrube © Monika Wildner
Porträt Autor © Ania Schulz | as-fotografie.com
LEKTORAT:
Sascha Exner
DRUCK:
Frick Kreativbüro & Onlinedruckerei e.K., Krumbach
VERLAG:
EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 1163 · 37104 Duderstadt · Deutschland
Fon: +49 (0)5527/8405-0 · Fax: +49 (0)5527/8405-21
E-Mail: [email protected]
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorwort
Die letzte Schicht der Knollengrube wurde im Jahr 1925 aufgefahren. Das Zechenhaus, das neben dem Mundloch des Luttertalstollens stand, hatte keine Bestimmung mehr und wurde auktioniert. Mein Großvater Karl Räkel und sein Schulfreund August Harms haben 1936 dieses Haus ersteigert, es vom Dach bis zum Fundament sorgsam abgebaut und das Material mit einem Pferdefuhrwerk in die Lauterberger Aue transportiert. In der Uferstraße haben sie daraus ein Doppelhaus gebaut, in dem ich geboren wurde und meine Kindheit verbracht habe. Eine Doppelhaushälfte gehört heute mir und ich freue mich, dass sich noch immer eine Familie darin wohlfühlt.
Mit der Königshütte verbunden sind Kindheitserinnerungen an meinen Vater Georg Wildner, der in den Fünfzigerjahren dort als Gussputzer sein Geld verdiente. Ich sehe ihn noch lächelnd vor mir, verschmutzt vom schwarzen Formsand und Kohlenstaub, wie er mittags meine Mutter und mich vor der Hüttenschenke erwartete. Sie hatte mich oft mit dem Fahrrad mitgenommen, um ihm im Henkeltopf warmes Essen zu bringen.
Noch immer höre ich den längst verklungenen Glockenschlag der Hüttenuhr am Giebel des Formhauses, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Der Ton mit seinem unverwechselbaren Echo klingt mir heute noch im Ohr, und mit dem plätschernden Brunnen inmitten des Platzes scheint die Zeit stillzustehen.
Bad Lauterberg, im April 2018
Hans-Joachim Wildner
Mit der Königshütte und der Knollengrube eng verknüpft sind Erinnerungen an meinen Vater, Georg Wildner, und an meinen Großvater, Karl Räkel. In Dankbarkeit widme ich beiden dieses Buch.
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Vorwort
Freitagnacht, 18. Oktober 1833 - Auf der Königshütte
Freitagmorgen, 18. Oktober 1833 - Auf dem Weg zur Knollengrube
Freitag, 18. Oktober 1833 - Lauterberg, Ellernstraße
Freitag, 18. Oktober 1833 - Luttertal, Knollengrube
Freitag, 18. Oktober 1833 - Lauterberg, Polizeistation
Freitagabend, 18. Oktober 1833 - Schichtende in der Knollengrube
Freitag, 18. Oktober 1833 - Lauterberg, Friedhof
Samstagmorgen, 19. Oktober 1833 - Lauterberg, auf dem Wochenmarkt
Samstagnacht, 19. Oktober 1833 - Auf der Königshütte
Sonntag, 20. Oktober 1833 - Lauterberg, Ellernstraße
Montagmorgen, 21. Oktober 1833 - Luttertal, Knollengrube
Dienstagvormittag, 22. Oktober 1833 - Auf der Königshütte
Dienstag, 22. Oktober 1833 - Lauterberg, Polizeistation
Sonntag, 27. Oktober 1833 - Lauterberg, Andreaskirche
Montag, 28. Oktober 1833 - Knollengrube und später Königshütte
Mittwoch, 30. Oktober 1833 - Auf dem Weg nach Clausthal
Sonntag, 3. November 1833 - In Clausthal
Sonnabend, 2. November 1833 - Lauterberg, Andreaskirche
Sonntag, 3. November 1833 - Lauterberg, Ellernstraße
Mittwoch, 6. November 1833 - Auf der Königshütte
Montag, 11. November 1833 - Auf der Königshütte
Dienstag, 10. Dezember 1833 - Lauterberg, Unter den Linden
Zweiter Weihnachtstag 1833 - Lauterberg, Hüttenweg
Freitag, 10. Januar 1834 - Lauterberg, Pfarrhaus
Donnerstag, 23. Januar 1834 - Auf der Königshütte
Am Abend bei Pastor Gerstacker
Sonntag, 2. Februar 1834 - Lauterberg, Hauptstraße
Montag, 17. März 1834 - Auf der Königshütte
Zwei Tage später
Mittwoch, 19. März 1834 - Auf der Königshütte
Mittwoch, 19. März 1834 - Lauterberg, in der Aue
Donnerstag, 20. März 1834 - Auf dem Weg nach Göttingen
Freitag, 21. März 1834 - Göttingen
Sonntag, 23. März 1834
Sonntag, 23. März 1834 - Clausthal, Büttnerstraße
Montag, 24. März 1834 - Clausthal
Montag, 24. März 1834 - Clausthal, Büttnerstraße
Dienstag, 25. März 1834 - Clausthal
Mittwoch, 26. März 1834 - Clausthal
Donnerstag, 27. März 1834 - Clausthal
Donnerstag, 27. März 1834 - Zurück in Lauterberg
Sonntag, 30. März 1834 - Lauterberg, im Hüttenweg
Montag, 31. März 1834
Dienstag, 1. April 1834
Dienstag, 1. April 1834, früher Abend - Lauterberg, Pfarrhaus
Mittwoch, 16. April 1834 - Scharzfels, Neuer Hof
Sonnabend, 19. April 1834 - Lauterberg, Hüttenweg
Dienstag, 22. April 1834 - Lauterberg, im Kummelweg
Donnerstag, 24. April 1834 - Auf der Königshütte
Heute - Auf der Königshütte
Danksagung
Über den Autor
Weitere Harzkrimis
Freitagnacht, 18. Oktober 1833
Auf der Königshütte
Die Hitze traf sein Gesicht wie Nadelstiche. Hans Röger drehte den Kopf schützend zur Seite, als er sich der Abstichöffnung des Hochofens näherte, um die ungewöhnlichen Geräusche besser hören zu können. Irgendetwas stimmte nicht. Das dumpfe Fauchen des Feuers klang anders als sonst.
Hans kannte die Stimmen der Hütte, das Hämmern der Pochstempel1, das rhythmische Schnaufen des Gebläses und das gleichmäßige Planschen der Wasserräder im Hintergrund, schließlich arbeitete er länger als zwanzig Jahre hier. Er kannte auch das Geräusch der verglühenden Holzkohle und das Schmelzen des Erzes im Schacht des Ofens, aber dieses Brummen hatte er noch nie gehört. Erst vor Kurzem war er zum Ersten Schmelzer befördert worden und wusste dieses ungewohnte Geräusch im Hochofen nicht genau zu deuten. Der Ofen war fällig zum Abstich2, und nun das. »Mist«, fluchte er laut vor sich hin. Beim Abstich um Mitternacht durfte keine Panne passieren. Gerade jetzt nicht, wo er sich noch bewähren musste. Verdammt, was ist da los?, dachte er. Ludwig Rathmann, der Hüttenmeister, würde ihn in den Boden stampfen, wenn etwas schief liefe. Er trat einige Schritte aus der Hitze heraus und blickte sich in der Halle um.
»Paul«, rief er gegen den Lärm der Gießhalle an. Paul Engelmann, den alle Eisenkocher nannten, stand an der Frischesse3 und stieß mit einer Eisenstange die Schlackenkruste von der glühenden Massel4. »Paul!« Hans winkte seinen Kameraden zu sich. Der Eisenkocher horchte auf, stellte die Stange zur Seite und kam herüber. Paul hatte ebenfalls als Pochknabe auf der Hütte angefangen und kannte sich aus. »Hörst du das auch?«, fragte Hans Röger.
Paul stellte sich dicht an den Ofen und lauschte. »Was soll ich hören?«
»Ich finde, der Ofen klingt anders als sonst. Was meinst du?«, erkundigte sich Hans.
»Wahrscheinlich hat sich eine Schichtung hart gemacht«, vermutete der Eisenkocher. »Kein Wunder, die Kohle, die in letzter Zeit geliefert wird, taugt nicht viel. Sie ist zu kleinstückig und brüchig. Aber die Herren Beamten interessiert nur der Preis«, schimpfte er auf die Hüttenleitung.
»Ja, ja«, stimmte Hans zu, »die müssen auch nicht in den Ofen reinkriechen und die Drecksarbeit machen.« Hans drehte sich um und ging auf die Treppe zu, die zur Gichtbühne hinauf führte. »Ich geh mal nach oben und seh nach, was ich machen kann«, rief er seinem Kameraden zu.
»Du kannst nur versuchen, mit der Lanze nachzustochern, aber beeil dich, wenn Georg das mitkriegt, gibt`s ein Donnerwetter«, rief ihm Paul hinterher. Georg Töpfer war Gießer auf der Hütte und für den Abstich verantwortlich. Sein Handwerkzeug hütete er wie einen Schatz, und wehe dem, der sich daran vergriff.
Hans schnappte sich das Werkzeug mit der Eisenspitze auf dem langen Holzstiel und eilte die Treppe zur Möllerbühne5 hinauf, die fast acht Meter über dem Hallenboden lag. Hier befand sich der Arbeitsplatz von Gottfried Mehmke, der als Erster Vorläufer6 für die Beschickung des Hochofens verantwortlich war. Mehmke, ein untersetzter Mann mit Halbglatze, war einer der Dienstältesten auf der Hütte und kannte sich überall aus. Deswegen schätzte ihn der Hüttenmeister, die Kameraden allerdings weniger, der finsteren Miene wegen, die seine alltägliche Übellaunigkeit widerspiegelte. Die meisten gingen ihm besser aus dem Weg.
Hans fand die Bühne verlassen vor. »Verflixt, wo stecken diese Strolche?«, fluchte er laut vor sich hin. Körbe, Schaufeln und allerhand Werkzeuge lagen herum, als wären sie nutzlos geworden. Dicker Qualm stieg im Atemrhythmus des Gebläses aus der Schachtöffnung und verschwand seitlich im Sog des Kamins. Es roch schwefelig nach verglühender Holzkohle. Hans Röger lief die Bühne ab und hielt nach Gottfried Mehmke Ausschau. Er konnte ihn nirgends entdecken und wollte gerade wieder nach unten gehen, als sich plötzlich eine Gestalt aus dem Dunkel des angrenzenden Kohlenschuppens herauslöste. Hans fuhr leicht zusammen, erkannte aber im selben Moment seinen Kameraden Otto Wiegand. Groß, breitschultrig und mit schlürfendem Schritt kam er auf Hans zu.
»Otto!«, rief Hans erleichtert. »Hast du mich erschreckt.«
Otto Wiegand betrat die spärlich beleuchtete Bühne und sah Hans staunend an. Seine Augen leuchteten wie weiße Kreise in seinem verrußten Gesicht. Er war gut einen Kopf größer als Hans und von kräftiger Statur. »Ha ... Hans, wollte ich nicht«, entschuldigte er sich stotternd und lächelte breit, dass seine ungleichmäßigen und lückenhaften Zähne sichtbar wurden. Otto war nicht gerade mit Geistesgaben gesegnet. Manche meinten, er sei reif fürs Irrenhaus. Aber die einfachen Arbeiten, die man ihm zuwies, machte er gewissenhaft und ohne zu murren. Wegen seiner Hilfsbereitschaft mochten ihn die Kameraden. Manche nutzten seine Gutmütigkeit auch aus.
»Was treibt ihr euch rum, verdammt! Wo ist Gottfried?«, blaffte er Otto an.
Otto sah ihm eine Weile in die Augen, so, als hätte er die Frage nicht verstanden, aber Hans kannte Otto und wusste, dass es in seinem Kopf arbeitete, was bei ihm etwas länger dauerte. »Da im Schuppen.« Er zeigte mit ausgestrecktem Arm ins Dunkel des angrenzenden Gebäudes, in dem Holzkohle und Erz gebunkert wurden, dann schlurfte er weiter zum Ausgang.
»Wo willst du hin? Du weißt, dass du die Bühne nicht verlassen darfst!«, wies Hans ihn zurecht, der sein Vorgesetzter war.
»Ich – ich muss mal«, sagte Otto und lief weiter.
»Zum Kuckuck, du Schnarchnase! Mach hin, ich brauche dich gleich hier«, schimpfte Hans hinter ihm her und ging rüber zum Schuppen. Er musste im Eingang einen Moment warten, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Der Kohlenschuppen wurde nicht beleuchtet, wegen der Brandgefahr waren offene Flammen streng verboten.
»Gottfried, wo steckst du?«, rief Hans in die Dunkelheit. Er bekam keine Antwort. »Gottfried!« Nichts rührte sich. Nur die Wasserräder planschten im gleichmäßigen Rhythmus aus den Räderschächten, und der Ofen fauchte wie ein schlafender Drachen. Hans ging ein Stück weiter hinein, bis er vor einer steilen Wand des aufgeschütteten Kohlenhaufens stand. Diese Steilwände, die aussahen, als hätte man von einem Kegel ein senkrechtes Stück abgeschnitten, entstanden beim Abschaufeln der Kohle. Das sollte vermieden werden, dazu gab es eine klare Anweisung. Diese Wände konnten plötzlich in sich zusammenbrechen und Arbeiter unter sich begraben. Hans ärgerte sich über Gottfried, der die Vorschrift kennen musste. »Gottfried!«, rief er jetzt energisch. Er bekam keine Antwort. Plötzlich riss ihm jemand von hinten die Lanze aus der Hand. Hans drehte sich erschrocken um und sah den Schatten einer Gestalt vor sich. »Gott ... Nein!« Das waren die letzten Worte, die Hans hervorbrachte.
*
»Wo ist die verdammte Lanze? Wir müssen dringend den Ofen abstechen«, schnauzte Georg Töpfer durch die Halle. Alle, die ihn gehört hatten, schauten zu ihm rüber und zuckten mit den Schultern. »Das gibt`s doch nicht«, maulte er vor sich hin. Dann sah er Paul Engelmann, der an der Frischesse stand, und ging zu ihm. »Paul! Hast du die Stichlanze weggenommen?«
Paul Engelmann wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. »Was sollte ich mit dem Ding? Hans wollte damit nach oben und die Schichtung im Ofen lockern«, erklärte er.
»Himmel! Muss man denn hier alles festnageln? Wenn ich den zu fassen kriege, kann er sich warm anziehen«, schimpfte er und lief wütend die Treppe zur Bühne hinauf. Gottfried Mehmke stand mit der Schubkarre vor der Gichtöffnung und kippte die Ladung Möller7 in den Schacht. Staub wirbelte auf und zog in den Kamin. Otto Wiegand schaufelte aus einem Holzverschlag Kohle in eine Karre.
»Gottfried hast du Hans gesehen?«, rief Georg ihm noch auf der Treppe stehend zu. Mehmke kam näher heran und schob die leere Karre mit einem schwungvollen Stoß vor den Verschlag mit dem Erzvorrat. Er antwortete nicht. »Gottfried?«, setzte Georg Töpfer ärgerlich nach. Gottfried Mehmke sah ihn mit sturem Blick an, als wäre ihm gerade der Teufel begegnet. »Krieg ich nun eine Antwort?«, knurrte Georg ihn an.
»Ich hab August gesucht. Der muss die Möllerkarre reparieren, die ist schon wieder kaputt«, fauchte Mehmke zurück. Er stand da und hielt krampfhaft seine Hände fest.
»Quatsch nicht rum. Wo ist Hans? Wir müssen abstechen«, gab Georg scharf zurück und wunderte sich über Gottfrieds zittrigen Hände. Er antwortete nicht. »Gottfried, bist du ...?«
Gottfried Mehmke schnitt Georg das Wort ab. »Was ist denn noch?«, blaffte er ihn an.
»Du zitterst, fühlst du dich krank?«, fragte Georg Töpfer besorgt.
Gottfried warf ihm einen bissigen Blick zu. »Was denkst du? Draußen ist es kalt, und außerdem, was geht das dich an?«
»Dann zieh dir die Jacke über«, riet Georg.
»Hau endlich ab und lass mich meine Arbeit machen«, brüllte er außer sich.
Was ist nur mit dem los?, fragte sich Georg. Grämte es ihn immer noch, nicht selbst zum Ersten Schmelzer ernannt worden zu sein, was ihn derart aufbrachte? »Lass deinen Frust nicht an den Kameraden aus«, entgegnete er.
»Du solltest besser den Ofen abstechen, bevor Rathmann erfährt, dass die Schmelze schon überläuft«, drohte er unterschwellig.
»Willst du mich bei ihm anschwärzen? Nur zu, wirst schon sehen, was du davon hast«, konterte Georg.
»Hau ab und lass mich in Ruhe«, fauchte er verächtlich und drehte sich zur Seite.
Georg wandte sich an Otto, der mit offenem Mund dastand und dem Gespräch zugehört hatte. »Otto, weißt du, wo Hans sein könnte? Denk mal nach, auch wenn es dir schwerfällt«, fragte Georg.
»W ... Weiß nicht. Da ist einer zum kalten Born raufgegangen«, stotterte er und blickte dabei Hilfe suchend zu Gottfried.
»Hans? Zum kalten Born?«, fragte Georg nach.
»W ... weiß nicht«, antwortete Otto.
Gottfried tippte sich an die Stirn. »Da hörst du`s. Der hat nur Stroh im Kopf.« Er winkte mit einer abfälligen Handbewegung ab. »Weiß der Kuckuck, wo Hans steckt.« Mehmke hob die Schultern und bemerkte beiläufig: »Wie kann man so einen unzuverlässigen Mann zum Ersten Schmelzer machen?«
Georg ging nicht auf seine Anspielung ein. Jeder auf der Hütte wusste, dass Gottfried sich gern auf Kosten anderer bei seinen Vorgesetzten anbiederte, um sich zu profilieren. Die meisten versuchten, sich mit ihm gutzustellen, um nicht von ihm angeschwärzt zu werden oder aufzufallen.
»Es ist höchste Zeit für den Abstich. Habt ihr den Schacht schon nachgestochert? Ich brauche die Lanze, verdammt noch mal«, wetterte Georg.
»Nein, Otto hat sie zerbrochen. Wenn der so viel Kraft im Hirn wie in seinen Armen hätte«, meinte Gottfried und tippte sich an die Stirn.
»Das darf doch nicht wahr sein. Holt sofort eine neue aus dem Magazin und schickt mir Hans runter. Ich brauche ihn. Los jetzt!«, schrie Georg ärgerlich und wollte gerade gehen, als August Fricke, der Grabenwärter8 von draußen hereinkam. Es gehörte mit zu seinen Aufgaben, die Zulaufrinnen vor den Wasserrädern von angeschwemmtem Unrat zu befreien. Augusts Jackenärmel trieften vor Nässe.
»In dieser Jahreszeit würde ich auch gerne am Ofen arbeiten«, sagte er und rieb sich die Hände warm. Ein Hauch von Alkoholgeruch umgab ihn. »Hoffentlich hört der Regen bald
auf. Ich weiß sonst nicht mehr wohin mit den Wassermassen und dem Gestrüpp. Das verstopft uns noch die Räder«, befürchtete er und steckte seine Hände tief in die Hosentaschen.
»Ist dir Hans zufällig begegnet?«, fragte Georg. August wartete einen Moment mit der Antwort, fixierte Gottfried und sagte, ohne den Blick von ihm abzuwenden: »Mir ist was anderes begegnet«, sagte er nachdenklich.
»Was denn nun?«, fragte Georg nach, »hast du ihn gesehen oder nicht?«
»Kann sein. Irgend eine Gestalt schlich um den Schuppen«, sagte er verunsichert.
»Was für eine Gestalt? War es Hans?«, drängte Georg ihn zum Reden.
»Vielleicht – kann ich nicht genau sagen«, antwortete August.
»Ich glaube, der Schnaps hat deine Sinne vernebelt, du Saufkopf«, warf ihm Georg vor.
»Meine Sinne sind in Ordnung, aber ihr scheint taub zu sein. Habt ihr vorhin das Scheppern nicht gehört?«, fragte August.
»Welches Scheppern?«, erkundigte sich Georg.
»Der Kohlenhaufen ist zusammengefallen. Vielleicht liegt Hans da drunter«, sagte August.
»Mann«, brüllte Georg schockiert, »warum sagst du das nicht gleich, du Schnapsheini? Los in den Schuppen!«
»Ich wusste doch nicht, dass jemand vermisst wird«, verteidigte sich August. Sie griffen sich Schaufeln und rannten sofort in den Kohlenschuppen.
Gottfried Mehmke blieb. »Ich hole die neue Lanze«, rief er den anderen nach.
Georg wollte ihn noch zurückpfeifen, aber es war jetzt keine Zeit, sich mit ihm anzulegen. Wenn Hans tatsächlich unter der Kohle lag, zählte jede Minute. Sie schaufelten wie besessen den zusammengerutschten Kohlenhaufen auseinander, aber sie fanden nichts. Abgekämpft und mit hängenden Köpfen schlurften sie zur Möllerbühne zurück. Georg ging wieder nach unten.
Vielleicht war Hans vom Gichtgas9, das man auf der Bühne unweigerlich einatmete, unwohl geworden, und er hatte sich in die Butze verkrochen, mutmaßte er. Butze nannten die Arbeiter eine versteckte Nische hinter dem Formsandlager, wo fast nie ein Vorgesetzter hinkam. Dorthin zogen sich diejenigen heimlich zurück, die am Abend zuvor zu viel Branntwein getrunken hatten oder die krank waren und eine zusätzliche Pause brauchten. Wer arbeitsunfähig zu Hause blieb, bekam die Zeit vom Lohn abgezogen, und deshalb gingen sie oft sogar mit Fieber zur Arbeit und versuchten über die Runden zu kommen.
In der Butze war niemand. Georg war ratlos. Man kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen, ging es ihm durch den Kopf. Und während der Arbeit abhauen, war nicht Hans` Art. Als Letztes befragte er noch hinter vorgehaltener Hand die anderen Kameraden. Seinen Arbeitsplatz unbefugt zu verlassen, wurde von den Hüttenbeamten mit bis zu einem halben Wochenlohn geahndet. Deswegen hielten die Hüttenleute zunächst dicht und fragten untereinander weiter herum – jedoch ohne Ergebnis. Alle schüttelten mit dem Kopf. Es half nichts, Georg musste den Hüttenmeister Ludwig Rathmann informieren. Wenig später erschallte das Alarmgeläut der Hüttenglocke über den Hof. Bald darauf begann eine offizielle Suche, die erst zum Schichtende eingestellt wurde. Hans Röger blieb verschwunden.
*
Als Otto Wiegand nach verfahrener Nachtschicht am frühen Morgen die Gießhalle als einer der Letzten verließ, sah er von Weitem, wie jemand etwas auf die heiße Schlacke warf. Es war ungewöhnlich, dass Arbeiter etwas wegwarfen. Selbst Arbeitskleidung, die durch Metallspritzer oder Funkenflug durchlöchert war, wurde mit nach Hause genommen, um sie als Putzlappen oder Flicken weiter zu verwenden.
Otto wunderte sich, trat an den Rand der Grube und sah hinein. Die Hitze, die ihm entgegen strahlte, fühlte sich in der kalten Morgenluft wie ein wärmender Ofen an. Auf der Schlacke sah er einen Lappen mit glänzenden Metallteilen daran, der soeben Feuer fing. Otto liebte alles, was glitzerte und funkelte. Zuhause im Schuppen hatte er ein Versteck, wo er seine Schätze aufbewahrte. Murmeln, Knöpfe und bunte Steine. Otto hangelte mit dem Holzstiel, den er von Gottfried bekommen hatte, nach dem Stoffteil, hob es heraus und erstickte die Flämmchen. Er knüllte den Fetzen zusammen, klemmte es unter seinen Arm und nahm es mit. Am Ausgang des Hüttenplatzes kam ihm gerade Johannes Klapproth entgegen. »Steig auf, Otto«, rief er ihm zu. Otto stieg mit einem Satz auf den Fuhrmannsbock und ließ sich das kurze Stück bis nach Hause mitnehmen. Dort sprang er vom Bock herunter, eilte zum Schuppen und die Treppe zum Heuboden hinauf. Hinter einem alten Schrank holte er einen Kartoffelsack hervor, in dem er all seine glitzernden Kostbarkeiten aufbewahrte. Er stecke den Stofffetzen in den Sack und schob ihn hinter den Schrank zurück.
1 Von Wasserrädern angetriebene Stempel, mit denen Erzstücke oder Schlacke zerkleinert wurden.
2 Abstich ist das periodische Öffnen des Verschlusses eines Hochofens, um das Ausfließen des Roheisens zu ermöglichen.
3 Dem Roheisen musste Kohlenstoff entzogen werden, um es schmiedbar zu machen. Das geschah mittels Herdfeuer, ähnlich einer Schmiedeesse. Der Vorgang wurde »Frischen« genannt.
4 Als Massel bezeichnet man kleinere Barren bei der Roheisengewinnung.
5 Die Möllerbühne ist eine Plattform, von der aus der Hochofen von oben abwechselnd mit Kohle und Möller beschickt wurde.
6 Vorläufer wurden die Arbeiter genannt, die auf der Möllerbühne den Hochofen beschickten.
7 Möller ist ein Gemisch aus verschiedenen Erzsorten und Zuschlagstoffen (Kalk), mit dem der Hochofen beschickt wurde.
8 Der Grabenwärter war für die Unterhaltung des Betriebsgrabens und den freien Zulauf des Wassers zu den Wasserrädern verantwortlich.
9 Gichtgas nennt man die Abgase des Hochofens.
Freitagmorgen, 18. Oktober 1833
Auf dem Weg zur Knollengrube
Das konnte nicht gut gehen. Karl sah das Unheil kommen. Aus dem Rohr schoss das Wasser in dickem Strahl auf die Schaufeln des Rades, das von einem Gehäuse umkleidet war. Ein solches Wasserrad hatte er noch nirgends gesehen. Die Kurbel drehte sich schneller und schneller und war bald nur noch als rotierender Kreis zu erkennen. Durch die Wucht hatte sich die eiserne Schubstange vom Kurbelzapfen gelöst, der in rascher Folge dagegen schlug. Das Wasser musste aufgehalten werden, damit die schwere Stange nicht durch die Radstube1 geschleudert wurde. Sie würde alles zerstören. Karl versuchte das Rohr zu verschließen, aber der Schieber saß fest. Warum ließ er sich nicht bewegen? Wir müssen raus, war sein nächster Gedanke. Bim, bim, bim schallte das klingende Eisen unheilvoll durch die Stollen und Schächte der Grube. Er musste das Wasser stoppen, er musste das Unglück verhindern. Bim, bim, ...
»Karl!«, hörte er eine Stimme und jemand tippte ihm auf den Rücken. Er wandte sich um, aber da war niemand. »Karl?«
Er schlug die Augen auf. Vor seinem Bett stand Clara, seine kleine Schwester, die im selben Zimmer schlief. »Ach du bist es, Häkchen«, sagte Karl müde und wischte sich die Augen.
»Kann ich zu dir kommen, mir ist kalt?«, fragte sie mit zittrigen Lippen. Karl schlug seine schwere Wolldecke auf, Clara kroch an seine Seite und drückte sich an ihn. Ihre Füße fühlten sich wie Eiszapfen an. »Hörst du die Glocke?«, flüsterte Clara.
Karl lauschte. Er hatte geträumt, aber das Geläut war Wirklichkeit. »Ja. Auf der Königshütte muss wohl etwas passiert sein«, flüsterte er zurück.
»Hoffentlich ist Otto nichts zugestoßen«, sagte Clara und klammerte sich fester an Karl.
»Sicher nicht. Schlaf weiter.« Karl stieg aus dem Bett, wickelte Clara in die Decke ein und strich ihr über das dunkelblonde Haar. »Ich muss bald zur Arbeit.«
Clara antwortete nicht mehr. Karl klemmte seine Sachen unter den Arm und verließ auf Zehenspitzen die Kammer. Die Dielen knarrten unter seinen Schritten.
Am Küchentisch saß bereits sein Vater Wilhelm mit der Pfeife im Mund und schnitt dabei eine Scheibe von dem Brotlaib ab. Auf einer Schale lag ein rundes Stück Käse, mehr nicht.
»Habt ihr den Alarm gehört?«, fragte Karl, legte seine Sachen auf die Bank unter dem Fenster und zog sich an.
»Ja. Ein Feuer scheint es nicht zu sein, es war jedenfalls nichts zu sehen«, antwortete sein Vater. »Vielleicht ein Unfall«, mutmaßte er.
»Ich mach mir Sorgen um Otto«, sagte seine Mutter, die am Herd stand.
»Otto ist nicht der Hellste, aber er kann gut auf sich aufpassen«, meinte Wilhelm.
»Das Teewasser kocht gleich«, sagte Karls Mutter und schob zwei Holzscheite hinein.
»Sei sparsam mit dem Holz, Frieda. Es soll einen langen Winter geben«, mahnte Wilhelm.
Im Kessel blubberte das kochende Wasser. Frieda goss es über das Teesieb in eine Kanne. Der Duft von Brennnesseltee breitete sich in der Küche aus.
»Wenn wir das Ofenrohr verlängern, bleibt mehr Wärme im Haus. So können wir Holz sparen«, schlug Karl vor.
Wilhelm sah seinen Sohn missmutig an. »Du scheinst noch zu viel Zeit für deine verrückten Ideen zu haben, anstatt dich nützlich zu machen. Selbst wenn du recht hättest, wer soll das Ofenrohr bezahlen? Mach dir lieber Gedanken darüber, wie wir zu mehr Holz kommen«, wetterte sein Vater.
»Wir könnten auch das Haus besser abdichten und alle Ritzen ...«
»Schluss jetzt! Ich will nichts mehr davon hören. Du bist zweiundzwanzig Jahre alt und immer noch ein Kindskopf.«
Karl erwiderte nichts darauf. Sein Vater war ein Sturkopf und schwer zu überzeugen. Als gottesfürchtiger Mann und standesbewusster Bergmann hatte er seine Prinzipien, an denen nicht zu rütteln war. Die Mutter hatte inzwischen die Brote mit dem hausgemachten Käse belegt, den Tee in Flaschen gefüllt und alles in die Rucksäcke verstaut. Die Glocke der Kirchturmuhr schlug vier Mal.
»Wir müssen los«, sagte sein Vater, stopfte die Pfeife mit dem Finger nach und verließ die Küche. Karl folgte ihm in den Flur hinaus. Dort nahmen sie die warmen Jacken vom Haken, setzten die Mooskappen auf und steckten ihre Tscherpermesser in die Koppeltaschen. Bis zur Knollengrube im Luttertal hatten sie noch einen eineinhalbstündigen Fußmarsch vor sich. »Glückauf«, sagten Karl und sein Vater, bevor sie das Haus verließen. »Fahrt glücklich«, erwiderte die Mutter den Gruß. Feuchtkalte Luft wehte ihnen entgegen. Die letzten Oktobertage des Jahres 1833 waren kühl. Es hatte einige Tage zuvor ausgiebig geregnet. Als sie vor die Haustür traten, sagte Frieda: »Wilhelm? Karl?« Sie schauten zurück. »Gott schütze euch«, sagte sie ehrfürchtig und hob eine Hand, so, als würde sie die beiden segnen wollen. »Die heilige Catharina ist an unserer Seite, Frau«, antwortete Wilhelm.
Karl sah seine Mutter einen Moment lang an. Ein zartes Persönchen, aber eine starke Frau, kam ihm bei ihrem Augenblick in den Sinn. In der bunten, selbst genähten Schürze über dem schlichten Kleid und dem Kerzenlicht in der Hand sah sie selbst aus wie eine Schutzpatronin. Ihre nach hinten zusammengebundenen krausen Haare gaben den Blick auf ihre Stirn frei, die von zwei Furchen durchzogen war. Das harte und entbehrungsvolle Leben konnte man aus ihren Gesichtszügen ablesen. Trotz ständiger Sorge um Wilhelm und Karl, die täglich den Gefahren des Berges ausgesetzt waren, bewahrte sie ihre Frohnatur. Jeder kannte sie als gottesfürchtige Frau, die an das vorbestimmte Schicksal glaubte. »Gott hat jedem eine Bestimmung zugewiesen«, entgegnete sie denjenigen, die sich über das schlichte Leben beklagten. Aber wehe, wenn jemand ein schlechtes Wort gegen ihre Familie richtete, dann konnte sie ungehalten werden. »Schlag keine Wurzeln«, rief sie ihrem Sohn zu, »dein Vater ist schon ein Stück voraus.« Sie hielt ihren Kopf leicht geneigt und Ihr schmaler Mund lächelte.
Karl hatte seinen Vater rasch eingeholt. Aus den umliegenden Häusern kamen nach und nach Männer in Bergmannskleidung heraus und gesellten sich zu ihnen. Sie grüßten sich knapp und müde mit »Glückauf«. Normalerweise wurde auf dem Weg zur Grube kaum geredet, aber heute weckte der nächtliche Alarm auf der Königshütte ihre Neugier.
»Habt ihr die Alarmglocke gehört?«, fragte Ernst Müller, der zwei Häuser nebenan wohnte.
»Ein Feuer kann es nicht gewesen sein, das hätten wir gesehen«, meinte Wilhelm.
»Was mag dort nur passiert sein?«, fragte ein anderer.
»Wartet`s ab, vielleicht hat der Steiger etwas erfahren«, fuhr Wilhelm dazwischen.
Die Männer schwiegen, nur der Kies des Hüttenweges knirschte unter ihren Schnürstiefeln. Unter der hölzernen Schanzenbrücke rauschte die Oder wie ein Wildwasser hindurch. In der Dunkelheit konnte Karl nur wenig erkennen, aber das Getöse des Wassers ließ erahnen, dass das Flussbett randvoll war. Wenn es weiter regnet, wird die Aue bald überschwemmt, befürchtete er. Den Gedanken hatte er kaum beendet, als ein Nieselregen einsetzte. Die Männer gingen wie auf Kommando einen Schritt schneller. Sie fürchteten den Regen, der ihre Kleidung durchnässte, bevor sie in die Gruben einfuhren. Karl und sein Vater hatten einen Umhang aus grobem Segeltuch im Rucksack, der sie vor Nässe schützen sollte, aber den benutzten sie nur bei starkem Regen.
Von der Hauptstraße her stießen neun Jungen zu ihnen. Sie waren etwa dreizehn oder vierzehn Jahre alt und arbeiteten als Klauber2 in der zugigen Klauberbucht der Grube. Ihre verhärmten Gesichter sahen müde aus. Die harte Arbeit hatte diese Jungen bereits gezeichnet. Wie fast alle Bergmannsknaben hatte auch Karl an den Pochtischen begonnen. Dort mussten sie das Gestein in Stücke schlagen, daraus den Eisenstein klauben und das Erz sowie das taube Gestein3 in die Förderwagen verladen. Ein entbehrungsreiches Leben für Kinder, die zwölf Stunden täglich diese Schinderei und die Launen des Aufsehers ertragen mussten.
Von der oberen Hauptstraße kommend, stießen weitere Bergleute hinzu. Auch ihnen war die jahrelange harte Arbeit unter Tage anzumerken. Einigen hatte die Last den Rücken gebeugt, andere gingen schief oder hinkten. Hier und da hörte Karl ein verschlafenes »Glückauf«. Die Männer schlurften durch die Doktorgasse, dann keuchend den steilen Weg zum Weinberg hinauf und von dort abwärts über den Kohschießenwech ins Luttertal.
Karl hörte auf einmal hinter sich ein knabenhaftes Schluchzen. Er wand sich um und sah einen der Klauberjungen, der von der Gruppe ein Stück abgehängt worden war und nun hinterhertrottete. Karl blieb stehen und wartete. Der Junge schlurfte mit gesenktem Kopf an ihm vorüber und schien leise vor sich hin zu weinen.
»Heh, was ist mit dir?«, fragte Karl.
»Nichts«, gab er zur Antwort und zog schleimig die Nase hoch.
»Dann hör auf zu heulen. Das schickt sich nicht für jemanden, der Bergmann werden will. Heulsusen können wir im Berg nicht gebrauchen«, warf Karl ihm vor. Den Jungen beeindruckte das nicht. »Wie alt bist du?«, fragte Karl.
»Zwölf«, sagte er.
Karl betrachtete ihn genauer. Er war schmächtig und kleiner als die anderen Jungs. »Dich kenn ich doch«, meinte Karl, »bist du nicht Michel, der Junge von Holtzappelts Hermann?«
Der Junge nickte. »Dann solltest du dir an deinem Vater ein Vorbild nehmen«, sagte Karl.
»Der schlägt mich auch«, sagte Michel und schluchzte.
»Wer denn noch?«, fragte Karl.
»Bruns, er hat es auf mich abgesehen und findet immer einen Grund.«
Bruns, der Untersteiger, war einer von der Sorte, die meinten, sie müssten die Prügel, die sie selbst früher bezogen hätten, an andere weitergeben. Wenn er jemanden auf dem Kieker hatte, hatte derjenige nichts zu lachen.
»Mit Prügel haben wir alle angefangen, und sie haben uns hart gemacht. Wenn du ein Mann werden willst wie dein Vater, dann reiß dich zusammen.« Karl gab ihm einen Klaps auf die Schulter. Michel sah ihn an, zog nochmals die Nase hoch und legte einen Schritt zu.
An der Kupferhütte, wo die Krumme und die Gerade Lutter zusammenflossen, teilten sich die Wege der Männer. Einige gingen nach rechts ins Tal der Krummen Lutter zur Grube Louise Christiane, die anderen nach links der Graden Lutter entlang zur Knollengrube. Es war stockfinster, nur das wilde Rauschen des Flusses, der ebenfalls angeschwollen war, gab ihnen Orientierung. Karl kannte die Geräusche des Wassers, das Glupschen, Plätschern und Gurgeln. Er konnte im Dunkeln daran erkennen, an welcher Stelle des Weges sie sich befanden. Aber heute hörte man keinen Unterschied heraus. Der Fluss gab nur ein gleichförmiges Grollen von sich. Seit seinem fünfzehnten Lebensjahr ging Karl diesen Weg. Tagein, tagaus, nur von Sonn- oder Feiertagen unterbrochen. Sein Vater hatte ihm beigebracht, die Stimmen des Wassers und des Berges zu verstehen.
Das Nieseln war in einen leichten Regen übergegangen. Allmählich kroch die Kälte unter seine Kleidung. Karl hing seinen Gedanken nach und dachte an seinen Traum. Was hatte er zu bedeuten? War es die Vorahnung eines Unglückes oder beschäftigten ihn wieder seine verrückten Ideen bis in seine Träume hinein? Ein umkleidetes Wasserrad, was so schnell rotierte, hatte er noch nirgendwo gesehen. Ihn interessierte alles, was sich drehte und bewegte, die Kunst, die Kraft des Wassers zu nutzen. Könnte er doch nur in der Hütte arbeiten. Er stellte sich vor, selbst Wasserräder zu bauen, die größer waren, mehr Leistung abgaben und Maschinen antreiben konnten. Von Dampfmaschinen hatte er auch bereits gehört, die im Kupferschieferrevier bei Mansfeld und Hettstedt Pumpen antrieben. Darüber hätte er gerne alles erfahren. Es gab Bücher davon, aber er hatte kein Geld, um sich welche zu kaufen, und die Bergschule in Clausthal schien ihm unerreichbar.
»Spinnst du dir wieder verrückte Sachen zusammen?«, fragte sein Vater, der das Schweigen seines Sohnes hinterblickte.
»Vater, ich will aus dem Berg raus«, antwortete Karl unverhohlen.
Wilhelm blieb stehen. »Du spinnst ja wirklich«, sagte er in scharfem Ton. »Vergiss deine Wurzeln nicht. Wir sind Bergleute, seit Generationen. Das ist unsere Bestimmung.«
»Ich will mein Leben nicht in der feuchten und kalten Dunkelheit der Grube fristen. Ich will Maschinen bauen«, widersprach er.
»Ich will, ich will. Mehr höre ich von dir nicht«, fauchte Wilhelm ihn an. »Aber ich will, dass du dich auf deine Aufgaben besinnst, und jetzt ist Schluss damit.«
Der helle Ton der Bergwerksglocke schallte durchs Hübichental und unterbrach ihr Streitgespräch. Sie gingen weiter. Bald erreichten sie das Bergwerksgelände. Schweigend und fröstelnd betraten sie mit den anderen das Zechenhaus. Aufgeregte Stimmen schallten ihnen entgegen. Was ist denn los, wunderte sich Karl. Hatte es womöglich einen Unfall gegeben?
1 Radstube nannte man den Raum, in dem ein Wasserrad lief.
2 Klauber waren meist Kinder (ab zwölf Jahren), die aus dem grob zerschlagenen Erzgestein die unhaltigen Beimengungen herausklaubten.
3 Taubes Gestein nennt man jenes, das kein Erz enthält.
Freitag, 18. Oktober 1833
Lauterberg, Ellernstraße
Johanna Röger wartete an diesem Morgen vergeblich auf ihren Vater. Die Steckrübensuppe, die er besonders mochte, dampfte schon eine ganze Weile nicht mehr. Johanna saß mit verschränkten Armen aufgestützt an dem groben Holztisch und sah auf den leeren Teller gegenüber. Auf dem Rand hatte sie eine Scheibe Brot gelegt, weil die Suppe wieder einmal dünn ausgefallen war. Sie mussten selbst am Essen sparen, denn das Geld reichte hinten und vorne nicht. »Die Preise steigen schneller, als ein Pferd laufen kann«, schimpfte ihr Vater jedes Mal auf die Obrigkeit, wenn Johanna vom Wochenmarkt mit halb gefülltem Korb zurückgekommen war.
Die Glocke hatte schon sieben Mal geschlagen und Johanna erwartete den nächsten Stundenschlag. Ihr Vater hätte längst zurück sein müssen. Vielleicht gab es ja wieder etwas zu reparieren und die Männer mussten deshalb länger arbeiten.
Johanna legte den Deckel auf den Topf, stellte ihn zum Warmhalten auf den Ofenrand und verließ die kleine Dachgeschosswohnung in der Ellernstraße1, um draußen nach ihm Ausschau zu halten. Als sie die knarrende Holztreppe hinunterstieg, ging unten im Flur die Tür auf und Franz Weber, ihr Vermieter, stellte sich ihr in den Weg.
»Na? Schönes Kind«, griente er sie gehässig an, »wann zahlt ihr denn die Miete? Es ist bald November und ich habe noch keinen Groschen gesehen.« Johanna war dieser Mann zuwider. Er war grob und ordinär.
»Mein Vater ist zum Ersten Schmelzer befördert worden und bekommt auch mehr Lohn. Er wird die Miete sicher heute noch bezahlen«, sagte Johanna und ging an ihm vorbei.
Er klopfte ihr dabei auf den Po. »Wenn du mal einen Mann brauchst, dann will ich dich gern bedienen und einen Teil der Miete erlassen.« Johanna drehte sich augenblicklich um und gab ihm eine schallende Ohrfeige. Sein Blick verfinsterte sich und er packte sie am Arm. »Alte Kanaille, kriegst doch sowieso keinen Mann, du Krüppel!« Mit der anderen Hand drückte er sie am Po an sich. Johanna trommelte mit den Fäusten gegen seine Brust.
»Lass mich, du Bock!«, rief sie.
»Franz!«, schallte es herrisch durchs Haus.
Frau Weber stand jetzt in der Tür. Er stieß Johanna beiseite, zwängte sich an seiner Frau vorbei und verschwand in der Wohnung. Herta Weber stemmte ihre Fäuste in die Hüften und stand wie ein Gurkenfass zwischen den Türpfosten. Ihr rundliches Gesicht glühte.
»Lass meinen Franz in Ruhe«, fauchte sie Johanna an. »Wenn du einen Mann brauchst, such dir einen anderen. Vielleicht findest du einen Krüppel, so wie du einer bist.«
»Kümmere du dich gefälligst besser um deinen Mann, damit er mir nicht ständig nachstellt«, konterte Johanna. »Oder hast du ihm im Bett nichts mehr zu bieten?«
»Geh mir aus den Augen, du freches Luder!«, schrie sie.
Johanna lief aus dem Haus. »Ich bin kein Krüppel«, rief sie zurück. Sie spürte, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten. Mit dem Zipfel ihrer Schürze wischte sie sich übers Gesicht, schaute die Ellernstraße hinunter und ging ein Stück den unbefestigten Weg entlang. Sie hoffte, ihr Vater würde ihr bald entgegenkommen, aber da kam niemand. Sie lief allein durch den Regen, der dicke Blasen auf den Pfützen hinterließ.
Johanna hinkte etwas mit dem linken Bein, seit sie vor sieben Jahren einen Unfall hatte. Es war bei der Heuernte auf dem Heikenberg passiert. Die Erntezeit gab den Frauen eine willkommene Möglichkeit, etwas Geld hinzuzuverdienen, und Johannas Mutter hatte sie mitgenommen. Sie war damals dreizehn Jahre alt gewesen. Die Arbeit im Heu hatte ihr Spaß gemacht und mit den anderen Kindern hatte sie auf dem Wagen im Heu ausgelassen herumgealbert. Plötzlich knallte vom angrenzenden Weg her die Peitsche eines anderen Fuhrmannes. Die Pferde vor dem Heuwagen zogen an und es gab einen Ruck. Johanna hatte noch versucht, sich festzuhalten, aber das Heu gab nach. Sie fiel herunter und rutschte unglücklich unter den Wagen. Ein Rad überrollte ihren linken Unterschenkel und zertrümmerte die Knochen. Seitdem war das Bein etwas verkürzt.
Als Kind wurde sie deswegen oft von den anderen gehänselt. Manche glotzten Johanna an, als sei sie eine Jahrmarktattraktion und riefen »Hinkefuß« hinter ihr her. Sie hatte sehr darunter gelitten und empfand es immer noch verletzend, wenn man ihr hinterher gaffte oder sie als Krüppel bezeichnete.
Weite Strecken konnte sie seitdem nicht mehr laufen, ohne dass ihr die Hüfte und das Knie schmerzten. Sonst hätte sie das Geschäft ihrer Mutter weiterführen können, die als Kiepenfrau2 mit Knöpfen und Schnallen aus Hirschhorn handelte. Sie war bis Osterode und St. Andreasberg unterwegs gewesen, und ihre Artikel waren begehrt. Ihr Vater streifte im Frühjahr durch die umliegenden Wälder und suchte abgeschlagene Geweihstangen. Er kannte die Stellen genau und nach Feierabend schnitzte und drechselte er aus dem Horn die gefragten Stücke. Johanna hatte ihm dabei oft zugesehen und es später selbst ausprobiert. Sie hätte geschickte Hände, hatte ihr Vater sie gelobt. Das Geschäft lief gut, und ihre beiden Brüder, Lorenz und Albin, die im Kupferhütter Stollen arbeiteten, trugen ebenfalls zum Lebensunterhalt bei. Ihre Eltern hatten ihr Auskommen und konnte sich sogar ein paar Taler als Notgroschen ansparen.
Dabei entstammten die Rögers einer reichen Tuchhändlerdynastie, die allerdings im Dreißigjährigen Krieg alles verloren hatten. Oft hatte ihr Vater den Kindern davon erzählt, und von dem Geheimnis der Erzbibel, die der Graf Ernst von Honstein damals der Familie zur Aufbewahrung überließ. Gespannt hörten sie und ihre Brüder jedes Mal dieser mystisch anmutenden Geschichte zu. Er erzählte von Fremden, die »Venediger« genannt wurden und im Harz heimlich nach Erzen suchten. Sie hinterließen seltsame Zeichen auf Steinblöcken, meist Mönchsköpfe. Johanna gruselte es immer noch ein wenig, wenn sie an diese Geschichte dachte. Leider brachte das Buch, in dem reiche Silbererzvorkommen verzeichnet sein sollten, nur Unheil über die Familie. Neid, Missgunst und Habgier beherrschten fortan die Geschicke, woran das Familienband zu zerreißen drohte. Dann verschwand das Buch. »Es liegt in der Obhut des Herrn«, hatte Johannas Vater geantwortet, wenn sie und ihre Brüder neugierig danach fragten.
Johanna ging weiter und hoffte, ihr Vater würde jeden Augenblick auf sie zukommen. Doch sie war die Einzige, die durch den Regen stiefelte. Was, wenn ihm etwas zugestoßen wäre? Unfälle passierten hin und wieder. In den Gruben und Hütten lauerten allerlei Gefahren. Unsinn, versuchte Johanna, diese Gedanken zu verdrängen, er muss länger arbeiten, wie so oft.
Alles andere wäre ein Schicksalsschlag, wie damals, als ihre Mutter eines Tages Husten bekam. Zuerst glaubten sie an eine Erkältung, die man sich bei den langen Fußmärschen und dem nasskalten Wetter leicht einfangen konnte. Doch heißer Holundertee und Schwitzkuren halfen diesmal nicht. Der Husten hörte nicht auf. Ihr Vater hatte einen schlimmen Verdacht, der von Medizinalrat Doktor Ritscher bestätigt wurde: Schwindsucht. Der Doktor hatte sie regelmäßig zu Hause besucht und behandelt, aber er konnte ihr nicht mehr helfen. Sie starb einige Wochen später. Die Behandlung und die Medikamente hatten ihren Notgroschen aufgezehrt und die Familie fast in den finanziellen Ruin gestürzt. Das war vor drei Jahren gewesen und hatte sie tief getroffen. Johanna, nun als einzige Frau in der Familie, musste danach allein den Haushalt führen und sich um alles drum herum kümmern. Eine Verantwortung, die ihr letztendlich gut tat und ihr Selbstbewusstsein stärkte. Es dauerte einige Wochen, bis die Familie in die veränderte Lebenssituation reingefunden und sich ihr Tagesablauf neu eingespielt hatte. Das Leben ging weiter und fühlte sich bald wieder normal an. Bis vor zwei Jahren.
Gerüchte über die Schließung der letzten Kupfererzgrube machten in Lauterberg die Runde und sorgten für Unruhe unter den Bergleuten. Sie wussten selbst, dass die Erzgänge in der Tiefe von mehr als 150 Lachter3 vertaubten und es immer schwieriger wurde, sie zu betreiben. Johannas Vater war ernsthaft in Sorge gewesen, denn das hätte auch seine beiden Söhne betroffen, auf die er so stolz war. Der Abstieg in die Armut und ein Leben als Kümmerexistenz drohten der Familie. Diese Schmach hätte Ihr Vater wohl kaum überwunden. Das Bergamt bemühte sich zwar, die Arbeiter in anderen Gruben unterzubringen, aber auch dort brauchte man keine weiteren Arbeitskräfte, da der Ertrag fast überall stagnierte.
Bald verbreitete sich die Nachricht, dass Männer und Frauen ohne Arbeit den Harz verlassen könnten. Vom Bergamt war zu hören gewesen, dass sogar Aufnahmescheine für eine Schiffspassage nach Nordamerika ausgestellt wurden. Das machte viele neugierig. Auch Johannas Brüder hörten interessiert zu, wenn auf dem Wochenmarkt oder nach dem Kirchgang sensationshungrig über Auswanderer erzählt wurde, die angeblich in Amerika ihr Glück gemacht hätten. Von Wohlstand und großen Villen mit Bediensteten wurde großmundig berichtet. In vielen Köpfen regten sich Träume und Sehnsüchte, die Johannas Vater als Hirngespinste abtat. Aber als er eines Tages aufwachte, waren seine Söhne in Übersee. Er hatte es ihnen nie verziehen.
Ihr Vater war immer noch nicht zu sehen. Johanna setzte sich auf einen Holzstapel am Wegrand. »Ich bin kein Krüppel«, sagte sie leise zu sich selbst, aber sie wusste, dass sie ihre Behinderung zur Außenseiterin machte. Andere Frauen in ihrem Alter waren längst verheiratet und hatten Kinder. Es lag nicht an ihrem Aussehen, denn sie war hübsch – sogar ausgesprochen hübsch – hatte ihre Mutter ihr immer wieder versichert und nicht nur zum Trost gesagt. Ihre magisch blauen Augen hätten eine fesselnde Ausstrahlung, hatte sie geschwärmt. Aber Johanna machte sich nichts vor, eine Frau, die hinkte, galt als kränklich und war für Männer wenig attraktiv. Sie malte sich oft in Gedanken aus, wie es wohl wäre, eine eigene Familie zu haben, und diese Vorstellung gefiel ihr. Genauso wie die Blicke der Männer, die hin und wieder zu ihr schielten, leider aber rasch das Interesse verloren, wenn sie Johannas Gehbehinderung bemerkten. Wieder normal gehen zu können, war ihr innigster Wunsch, irgendwann würde sie das Bein richten lassen. Sie hatte von Ärzten gehört, die solche Operationen durchführten, aber ... Johanna kam sich bei diesem Gedanken töricht vor, denn das würde sie niemals bezahlen können.
Das Klappern von Hufeisen und Klingeln aneinanderschlagender Ketten ließ Johanna aufblicken. Von Weitem, aus Richtung Odertal, kam ein Fuhrwerk auf sie zu. Johanna kannte die schweren Kaltblüter sowie deren Fuhrmann. Es war Johannes Klapproth, der an der Lutter unterhalb des Heikenberges seinen Hof hatte. Alle nannten ihn einfach Hannes. Er fuhr Erz aus der Knollengrube und Holzkohle von den Meilerplätzen im Odertal zur Königshütte. Vielleicht wusste er etwas über ihren Vater oder Problemen auf der Hütte. Sie ging dem Gespann entgegen. Hannes saß mit hängendem Kopf zusammengekauert auf dem Bock und schien zu schlafen. Die Pferde kannten den Weg zu ihrem Stall genau und die Leute erzählten manchmal schmunzelnd darüber, wie Hannes einfach weiterschlief, während die Tiere bereits auf dem Hof standen.
»Gevatter Klapproth«, rief Johanna. Die Pferde trotteten gemächlich weiter und der rundliche Kopf des Fuhrmannes baumelte, wie an einem Band hängend, von einer zur anderen Seite. Johanna schritt neben dem Wagen her. »Gevatter Klapproth, hörst du mich?« Er schlief weiter. Johanna ging einen Schritt schneller und nahm eines der Pferde am Kopfgeschirr. »Brrr. Hooh«, sie zog dabei an dem Riemen. Beide Tiere blieben stehen, schüttelten die Köpfe und schnaubten.
Hannes Klapproth, noch ein wenig irritiert, schlug die Augen auf. »Pferd, geh weiter, wir sind gleich zu Hause«, sagte er verschlafen. Dann schaute er auf sie herunter. »Johanna? Du?« Er richtete sich auf.
»Hast du meinen Vater gesehen? Er müsste längst zu Hause sein«, fragte sie.
»Dein Vater? Dann weißt du`s wohl noch nicht«, sagte er und schien auf einmal hellwach zu sein. Seine vollen Wangen leuchteten rot wie Tomaten.
»Was?«, fragte sie und spürte, wie ihr Herz schneller schlug.
»Die halbe Nacht haben sie ihn auf der Hütte gesucht. Er ist einfach nicht mehr aufgetaucht und niemand weiß, wo er sein könnte. Weißt du es?«, sagte Hannes.
Johanna sah ihn an und war unsicher, ob sie ihn recht verstanden hatte. »Verschwunden? Einfach so?«
»Sieht so aus«, meinte Hannes Klapproth, »wenn er nicht zu Hause ist?«
»Nein. Ist er nicht«, sagte sie, ließ das Pferd los und ging, so schnell es ihr Bein zuließ, weiter. Sie wollte sich selbst beim Hüttenmeister erkundigen, was vorgefallen war. Hinter sich hörte sie noch Hannes Klapproth mit der Zunge schnalzen und kurz darauf das Knirschen der eisenbereiften Wagenräder auf dem Kiesbelag des Weges.
Johanna kannte die Hütte schon als kleines Kind. Der große Hof, der schwefelige Geruch der Rösthaufen, das Klingen der Schmiedehämmer und die rot glühende Schlacke vor der Gießhalle waren ihr vertraut. Der Hüttenbrunnen plätscherte in gewohnter Weise, unaufhörlich, als sei er das Herz der Königshütte. Johanna stützte sich auf das gusseiserne Geländer und sah ihr Spiegelbild unter der gekräuselten Wasseroberfläche. Solange er sprudelt, solange lebt diese Hütte, ging Johanna durch den Kopf, und solange verdienen Männer Lohn und Brot und können ihre Familien versorgen. Aber was, wenn ihr Vater jetzt ausfiele? Sie dachte mit Schrecken daran. Johanna hatte niemanden mehr, der sie unterstützen würde. Sie wäre auf sich allein gestellt. Ohne Vater, ohne Einkommen, ohne Zukunft. Vielleicht hatte sie Anspruch auf Leistungen aus der Büchsenkasse. Was für absurde Gedanken, rügte sie sich selbst. Bis jetzt war nichts verloren, es konnte sich alles noch aufklären.
Die Glocke schlug zur Frühstückspause. Kurze Zeit später strömten die Arbeiter aus den Toren der Gießhalle, der Formerei und den Werkstätten. Sie gingen zielstrebig auf die Hüttenschenke zu, vor der bereits einige Frauen mit Essen für ihre Männer warteten. Viele der Arbeiter, die mit rußgeschwärzten Gesichtern an ihr vorübergingen, kannten Johanna.
»Dein Vater wird vermisst«, sagte einer von ihnen.
»Ich weiß«, erwiderte sie.
Vor dem Eisenmagazin schaufelte die Frau des Kohlenvoigts die herumliegenden Pferdeäpfel in einen Eimer. Tschilpend flogen Spatzen auf, die an den Häufchen herumgepickt hatten.
»Wo finde ich den Hüttenmeister?«, fragte Johanna.
»Drüben, in seinem Kontor«, antwortete sie und zeigte auf das Faktoreihaus.
Der Mief von alten Akten, Tinte und Bohnerwachs stieg Johanna in die Nase, als sie das Gebäude betrat. Ein zierlicher Mann mit Brille und schwarzen Ärmelschonern kam ihr auf dem Flur entgegen. Johanna kannte den Mann vom Sehen, er war der Hüttenschreiber. Unter dem Arm trug er einige Aktendeckel und kaute unablässig.
»Zu wem wollen Sie denn, Fräulein?«, fragte er mit halb vollem Mund.
»Ich bin Johanna Röger und möchte Ludwig Rathmann sprechen«, antwortete sie.
Er stellte die Kaubewegung ein und schluckte. »Fräulein Röger? Gut, dass Sie kommen, der Meister hat schon nach Ihnen gefragt. Treppe hoch und dann links. Steht an der Tür.«
Johanna ging nach oben und klopfte an.
»Herein!«, schallte eine kraftvolle Männerstimme durch die Tür. Johanna trat ein. Vor dem Fenster, das zum Hüttenhof zeigte, stand Ludwig Rathmann. Er drehte sich zu ihr und sah sie einen Augenblick lang an.
»Ich bin Johanna Röger und möchte wissen, wo mein Vater ist«, sagte sie selbstbewusst.
Ludwig Rathmann kam auf sie zu. Er war von kräftiger Statur, trug einen schwarzen Kittel. Sein Gesicht war blass und die Augen blickten etwas müde, bemerkte Johanna.
»Das möchte ich auch wissen«, sagte er, »Ihr Vater wurde in der Nacht das letzte Mal gesehen. Wir haben alles abgesucht, selbst die Wassergräben.«
»Wer hat ihn zuletzt gesehen?«, wollte Johanna wissen.
»Otto Wiegand, er ist unser Schlackenpocher4 und arbeitet zurzeit auf der Gichtbühne.«
»Kann ich mit ihm sprechen?«
»Das wird nicht viel nutzen. Er ist schwachsinnig und kann sich schwerlich ausdrücken. Außerdem wird er jetzt zu Hause sein und schlafen, er hatte Nachtschicht«, antwortete Rathmann, setzte sich hinter seinen klobigen Schreibtisch und forderte Johanna mit einer Handbewegung auf, ebenfalls Platz zu nehmen.
»Ist der Amtmann verständigt worden?«, fragte Johanna und erntete umgehend einen finsteren Blick vom Hüttenmeister.
»Der Amtmann? Nein! Warum denn?« Er war sichtlich entrüstet.
»Vielleicht liegt ein Verbrechen vor«, gab Johanna zu bedenken.
»Fräulein Röger«, sagte er empört, »auf einer fiskalischen Hütte herrschen Zucht und Ordnung. Hier ist kein Ort für Verbrechen! Wer weiß, wo sich ihr Vater rumtreibt.«
Johanna rutschte auf dem Stuhl ein Stück nach vorn. »Mein Vater ist kein Rumtreiber, und das wissen sie«, erwiderte sie scharf. »Wie kann jemand während der Arbeit einfach verschwinden?«, setzte sie noch nach.
»Ich verbitte mir diesen Ton«, fuhr Ludwig Rathmann sie an. »Sie sollten jetzt besser gehen.«
Johanna erschrak über seinen plötzlichen Stimmungswechsel, stand auf und ging zur Tür. Bevor sie das Kontor verließ, drehte sie sich um. »Mein Vater bekommt noch seinen Lohn, heute ist Freitag«, forderte sie.
Rathmann erhob sich. »Abzüglich fünf Groschen wegen Abwesenheit. Und falls ihr Vater auftaucht, er soll sich umgehend bei mir melden«, gab ihr Rathmann mit auf den Weg.
Johanna verließ das Kontor, ohne sich noch einmal umzuschauen, und ging nach unten zum Buchhalter. Sie bekam zwei Taler und fünfzehn Mariengroschen.
Die Glocke, die auf dem weitläufigen Hof zu hören war, läutete das Ende der Frühstückspause ein. Die Arbeiter quollen in Scharen aus der Schenke heraus und Johanna schaute ihnen nach, wie sie sich in verschiedene Richtungen verteilten. Ihr Vater war nicht darunter. Wo steckte er nur, oder war ihm am Ende etwas zugestoßen? Dieser Gedanke machte ihr Angst und sie kämpfte mit den Tränen.
1 Heute: Ahnstraße
2 Kiepenfrauen oder Landgängerinnen zogen ein- bis zweimal die Woche ins Umland, um hauswirtschaftliche Erzeugnisse wie Käse, Butter, Strickwaren etc. zu verkaufen, oder um sich als Lasterträgerinnen zu verdingen.
3 Lachter war ein bergmännisches Längenmaß. Ein hannoverscher Lachter beträgt ca. 1,92m.
4 Schlackenpocher (niedere Arbeit) zerkleinerten die Hochofenschlacke, die noch Eisen enthielt. Dieses wurde ausgeklaubt, ausgewaschen und an Silberhütten verkauft.
Freitag, 18. Oktober 1833
Luttertal, Knollengrube
Vor dem Tresen, an dem die Bergleute zum Schichtbeginn das Rüböl für ihr Geleucht bekamen, gab es einen lauten Wortwechsel.
»Du hast zu wenig Öl eingefüllt. Das reicht nicht einmal, um einzufahren!«, beschwerte sich ein Kollege, der vor der Ausgabe stand. »Ich komme damit auch nicht über die Schicht. Willst du, dass wir im Dunkeln bohren«, unterstützte ein anderer die Beschwerde.
Friedrich Meyer, der Geleuchtwart, lief rot an. »Wenn ihr keine Festbeleuchtung einstellt, reicht es allemal. Für Verschwendung gibt es kein Öl«, erwiderte er.
Der Hauer, der am Tresen stand, schlug mit der Hand darauf. »Dann fahr selber ein und beweis es uns!«
Ein Raunen erfüllte den Raum und verstummte augenblicklich, als Walter Franke, der Obersteiger aus seinem Kontor herauskam. »Was ist der Grund dieses Aufstandes«, fragte er.
»Die Kameraden beschweren sich über die ausgegebene Ölmenge in den Fröschen1«, erklärte der Mann hinter dem Tresen.
»Lasst mich sehen«, forderte Franke mit ausgestreckter Hand. Er ließ sich von dem Mann die Lampe geben und öffnete den Schiebeverschluss. »Es ist genügend Rüböl darin, ihr müsst nur sparsamer damit umgehen und es nicht beim Frühstück auffressen«, sagte er. Das Gemurmel in der Ausgabe schwoll an. Der Steiger stützte die Fäuste in die Hüften. »Hat noch jemand etwas dazu zu sagen?«, fragte er in einem Ton, der als Warnung gegen weitere Proteste zu verstehen galt.
Karl hob trotzdem die Hand. Sein Vater stieß ihm sogleich in die Seite und deutete mit einem Blick an, er solle sich aus dem Streit heraushalten.
»Was hast du zu sagen?«, forderte Franke ihn auf.
»Der Mann hat recht. Seit einiger Zeit wird die Füllung nach und nach reduziert«, stand Karl seinem Kameraden bei.
Franke schob sein Kinn etwas nach vorne. »Also gut. Ihr könnt mehr bekommen, aber ich ziehe es euch vom Lohn ab. Dann wird euch der sparsame Umgang mit der Flamme leichter fallen«, konterte Walter Franke.
Karl wurde ärgerlich. »Wenn ihr das so wollt, Steiger, dann beschwert euch demnächst nicht über steigende Unfälle und unreine Förderung.«
Ein Raunen ging um. »Das stimmt«, murrte einer aus der Mannschaft. Ein anderer maulte: »Es ist gefährlich. Auf der Firste2 nahe der Ruschel3, da hängen die Sargdeckel nur so.«
»Du führst ein vorlautes Mundwerk, Wiegand«, erhob der Steiger seine Stimme. »Willst du die Leute aufwiegeln?«
»Ich war nicht die Ursache des Streits«, entgegnete Karl, »aber darf ich einen Vorschlag machen?«
»Ich höre!«, sagte der Steiger.
»Nehmt meinen Frosch und stellt den Docht so ein, wie ihr es für richtig haltet. Wenn das Geleucht erlischt, bevor die Glocke die Schicht beendet, fahren wir aus und bekommen die volle Zeit bezahlt.«
»Ja! Das ist gerecht«, unterstützte ihn jetzt sein Vater. Die anderen stimmten ebenfalls nickend zu.
»Niemand fährt aus, bevor er seine Löcher vollständig abgebohrt hat«, stellte er klar. Die Leute ließen die Köpfe hängen und wollten gehen. »Meyer«, rief der Steiger, »jeder bekommt noch etwas Öl ins Geleucht!« Er ging zurück ins Kontor.
Die Männer klapsten Karl auf die Schulter und stellten sich erneut vor der Ausgabe an. Als die Glocke den Schichtbeginn anläutete, gingen sie nach nebenan in den Andachtsraum zur Gebetsstunde. Auf einem schlichten Holzaltar brannten zwei Kerzen. An der Wand hinter dem Altar hing ein Kruzifix aus Kunstguss von der Königshütte, zu der die Knollengrube gehörte. Es war das einzige Schmuckstück in diesem tristen Raum. Die Männer drängten sich in die drei Bankreihen, knieten nieder und murmelten, jeder für sich, ein kurzes Gebet. Der Untersteiger Gustav Bruns kam dazu. »Glückauf!«, grüßte er die Männer, die wie ein verstimmter Chor antworteten und aufstanden. Dann las Bruns von einer Liste die Namen vor und hakte sie ab, wenn sich der Aufgerufene setzte. Die Mannschaft war vollzählig.
»Lasst uns beten«, sagte er und las aus der Bibel. Zum Schluss sprach er das Gebet: »Fahr wohl mit Gott auf allen Wegen, fahr in den Berg mit Gottes Segen, fahr wieder heil zum Tag hinauf, mit frommem Bergmannsgruß Glückauf!«
»Glückauf«, antworteten die Bergleute. Bevor Karl die Kapelle verließ, sprach er den Untersteiger an: »Es gab heute Nacht Alarm auf der Königshütte. Weißt du etwas darüber?« Die anderen warteten gespannt.
»Nein, ich weiß nicht, was los war«, antwortete er. Die Männer murmelten vor sich hin und verließen das Zechenhaus.