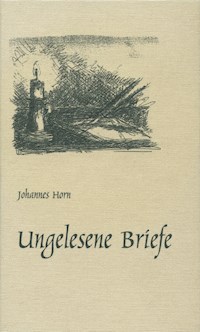11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der mörderische Krieg Putins gegen die Ukraine trifft Europa unvorbereitet in einer Zeit sicher geglaubten Friedens. Im Vorwort wird beschrieben, was den Autor zu diesem Buch motiviert hat. Es gibt auch Einblicke in ein Land und dessen Geschichte, das Vielen oftmals hinsichtlich seiner Größe und seiner Bedeutung noch weitgehend unbekannt ist. Die Psychologie und die Beweggründe des russischen Präsidenten, die ihn zu diesem Krieg veranlasst hat werden ausführlich dargestellt. Die einzelnen Betrachtungen sind zeitlich datiert und beinhalten Stellungnahmen zum Kriegsverlauf und immer wieder grundsätzliche Überlegungen zu Reaktionen von Seiten des Westens, der Rolle des deutschen Bundeskanzlers und zu der Art der russischen Kriegsführung. Es werden Überlegungen zu einer möglichen Beendigung des Krieges angestellt. Im Mittelpunkt steht immer wieder die Bedeutung der Freiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gewidmet
dem Präsidenten Wolodymyr Selenskyi und dem ukrainischen Volk
In inniger Freundschaft:
Prof. Dr. Fjodor Kostew (Nationale medizinische Universität Odessa)
Prof. Dr. Wolodymyr Kowalenko (Straschesko Institut für Kardiologie und regenerative Medizin, Kiew)
Der Krieg, wo er nicht erzwungene Selbstverteidigung, sondern ein toller Angriff auf eine ruhige benachbarte Nation ist, ist ein unmenschliches, ärger als tierisches Beginnen, indem er nicht nur der Nation, die er angreift, unschuldigerweise Mord und Verwüstung drohet, sondern auch die Nation, die ihn führet, ebenso unverdient und schrecklich hinopfert.
Johann Gottfried Herder, 1793
Vorwort
Das Jahr 1991 bedeutete für die Sowjetunion das Ende, für die Ukraine den Beginn von Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Seit 1922 war die Ukraine Teil des sozialistisch kommunistischen Systems der UdSSR. Am 1. Dezember 1991 erklärte die Ukraine ihre Unabhängigkeit mit vertraglicher Bestätigung durch Russland.
Die Wirtschaft lag in jenen Tagen der erreichten Unabhängigkeit am Boden. Versorgungsprobleme führten zu Engpässen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens; die Nahrungsmittel waren knapp; besonders beklagenswert war die Situation im Gesundheitswesen, in den Kliniken, im Bereich der ambulanten und stationären Patientenversorgung. Die allgemeine Not war verständlich, musste doch in dieser Situation alles organisiert und neu durchdacht werden. Im Rahmen einer schon länger bestehenden Partnerschaft zwischen Kiew und München hatte der damalige Oberbürgermeister Georg Kronawitter ein Projekt „München für Kiew“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Projektes wurde eine Hilfsaktion für zwei Kliniken in Kiew gestartet, deren Organisation und Durchführung von der Chirurgischen Abteilung des Krankenhauses München-Harlaching übernommen wurde. Mit einer deutschlandweiten Spenden- und Sammelaktion gelang es, eine Fülle medizinischer Materialien und technischer Geräte im Wert von mehreren Millionen DM zusammenzutragen (Ultraschallgeräte, OP-Instrumente, Blutdruckmessgeräte, Decken, Verbandsmaterialien, Medikamente, Impfstoffe, Infusionen, Babynahrung u. a.). Der Transport erfolgte in drei gesonderten Aktionen, zunächst mit Hilfe einer russischen Maschine, später mit zwei Flugzeugen der Lufthansa.
In den Abendstunden des 10. Februar 1991 trafen wir bei frostigem Winterwetter in Kiew ein, auf dem Flughafen, weit draußen vor der Stadt. Eine Delegation des Kiewer Stadtrates holte uns ab. Auf einer langen, geraden Straße, an verschneiten Birkenwäldern vorbei fuhren wir mit einer Limousine schon sehr alter Bauart Richtung Kiew. Die Fahrt schien endlos bis schließlich die ersten Hochhäuser auftauchten. Immer dichter standen die hohen Plattenbauten, die in der beginnenden Dämmerung düster und befremdlich aussahen. Sozialistische Hochhäuser, gemeinhin als Plattenbauten errichtet, erkennt man allein schon an den mit allen möglichen Möbeln und Gerätschaften vollgestellten Balkonen, denn die Wohnungen dahinter sind klein und wenig geräumig. Diesen Anblick boten diese Hochhäuser damals überall, ob in der ehem. DDR, in Polen oder der Tschechoslowakei. Der Eindruck, in einer anderen Welt zu sein, wurde durch die Grauschattierungen der sich ausbreitenden Nacht noch verstärkt. Immerhin konnte man irgendwann die Kuppeln des Höhlenklosters in seinen Umrissen erkennen und so näherten wir uns dem eigentlichen Stadtkern. Vor einem mächtigen vielstöckigen Bürohaus in einer boulevardartigen, breiten Straße hielten wir an. Es war kalt, der Wind eisig, auf den Straßen lag Schnee. Die Menschen, dick eingehüllt in Mänteln und wärmende Kleidungsstücke, huschten schattenhaft und wortlos vorüber. Auf der anderen Straßenseite, am Ende einer aufsteigenden Treppe, ein steinernes Denkmal; vermutlich Lenin, genau zu erkennen war es an diesem Winterabend nicht; die Straßenlaternen verloren ihr Licht im Widerschein der verschneiten Straßen.
Die Räumlichkeiten des Bürohauses, in das wir geführt wurden, waren überdimensioniert groß, doch wenig einladend, mit dem einfachsten Mobiliar ausgestattet. Die Räume waren ungeheizt. Jedem unserer Begleiter wurde ein Zimmer zugeteilt mit Bett, Tisch, Stuhl, Waschbecken und dem Kommentar, man würde uns morgen um 8:00 Uhr wecken. Wegen der durchdringenden Kälte war an Schlaf kaum zu denken. Immer wieder stand ich auf, um mit Bewegung meinem Körper ein wenig wärmende Aufmerksamkeit zu geben. So war ich auch schon gegen 6:00 Uhr wach und blickte auf die unten vorbeiziehende Straße. Im Gegenlicht der in der Nachtbeleuchtung seltsam vereinsamten Schneeflächen sah ich neben einzelnen vorüberhuschenden Gestalten zwei in langen Reihen geduldig stehende Menschen vor schon geöffneten Geschäften. Es war eine seltsam bedrückende Stimmung, in der frostigen Kälte draußen so lange Schlangen geduldig wartender Menschen zu sehen auf der Suche nach dem Nötigsten für den Tag.
Nach dem Frühstück, eine Tasse schwarzer Kaffee, eine Scheibe Schwarzbrot, Butter und Speck, fuhren wir zum Krankenhaus 25. Auf holprigen Straßen mit tiefen Löchern fuhren wir durch die aus dem Schlaf erwachende Stadt und kamen schließlich vor einer Schranke zum Stehen. Ein schon älterer Mann trat aus einer seitlich stehenden Baracke und drückte das kurze Ende des Schlagbaumes nach unten. Die Ärzteschaft des Krankenhauses erwartete uns im Schreibzimmer des Chefarztes. An den Wänden eine Fülle von Zertifikaten in kyrillischer Schrift, in einer Glasvitrine Insignien ärztlicher Kunst (Bücher, Stethoskop und manch veraltetes Instrumentarium). Die Ärzte, Frauen und Männer, stellten sich in langen, weißen Gewändern und einer hygienischen Kopfbedeckung vor. Es folgte eine sehr freundliche Begrüßung durch den Chefarzt und die Betriebsrätin, die Dolmetscherin übersetzte. Es waren sehr glückliche Augenblicke. Wir wurden durchs Haus geführt, Behandlungsräume, OP-Säle, Patientenzimmer, sämtliche im Zustand der absoluten Renovierungsbedürftigkeit, die technischen Geräte veraltet, kaum noch gebrauchstauglich. Das Erscheinungsbild der Klinik machte uns betroffen, ja traurig und immer mehr waren wir überzeugt von der Notwendigkeit unserer Hilfsbemühungen. Wir halfen die inzwischen eingetroffenen Lastkraftwagen auszuladen, es waren alte sowjetische Militärfahrzeuge. Die Menschen waren von großer Freundlichkeit und liebenswerter Hilfsbereitschaft. Am Abend sagte man uns, dass für den nächsten Tag eine Stadtrundfahrt und am Abend ein Konzert in einem orthodoxen Kloster geplant sei.
Ein kleiner Bus holte uns am nächsten Morgen von unserem Quartier im Bürohaus an der breiten Straße ab. Die Stadt war erwacht; in verhaltener Lebendigkeit trotzte sie der winterlichen Kälte. Wir fuhren gar nicht weit, wenige Straßen entlang, bis der Bus vor einem großen Holzbau stehen blieb: Das Große Tor von Kiew. Ein gewaltiges Erinnern an den Schluss der vielfach gehörten Tondichtung „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski. Endlich wurde das konkret, was bisher nur angedacht und aus dem Jenseits musikalischer Ferne immer wieder angeregt wurde. So also begann die Fahrt durch das winterliche Kiew. Und dann kam noch etwas, was der vergänglichen Zeit entrissen ist und wie ein Siegel der Kultur das reiche Innenleben von Kiew dauerhaft prägt: Das Sophien- und das St. Michaelskloster und etwas abseits das Höhlenkloster. Als ob die Seele Kiews in diesen großartigen und würdigen Gebäuden Gestalt angenommen und sich für die Ewigkeit eingerichtet hätte. Auf Schnee bedeckten Straßen, einen Weg suchend durch den unruhigen Verkehr fuhren wir weiter – nichts ahnend den Spuren der Geschichte folgend.
Etwas außerhalb der Stadt erreichten wir eine Schlucht innerhalb eines größeren Waldgebietes. Man klärte uns auf; es ist die Schlucht, in der die Deutschen an einem Tag über dreißigtausend Juden erschossen haben; es war der 29. September 1941. Auch das ist Kiew, eine in seiner Geschichte geschundene und verwundete Stadt. Das Herz scheint still zu stehen angesichts dieser unbegreiflichen Tragödie und der unvorstellbaren menschlichen Schuld. „Auch das ist Kiew“, dieser Gedanke begleitete uns auf der weiteren Fahrt. Plötzlich machte der Fahrer Halt an einer alten, der Witterung preisgegebenen Steinmauer. Die Dolmetscherin, gleichzeitig unsere Stadtführerin, erzählte: „Hinter dieser Mauer befindet sich ein kleines Stadion. Deutsche Wehrmachtsangehörige forderten ukrainische Gefangene zu einem Fußballspiel heraus. Noch vor dem Spiel legten die Deutschen fest, dass die Ukrainer im Falle des Verlierens freigelassen, im Falle des Gewinnens aber unmittelbar nach dem Spiel erschossen werden würden. Das Spiel wurde gespielt; am Ende wurden die ukrainischen Gefangenen erschossen“. Wir fuhren weiter durch die verwundeten Straßen Kiews. Überall an den Fassaden der durch das sozialistische System verarmten Häuser schien gequältes Blut zu kleben, menschliches Leid und immer wieder Schuld, erst Stalin und dann die Deutschen und jetzt wieder die Russen, Was kann ein Mensch, was eine Stadt ertragen, was aushalten?
Beim Rückzug der Deutschen 1941 zerstörte die deutsche Luftwaffe große Teile der Stadt; Hitler hatte den Befehl gegeben, Kiew auszulöschen. Millionen von Kiewer Bürger wurden auf langen Märschen nach Deutschland in die Zwangsarbeit gezwungen, die meisten von ihnen starben. Was Hitler nicht geschafft hat, ist heute das Ziel Putins. Doch gehen wir noch einmal zurück zu jener ersten Fahrt durch diese großartige Stadt. Mit vielen Ereignissen aus der Biographie Kiews konfrontierte uns die Dolmetscherin und gleichzeitige Stadtführerin Doch hinter den oft bedrückenden Beschreibungen entstand mehr und mehr ein Bild von den in dieser Stadt lebenden Menschen. Es entstand das Bild eines starken, wehrhaften, lebensgereiften, furchtlosen Menschen, fest im Glauben stehend, stets dem Leben zugewandt. Ein kurzes Jahrzehnt vor den teuflischen Umtrieben der Deutschen war es Stalin, der nicht nur Millionen von Toten zu verantworten hat (Holodomor und umfassende Erschießungskommandos), sondern auch durch unzählige Maßnahmen versuchte, die Geschichte der Ukraine und ihre Kultur ins Namenlose zu verdammen. Die russisch-ukrainische Geschichte ist die Geschichte von Kain und Abel. Doch die Geschichte geht weiter und es wird David sein, der schließlich obsiegt.
Am Abend, es hatte den ganzen Tag über geschneit, gingen wir die letzten Schritte zu Fuß durch einen Vorgarten ins Höhlenkloster. Die schneebeladenen Kuppeln im nächtlichen Widerschein einzelner Laternen vermittelten eine Stimmung von Innerlichkeit und vorbereitender Stille. Die Türen standen offen und schnell wurde unser Blick auf die Bildgestaltung des Inneren gelenkt. Von unzähligen Kerzen erleuchtet strahlten die ikonenhaften Wandbilder, unsere Gedanken völlig vereinnahmend, wie bildgewaltige Glaubensbekenntnisse. Es herrschte vollkommene Stille. In den vorbereiteten Stuhlreihen nahmen wir schweigend Platz. In diese erwartungsvollen Stille hinein begann der Chor zu singen. Gregorianische Gesänge. Man sah den Chor nicht, er klang von überall her und eindrucksvoll nahmen seine Klänge den Kontakt auf zu den zum Leben erweckten Wandmalereien. Alles wurde eins in seinem unbändigen Verkündigungswillen. Wir waren gerührt und betroffen. Schweigend und nachdenklich fuhren wir zurück in unser Quartier. Am nächsten Abend waren wir eingeladen zum gemeinsamen Abendessen in der Datscha des Klinikdirektors. Neben reichhaltig gedeckten Tischen und einer nicht enden wollenden Ermunterung, die Freundschaft zu besiegeln, lernten wir die Freundlichkeit und Offenheit zugewandter, fröhlicher Menschen kennen, die manch äußerem Mangel die Fülle eines belebenden inneren Reichtums entgegenzusetzen wussten.
Es vergingen 20 Jahre, in denen ich Kiew nicht sehen sollte. Inzwischen hatte die zweite Hälfte meines Berufslebens begonnen; ich befasste mich mit der Natur und insbesondere mit in der Natur vorkommenden Wirkstoffen, die in der Medizin Verwendung finden. Im Jahr 2011 wurde ich wissenschaftlicher Berater einer Firma, die sich mit pflanzlichen Wirkstoffen befasst und entsprechende Medikamente herstellt, mit Zulassungen ihrer Präparate in Deutschland, in Österreich und in der Ukraine. So kam es, dass ich in diesen Ländern unterwegs war, um in Vorträgen und Fortbildungsveranstaltungen die Bedeutung dieser Wirkstoffe wissenschaftlich zu untermauern. In der Ukraine, die intensiv um die moderne Medizinentwicklung und um eine Angleichung an westliche Standards bemüht war, entwickelten sich bei den immer häufiger werdenden Kontakten freundschaftliche Verbindungen mit Kollegen aus allen Fachbereichen der Medizin. So lernte ich Kollegen in Universitätskliniken und anderen medizinischen Einrichtungen kennen und über sie gewann ich und meine Begleiter Einblicke in die Buntheit des gesellschaftlichen Lebens in der Ukraine.
Die regelmäßigen Besuche in die Ukraine führten uns häufig nach Kiew, aber auch in vielen anderen Städten entstanden eine Vielzahl persönlicher Kontakte, ja freundschaftliche Beziehungen. Jede dieser Städte, die wir kennengelernt haben, hat einen sehr eigenen Charakter in Abhängigkeit von ihrer Entstehung und ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung. Das heutige Erscheinungsbild dieser Städte verglich ich unweigerlich mit jenen Eindrücken, die vor 20 Jahren bei meinen ersten Besuchen in Kiew entstanden sind. So erinnerte ich mich an die damaligen, in sozialistischen Stereotypien verarmten und wundgeriebenen Stadtbilder, an das schattenhaft verängstigte Dasein der Menschen, doch auch damals schon an den entschlossenen Willen, das Leben zu gewinnen und freundschaftlich die Hand zu reichen. Im Unterschied zu den damaligen Eindrücken erlebte ich jetzt ein völlig verändertes Land. Alles war nach vorn gerichtet, in eine Zukunft, die von Freiheit und Tatendrang gekennzeichnet ist, von Gestaltungswillen und dem festen Glauben an eine Gesellschaft, in der jeder eine Chance, jeder eine Möglichkeit hat, seine Lebensvorstellungen zu realisieren. Es ist eine frühlingshafte Aufbruchstimmung, durchdrungen von einer tiefen Überzeugung des Gelingens.
Ein Land, endlich in die Unabhängigkeit und in die Freiheit entlassen, ist auf dem Weg, bunt und stark zu sein und es entwickelte sich zu einem bunten und starken Land. Die Grundlage von allem war die Freiheit, die jedem Gedanken die Chance zu seiner Verwirklichung bot. Als einen tiefen Einschnitt in die nach vorn gerichtete Aufbruchstimmung erlebte die Ukraine die Annexion der Krim im Jahr 2014. Es war ein an Perfidie, Brutalität und Lüge nicht zu überbietender völkerrechtswidriger Vorgang. Der Westen reagierte mit wortreichem und lautstarkem Missfallen. Wenig später unterzeichnete die Bundesrepublik Deutschland den Vertrag zu Nord Stream 2. Doch damit endete nicht das abscheulich aggressive Verhalten Russlands gegenüber der Ukraine. Mit Unterstützung durch anonymisierte russische Soldaten, deren Existenz Putin lange bestritt, führten oppositionelle Gruppen einen lokalen Abnutzungskrieg in den östlichen Oblasten; mit erheblichen Verlusten auf beiden Seiten. Kurz vor Beginn dieser militärischen Auseinandersetzung besuchten wir die Stadt Donezk. Wir erlebten sie wie ein wirtschaftlich in voller Blüte stehendes Wintermärchen. Der Flughafen am Rande der Stadt war eben erst fertiggestellt worden; eine, lichte Stahl-Glas-Konstruktion – wenige Tage später erreichte sie das Kriegsgeschehen, es blieben nur noch Schutt und Trümmer, von menschlichen Opfern ganz zu schweigen. An den Außenmauern von St. Michael in Kiew vergrößerte sich täglich die Anzahl der photographischen Portraits im Osten gefallener ukrainischer Soldaten. Über viele Jahre sorgte Russland für den Fortgang dieser bestialischen Grausamkeiten im Osten. Die Ukraine aber beugte sich nicht.
In den anderen Städten, die wir regelmäßig besuchten, ging das Leben weiter, in Odessa, in Dnipro, in Charkiw, in Lemberg (Lwiw) und natürlich in Kiew. Was sind das für wunderbare Städte! In jeder von ihnen ist der Wille spürbar, das eigene Leben in das große Erfolgsvorhaben des aufstrebenden Landes zu stellen. An jeder Ecke entstanden kleine Geschäfte, Cafés und Startups mit erkennbarem Fleiß, mit Hingabe und Stolz.
Jede dieser Städte atmet auf ihre Weise den Geist einer großen und stolzen Vergangenheit und einer Zukunft voller Zusagen und Versprechen. Und jede dieser Städte hat ein eigenes Profil markanter Schönheiten, wie etwa in Odessa die Skulptur von Richelieu, dem ersten Bürgermeister der Stadt, oben an der Potemkin’schen Brücke mit Blick auf den Hafen, aufs Meer und in die Weite des Himmels. Oder in Charkiw, der ehemaligen Hauptstadt der Ukraine, mit seinen 30 Universitäten und Hochschulen, mit ihrer modernen Architektur. Um den größten Marktplatz Europas schlägt das Herz der Jugend mit Neugier und Lebenszuversicht. Oder in Kiew, wo man auf dem Dach des Hotels „Interkontinental“ einen atemberaubenden Blick über ganz Kiew genießen kann. Gleich nebenan das Kloster St. Michael, einen Steinwurf entfernt das Außenministerium und die Polizeizentrale; etwas weiter weg das große, moderne Fußballstadion und drüben, jenseits des Dnjepr die unzähligen Hochhäuser der Stadt.
Ob Stadt oder Land, überall ist die Zukunft der Ukraine greifbar. Es ist ein Land, das mit großem Willen und beeindruckender Entschiedenheit dabei ist, Freiheit im Kontext demokratischer Werte zu leben und die Fülle neuer Errungenschaften konsequent in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens einzubringen. Während sich ein solches Land bestens als Partner für eine friedliche Existenz, aber auch als Partner für eine wirtschaftliche und kulturelle Kooperation eignen würde, sieht Putin in der Ukraine eine existenzielle Bedrohung. Es bedrohen ihn die Freiheit und die aufblühende Wirtschaft. Aus der Sicht Putins wäre der Krieg schon gewonnen, wenn es ihm gelänge, die Ukraine komplett zu zerstören.
Putin hat in den vergangenen Jahrzehnten alle wirtschaftlichen Kapazitäten vorrangig zum Ausbau und der Entwicklung militärischer Technologien genutzt. Wirtschaft war für ihn nicht Wegbereiter für einen allgemeinen Wohlstand, für soziale Programme oder für kulturelle Gestaltungen. Kultur ist nicht seine Sache; die Interessen eines Geheimdienstlers beziehen sich auf Machtdemonstration und Intervention. Freiheit ist für ihn nicht nur ein Dorn im Auge, er macht sie zur existenzentscheidenden Grundsatzfrage. Eben das macht ihn gefährlich für die freie, westliche Welt. Wer gegen die Freiheit ist, der ignoriert das Leben, er tötet die Wahrheit. Der Westen sollte nicht aufhören, daran zu denken.
Anhand der zeitlichen Zuordnung der einzelnen Kapitel ergibt sich eine ungefähre Projektion auf die Chronologie des bisherigen Kriegsverlaufs und der sich daraus ergebenden Probleme. Jedes Kapitel ist geschrieben unter dem Eindruck der jeweils aktuellen Begebenheiten und ist dennoch der Versuch einer jeweils ganzheitlichen Betrachtung. Aus diesem Grund sind Wiederholungen bedauerlicherweise unumgänglich.
Danken möchte ich Herrn Norbert Krämer und Herrn Christian Molter für die Mithilfe bei der Entstehung dieses Buches, für ihre Beratung und ihre fachmännische Begleitung.
Mutlose Empörung
Politische Absichtserklärungen im Konjunktiv, wie verlässlich können sie sein? Der Indikativ gehört dem, der das Gesetz des Handelns innehat. China und Russland handeln, sie loten aus, was möglich ist. Wie weit der Konjunktiv des Westens, insbesondere Europas belastbar ist: Die Annexion der Krim, der Krieg im Donbas; die systemische Vereinnahmung von Hongkong. Von diesen Erfahrungen wird es abhängen, wie es in Taiwan, wie es in der Ukraine weitergeht. Europa erweist sich keineswegs als stabil – im Gegenteil: Der Zusammenhalt relativiert sich durch die Ansprüche und die Egoismen seiner Mitglieder. Europa handelt so oft im kläglichen Konjunktiv, wenn es überhaupt beabsichtigt, zu handeln. Europäische Empörung hat somit immer etwas Mutloses, etwas Unentschiedenes, etwas entschlossen Zaghaftes. Dies gilt insbesondere für sein außenpolitisches Selbstverständnis, für sein Erscheinungsbild im internationalen Geschehen.
Zwei politische Systeme stehen sich gegenüber: Die absolute Kontrolle im totalitären Machtanspruch auf der einen, das demokratische Prinzip der individuellen Freiheit, auf der anderen Seite. Im ersteren stehen Macht und Anspruch des Staatsapparates im Mittelpunkt, im letzteren das Wohl und die Würde des Menschen, jedes einzelnen Bürgers. Im Zentrum des ersteren steht der Wille, den Machtanspruch zu erhalten und zu verteidigen, ihn nach Möglichkeit auszuweiten. Im Mittelpunkt des letzteren steht die Freiheit als ein anerkanntes und respektiertes individuelles Gut. Der Zusammenhalt innerhalb der beiden Systems ist auf sehr unterschiedliche Art gewährleistet: Im ersteren durch eine unerbittliche und allgegenwärtige staatliche Kontrolle, im letzteren durch einen inneren Konsens hinsichtlich Mitverantwortung und Solidarität. Das erste System erscheint auf den ersten Blick stark, effektiv und jederzeit handlungsfähig, während das zweite angewiesen ist auf Meinungs- und Konsensbildung, auf das Zusammenwirken von oft widersprüchlichen Überzeugungen. Im ersten Fall ist es das Machtzentrum, welches mit eiserner Hand für Stabilität sorgt; im zweiten Fall sind es persönliche Überzeugungen und das Festhalten an Werten, die das demokratische Gefüge lebendig erhalten. Die Stabilität ist stets so groß wie die hinter den Werten stehende Überzeugung.
Die Demokratie lebt von der Wechselwirkung zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft. Jeder Mensch hat eine Daseinsberechtigung und jeder Mensch hat zu Recht Ansprüche für die Umsetzung seines eigenen Lebensentwurfes. Jeder Mensch hat das Recht respektiert zu werden, vice versa hat jeder Mensch die Pflicht, seine Mitmenschen zu respektieren und sie zu achten. Jeder Mensch hat die gleichen Rechte und Pflichten. Ansprüche, die jeder Mensch zur Geltung bringen kann, enden dort, wo das Recht des oder der Anderen beginnt. Das zwischenmenschliche Leben ist auf die Wahrnehmung dieser sensiblen Grenzbereiche hin ausgerichtet. In diesen Grenzen sichert die Demokratie das Lebens- und Existenzrecht eines jeden Einzelnen. Ohne Solidarität und eine gewisse Verzicht- und Opferbereitschaft ist Demokratie nicht vorstellbar und nicht praktikabel. Für den Einzelnen bedeutet dies, neben den eigenen Interessen stets das Ganze im Auge zu behalten. So lebt und profitiert der Einzelne von der Solidarität der Anderen und die Anderen leben und profitieren von der Verzicht- und Opferbereitschaft des Einzelnen. Die Hauptgefahr für das demokratische Gefüge lauert darin, die Gültigkeit dieser Grenzbereiche nicht mehr ernst zu nehmen, Grenzen zu missachten, Rechte zu missbrauchen und damit die Überzeugungen hinsichtlich der demokratischen Werte zu schwächen.
Ein totalitäres System wird immer bereit und entschlossen sein, seinen Machtanspruch zu verteidigen. Eine Demokratie handelt nicht primär nach macht- und geopolitischen Gesichtspunkten; ihrem Wesen nach lebt sie von der geteilten Überzeugung hinsichtlich der elementaren Bedeutung menschlicher Werte, wie Freiheit und Gerechtigkeit. Dadurch, dass das totalitäre System vorrangig machtpolitische Ziele im Auge hat, ist es bereit und fähig, Machtmittel auch gegen das Wohl des Menschen einzusetzen. Eine solche Politik geht über die Menschen hinweg. Das totalitäre System denkt in den Kategorien der Macht. Das demokratische System denkt und lebt in den Kategorien ideeller Werte. Um seine Macht zu verteidigen bzw. seinen Machtanspruch auszuweiten bedient sich das totalitäre System aller verfügbaren Machtmittel durch Anordnung und Verfügung von oben. Es rechtfertigt seine Maßnahmen und motiviert die Bürger über das Konstrukt der vermeintlichen Bedrohung. Auch in der Demokratie lauert Bedrohung, in der Regel nicht von außen, sondern von innen. Für die Gewährleistung der menschlichen Werte ist primär jeder Einzelne verantwortlich. Es geht um das Bewusstsein einer Existenz in der Gemeinschaft, die der Staat repräsentiert. Der Staat greift regelnd in das Leben ein; nie ist er im demokratischen Verständnis selbst das Leben! Auch der Staat ist gefragt, wenn es darum geht, die demokratischen Werte lebendig zu erhalten. Die eigentliche Verantwortung aber trägt der Einzelne, Wie weit reicht die Bereitschaft, in der Selbstverständlichkeit, das Angebot der Freiheit zu nutzen, für den Erhalt dieser Freiheit einzustehen und zum Erhalt dieser Freiheit Verzicht zu leisten oder gar Opfer zu bringen? Denn so, wie die alles kontrollierende Macht im totalitären System zu ihrem Erhalt alle Mittel der Verteidigung mobilisiert, stellt sich für eine Demokratie die Frage, was sie für wert erachtet, verteidigt zu werden. Könnte es aber sein, dass Wohlstand unseren Blick getrübt hat, dass Eigeninteressen dem Blick auf das Ganze im Wege stehen? Die Mitverantwortung scheint Risse zu bekommen. („Ich bin sehr dafür, Flüchtlinge aufzunehmen, doch bitte nicht hier!“; „Wir brauchen dringend grüne Energie, aber für die Windräder und die Nord-Süd-Trassen werden sich andere Orte finden lassen). Die Solidarität verliert im Freiheitsanspruch ihre gesellschaftspolitische Bedeutung („Ich werde mich nicht impfen lassen; ich habe das Recht, mich so zu entscheiden“). Unabhängig von der scheinbar sachlichen Begründung dieser Entscheidung, wird offensichtlich, dass sie abseits des gemeinschaftlichen Bewusstseins getroffen wurde. Und es sind andere Beispiele: Gedankenloses Geschäftsgebaren korrumpiert die Moral („Wenn wir die Lieferung von Waffen einstellen, verlieren wir tausende Arbeitsplätze“). Mit Sanktionen gegen Russland versucht der Westen, Russland von ihrem möglichen Vorhaben, in die Ukraine einzumarschieren abzuhalten. Mit Solidaritätsbekundungen zeigt der Westen Mitgefühl und verspricht der ukrainischen Bevölkerung ideellen Beistand. Eine Möglichkeit wäre, Russland vom internationalen Netzwerk (Swift) auszuschließen. Auf die Frage, was das für Russland bedeuten würde, antwortet ein renommierter Wirtschaftsfachmann: „Es wäre so, als würden Sie über Russland eine Atombombe zünden“. Mehr als 100 000 Soldaten und mörderisches Kriegsgerät stehen unmittelbar an der ukrainischen Grenze. Der Westen hätte demnach eine Möglichkeit, dem Einmarsch hohe Hürden entgegenzusetzen. Es gibt nun nicht wenig deutsche Firmen, für die der Profit Vorrang hat vor allen Überlegungen der Hilfe und der Solidarität; sie ignorieren die Sanktionen und unterlaufen sie. In der Ukraine droht ein Krieg; so manche Firma befürchtet einen Schaden für die deutsche Wirtschaft für den Fall von Wirtschaftssanktionen. So viel zur Opferbereitschaft in unserer Demokratie. Eine Demokratie ist so stark wie ihr Glaube an die Werte, von denen sie lebt.