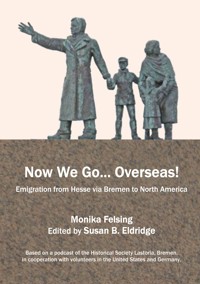Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Es war einmal eine Mundart, die war in einem Dorf in Oberhessen deheem. Irgendwann aber hörten die Leute auf, die Untertasse Bleedche und die Hakenleiste Krabbeläisd zu nennen. Immer weniger Eltern erzählten Kindern Geschichten, in denen ein Ruudkäbbche oder sewwe Roawe vorkommen. Auch in diesen hochdeut- schen Märchen spielt der Dialekt eine Nebenrolle. Anders als im Original, einem Buch in oberhessischer Mundart unter dem Titel "Es woar èmo".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen Eltern,
meinem Bruder,
meinen Großmüttern,
meinen Onkeln und Tanten
und ein paar von denen,
die wir so nannten.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Stadtmusikanten
Roths Käthchen und die Wölfe (Kein Märchen).
Der Schneider und seine Frau
Von einer, die sich fürchtete, dass das Wissen ausgehen könnte
Die sieben Raben
Sechs kommen durch die ganze Welt
Schdombs Lies-che
Allerleineu
Die Margret und das Hänschen
Das arme Kind
Das verrückte Huhn
Der
Hannebambel
Das Schabernackchen
Die Katze und der Hund und der Siebenschläfer
Die Schlampe und ihr Schelm
Die verwunschene Spinnstube
Die Schlange im Wald
Der Fuchs und die sieben alten Leute
Der Umstandskrämer
Mit Schimpf und Schande
Die Suppenschmeckerin
Der alte Kostverächter
Das Zwitscherchen
Drei
Zwerche
und vier
Ewwerzwerche
und das Mädchen im schneeweißen Kleidchen
Der Hännes im Glück
Makkaronien
Von Kohlweißchen und Rosenmottchen
Der Stichling und die Kaulguappe
Das
henneschdèverreschdè
Haus
Die Bohnenstange, die Dickmamsell und der kleine Kerl
Keentied
Die Runkelrübenrupfmarie
Der Tollpatsch
Ein bekannter Unbekannter
Der Eisprinz und die Prinzessin Limone
Die Gans als Baumeister
Von Menschen und Bäumen
Fledermäuse im Glockenturm
Die Äpfel, die ihren Baum nicht loslassen wollten
Von einem, der fortging, um Kapitän zu werden
Die zauberhafte Hakenleiste
Das
Muhbleedche
und der
Rungge
Der Winter macht Urlaub
Anhang
Geschichtsverein Lastoria Bremen
Dank
Vorwort
Märchen, Sagen und Legenden verraten uns, wer wir sind und woher wir kommen. Einige der berühmtesten Mär-chen der Welt sind in Hessen aufgeschrieben worden: In Kassel haben die Brüder Grimm aus Hanau sich im frühen 19. Jahrhundert allerhand Geschichten erzählen lassen und ihre Sammlungen schon bald als Bücher unters Volk gebracht. In Oberhessen sind Sagen und Legenden von Generation zu Generation weitergegeben worden, gruselige oder lehrreiche Geschichten über weiße Frauen, Grenzsteingeister, Schimmelreiter, Laternenläufer und andere geheimnisvolle Gestalten. Allein aus Ober-Gleen, Owenglie, aus dem Dorf im Vogelsbergkreis, aus dem ich stamme, sind mehrere solcher Sagen bekannt. Erzählt worden sind solche Geschichten früher in den Spinnstuben, wenn sich die Jugend und die Jungen Erwachsenen im Winter zum Feiern trafen und sich ein bisschen gruseln wollten.
Im Blog Owenglie auf meiner Website veröffentliche ich meine oberhessischen Dialektmärchen mit Musik als Tonaufnahmen mit Vokabeln. Angefangen hat alles mit einer Mundartversion der Stadtmusikanten, die ich im Frühjahr 2023 für die „Sprachmusikanten“ des Bremer Literaturhauses aufgenommen hatte. Immer noch fast ein Geheimtipp: Das Projekt des Literaturhauses hat eine Website, auf der die Geschichte vom Esel, vom Hund, von der Katze und dem Hahn in vielen verschiedenen Sprachen der Welt zu hören sind. Auch auf Plattdeutsch und im Ober-Gleener Pladd
Sprachen bauen Brücken und geben uns die Möglichkeit, die Welt auf andere Weise zu verstehen und uns selbst anders zu erleben und auszudrücken. Wer über eigene Fehler schmunzeln kann, hat in einer anderen Sprache viel Gelegenheit dazu. Ich habe die Mundart meiner Ober-Gleener Vorfahren von Grund auf lernen müssen, mit Hilfe meiner Ober-Gleener Großmutter, aber auch von Freundinnen, Nachbarn und Nachbarinnen, und bin dankbar für diese Chance. Was weg ist, ist weg. Und deshalb geht es mir auch nicht in erster Linie ums Märchenerzählen, sondern darum, die oberhessische Mundart lebendig zu halten. Die hochdeutsche Übersetzung ist keine Brücke, sondern eher ein Steg.
Einige meiner Märchen sind von Grimmschen Märchen inspiriert, andere sind eigenständige Geschichten oder haben andere Bezüge. Wenn ich schreibe, lasse ich mich nicht nur von meiner Fantasie leiten, so schön es auch ist, sich die Abenteuer von Kobolden und Feen auszumalen. Viele meiner Märchen haben einen wahren Kern, schildern das Leben früherer Generationen oder in der heutigen Zeit. Mit manchen will ich die Erinnerung an einzelne Menschen, an vom Aussterben bedrohte Tiere, sich verändernde Regionen und besondere Begebenheiten am Leben halten. Häufig kann ich aus den Büchern schöpfen, die wir mit unserem Bremer Geschichts- und Kulturverein Lastoria in ehrenamtlicher Arbeit herausgebracht haben, und aus Gesprächen mit Menschen, denen ich als Journalistin und Historikerin beruflich oder als Hessin, die in Bremen lebt, privat begegne oder noch begegnen könnte.
Die meisten dieser Geschichten sollen unterhalten und nehmen ein glückliches Ende, weil der Mensch nicht ohne Hoffnung oder ohne Humor leben kann. Ein paar Gestalten, die in Grimms Märchen schlecht wegkommen, habe ich rehabilitiert, wie die Ilsebill, den Wolf oder die angebliche Hexe in „Hänsel und Gretel“, das bei mir „Die Maggreed on es Hänns-che" (Margret und Hänschen) heißt. Mehrere Märchen habe ich dem Gedenken an Opfer von Gewalt oder Menschen mit Zivilcourage gewidmet, wie Ruuds Käddche (Roths Käthchen) über Käthe Roth aus Lauterbach und ihre Verwandten, die jüdischen Verfolgten geholfen haben, und Es oarme Keand (Das arme Kind) über Elsa Eislöffel aus Offenbach, die Enkelin eines Ober-Gleeners, die körperbehindert war und im Alter von 16 Jahren in Hadamar umgebracht worden ist.
Märchen sind Erzählkultur. Mundarten sind Erzählkultur. Musik ist in gewissem Sinne auch Erzählkultur. Ich habe die drei gemeinsame Sache machen lassen und reiche jetzt zum besseren Verständnis die Übersetzungen nach. Aber Originale sind nicht zu ersetzen, eine alte Mundart hat ihre eigene Melodie, ihre eigene Weisheit und ihren eigenen Witz, in ihr schwingen Lebenseinstellungen und Erfahrungen von Menschen mit, die nicht mehr unter uns sind, und wenn sie nicht mehr gesprochen wird, stirbt sie aus, wird leiser und leiser, bis sie verstummt und mit ihr die Erinnerung. Beim Hören der Originale im Blog, beim Lesen in dem Mundartbuch „Es woar èmo" geht die Tür zu einer anderen Welt auf. Die hochdeutsche Übersetzung ist ein Schritt auf dem Weg dorthin.
Die Stadtmusikanten
Es war einmal ein Esel, der hat in Oberhessen gewohnt und von klein auf nichts als gearbeitet. Nun war er schon einen Tag älter und war nicht mehr so gut beieinander. Wenn es das steile Mühlgässchen hinaufging, schnaubte er wie eine Lokomotive. Und abwärts war es noch schlimmer! Dann hatte er Angst, der Wagen würde ihn überrollen. Gestern Abend war das Fenster offen, und er hat gehört, worüber die Müllerfamilie beim Essen gesprochen hat. „Mir reicht’s“, sagte Müllers Karl. „Unser Esel taugt nur noch für Ahle Worscht1. Dem kannst du die Hufe beim Laufen beschlagen. Lass uns den Metzger holen, und wir kaufen uns einen Lastwagen, einen elektrischen oder einen mit Wasserstoff." Und weil er keine Ahle Worscht werden wollte auf seine alten Tage, machte sich der Esel aus dem Staub. „Etwas Besseres als den Tod findest du überall“, hat er sich gesagt. Und recht hatte er.
Und dann traf er einen Hund, der heulte, dass man es nicht aushalten konnte. „Zu wem gehörst du denn“, fragte ihn der Esel, wie sich das gehört. „Ei“, heulte der Hund, „ich bin der Hund des Ortsdieners.“ „Und warum heulst du dann so?“ „Ach, der Ortsdiener braucht mich nicht mehr. Er hat seinen Posten verloren! Jetzt passt die Polizei auf, dass sich alle an die Gesetze halten. Und die Leute haben Alarmgeräte, die sehen und hören mehr als ich! Meine Leute wollten mich ausstopfen lassen und ins Museum stellen. Da bin ich fort, und jetzt weiß ich nicht, wohin.“ „Ei, dann kommst du mit nach Bremen. Da machen wir Musik auf den Straßen und sitzen abends im Ratskeller.“ Dem Hund war’s recht.
Und so sind sie zusammen die Weser lang, wie früher die Leute, wenn sie auswandern wollten. Aber zu Fuß. Schon bald kamen sie zu einem Baum, auf dem saß eine Katze und weinte. „Was ist denn los“, fragte der Esel die Katze. „Ei, meine Leute wollen mich nicht mehr, weil ich alt bin und den lieben langen Tag am Ofen liege und schlafe. Meine Work-Life-Balance würde nicht stimmen, haben sie gesagt. Ein bisschen zu faulenzen wäre ja ganz schön. Aber gar nichts zu tun, wäre auch nichts. Bevor ich mich rauswerfen lasse, geh ich lieber von selbst. Und jetzt suchen sie mich nicht!“
„Dafür haben wir dich gefunden“, sagte der Esel. „Auf, komm mit nach Bremen, da kannst du singen und beim Ofen liegen, so viel du willst.“ Und so sind sie weiter, und es dauerte nicht lange, da sahen sie einen Hahn auf einem Leitpfahl sitzen, der sah aus wie ein gerupftes Huhn. „Mensch, was ist denn mit dir passiert“, fragte der Esel. „Ich bin nicht mehr in Mode“, klagte der Hahn. „All die Jahre habe ich meine Leute morgens geweckt, und die Nachbarn auch. Und jetzt beschweren sich die Leute über mich und ziehen vor Gericht und sagen, ich wäre ihnen zu laut! Und dass sie Suppe aus mir machen wollen! Da bin ich fort, so schnell, wie ich konnte! Wenn es auf dem Land keine Hähne mehr geben darf, wo soll ich dann hin?“ „Nach Bremen", sagte der Esel. „Da kannst du so laut sein, wie du willst. Wenigstens morgens.“
Die vier Alten sind weiter, und der Weg nach Bremen war doch weit. Da haben sie sich was zum Schlafen gesucht und ein kleines Häuschen gefunden. Mitten im Wald. Das Dumme war nur: Da wohnten Räuber drin, wilde Kerle, die saßen da und aßen und tranken. „Unser erstes Publikum“, sagte der Esel. „Wenn die von den Socken sind, sind es andere auch.“
Und so haben sie, ohne zu proben, ihr erstes Konzert gegeben. Weil sie keine ordentliche Bühne hatten, ist der Hund auf den Esel geklettert und die Katze auf den Hund und der Hahn auf die Katze. Was für ein Lied sie gesungen haben, weiß niemand mehr. Aber die Räuber waren von den Socken – und auf und davon. Da sind der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn ins Haus und haben darauf gewartet, dass ihr Publikum zurückkam. Und als die Räuber nachschauen wollten, was los war, haben sie eine Zugabe bekommen, dass die Wände wackelten! Da sind die Räuber ab nach Hamburg. Und wenn die vier Viecher nicht gestorben sind, dann singen sie noch heute und nehmen Platten auf!
„Wir sind die Stadtmusikante’,
vier Viecher, weltbekannt!
In Bremen haben wir Verwandte,
sind ihnen nur noch nie begegnet!“2
1Ahle Worscht – nordhessisch, auf Oberhessisch: aale Woaschdeine Dauerwurst aus Ober- oder Nordhessen, meist luftgetrocknet, gern mit Knoblauch. In Oberhessen sagt man auch ruure Woaschd, rote Wurst, oder Schdragge (Gerade, auch ein Wort für einen Menschen, der sehr geradeaus ist, anderen etwas ins Gesicht sagt ohne Rücksicht auf deren Gefühle).
2 Wörtliche Übersetzung des Mundartliedertextes: „Mir sai die Schdaddmusigaande, vicher Viecher weaidbekaand. Ean Breme huh merr Verwaande, saien nur nonnie begaand.“ Vicher heißt vier, vier vor, fier füv, und Viecher sind Tiere. Nicht verwechseln!
Roths Käthchen und die Wölfe (Kein Märchen)
Es war einmal, und das ist wahr, eine Familie Roth3, die hat in einem kleinen Städtchen im Vogelsberg gewohnt. Das waren gute Menschen. Sie hatten selbst nicht viel, aber was sie hatten, haben sie geteilt – mit Menschen, die noch weniger hatten.
Die Zeiten waren schlecht, und viele Menschen auch. Schon Kinder liefen durch die Straßen, in braunen Hemden, und schrien Juden raus!“ Denn die hatten was gegen Juden und auch gegen Zigeuner, wie man die Sinti und Roma damals genannt hat, und gegen alle, die ihnen nicht recht gegeben haben. Gefolgt sind sie ihrem Führer, einem kleinen Mann mit Seitenscheitel und einem kurzen Schnurrbart. Wenn der im Radio zu hören war, schrie er noch lauter als alle anderen zusammen. Der war so voller Hass, dass du es mit der Angst bekommen konntest. Und wie er das Sagen hatte im Land, gab’s Mord und Totschlag. Wer konnte, hat seine Heimat verlassen. Wer blieb, wusste nicht, wohin, oder hat gedacht: Dieser Schwindel wird bald ein Ende haben.
Tausend Jahre wollten die in den braunen Hemden regieren. Am Ende waren es zwölf. Zwölf lange, böse Jahre. Roths sind in ihrem Städtchen geblieben. Sie waren keine Sinti oder Roma und auch keine Juden, aber sie hatten Nachbarn, die waren nicht mehr sicher, und das war schlimm. Die hatten nicht mehr genug zu essen, durften nicht mehr an die Arbeit gehen und ihre Kinder nicht mehr in die Schule. Nicht einmal ins Kino ließ man sie. Und kein Doktor wollte sie mehr behandeln. Alles, was sie hatten, mussten sie nach und nach abgeben, auch ihr Vieh, ihren Radioapparat und ihre Fahrräder.
Ein paar aus der Familie Roth haben in der Molkerei gearbeitet, und so war immer genug Milch und Käse und Quark im Haus. Eines Tages hat Roths Käthchen was in ihr Körbchen getan und ist losmarschiert. Auf der Bahnhofstraße hat sie einen von denen in den braunen Hemden getroffen, der wollte wissen, wo sie hin sollte.
„In den Wald, zu meiner Oma“, sagte sie. „Ich will ihr was zu essen bringen, denn sie ist schon alt und kann nicht mehr für sich selbst einkaufen.“ „Ich hab gar nicht gewusst, dass du eine Oma hast, die im Wald wohnt“, sagte der Kerl und guckte, als könne er keiner Fliege etwas zu leide tun. Aber Roths Käthchen war auf der Hut. „Das ist eine angeheiratete Verwandte“, sagte sie. „Wir sagen nur Oma, weil sie so alt ist, dass sie meine Oma sein könnte.“
„Und wo wohnt die genau?“ Er wollte es wissen. „Ganz hinten im Wald, wo sich die Hasen und die Füchse gute Nacht sagen. Und jetzt muss ich weiter, ich bin spät dran, und es wird schon bald dunkel.“ Und weg war sie. Sie ging aber nicht in den Wald, sondern lief durch ein paar Gärten und stellte die Sachen, die sie im Körbchen hatte, an die Hintertüren der Häuser von Bekannten. Niemand durfte es sehen. Und so hat sie sich nicht lange aufgehalten und ist nach Hause.
Eine ganze Zeit ging das so, und wer es mitbekam, hat nichts gesagt. Eines Abends wäre sie denen in den braunen Hemden beinahe in die Falle getappt. Die hatten Steine in die Fenster von Häusern geworfen, die Juden gehörten. Und dann standen sie auf der Straße und freuten sich.
Roths Käthchen kam um die Ecke und sah, was los war. Die Scherben auf der Straße, und die Leute, die Maulaffen feilhielten. Wie sonst auch, hatte sie ihren Korb dabei und darin Quark aus der Molkerei und Käse und ein paar Äpfel aus dem Garten.
„Na, willst du wieder in den Wald“, fragte der Kerl, der sie schon einmal angehalten hatte, und tat, als ob nichts wäre. „Nein, heute nicht“, sagte Roths Käthchen. „Ich habe bloß ein paar Steine im Korb. Die habe ich beim Spazieren-gehen aufgelesen, und jetzt weiß ich nicht, wohin damit.“
„Ei, da wüsste ich dir was“, sagte der Kerl und lächelte ganz böse. „Willst du nicht auch einen Stein werfen auf das Haus der Juden?“
Roths Käthchen schaute ihn an und sah, wie klein seine Augen waren vor lauter Hass, und der Mund war nur noch ein Pinselstrich. Und die Ohren leuchteten vor Aufregung. „Ei, ja, warum denn nicht“, sagte Roths Käthchen und packte schnell was aus ihrem Korb, und bevor er gewahr wurde, was das war, flog ein Pfund Quark durch eins von den zerstörten Fenstern ins Haus.
Der Kerl und die anderen jubelten wie verrückt. „Jetzt kriegen sie, was ihnen zusteht“, schrien sie. Und Roths Käthchen dachte an den Quark und sagte: „Das will ich doch hoffen.“
Ihre Familie hat noch lange Zeit Juden etwas zu essen gebracht. Bis nach Frankfurt am Main sind sie gefahren, und das war weit. Herumgesprochen hat sich das erst viel, viel später. Und dann wollte es keiner mehr wahr haben, wie weit manche in ihrem Hass gegangen waren. Und wie viele weggesehen hatten.
Roths Käthchen hat noch eine ganze Weile gelebt. Und wenn sie und ihre Familie nicht gewesen wären, dann würden sich Steine nie in Quark verwandeln.
3Familie Roth wohnte in Lauterbach. Die märchenhafte Erzählung ihrer wahren Geschichte und das dazu gehörige Mundartlied, ein Original, ist Käthe Roth gewidmet, aber auch Elfriede Roth, ihrer Nichte, deren Eltern und Bruder. Elfriede war in ihrer Jugend auch Schabbesmädchen der jüdischen Familie Weinberg.
Der Schneider und seine Frau
Es war einmal ein Schneider, der hatte eine Frau, die wusste, was sie wollte. Und das hat ihm gefallen. Schon bei der Hochzeit hat sie gesagt: „Ich will.“ Und er: „Ich auch.“ Die zwei waren sich sehr einig. Und wenn die anderen gelästert haben, er hätte ja zu Hause nichts zu sagen, dann lachte er nur. „Ich will, was die Ilse will.“ Das war sein Glück.
Eines Tages war er in der Stadt zum Einkaufen. Gemüse stand auf seinem Zettel, und da hat er Wirsing genommen. Auf dem Heimweg dachte er, er hätte sich verhört. Aber nein, der Wirsing sprach mit ihm! „Ich bin kein Gemüse“, sagte er. „Lass mich frei.“
„Das wird ja immer schöner“, sagte der Schneider, „Jetzt hat ein Wirsing schon Wünsche.“ „Ich bin kein normaler Wirsing“, sagte der Wirsing. „Ich bin ein verzauberter Minister. Lass mich frei, setz mich hier auf den Acker, und du darfst dir was wünschen.“ Das hat sich der Schneider nicht zweimal sagen lassen. „Ich lasse dich frei, aber was für Wünsche kannst du mir denn erfüllen?"
„Große Straßen kann ich bauen lassen, sechs oder acht Spuren, da kannst du bis nach Frankfurt fahren oder nach Kassel.“ „Ich weiß nicht“, sagte der Schneider. „Ich will mal meine Frau fragen gehen.“ Und er ist heim. Die Ilse hat schon auf ihn gewartet, auf ihn und auf den Wirsing. Aber die Tasche war leer.
„Sag mal, wo ist denn der Wirsing", fragte sie. „Hast du nicht dran gedacht?" „Doch, doch", sagte er. „Aber er wollte nicht mit. Er hat gesagt, er könnte uns einen Wunsch erfüllen, wenn ich ihn frei lasse." „So was", sagte Ilse. „Und was hast du gewollt?" „Ich will das, was du willst“, sagte er. „Große Straßen will er uns bauen lassen. Was meinst du, brauchen wir die?“
„Geh mir fort mit großen Straßen", sagte Ilse. „Die Wiesen und die Wälder sind mir lieber. Sag’s ihm!“ Und so ist er zurück zum Wirsing und hat es ihm gesagt.
„Keine großen Straßen", wunderte sich der Wirsing. „Wie wär’s denn, wenn ihr so schnell fahren dürftet, wie ihr wollt?" „Ich will, was die Ilse will", antwortete der Schneider und machte sich wieder auf den Weg nach Hause. Ilse hat sich angehört, was sie sich wünschen konnte, und hat nur den Kopf geschüttelt. „So schnell kann ich gar nicht fahren mit unserem alten Wagen. Und gut ist das auch nicht. Liest der denn keine Zeitung? Geh und sag’s ihm: So was will ich nicht.“
Und der Schneider ist wieder fort zum Acker, wo der Wirsing wartete. „Und was will sie, deine Ilse", fragte er den Schneider. „Nicht so schnell fahren, und die anderen sollen das auch nicht."
„Das ist zu viel verlangt“, sagte der Wirsing. „Aber ich weiß dir was. Ich habe noch ein paar Roller, die fahren mit Strom, nicht so schnell wie ein Auto, aber auch ganz schön. Der Minister vor mir hat sie angeschafft. Wie wär’s?"
„Ich will, was die Ilse will“, sagte der Schneider und stellte sich auf einen Roller und fuhr heim. Als er ums Eck kam, stand Ilse auf dem Hof und schlug die Hände überm Kopf zusammen. „Was ist denn das für ein Scheißding?“, rief sie. „Ei, ein Elektroroller. Der Wirsing will ihn uns schenken.“ „Den kann er behalten“, sagte die Ilse. „Auf so einen Hobel stell ich mich nicht. Nicht für eine goldene Geiß!4 Da lauf ich lieber.“
Und so brachte der Schneider den Elektroroller wieder zurück. „Willst du ihn nicht“, wunderte sich der Wirsing. „Alle anderen sind wie verrückt darauf.“ „Ich will, was die Ilse will“, sagte der Schneider. „Und die Ilse läuft lieber.“
„Euch ist nicht zu helfen“, sagte der Wirsing. „Ihr wisst ja nicht, was euch entgeht!“
„Doch, das wissen wir“, sagte der Schneider. „Alle halbe Stunde wollen wir einen Bus, am liebsten ein Sonnenmobil, und mit der Bahn weiter nach Frankfurt und nach Kassel. Und gute Wege für die Fahrräder und für die Fußgänger. Und billige Fahrkarten für den öffentlichen Verkehr. Und Mitfahrgelegenheiten für die, die keinen Führerschein haben oder kein Auto oder nicht mehr selbst fahren wollen. Und...“
„Hör auf, hör auf“, schrie der Wirsing. Und wenn er nicht doch noch gegessen worden ist, dann hat es ihm wenigstens die Sprache verschlagen.
4 Nit fier è golden Gäis- nicht für eine goldene Geiß – für nichts in der Welt – ist ein alter oberhessischer Ausspruch.
Von einer, die sich fürchtete, dass das Wissen ausgehen könnte
Es waren einmal Zeiten, da war Wissen etwas, das nicht für alle Menschen gedacht war. Wer es hatte, hat es für sich behalten oder sich’s teuer bezahlen lassen. Dann haben sie die Schulen erfunden und die Universitäten, aber auch nicht für alle. Und dann erst nur für die Jungen und nicht für die Mädchen. Das war lange, bevor Lernen ein Menschenrecht geworden ist, und so etwas gilt überall auf der Welt. Sagt das den Taliban in Afghanistan.
Auf dem Land, in Oberhessen, da hat eine Kleine gewohnt, die hatte, als sie noch im Bauch ihrer Mutter war, zur Hebamme gesagt: „Selber!“ Und hat sich zeigen lassen, wie man auf die Welt kommt. Und schon war sie da. Und hat gefragt und gefragt und wollte alles selbst probieren und wissen.
Wenn sie gefüttert werden sollte: „Selber!“ Und ließ sich zeigen, wie das mit dem Löffel geht. Und löffelte ihren Brei. Als man ihr was anziehen wollte, sagte sie: „Selber!“ Und hat gelernt, wie man in seine Strampelhose kommt, ohne mit dem Kopf im Hosenbein stecken zu bleiben. Als man ihr die Schuhe binden wollte, rief sie: „Selber!“ Und die Nachbarin hat ihr beigebracht, wie das geht: Zwei Schlaufen über Kreuz und dann eine mitten durch gezogen. Der Opa hat ihr gezeigt, wie man den Hühnern die Eier fortnimmt, ohne sie zu erschrecken, die Oma, wie man Salzekuchen5 macht, ein Nachbar erklärte ihr, wie man die Uhr liest. Das hat ihr besonders gut gefallen. „Wenn die Uhr schlägt, ist die Stunde voll“, sagte sie. Und jedes Tick und Tack war eine Sekunde. Und sechzig Sekunden waren eine Minute. Und 60 Minuten eine Stunde. Und vierundzwanzig Stunden ein Tag. „Das ist die Zeit“, sagte der Onkel, wie sie den Nachbarn nannte. „Unendlich. Darum sind die Uhren rund.“
Und die Kleine hat zugehört und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Auch als sie schon in die Schule ging mit anderen Kindern. Und wenn es etwas gab, das ihr jemand zeigen konnte, dann rief sie immer noch: „Selber!“ Oder: „Erklär’s mir!“ „Lehre es mich!“ Nur eine Tante hatte kein Glück: Strümpfestricken hat die Kleine nie gelernt. Das war nicht ihr Ding.
Nachts schlief sie immer und immer schlechter. Die Mutter und der Vater merkten es und haben sich Sorgen gemacht. „Was ist denn mit dir“, wollten sie wissen. „Ist dir nicht gut? Träumst du schlecht?“ „Ei“, sagte die Kleine. „Mir ist so Angst, ich könnte aufwachen, und das Wissen wäre alle, und es gäbe nichts mehr zu lernen. Da schlaf ich lieber nicht ein.“
Und weil niemand wusste, wie viel Wissen es in Oberhessen gab und im ganzen Land und auf der ganzen Welt, konnte auch niemand sie beruhigen. Und die Kleine schlief nicht mehr. Wer sie sah, hat sich erschrocken, sie sah aus wie ihr eigener Schatten*. Das hat sich herumgesprochen, wie so vieles. Und von fern und nah sind Männer und Frauen ins Dorf gekommen, um der Kleinen was beizubringen. Ganz altes Wissen war dabei und auch neues, warm wie frisch gemolkene Milch, die die Kälber zu gern gehabt hätten. Aber so viele Leute auch kamen mit ihrem Wissen: Die Kleine konnte immer noch nicht schlafen.
„Ich habe Angst, das Wissen könnte uns ausgehen", sagte sie. „Alle wissen sie was, aber niemand weiß, wie tief der Brunnen ist, aus dem sie schöpfen. Das haben sie vergessen. Wie soll ich dann glauben, dass immer noch was aus dieser Quelle rauskommt?" Und wirklich, viele Menschen wussten, was sie wussten, aber nicht mehr, von wem. Und wer’s denen beigebracht hatte, von denen sie es gelernt hatten. Ein paar haben gedacht, sie wären von selbst drauf gekommen. Mag sein.
Als die Kleine „selbst“ gehört hat, da hat sie sich ganz dunkel daran erinnert, wie alles angefangen hatte. Und fragte nach der Hebamme. „Ei, die Marie, die ist schon alt, aber wenn du willst, dann besuch sie“, sagte ihre Mutter. „Die freut sich bestimmt.“
Und so ist die Kleine, die nicht mehr so klein war, hinauf ins Dorf und hat bei der Marie an die Tür geklopft. „Wer ist da?“, fragte eine. „Ich bin’s, die Kleine, der du gezeigt hast, wie man auf die Welt kommt.“
„Ach“, sagte die Hebamme. „Nicht dir alleine.“ „Anderen auch?“ „Anderen auch. Erst fragen sie mich: Wie komm ich auf die Wellt und später fragen sie mich: Wo komm ich her? Und wo geh ich hin? Und all solche Sachen.“
Die Kleine stand da und musste ihre Frage loswerden: „Wo kommt das Wissen her? Ich habe Angst, es könnte eines Tages ein Ende haben.“ Die Hebamme hatte schon lange nicht mehr so laut gelacht. „Wer viel fragt, bekommt viele Antworten. Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als die, die glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und du kannst alt werden wie eine Kuh und lernst immer noch was dazu. Ist es das, was du hören willst?“
Sie sah die Kleine an, als ob sie sie wiegen wollte. Aber die war’s nicht zufrieden. „Das sagen die anderen auch. Ich dachte, du wüsstest mehr als alle anderen zusammen.“
„Ei, woher denn?“, fragte die Hebamme und guckte wie eine Katze, die die Mäuse leid ist. So viele waren schon da gewesen und wollten Rezepte fürs Leben haben und was nicht alles. „Woher“, sagte die Kleine. „Na, von den Kindern. Da, wo die Kinder her sind, kommt auch das Wissen her.“
Jetzt war’s auf einmal hell in dem kleinen Häuschen von der Hebamme, als ob die Sonne aus allen Knopflöchern scheinen würde. Das war, weil wieder Strom da war. Ein Zufall, aber einer von der guten Sorte. „Weißt du“, sagte die Hebamme, als sie wieder Worte hatte. „Ich weiß dir was. Geh heim und schlaf dich aus. Heute Nacht kommst du selbst drauf, ob das Wissen ausgehen kann.“
Und so ist die Kleine heim, hat sich ins Bett gelegt und gewartet, ob der Schlaf dieses Mal früher da war als die Angst. Von irgendwo her hat jemand ein Schlaflied für sie gesungen:
Vier Dimensionen6
In der ersten warst’n Punkt
oder auch ne Linie.
In der zweiten warst du rund
oder hattest Ecken,
warst nicht krank und nicht gesund,
musst’ dich nicht verstecken.
In der dritten kugelst du
einfach durch dein Leben,
würfelst manchmal um dein Glück.
Es hat auch Pech gegeben.
In der vierten sehn wir uns
irgendwann mal wieder.
Erkennst du mich, kenn ich dich auch
an lautlosen Schritten....
Und als sie aufgewacht ist, wusste sie nicht mehr, was sie geträumt hatte. Aber die Angst, das Wissen könnte ausgehen, war weg und blieb weg. Und die Kleine hatte kapiert, warum man die Hebammen früher auch weise Frauen genannt hat. Und wenn sie aus ihrem Bett herausgekommen ist, dann lernt sie heute noch alle Tage etwas Neues und ist vielleicht selbst Hebamme geworden. Weise war sie ja schon.
Warum das Wissen nicht ausgehen kann, willst du wissen?
Denk nach, und du kommst drauf.
Selber.
5lm Original: Emm Duud senn Derrflääschraisende, der Dörrfleisch-reisende des Todes.
6 Unserem inzwischen verstorbenen Nachbarn Karl Gemmer gewidmet.
Die sieben Raben
Es war einmal, in alter Zeit, da sind Menschen in Frösche, Bären oder Raben verwandelt worden. In dem Märchen, das ich euch heute erzählen will, war’s umgekehrt. Mir ist, als ob es gestern gewesen wäre.
Rabeneltern im Vogelsberg hatten acht Kinder: sieben Jungen und ein Mädchen. Die Kleine hatte, als Einzige in der Familie, eine weiße Feder in ihrem rabenschwarzen Federkleid. Darum nannte man sie Weißfeder. Als ihre sieben Brüder alt genug waren, um in die Welt zu ziehen, wie Raben das machen, da blieb Weißfeder als Einzige bei ihrem Vater und ihrer Mutter. Die Jungen wollten sie nicht dabei haben.
„Sei nicht traurig, Schwesterchen“, sagte der jüngste Bruder. „Ich denke an dich, so fest, als ob du dabei wärst.“ „Vergiss mich nicht“, sagte sie. Und verdrückte eine Träne. „Verlass dich drauf“, sagte er, und die anderen sechs schworen Stein und Bein, dass sie sie auch nicht vergessen würden. „Niemals“, schrien sie, als sie schon über alle Berge waren. Irgendwo hinten in der Rhön. Mit den Gedanken waren sie schon ganz woanders. Frei zu sein, das war aufregend, und schnell hatten sie alles vergessen, auch wo es heimging und wer ihre Eltern waren und wie ihre Schwester aussah. Nur der Jüngste wusste es noch, aber der hatte nichts zu melden.
Kurz drauf, als sie wieder im Vogelsberg waren, im Wald bei Rimlos, da hat ein Zauberer die sieben Raben eingefangen. Ihm war nach Experimenten, und da verwandelte er sie in Menschen und schickte sie einzeln in die Welt. Wo es doch schon kaum noch Raben gab und schon so viele Menschen.
Daheim machten sich die Rabeneltern Sorgen, denn Rabeneltern lieben ihre Kinder. Kein anderer Vogel, kein Fuchs und kein Hase hatte etwas von ihren sieben Söhnen gehört oder gesehen. So oft sie sich umgehört hatten: Die Jungen waren wie vom Erdboden verschluckt. „Ich will sie suchen gehen“, sagte die Schwester. Aber das war der Mutter und dem Vater nicht recht. Jetzt sind deine Brüder schon alle fort. Das fehlt noch, dass du auch noch verloren gehst. Dann sterben wir Raben aus.“
Sie konnte sagen, was sie wollte: Ihre Eltern blieben dabei. Da ist sie heimlich auf und davon. Und es dauerte nicht lange, und sie war im Wald bei Rimlos, wo der Zauberer wohnte. Ein Dompfaff hatte ihr gezwitschert, dass er ihre Brüder gesehen hatte. Und das dass nichts Gutes bedeuten konnte.
Weißfeder hat den Zauberer gefunden und war schon längst, ohne es zu wissen, Teil von seinem Experiment. „Ich habe deine Brüder in Menschen verwandelt. Wenn du sie findest und sie noch wissen, wer du bist, dann werden sie wieder Raben. Dreimal darfst du dich jedem von ihnen zeigen, und wenn er’s dann noch nicht weiß, bleibt er ein Mensch.“
Weißfeder nahm ihren Mut zusammen. „Darf ich mit ihnen sprechen?“, fragte sie den Zauberer, und der lachte böse und dreckig. „Darfst du. Aber sie verstehen die Rabensprache nicht mehr."
Und so ist sie los. Weil sie schlau war, wie Raben halt so sind, hat sie den Ersten schnell gefunden. Er hatte sich ein Nest gebaut, ein Häuschen auf Menschenart, und hatte ein Weibchen gefunden, und die zwei hatten auch schon Junge. Weißfeder setzte sich auf die Fensterbank, als ihr Bruder mit seiner Familie beim Abendessen war. „liih", schrie seine Frau. „Was für ein großer Vogel! Der scheißt mir die Fensterbank voll! Jag ihn weg!" Und der Bruder hat sie weggejagt.
Der nächste Tag war ein Sonntag, und da stand er alleine draußen im Garten bei seinem Gasgrill. Als Weißfeder in seine Nähe kam, warf er mit einer Grillzange nach ihr, weil er Angst hatte, sie wolle sich ein Würstchen stibitzen.
Der dritte Versuch war auch nicht besser: Da holten die Jungen ihre Zwille und hätten sie beinahe mit einem Stein getroffen. Da ist sie weg und suchte den zweiten Bruder. Der war Filmstar geworden, weil er so geheimnisvoll aussah und so einen traurigen, verlorenen Blick hatte, als ob er nicht wusste, wo er hingehörte. Weißfeder setzte sich auf einen Baum in seiner Nähe, als sie einen neuen Naturfilm mit ihm drehten. Aber ihr Bruder hatte nur Augen für die Kamera.
Am zweiten Tag hat ein Beleuchter sie verjagt, weil sie durchs Bild geflogen war, und ihr Bruder sagte nichts dazu. Am dritten Tag hätten sie einen Raben gebraucht für ihren Film, und ihr Bruder sagte: „Nehmen wir doch den. 1st doch egal, die Krähen sind doch eine wie die andere!“ Doch seine Schwester, die er nicht erkannt hatte, war schon auf und davon.
Ihren dritten Bruder hat sie in Frankfurt am Main gefunden, der war Banker geworden und saß in einem Hochhaus mit verspiegelten Fenstern. Drei Tage lang ist sie um das Haus gekreist, weil sie nicht sehen konnte, wo er sein Büro hatte, und er ist an keinem Tag herausgekommen. Sogar das Fernsehen war schon da, um über den Raben zu berichten, der in der Bank nisten will. Aber Weißfeder wollte kein Nest bauen, die war schon auf und davon.
Der vierte Bruder war, wie sie gehört hatte, Vogelkundler und arbeitete im Frankfurter Zoo. Das war nicht weit. „Der muss mich erkennen“, sagte sie sich. „Der kennt sich aus.“ Als sie im Zoo gelandet ist, gab’s gleich Alarm. „Ein Rabe ist frei“, schrie einer. „Fangt ihn bloß wieder ein!“ Und schon kamen sie angelaufen, auch ihr Bruder, gut zu erkennen an seinen rabenschwarzen Haaren. Der pfiff die anderen zurück. „Lasst ihn! Das ist keiner von unseren Raben. Den habe ich noch nie gesehen!“
Am nächsten Tag war Weißfeder wieder da. Dieses Mal war sie allein mit ihm und sah ihm sehr lange in die schwarzen Augen. Ihr Bruder murmelte lateinische Namen. Sie hatte ihm auf Rabenart geantwortet, aber er hatte sie nicht verstanden. Und so war sie fortgeflogen. „Schade“, sagte er, und es zuckte um seinen Schnabel, seinen Menschenmund.
Beim dritten Versuch war’s nicht besser. Ihr Bruder wollte sie fangen, um nachzusehen, ob sie einen Chip hatte oder einen Ring. Da flog sie auf und davon.