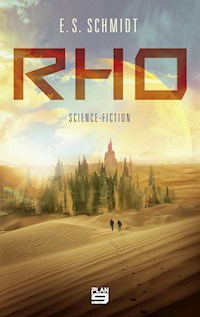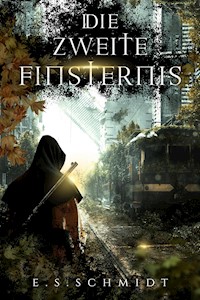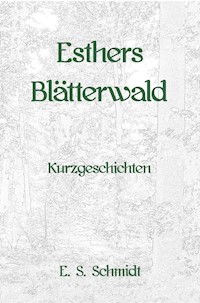
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In dieser Autoren-Anthologie sind Kurzgeschichten von E. S. Schmidt versammelt, die im Laufe von drei Jahrzehnten entstanden sind. Einige davon sind bereits in Zeitschriften und Anthologien erschienen, andere werden hier zum ersten Mal veröffentlicht. Sie handeln von Ankunft und Abschied, Rache und Erlösung, Liebe und Tod. Fast immer aber geht es um Hoffnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
E. S. Schmidt
Esthers Blätterwald
Kurzgeschichten
eBook-Ausgabe 2022
Copyright © Esther S. Schmidt, Frankfurt am Main
www.esther-s-schmidt.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung der Autorin wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Esther S. Schmidt
Satz: Esther S. Schmidt
epubli, ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Vorwort
Für einen Schriftsteller sind Kurzgeschichten eine Möglichkeit, sich auszuprobieren. Stilmittel, Genres, Ideen lassen sich rasch umsetzen. Zudem zeigen einem die Ergebnisse von Wettbewerben und Ausschreibungen, ob man schon gut genug ist, um in eine Zeitschrift oder Anthologie aufgenommen zu werden. Vielleicht ist es dann ja auch an der Zeit, mal mit dem großen Roman zu beginnen.
Ich danke daher den Klein- und Kleinstverlagen, die immer wieder Anthologien finanzieren, auch wenn sich damit erfahrungsgemäß kein Geld verdienen lässt. Ihr fördert den Nachwuchs!
Die folgenden der in diesem Band versammelten Geschichten wurden bereits erstveröffentlicht, und zwar:
Die Leine: Verlassene Orte, Corinna Griesbach (Hrsg.), p.machinery, 2012
Im Café: Naturkost Kalender, Bio-Verlag GmbH, 2009
Einsamkeit: Rote Lilo Trifft Wolfsmann, Duft des Doppelpunktes (Hrsg.), 2008
Kaslov: Schreib-Lust Print, Schreiblust-Verlag, 2009
Der Einzelgänger: Geschichten auf vier Pfoten, Codi-Verlag, 2011
Bombenkeller
Als Kind denkt man, dass die eigene Mutter schon immer genau das gewesen ist – eine Mutter. Man glaubt, dass sie schon immer unter der Woche arbeiten gegangen ist, schon immer am Wochenende Kuchen gebacken und schon immer beim Fernsehen gebügelt hat. Erst später wird einem klar, dass auch sie einmal ein junges Mädchen gewesen ist, mit schwarzen Zöpfen und weißen Kniestrümpfen.
Zu der Zeit, als meine Mutter schwarz bezopft und weiß bestrumpft ist, wütet ein furchtbarer Krieg. Ein Krieg, der nach Sirenen klingt und nach dumpfen Detonationen. Ein Krieg der dunklen Keller, dessen Zerstörung man nicht sieht, während sie geschieht, sondern erst danach, wenn man aus den Kellern wieder hinaufsteigt in eine entsetzlich veränderte Welt. Ein Krieg, der mehr noch als alle vorangegangenen in den Köpfen stattfindet, nicht nur wegen der allgegenwärtigen Propaganda, sondern auch wegen der Bilder, die in den Köpfen entstehen, während man sich mit Anderen im Bunker zusammengedrängt, lauschend auf das mechanische Heulen, das zugleich ängstigt und beruhigt – denn direkt unter den Bomben hört man deren Heulen nicht.
Zum Zeitpunkt, an dem meine Geschichte einsetzt, wird meine Mutter auf dem Weg durch den Grüneburg-Park vom Warnsign1al der Sirenen überrascht. Fliegeralarm. Sie ist ein Kriegskind, sie weiß, was zu tun ist, wenn die Sirenen singen.
Als befinde sich eine entsetzliche Kreatur in der Mitte des Parks streben die Menschen nach allen Richtungen hinaus – im Nu ist er menschenleer. Nur ein einzelner Mann steht verloren auf der Lindenwiese, steht dort wie verwirrt und schaut sich um.
»Kommen Sie!«, ruft meine Mutter ihm zu und winkt. »Wir müssen in die Kaiser-Siegmund-Straße!«
Der Mann dreht sich um, und ob er ihre Worte versteht oder ihr Winken, jedenfalls kommt er zu ihr herüber. Ein junger Mann ist er, gute Figur, dunkles Haar, intensive, blaue Augen. Vielleicht schaut meine Mutter ihn ein wenig kokett an, vielleicht verguckt sie sich sogar ein bisschen in ihn – wenn sie auch noch recht jung ist und Kniestrümpfe trägt.
Doch der Bunker in der Kaiser-Siegmund-Straße ist weit weg. Schon hört man aus der Ferne die Motoren brummen. Die Beiden mischen sich unter die Leute, die in ein Wohnhaus drängen, dessen Keller zu einem Schutzraum ausgebaut wurde. Meine Mutter hat hier schon manches Mal gesessen und kennt das eine oder andere Gesicht. Vielleicht durch Zufall kommt sie neben dem Mann aus dem Park zu sitzen. Er kauert vornübergebeugt, die Ellenbogen auf die Beine gestützt, den Kopf gesenkt, als ob er niemanden anschauen wolle.
Eng ist es im Keller und muffig. Meine Mutter lernt in diesen Tagen, dass Angst stinkt: nach Schweiß, nach Mundgeruch und nach den Eimern hinter den Türen, die mit »Männer« und »Frauen« beschriftet sind. Niemand spricht. Wer mag schon plaudern, wenn um ihn her die Welt in Trümmer geht?
Ein Heulen, dann eine Erschütterung. Eine Frau hebt lauschend den Kopf. »Das war im Norden. Vilbel, vielleicht, oder Friedberg.«
Natürlich kann sie das unmöglich aus dem dumpfen Poltern herausgehört haben, doch einige nicken. In den Köpfen entstehen Bilder brennender Dörfer.
»Die Tommys sollen schon fast am Rhein sein«, sagt ein Mann.
Wieder Bilder, von Panzern diesmal und Soldaten, die unerbittlich näher rücken, und von denen man nur Schlechtes zu erwarten hat. Lassen sie nicht die Bomben regnen? Werden sie sich nicht rächen wollen für den Krieg, den Deutschland ihnen gebracht hat.
»Die kamen von Westen, nicht wahr? Nicht von Norden, diesmal. Sie waren doch einer der letzten. Haben Sie die Bomber schon gesehen?«
Die Worte sind an den Mann aus dem Park gerichtet, doch der schaut nicht auf, antwortet auch nicht. Fragende Blicke treffen ihn.
»Wollen Sie dem Herrn nicht antworten?«
Jemand stößt ihn an. Er sieht hoch – ein stummer Blick, nicht ohne Intelligenz, doch ohne Verstehen.
Und jetzt entstehen andere Bilder in den Köpfen: Von einem britischen Soldaten, der abgeschossen wurde. Von einem Ballen Fallschirmseide, irgendwo im Park versteckt. Von der Gestapo, der man ihn übergeben müsste. Aber nicht bevor man ihn hat spüren lassen, was man von Spionen hält. Kleine Feuer entzünden sich in den Köpfen, werden tuschelnd geschürt. Es tut gut, dieses Gefühl, man könne etwas machen, wenn man tatsächlich nur hilflos in einem Keller sitzt und darauf wartet, dass Feuer und Bomben einem alles nehmen. Die ersten stehen auf, ballen die Fäuste, ziehen die Brauen zusammen.
Weiß er, was hier geschieht? Spürt er, wie Angst und Misstrauen zu einem giftigen Gericht einkochen? Das Mädchen, das einmal meine Mutter sein wird, spürt es, und schüchtern schiebt sie ihre Hand unter seinen Arm. Ihre helle Stimme übertönt das Tuscheln und sogar das Dröhnen von draußen.
»Onkel Harald ist taubstumm«, sagt sie trotzig. Und dann, zu ihm hochschauend: »Gell? Das nächste Mal gehen wir wieder in den Bunker an der Kaiser-Siegmund!«
Er schaut sie an. Seine Mundwinkel dehnen sich zu einem warmen Lächeln, in dem ein klein wenig Traurigkeit liegt. Dann hebt er die Hand und streicht ihr über das Haar. Das Tuscheln verstummt. Draußen melden die Sirenen Entwarnung.
Hand in Hand verlassen sie den Keller. Erst, als die Menge sich zerstreut hat, lösen sie sich voneinander, wie in abgesprochener Übereinkunft. Die Bertramswiese liegt vor ihnen. Ihre Schritte werden langsamer, sie bleiben stehen, wenden sich einander zu. Und dann sagt er doch etwas: zwei Silben, deren Bedeutung meiner Mutter verschlossen bleibt und über deren Klang sie bereits unsicher ist, als er die Kastanienbäume vor dem Park erreicht hat.
Und dennoch nimmt sie diese beiden Silben ohne Klang und ohne Bedeutung mit sich wie ein Kleinod. Sie verstaut sie in den Schubladen ihrer Erinnerung und manchmal zieht sie das Seidentuch darüber zur Seite und betrachtet sie. Und dann glaube ich in einem versonnenen Lächeln das schwarzbezopfte, weißbestrumpfte Mädchen zu sehen, das meine Mutter einmal gewesen ist.
<><><><><><><>
Die Leine
Die Leine musste jemand gespannt haben, als der Kirschbaum noch dünner gewesen war. Inzwischen war sie in seine Rinde eingewachsen und vermutlich genauso morsch wie der Pfosten an ihrem anderen Ende. Trotzdem: wenn Peter mit seinem klapprigen Rad den Waldweg entlangkam, hingen manchmal Kleider daran.
Das war umso erstaunlicher, als das Sommerhaus, das zu der Leine gehörte, schon seit Jahren nicht mehr bewohnt war. Der Garten war von einem heruntergetretenen Drahtzaun umgeben und völlig verwildert. Früher einmal musste jemand ihn liebevoll gepflegt haben: An der Hausseite blühten noch verwilderte Gladiolen, und unter einer Art Efeubusch hatte Peter eine steinerne Vogeltränke entdeckt. Doch wer immer sich hier einst seine Oase am Waldrand geschaffen hatte, er war lange fort. Bewohnt wurde das Grundstück nur noch von schwarz und weiß gefleckten Katzen, wohl alle Nachkommen eines gemeinsamen Urahns, die durch das hohe Gras streiften oder blinzelnd auf den sonnenwarmen Platten der Veranda saßen.
Peter kannte die meisten von ihnen, denn wenn er die Leine besuchte, setzte er vorher stets ein wenig von seinem Taschengeld ein, um Futter zu kaufen. Die Tiere waren verwildert und schreckhaft. Nachdem er mehrmals erfolglos versucht hatte, eines zu streicheln, begnügte er sich damit, ihnen aus zwei, drei Schritt Entfernung beim Fressen zuzusehen.
Ihr Urahn hatte sich seinerzeit sicher auf dem abgewetzten Sofa zusammengerollt, das Peter durch die erblindeten Scheiben des Hauses erkennen konnte. Das war immer wie der Blick in eine Zeitblase: in ein Wohnzimmer ohne Fernseher, aber mit einem riesigen Radio und seltsam geformten Sesseln. In eine Küche mit pastellbunten Schränken und schwarz-weiß kariertem Boden, und in ein Schlafzimmer mit einer braun-grünen Strickdecke auf dem Ehebett aus lackiertem Holz. Es war, als schliefen hier die Jahre, eingekuschelt unter einer Decke aus Staub.
Als er das erste Mal über den Zaun gestiegen war, hatte Peter sich wie ein Einbrecher gefühlt. Nach unzähligen Besuchen aber war dies »sein« Garten geworden, so sehr, wie die Ortschaft im Tal »sein« Dorf war, und der Forst »sein« Wald. Er kannte die Stellen, an denen die kleinen Walderdbeeren reiften, und die Ecke, wo der Igel unter modrigen Brettern überwinterte.
Und er kannte die Leine.
Im Sommer hing oft ein farbenfrohes Kleid oder eine grelle Bluse daran, im Herbst eher mal ein Pullover oder eine Jacke. Im Frühjahr aber, wenn der Garten aus seinem Winterschlaf erwachte, dann tanzte ein luftiges Kleid voller Rüschen und aufgedruckter Blumen mit den Kirschblüten im Wind.
Peter wusste nicht, wer die Kleider aufhängte. Er hatte noch nie einen Menschen im Garten gesehen. Weder im Sommer noch im Winter hatte es jemals Reifenspuren an der Einfahrt gegeben, und weder der Staub im Haus noch der in die Tür geklemmte Grashalm waren jemals verwischt worden. Und dennoch wechselten die Kleider auf der Leine mit den Jahreszeiten. Manchmal blieb die Leine auch leer, und an diesen Tagen fühlte Peter eine leise Enttäuschung.
***
An solch einem Tag tauchte Kevin auf. Wusste der Himmel, was den von seiner Spielekonsole weggerissen hatte, aber er bemerkte Peter, der unter den herbstbunten Blättern des Kirschbaumes lag und las. Mit einer gewollten Bremsspur brachte Kevin sein Mountainbike zum Stehen. »Was machst‘n da?«
Peter hob das Buch. »Was glaubst du wohl?«
»Hier?« Kevin ließ scheppernd das Rad fallen und stieg über den Zaun. Zum Glück war es schon fast Mittag. Peter schaute demonstrativ auf die Uhr.
»Ich muss eh heim«, sagte er. »Mittagessen und so.« Er stand auf, während Kevin gelangweilt gegen den Pfosten der Wäscheleine trat.
»Lass das!«
»Das gehört doch eh keinem mehr.«
»Das ist nicht wahr. Manchmal hängt Wäsche auf der Leine.« Peter biss sich auf die Lippen. Ihm war, als hätte er ein Geheimnis verraten. Ein Geheimnis zwischen ihm und dem Garten.
»So’n Quatsch!« Kevin trat nochmal gegen den Pfosten, stärker diesmal. »Der kippt doch schon, und die Schnur da hält auch nichts mehr aus.«
»Nicht!«, rief Peter, doch es war zu spät. Mit einem hässlich raspelnden Geräusch riss die Leine. Peter hätte Kevin am liebsten ins Gesicht geboxt.
»Hab dich nicht so. War doch nur ne blöde Leine.«
Natürlich. Wer immer sie benutzte, konnte sich eine neue spannen. Und doch hatte Peter das Gefühl, dass etwas zerrissen war, das sich nicht mehr heilen ließ.
***