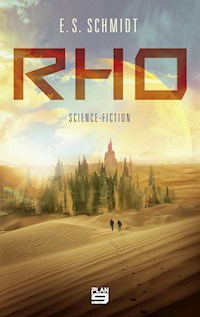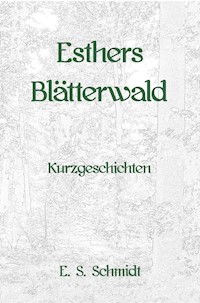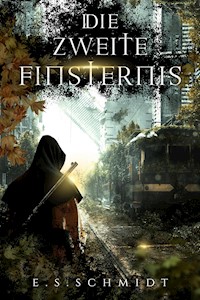
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Endlosigkeit der kanadischen Wälder stürzt ein außerirdisches Schiff ab und entlässt seine gefährliche Fracht: Reaper – telepathische Raubechsen, groß wie Löwen, mit enormer Reproduktionsfähigkeit und unersättlichem Hunger. Hinter hohen Mauern, zusammengedrängt in den ehemaligen Metropolen, harren die letzten Menschen aus. Die einzigen, die sich den Reapern entgegenstellen können, sind genetisch optimierte Krieger, die in Mönchsorden zu absoluter Disziplin erzogen werden. Doch als eine Stadt nach der anderen verstummt, befürchtet Bruder Kaleb, dass sich ein noch größerer Feind erhoben hat. Ein Feind, der nicht nur die zerbrechliche, neu geschaffene Ordnung bedroht, sondern auch den einzigen Menschen, für den Kaleb sein heiliges Gelübde brechen würde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die
zweite Finsternis
Print-Ausgabe 2022
Copyright © der E-Book Ausgabe Esther S. Schmidt, Frankfurt am Mai9n
Copyright © der Print-Ausgabe 2021 Esther S. Schmidt, Frankfurt am Main
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung der Autorin wiedergegeben werden. Coverdesign und Umschlaggestaltung: Florin Sayer-Gabor - www.100covers4you.com unter Verwendung von shutterstock/lassedesignen
Satz: Esther S. Schmidt
Druck der Print Ausgabe: epubli
Website: www.esther-s-schmidt.de
Prolog
Bill drückte die Sprechtaste des Funkgeräts. »Siehst du einen Krater? Oder Anzeichen eines Brandes? Over.«
Als Antwort kam nur lautes Knacken aus dem Lautsprecher. Mit einem Seufzen senkte Bill das Mikrofon und wartete. Er ließ seinen Blick durch das schmutzige Fenster der Bodenstation schweifen, über das Rollfeld von »Alain’s Wilderness Flights«. Dahinter gab es nichts als dichten Wald und vereinzelte Indianersiedlungen bis hinauf nach Alaska. Irgendwo in dieser namenlosen Wildnis lag ein Ort, den die Internetgemeinde »Impact Creek« getauft hatte. Dorthin war der Helikopter vor einer guten Stunde aufgebrochen.
Ein Knacken kündigte die Antwort an. »Noch nichts zu sehen. Wir müssen …« Das Geräusch der Heli-Rotoren überlagerte den Rest des Satzes, oder vielleicht lag es auch am alten Funkgerät der Station.
Bill hob das Mikrofon und drückte erneut den abgegriffenen Knopf. »Alain? Alles klar bei euch? Over!«
Wenigstens kamen die Bilder von Frosts kleiner Handheld gut durch.
Bill setzte sich vor den Laptop und suchte auf dem Bildschirm nach ungewöhnlichen Konturen in den dichten Baumkronen.
»Wir haben was gefunden.« Alain musste die Stimme gegen den Rotorenlärm erheben. »Sieht nach eurer Schneise aus. Over.«
Eine Sichtung schon beim ersten Erkundungsflug? Das hatte Bill nicht zu hoffen gewagt. Alain hatte ihnen erklärt, dass selbst eine so große Bresche in der menschenleeren Weite da draußen kaum auffallen würde – zumal die Natur bereits einige Jahre Zeit gehabt hatte, sie mit neuem Grün zu bedecken. »Großartig!«, rief Bill. »Gibt es Brandspuren?«
Die Funkverbindung wurde erneut schlechter und Bill erhielt nur eine zerstückelte Antwort. »... keine Anzeichen … Feuer …« Dann stabilisierte sich der Empfang wieder. »Die Bäume sind einfach umgerissen worden.«
»Wie breit ist die Schneise?«
»Ich schätze etwa siebzig Yards, wie aus den Satellitenbildern errechnet.«
Bill lehnte sich zurück und ließ die Stuhllehne federn. Er hatte also recht gehabt: Es war kein Meteorit gewesen.
Er und Frost hatten die Alternativen lange diskutiert, obwohl sich außer ihnen und einigen Verschwörungstheoretikern niemand sonderlich dafür interessierte, welches Phänomen ein paar hundert Bäume in der kanadischen Wildnis niedergemäht hatte. Der Vorfall war eigentlich eine Lappalie, reichte nicht annähernd an das Tunguska-Ereignis von 1908 heran. Aber immerhin waren nur drei Jahre vergangen, bis sich nun mit Bill und Frost die ersten Wissenschaftler ein Bild vor Ort machten. Bei Tunguska hatte es zwei Jahrzehnte gedauert.
Die größte Parallele zwischen Tunguska und Impact Creek war die Tatsache, dass sich das Phänomen nicht schlüssig erklären ließ. Ein Meteor wäre steiler eingetreten und hätte einen Krater und keine Schneise hinterlassen. Abgesehen davon hätte er eine messbare Anreicherung von Staub in der Atmosphäre verursacht. Flugzeuge waren zur fraglichen Zeit nicht vermisst worden und die meteorologischen Daten sprachen gegen ein Wetterphänomen.
Bill und Frost hofften auf eine andere, spektakulärere Antwort. Eine Antwort, die Bill die unangenehmen Fragen seines Dekans ersparen würde, denn für diese Forschungsreise in die unzugänglichste Gegend der Coast Mountains hatte Bill Geld aus allen Budgets seines Fachbereiches abgezogen.
»Die Schneise endet dort drüben.« Alains franko-kanadischer Akzent dehnte die Worte. »Es sieht tatsächlich aus, als hätte es einen Brand gegeben.«
Bill beugte sich vor. »Sag Frost, er soll die Kamera draufhalten!«
Das Bild wackelte, als Frost die Filmkamera in einen günstigeren Winkel neigte. Bill sah jetzt die Schneise und ihr verdicktes Ende – wie ein Streichholz mit einem abgebrannten Kopf. Verkohlte Bäume stapelten sich dort kreuz und quer übereinander.
»Könnt ihr landen?« Wenn es Platz zum Landen gab, würden sie auch ein Basislager errichten können – sofern es denn tatsächlich etwas zu untersuchen gab.
Es dauerte einen Moment, bis Alain antwortete. »Ja, dort drüben.« Und dann, leiser: »Was ist das für ein Ding?«
Der Bildschirm wurde von übereinanderliegenden Baumstämmen ausgefüllt, unter denen Bill ein Objekt ausmachte; ein Objekt, das auf den Satellitenfotos nicht zu erkennen gewesen war. Bill legte den Kopf schräg. Man hätte es für einen Container halten können, aber dazu war es viel zu groß.
»Vielleicht haben die Bäume die Tragflächen abgeschlagen«, sagte Alain. Offenbar war auch er inzwischen vom Jagdfieber ergriffen worden, obwohl er für die beiden »Spinner« zuerst gar nicht hatte fliegen wollen. Mit dieser Skepsis war Alain weiß Gott nicht allein – auch der kritische Blick des Dekans hatte Bände gesprochen; ganz zu schweigen vom Hohn, der Bill nach seinem wirklich zurückhaltenden Artikel im National Science Monitor entgegengeschlagen war.
Angespannt wartete Bill, beobachtete, wie die Bäume näher kamen und auch das Objekt. Wenn es wirklich ein Wrack war, musste es halb auf der Seite liegen. Wie das Auge eines gefangenen Tieres lugte ein Fenster unter den Baumstämmen hervor. Ein Cockpit?
Frost setzte die Kamera jetzt nicht mehr ab. Durch den flacheren Winkel erkannte Bill, dass der hintere Teil geborsten war. Eine klaffende Öffnung, aber keine Einbauten oder festgezurrte Ladung. Schwer zu schätzen, wie lang das Objekt ursprünglich gewesen war, die Breite war jedenfalls enorm.
Der Helikopter hatte kaum aufgesetzt, als Frost schon mit der Kamera nach draußen sprang. Das Bild auf dem Monitor wankte rhythmisch, während Frost auf die Absturzstelle zuging. Das Rotorendröhnen verebbte, und Stille breitete sich aus.
Bills Blick hing am Bildschirm. »Halt doch die Kamera ruhig!« Ohne den Lärm konnte er nun auch Frost erreichen.
»Ich klettere über Baumstämme!«, antwortete Frost.
Das Objekt kam in Sicht. »Kannst du etwas erkennen? Den Eingang? Ein Cockpit?«
»Warte.« Frost klang aufgeregt. Das Bild auf dem Monitor verwischte, zeigte grüne, blaue, schwarze Schlieren und kam dann zur Ruhe. »Mein Gott, siehst du das?«
»Undeutlich«, gab Bill zurück. »Kannst du es näher ranholen?«
Das Bild verschwamm, als der Zoom betätigt wurde, dann reagierte die automatische Schärfejustierung. Bill sah schwarze Gestalten, verkohlte Überreste hinter geborstenen Scheiben.
Ihm stockte der Atem. »Sind das Helme?«
»Mann, nein, das sieht aus wie Knochenfortsätze. Und sie sind riesig. Allein die Köpfe sind – ich weiß nicht – vielleicht ein Yard lang.«
»Ich wusste es!« Bill sprang auf und boxte in die Luft. »Wir hatten recht, Frost! Wir hatten verdammt nochmal recht!« Er fiel in die Freudenschreie seines Kollegen ein und sprang um seinen Stuhl, bis er merkte, dass die Schreie aus dem Lautsprecher nicht triumphierend klangen – sondern panisch. Und dann wurden sie zu Schmerzensschreien.
Mit einem Ruck wandte er sich dem Monitor zu. Trockene Blätter, Erde und ein Ast quer über dem Bild – die Kamera lag auf dem Boden.
Unvermittelt brachen die Schreie ab. Bill hörte nur noch seinen eigenen Atem.
Er griff nach dem Mikro. »Frost?«, rief er. »Alain?!«
Niemand antwortete. Der Monitor zeigte unverändert das gleiche Bild.
»Alain?!« Bill registrierte die Panik in seiner eigenen Stimme. Das Mikrofon zitterte in seiner Hand.
Und dann hörte Doktor William Robert Johnson ein tiefes, klackerndes Grollen. Es glich keinem Geräusch, das er kannte, weder dem Knurren eines Raubtieres, noch dem Klang des Donners. Es war ein Ton, den er bis zum Ende seines Lebens nie mehr vergaß.
183 Jahre später
Man sah es dem Kreuzgang nicht an, dass er auf das Dach eines Hochhauses gebaut worden war. Tatsächlich strahlte er die Erhabenheit alter Klosteranlagen aus. In den ausgewogenen Proportionen lag eine tiefe Ruhe, und die Sparsamkeit der Ausstattung unterstrich die Würde des Ortes. In der Regelmäßigkeit der wenigen Schmuckelemente kam der wandernde Blick zur Ruhe. Von oben fiel Sonnenlicht in das offene Viereck und wärmte die Herbstluft, die fast nach modrigen Blättern und Erde zu riechen schien.
Weniger erhaben waren das Geräusch aufeinanderschlagender Holzstöcke und der Geruch nach frischem Schweiß, der tatsächlich in der Luft hing. Als Eunice den Wandelgang betrat, hielt sie einen Moment inne. Sie trat zwischen die Säulen und sah zu den zwanzig Männern hinüber, die sich im Innenhof des Kreuzganges im Stockfechten übten. Die Mönche kämpften mit freien Oberkörpern, nur mit den schwarzen Hosen des Ordens bekleidet. Die schlichten Waffen handhabten sie mit beeindruckender Kunstfertigkeit und nur selten erklang ein Ausruf des Schmerzes oder der Frustration, wenn ein Schlag nicht hatte abgewehrt, ein Angriff nicht hatte gekontert werden können.
Einige bemerkten Eunice und unterbrachen ihren Kampf. Gerade die Blicke der Jüngeren folgten ihr, während sie die Säulenreihe entlangschritt. Eunice wurde oft zu jung geschätzt, was sicher auch am asiatischen Anteil ihres Erbgutes lag. Mit ihrem glänzend schwarzen Haar, dem feinen Porzellanteint und gekleidet in die fließenden Stoffe des Hochklerus, wirkte sie nicht wie Ende dreißig. Sie verübelte den Mönchen ihre Blicke nicht – diese Männer opferten dem Klerus ihr Leben.
Eunice folgte dem Gang und blieb nach einigen Schritten abwartend stehen. Ein hochgewachsener Kämpfer von Anfang vierzig maß sich hier mit einem Greis – und traf dabei auf einen ebenbürtigen Gegner. Die Bewegungen des Alten waren nicht weniger geschmeidig, seine Reaktionen nicht weniger schnell als die seines Trainingspartners.
Eunices respektvoller Abstand galt ebenso den beiden Mönchen wie den wirbelnden Stangen. In dieser Disziplin waren Geschwindigkeit und Geschick wichtiger als rohe Kraft; dennoch erzitterten Stäbe und Muskeln, wenn das Holz aufeinanderkrachte. Manchen der Bewegungen konnte das Auge kaum folgen, aber die Kämpfer ahnten die Angriffe ihres Gegners voraus, planten in jede Aktion bereits den nächsten und übernächsten Zug ein – dies war ebenso ein geistiges wie ein körperliches Kräftemessen.
Schließlich war es der Stab des Alten, der wuchtig sein Ziel fand und den jüngeren Mann in die Knie gehen ließ. Noch einmal zischte die Waffe durch die Luft und kam nur eine Handbreit vor der Schläfe des Knienden zu einem abrupten Halt. Der hob den Kopf und schaute den Sieger schwer atmend an.
Der alte Mann zwinkerte schalkhaft. »Sollte sich deine Konzentration tatsächlich von einem erfreulichen Besuch stören lassen, Bruder Kaleb?«
Ein tiefer Atemzug, ein kurzes Senken des Blickes. Dann erhob sich der getadelte Mönch und der Abt wandte sich um. »Eunice. Was führt dich zu uns?«
Eunice zögerte, hoffte, Kaleb würde zu ihr hinübersehen, doch der hielt den Blick gesenkt. Sie zog einen zusammengefalteten Zettel aus der Tasche. »Die Zentrale konnte Sie nicht erreichen, Vater Abt.«
Er nahm das Papier entgegen. »Gibt es endlich ein Lebenszeichen aus Dallas?«
»Nein, Vater. Noch immer nicht.«
Mit jeder Stadt hatte es heute bereits den üblichen Funkkontakt gegeben – nur Dallas schwieg. Neunzehn Städte gab es noch auf dem nordamerikanischen Kontinent. Niemand wusste, wie viele es auf dem Rest der Erde sein mochten, oder ob es überhaupt noch Menschen gab, dort draußen. Hier, in Philadelphia, wusste man nur von diesen neunzehn – und jetzt versank eine davon in völliger Stille.
Keiner der beiden Männer sagte etwas, als wäre Schweigen die einzig angemessene Reaktion auf das Verstummen von sechzigtausend Menschen.
Der Abt entfaltete den Zettel und überflog die wenigen Zeilen. »Das ist aus Selimsburgh, von Dillon Brent, dem Governor.«
Nun hob Bruder Kaleb doch den Kopf, und für einen flüchtigen Moment begegnete Eunice seinem Blick. Anders als die meisten im Konvent wusste sie, was der Name Selimsburgh für ihn bedeutete.
Der Abt faltete das Papier zusammen. »Brent hat in den Outlands Spuren von Reapern gefunden.«
»Ich kann sofort aufbrechen«, sagte Bruder Kaleb. Die raue Heiserkeit seiner Stimme war einer alten Kehlkopfverletzung geschuldet. Eunice konnte sich gut daran erinnern, wie er ins Lazarettzelt gebracht worden war, an ihr Erschrecken, als sie ihn erkannte, an den Ausdruck seiner hellen Augen in dem schmutzstarrenden Gesicht – so viel Blut, überall. Zwei Wochen lang hatte sie ihn versorgt, hatte seine Wunden gewaschen, genäht, verbunden. Zwei Wochen lang waren sie sich näher gewesen als je zuvor. Dann war er wieder in die Schlacht gezogen.
Der Krieg lag Jahre zurück, die Ketzer waren zurückgedrängt und von den Reapern gab es in den leeren Wäldern nur noch streunende Einzelgänger. Warum dachte sie jetzt daran? Vermutlich, weil die beunruhigenden Nachrichten Erinnerungen weckten, die weit weniger verblasst und vergessen waren, als Eunice gehofft hatte.
Der Abt hob schließlich den Kopf, er schien seine Antwort wohl überlegt zu haben. »Einverstanden, Kaleb, sieh dir die Sache an. Aber sei auf der Hut. Wenn es stimmt, ist es selbst für einen Mönch gefährlich, in der Dunkelheit zu reisen.« Nach einer Pause fügte er hinzu: »Richte Bruder Simeon meine Grüße aus. Der Herr sei mit dir, Bruder Kaleb.«
»Und mit deinem Geiste, Vater Abt.« Kaleb ging zu seiner Kutte, die zwischen den Säulen lag. Eunices Blick folgte ihm, ruhte für einen Moment auf den Narben, die seinen Rücken bedeckten und daran erinnerten, dass die Kampfübungen dem Überleben dienten. Sie wandte den Blick ab, als er sich die Kutte über die Schulter warf und sich zu ihr umdrehte. Dann folgte sie ihm wortlos aus dem Exerzitienhof.
Direkt hinter der Tür endete die würdevolle Stimmung des Kreuzganges. Eine Metalltreppe führte in die nüchterne Atmosphäre eines alten Verwaltungstraktes hinab. Eunice und Kaleb folgten einem Gang mit kahlen Wänden, vergilbt und schmutzig, liefen über brüchiges Linoleum, vorbei an Türen, von denen die Farbe blätterte. Sie gingen nebeneinander, schweigend, ohne sich anzusehen, doch Eunice war sich seiner Nähe sehr bewusst. Schließlich verlangsamten sich ihrer beider Schritte. Wo der Weg zu den Quartieren der Mönche abzweigte, blieben sie stehen.
Eunice suchte nach Worten, irgendetwas, das die Trennung noch für einige Sekunden hinauszögern konnte. Schließlich war er es, der zuerst sprach. »Soll ich deine Schwester aufsuchen?«
»Besser nicht.« Eunice lächelte schwach.
Kaleb neigte den Kopf und wandte sich zum Gehen.
Rasch sagte sie: »Es ist das erste Mal, dass du zurückkehrst, nicht wahr?«
»Ja.« Er hatte ihr den Rücken zugewandt, ging aber nicht weiter, so, als warte er auf eine weitere Frage.
Eunice wollte fragen, wollte so vieles wissen, doch das Verbot des Bischofs, über Kalebs Vergangenheit zu sprechen, dieses Verbot, dem sie so lange Zeit gehorcht hatten, nahm ihr die Worte. Als Kaleb schließlich den Kopf wandte und sie anblickte, sagte sie nur: »Der Herr sei mit dir, Bruder.«
Es lag mehr Wärme in diesem Satz, als einem Gruß zustand. Kalebs Blick ruhte auf Eunice. »Und mit deinem Geiste«, antwortete er sanft.
Dinah zuckte zusammen. Ein großer, blitzschneller Schatten hatte das Scheinwerferlicht des Pickups gekreuzt. »Hast du das gesehen?«
»Das war nichts.« John nahm die Rechte vom Lenkrad und fasste Dinahs Hand. »Hab keine Angst.«
Die Scheinwerfer erhellten nur ein kurzes Straßenstück voraus. Der Belag aus festgefahrener Erde und Laub war hier und dort aufgebrochen, und an diesen Stellen erkannte man die alte Teeroberfläche. Außerhalb des Scheinwerferlichts herrschte längst schwarze, undurchdringliche Nacht.
Es war nicht gut, jetzt draußen zu sein.
»Wir hätten bei Lucy übernachten sollen«, sagte Dinah leise, aber John antwortete darauf nicht. Was sollte er auch sagen? Er war für den geplatzten Wasserschlauch nicht verantwortlich – und auch nicht dafür, dass es bis zur Dämmerung gedauert hatte, bis der Motor abgekühlt war und sie neues Wasser aufgetrieben hatten.
Dinah zog die Jeansjacke enger zusammen. Der Pickup besaß nur noch die Windschutzscheibe, alle anderen Fensteröffnungen waren mit Plastikplane verklebt, die laut im Fahrtwind schlug.
Noch immer raste ihr Herz wegen des Schattens, der im Scheinwerferlicht aufgetaucht war. Erst letzte Woche hatte Dillon Brent Reaperspuren gefunden – ausgerechnet jetzt, wo sie für die Ernte vor die Palisade mussten. Wegen dieser Spuren hatte Dillon das erste Mal seit langer Zeit nach Unterstützung gefunkt. Allerdings war fraglich, ob der Konvent so lange nach Erntebeginn noch Schutztruppen entbehren konnte, denn die Mönche waren inzwischen vermutlich in anderen Lehen eingesetzt.
John konzentrierte sich auf den Weg, hielt das Lenkrad wieder mit beiden Händen fest. Dinah hatte sich in seiner Nähe immer sicher gefühlt. Und auch jetzt wollte sie darauf vertrauen, dass sie sicher waren. Seit Jahren gab es keine Angriffe mehr. Was immer Dillon am Südhang entdeckt hatte – nach dem Platzregen waren keine Spuren mehr zu finden gewesen.
Dinah legte die Hand auf Johns Bein, und er lächelte flüchtig.
Und dann barst die Windschutzscheibe. Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen, hingen die Glassplitter glitzernd in der Luft. Dinah schaute verwundert auf deren bizarre Schönheit. Dann setzte die Zeit unbarmherzig wieder ein – und mit ihr das Entsetzen.
Dinah schrie auf und hob die Hände gegen das berstende Glas. Sie wurde in ihren Gurt geworfen, als John auf die Bremse trat. Der Pickup schleuderte, prallte seitlich gegen ein Hindernis und der Motor erstarb. Nicht weit entfernt, schrecklich nah, das Grollen eines Reapers.
Mit einem Krachen landete ein riesiges, schwarzes Geschöpf auf der Motorhaube. John griff nach der Pumpgun auf dem Sitz und feuerte. Der Rückstoß riss den Lauf nach oben – doch der Schatten blieb. Rote Augen glühten in der Dunkelheit. John schrie gellend auf und ein Schwall warmer Flüssigkeit klatschte Dinah ins Gesicht. Im Augenblick darauf wurde John durch den leeren Fensterrahmen gerissen. Er schrie jetzt nicht mehr.
Die Pumpgun landete in Dinahs Schoß. Sie umklammerte die Waffe und erwartete jeden Moment, die Klauen des Reapers in ihrem eigenen Fleisch zu spüren – doch sie hörte nur die Geräusche eines Kampfes. Aber wer kämpfte? Stritten die Reaper um die Beute? Sie musste hier raus, weg, so lange die Reptilien mit sich selbst beschäftigt waren.
Dinahs Hände zitterten so sehr, dass sie den Gurt kaum lösen konnte. Sie hielt den Blick dabei starr auf den einen, verbliebenen Lichtkegel gerichtet, als könne der irgendwie Sicherheit bieten. Aber das tat er nicht, das wusste Dinah gut genug. Er weckte Aufmerksamkeit.
Als sie sich hinüberbeugte, um das Licht auszuschalten, rutschte ihre Hand durch das Blut auf dem Fahrersitz. Sie öffnete leise die Tür und stieg aus. Wohin fliehen? Zurück zu Lucy? Ins Dorf? Wo waren die Reaper?
Dinah lauschte. Es war still geworden. Zu still. Der Kampf war vorbei. In ihrer Angst glaubte sie, rote Augenpaare zu sehen, die sie aus der Dunkelheit anglühten. Spielten sie mit ihr? Warteten sie, dass die Beute losrannte?
Kein Mensch hatte eine Chance gegen die Raubechsen. Nicht einmal mit einem Gewehr. Nur ein Erwählter konnte sie töten.
Panik zerrte an Dinahs Eingeweiden, verursachte Übelkeit, ließ ihre Beine zittern und ihr Denken erstarren. Sie wollte sich zusammenkauern und einfach dem Unvermeidlichen ergeben – aber dann brach der Mond zwischen den Wolken hervor. In seinem Licht erkannte sie den Weg und darauf schwarze Silhouetten, die dort nicht hingehörten. Eine von ihnen bewegte sich. Dinah hob die Pumpgun und versuchte zu zielen. Der Schemen richtete sich auf, wuchs in die Höhe und wurde zu einer Gestalt – einer menschlichen Gestalt.
Eine ruhige, heisere Stimme sagte: »Die Waffe brauchen Sie nicht mehr.«
Sonntag
Für Kaleb war es immer wieder erstaunlich, wie manche Strukturen dem Verfall trotzten, während sich andere schon fast vollständig aufgelöst hatten. Als er die verrostete Gartenpumpe fand, hatte er nicht viel Hoffnung, doch der Schlegel war noch immer beweglich und nach einigen Leerbewegungen sprudelte braunes Wasser in den Eimer, den er unter den Ausguss gestellt hatte. Das Wasser roch metallisch aber nicht faulig.
Die fahle Morgensonne schien auf ein Areal, das man früher wohl Vorstadt genannt hatte: eine Ansammlung freistehender Häuser, jedes von einem Garten umgeben und nur von einer einzigen Familie bewohnt. Kaum vorzustellen, dass damals für jeden einzelnen so viel Wohnraum zur Verfügung gestanden hatte. Die Natur hatte das Areal zurückerobert, doch nicht mit dem üblichen Wald aus Ahorn und Koniferen. Hier hatten Zierpflanzen den Kampf gegeneinander aufgenommen. Die meisten waren vermutlich verschwunden, erstickt von stärkeren, lebensfähigeren Nachbarn. Wenige hatten sich durchgesetzt, waren zu Hecken absurder Höhe gewachsen oder hatten riesige Flächen überwuchert.
Zwischen dem üppigen Grün sah Kaleb die Ruinen von Gebäuden. Fast zweihundert Jahre war es her, dass die Reaper im Westen entdeckt worden waren, knapp hundert, dass sie die Ostküste erreicht hatten. In diesen hundert Jahren seit der Verheerung Pennsylvanias waren die meisten Holzhäuser zu Haufen zusammengefallen, aus denen nur die gemauerten Schornsteine hervorstanden. Gebäude aus Stein oder Beton hingegen waren oft erstaunlich gut erhalten. Die Qualität des Daches war ausschlaggebend. Gab das Dach nach, standen bald bloß noch die Außenwände.
Schon zuvor hatte Kaleb den gemauerten Geräteschuppen bemerkt. Jetzt ließ er den Eimer stehen und ging durch kniehohes Kraut um zwei Thujas herum. Sie mussten einmal Teil einer Hecke gewesen sein. Heute ragten sie gut vierzig Yards in die Höhe. Ihre unteren Äste krochen am Boden in alle Richtungen davon und richteten sich nach wenigen Yards zu Nebenstämmen auf. Niemand hatte sie mehr gestutzt, seit die Welle der Reaper das Land überrollt hatte.
Die Schuppentür ließ sich nicht bewegen. Als Kaleb kräftiger daran zog, gaben die festgerosteten Angeln nach und die gesamte Tür polterte zu Boden. Aus dem Inneren wehten ihm trockene Blätter entgegen. Kaleb schob die Kapuze vom Kopf und betrat wachsam die enge Hütte. Verrostete Gartengeräte waren im Dunkel zu erkennen: ein Rechen, eine Sense, ein Gerät mit einem Elektrokabel.
Obwohl nah an bewohnten Gegenden gelegen, waren Haus und Schuppen offensichtlich niemals geplündert worden. Der Leichnam der untergegangenen Zivilisation ließ sich an anderen Orten leichter fleddern: in den Zentren der toten Städte, in den ehemaligen Industriegebieten. Dort fanden sich noch immer ganze Lagerhallen voller Waren, verpackt und zur Auslieferung bereit. Die Menschheit würde zwei, drei weitere Generationen lang von den Errungenschaften ihrer Väter zehren können, bis sie ganz auf ihre eigenen Fähigkeiten zurückgeworfen war.
An der linken Wand fand Kaleb, was er suchte: Bretter. Eine Prüfung ergab, dass sie fest und trocken waren. Gut. Er durfte den Reapern nur wenige Zugänge lassen, musste ihr Eindringen kanalisieren.
Er schloss die Augen und sammelte sich, schickte seinen Geist in die Weite, um nach ihnen zu suchen. Nein, noch war kein Reaper in der Nähe. Er zweifelte nicht daran, dass sie kommen würden, aber sie waren nächtliche Jäger, die das Sonnenlicht mieden. Das gab ihm ein wenig Zeit.
Bereits auf dem Weg zurück zum Haus, in das er die Frau letzte Nacht gebracht hatte, suchte er nach Schwachstellen im Gebäude. Es war aus Stein gebaut, mit einem geneigten, verschindelten Dach. Die letzten Bewohner hatten sich gegen die Reaper verschanzt: Fenster und Türen waren vernagelt, manche sogar von innen und außen. Die Bretter an der Westseite waren im Laufe der Jahrzehnte morsch und brüchig geworden, doch dank dieses Schutzes hatten die beiden unteren Stockwerke der Witterung standgehalten. Nur ganz oben, unter dem Dach, hatte ein zerbrochenes Fenster der Feuchtigkeit Einlass gewährt und jene Seite des Giebels einsinken lassen. Diesen Zugang würde er blockieren müssen.
Mit der Schulter drückte Kaleb die Hintertür auf und trat von der Veranda direkt in den Wohnraum. Die Bretter vor den Fenstern ließen nur wenig Tageslicht herein. Strahlenbündel fielen in den Raum und beleuchteten tanzenden Staub.
Die Frau war erst im Morgengrauen eingeschlafen, hatte zuvor lange geweint. Jetzt saß sie über die Seitenlehne des Sofas gebeugt und würgte. Ihr kurzes, braunes Haar war zerzaust. Sie sah auf und wischte sich zitternd mit dem Ärmel ihrer aufgetragenen Jeansjacke über den Mund. Er wusste, dass Angst bei vielen Menschen eine Reaktion des Magens hervorrief, doch diese hier schien ihm verspätet.
Sie ließ den Arm sinken. »Guten Morgen, Bruder.«
Er nickte ihr zu. »Guten Morgen …?«
»Dinah«, antwortete sie. »Dinah Montjoy.«
Er lehnte die Bretter gegen die Wand und stellte den Eimer daneben. »Ich bin Bruder Kaleb.«
Sie blickte ihn scheu an, die Augen mehr auf die Kutte als in sein Gesicht gerichtet. Kaleb kannte das. Den meisten Laien waren die Mönche unheimlich. Selbst Mitglieder des Hochklerus übten Zurückhaltung im Umgang mit ihnen, obwohl sie selbst Erwählte waren. Bei den Mönchen wurden die angeborenen geistigen Fähigkeiten jedoch durch harten Drill gezielter ausgebildet und perfektioniert.
Die Einzige, bei der er diese Distanz niemals gespürt hatte, war Eunice. In ihren Gesten und Blicken lagen nur Zuwendung und tiefes Vertrauen.
»Wo sind wir?«, fragte die Frau und holte ihn aus seinen Gedanken.
Er hob den Blick, ließ ihn über die Wände wandern, an denen verblichene Fotografien hingen. »In einer alten Siedlung. Das Haus ist kaum zerstört.«
Bis auf das Dachfenster. Vermutlich waren die Reaper dort eingedrungen und der Schutz des Hauses war zu einer Falle geworden. Kaleb hatte die Scharten an der Türinnenseite gesehen. Mit dem Daumen war er über die noch immer scharfen Kanten gefahren – die dazugehörige Axt hatte er auf der anderen Raumseite gefunden, von einer schwarzen Substanz am Boden festgeklebt. Vermutlich war es schnell gegangen.
»Warum haben Sie mich nicht nach Selimsburgh gebracht?« Die Frau saß mit angezogenen Beinen auf dem Sofa, die Augen rot vom Weinen. Genau so hatte Rachel dagesessen, damals, als er es ihr gesagt hatte. Rachel. Ihr wieder zu begegnen, nach so langer Zeit – er wusste nicht, warum er sich davor fürchtete. Wegen dieser Furcht war er vom Konvent aus nicht direkt nach Selimsburgh gefahren, sondern hatte das Gelände um das Lehen herum erkundet.
Tatsächlich hatte er frische Spuren von sieben Reapern gefunden und war ihnen gefolgt. Gegen Mittag hatte er ihre Anwesenheit wahrgenommen – in der Nähe eines Hauses, das ungeschützt in den Outlands stand. Ohne Dorf und zusätzliche Mauern konnte es eigentlich nur ein Ketzerhaus sein, doch dafür war es zu sauber. Auch die Menschen darin, ein Mann und zwei Frauen, hatten aus der Ferne nicht wie Ketzer gewirkt – zu viel Haar. Eine von ihnen war jene Frau hier gewesen. Dinah.
Die drei hatten sich mit unbekümmerter Sicherheit im Garten bewegt, während die Reaper sie von ihrem Versteck aus beobachtet hatten. Es waren nur drei Tiere gewesen, nicht sieben, aber immer noch zu viele, um sie alleine im offenen Gelände anzugreifen. Selbst im Tageslicht, das die Reaper behinderte, wäre der Sieg ungewiss gewesen. Und es blieb die Frage, wo sich die restlichen vier aufhielten.
Kaleb hätte nach Selimsburgh zurückkehren und Verstärkung anfordern sollen. Stattdessen hatte er die weitere Entwicklung abgewartet.
Dinah und der Mann waren am Nachmittag aufgebrochen und hatten die blonde Frau zurückgelassen. Statt diese leichte Beute anzugehen oder die Dunkelheit abzuwarten, waren die Reaper im Schutz des Waldes dem Wagen gefolgt. Die Straße war in gutem Zustand, und der Mann fuhr schnell und sicher. Ohne die Panne hätte der Wagen Selimsburgh noch vor Sonnenuntergang erreicht.
Das Verhalten der Reaper gab Kaleb Rätsel auf. Es entsprach nicht dem, was er von diesen Tieren gewohnt war. Jagen und Fressen, das beschrieb ihre Interessen umfassend. Hier hatten sie weder das eine noch das andere getan. Sie hatten das Haus beobachtet, gelauert, gewartet und sich dann ohne Angriff entfernt, obwohl die Frau im Haus eine viel leichtere Beute war als der Wagen.
Als Kaleb aufschaute, begegnete er Dinahs Blick, die noch immer auf seine Antwort wartete.
»Ich muss eine Theorie überprüfen.«
»Eine Theorie?«
Er ging nach nebenan in die Küche. Im ersten Schrank fand er Becher aus grünem Plastik. Das Material war brüchig geworden und zerbröselte zwischen seinen Fingern. Im zweiten Schrank standen Gläser.
War es klug, Dinah einzuweihen? Aber vermutlich machte es keinen Unterschied. Zurück im Zimmer sagte er: »Die Reaper haben das Haus der blonden Frau beobachtet, während Sie dort waren. Ich habe ihre Spuren gesehen.«
»Lucy!« Dinah richtete sich erschrocken auf. »Ist sie …«
»Die Reaper haben sie nicht angegriffen.« Er betrachtete prüfend den Eimer. Die Schmutzpartikel hatten sich abgesetzt, im oberen Teil war das Wasser klar. Langsam senkte er das Glas hinein und ließ das Wasser über die Kante rinnen. »Eine einzelne Frau wäre ein leichtes Opfer gewesen. Stattdessen haben die Reaper ein fahrendes Auto angegriffen, Sie aber verschont.«
Die Reaper hatten den Mann aus dem Auto gerissen und dann den Wagen umkreist, als warteten sie darauf, dass die Frau ausstieg. Warum? Auch ohne Not würden Reaper eine schnelle Beute dem Kitzel der Jagd vorziehen. Worauf also hatten sie gewartet?
Kaleb hätte die Antwort vielleicht schon erhalten, wenn die Tiere ihn nicht bemerkt hätten. Das allein hatte ihn zum Kampf gezwungen – doch das musste die Frau nicht wissen. Wenn heute Nacht die übrigen vier Reaper kamen, war er zumindest sicher, dass die Frau die ganze Zeit über das Ziel des Rudels gewesen war. Und auch das musste sie nicht wissen. Er reichte ihr das Glas.
»Danke.« Sie trank nicht gleich, zögerte und schaute auf. »Nicht nur für das Wasser.«
Er begegnete ihrem Blick und nickte.
Dinah wusste nicht, was sie von ihrem Retter halten sollte. Er strahlte Ruhe aus, Sicherheit, aber wenig Wärme. Das Seltsame war, dass er sie an Sam erinnerte.
Allein dieser Gedanke machte ihr ein schlechtes Gewissen. Sie sollte jetzt an John denken, nicht an Sam. Schließlich war John noch keinen Tag tot, vor ihren Augen aus dem Wagen gerissen.
Aber im Grunde genommen hatte Sam von Anfang an zwischen ihnen gestanden. John war deswegen nicht sonderlich empfindlich gewesen. Natürlich hatte er gewusst, wie Sam empfand. Alle wussten es. Aber Dinah hatte sich für John entschieden, hatte ihn geheiratet, und das war es, was für ihn zählte. Ein paar Monate lang hatte sie sich selbst geglaubt, dass ihr die Sicherheit in seiner Nähe mehr bedeutete als Sams Lächeln. Als sie erkannte, wie sehr sie sich getäuscht hatte, fühlte sie sich als Verräterin.
John war ein guter Mann gewesen: zuverlässig, freundlich, arbeitsam. Es gab keinen Grund, ihn nicht zu lieben. Die Erkenntnis, dass sie es dennoch nicht tat, hatte sie getroffen. An jenem Abend hatte sie nicht aufgehört zu weinen. John gegenüber hatte sie es auf die »besondere Zeit des Monats« geschoben. Er war nicht der Mann, der weiter fragte. Sie hatte John nicht geliebt, zumindest nicht so wie Sam, aber sie hatte ihn respektiert und ihm vertraut.
Und jetzt stand sie vor dem Wagen und brachte es nicht über sich zu beginnen. Es sind nur braune Flecken, dachte sie. Angetrockneter Schmutz. Doch es gelang ihr nicht, sich zu überwinden. Es war Johns Blut, und jeder Gedanke daran brachte die Erinnerung zurück, an das Entsetzen der vergangenen Nacht und an das, was sie verloren hatte.
Eine Berührung ließ sie zusammenzucken. Der Mönch nahm ihr das Tuch ab. »Lassen Sie mich das machen.« Seine Stimme war sanft – und ließ doch keinen Widerspruch zu.
Dinah beobachtete, wie er das Tuch in die Seifenlauge tauchte und dann mit ruhigen Bewegungen über die Sitzbank des Wagens wischte. Das angetrocknete Blut löste sich, bildete Schlieren auf dem glatten Leder. Dinah hob den Blick in den Himmel, um es nicht sehen zu müssen. »Sie sind das Putzen sicher nicht gewöhnt«, sagte sie, nur um irgendetwas zu sagen.
»Im Gegenteil«, antwortete er, und wieder fiel ihr auf, dass seine Stimme heiser klang. »Im Konvent gibt es kein Personal. Und wir helfen auch in der Armenküche und den Siechenräumen.«
Sein Gesicht veränderte sich; ein Aufblitzen von Wärme, so schnell wieder verschwunden, dass Dinah es sich vielleicht nur eingebildet hatte. Sie schätzte den Mönch auf das Alter ihres Vaters. Er war groß, sicher einen Kopf größer als die meisten Männer in Selimsburgh. Die schwarze Kutte reichte ihm bis zu den Knöcheln und wurde um die Hüfte von einem Seil zusammengehalten. Der wollene Stoff strahlte eine schlichte Würde aus. Nur die schwarzen Armeestiefel verrieten den Kämpfer; ein Prediger hätte wohl Sandalen getragen. Durch die Kutte ließ es sich schwer einschätzen, aber sein Körper wirkte schlank, fast schon schmal, nicht gerade das, was Dinah sich unter einem Krieger vorstellte. Es war die Art, wie er sich bewegte, die seine Kraft zeigte: kontrolliert, fließend, mühelos.
Das kurz geschorene Haar war blond, seine Haut hell. Die Blässe ließ ihn verletzlich wirken – bis man in die harten, eisblauen Augen blickte. Auch die Brandzeichen, das Doppelkreuz des Konvents von Philadelphia, die er links und rechts an seinem Hals trug, verliehen ihm eine raue Härte. Dieser Mann hatte die Reaper getötet. Nicht nur diese drei, sondern vermutlich unzählige davor. Er trug Narben auf Gesicht und Händen, die deutlich zeigten, welchen Gegnern er sich bereits gestellt hatte.
»Sollten Sie nicht lieber Wache halten?«, fragte Dinah. »Falls die Reaper wiederkommen?«
»Ich werde spüren, wenn sie kommen – so wie auch sie meine Anwesenheit spüren werden.«
»Wird sie das fernhalten?«
»Das bezweifle ich … «
Dinah starrte auf den Eimer. Das Wasser war inzwischen rot vom Blut.
»Gehen Sie«, sagte der Bruder sanft. »Ich habe hinter dem Haus wilden Kohl gesehen. Wir müssen etwas essen.«
Dinah fand den Kohl und im Keller des Hauses einige Konserven. Die Dosen waren aufgebläht, der Inhalt der Gläser ausgeblichen und wenig appetitlich.
Dinah brachte die drei Dosen, die ihre ursprüngliche Form behalten hatten, hoch in die Küche. Die Oberfläche der Schränke war vergilbt, die Metallgriffe waren stumpf geworden und Risse zogen sich durch den Kunststoff der Arbeitsplatte. In einer Schublade fand Dinah Besteck: Von einer feinen Staubschicht bedeckt lagen Messer, Gabeln, Esslöffel und Teelöffel ordentlich in Fächer sortiert. Sie lagen aufeinandergestapelt, die gebogenen Flächen nach oben gekehrt, alle mit den gleichen, verzierten Griffen. Dinah ließ die Finger über das Metall gleiten und fragte sich, wie es gewesen war, als jemand diese Schublade zum letzten Mal geöffnet hatte. War das Haus damals schon verbarrikadiert gewesen, umzingelt von Reapern?
Die Küche war aufgeräumt, kein schmutziges Geschirr, keine Reste von Lebensmitteln. Die Bewohner mussten Halt gesucht haben in den Ritualen einer unbekümmerten Vergangenheit. Unter dem vernagelten Fenster stand eine faustgroße Tonfigur, vermutlich von einem Kind gemacht. Ausgeblichene Plastikblumen hatten einst Farbe in die dunkle Ecke neben der Spüle gebracht. Am Kühlschrank hingen Fotos.
Dinah trat näher, betrachtete die verblassten Bilder eines lachenden Mädchens und eines Jungen, der eine Grimasse zog. Daneben hing ein Votivbild des Ersten Erwählten.
Es hieß, dass man sein Bild immer wieder hier und dort in den Ruinen fand, doch bisher hatte Dinah das nicht geglaubt. Sie griff danach, zog es behutsam unter einem Magneten hervor. Sie betrachtete das sanfte, bärtige Gesicht vor dem hellblauen Hintergrund, ließ ihren Daumen sachte über die langen, braunen Haare gleiten, deren Wellen durch eine Prägung des Papiers nachgebildet wurden.
Türangeln knirschten und Dinah hörte die Schritte des Mönchs. Als Kaleb in die Küche trat, hielt sie ihm das Bild hin. »Woher wussten die Menschen es? Wie konnten sie Abbilder des Ersten Erwählten besitzen, bevor er überhaupt geboren wurde?«
Bruder Kaleb warf nur einen kurzen Blick auf das Bild. »Ihre Religion war prophetisch. Sie haben die Apokalypse schon seit Jahrtausenden erwartet.«
Sie ließ das Bild sinken. »Sie meinen, die Menschen haben es gewusst?«
Bruder Kaleb nahm eine der Dosen und musterte das Etikett. »Im Buch steht: Das Tier war gräulich und schrecklich und sehr stark und hatte große, eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und das übrige zertrat’s mit seinen Füßen.«
Dinah schob das Votivbild mit einem Gefühl der Befangenheit wieder unter den Magneten. Sie hörte nicht oft Worte aus Dem Buch, und wenn, dann erschien es ihr ungehörig. Es war verboten, ohne offiziellen Ausleger der Kirche darin zu lesen. Am sichersten war es, Das Buch gar nicht erst zu besitzen. Nicht, dass es im Dorf viele gegeben hätte, die überhaupt lesen konnten. Sam konnte lesen – seine Mutter hatte es ihm beigebracht – aber er las langsam und mühevoll.
Kaleb schüttelte den Kopf und stellte die Konserve auf den Tisch zurück. »Das können wir nicht essen.«
»Dann haben wir nur Kohl.«
Kaleb verließ die Küche und legte bald darauf einen unförmigen, fast schwarzen Klumpen auf die Arbeitsplatte.
»Reaperfleisch?«, fragte Dinah fassungslos.
»Sie fressen uns, wir fressen sie.« Er schaute sich um, streifte den nutzlosen Herd mit einem emotionslosen Blick. »Im Wohnzimmer gibt es einen Kamin, aber das Brennholz neben dem Schuppen ist verrottet.«
»Wir könnten die Stühle verfeuern«, schlug sie vor.
Wortlos nahm er einen davon und verließ die Küche.
Dinah sah auf das Fleisch. Fressen und gefressen werden. Sie schauderte. Hoffentlich brachte er sie bald zurück nach Selimsburgh.
In der zweiten Schublade fand sie ein großes Messer. Während sie den Kohl in Stücke schnitt, hörte sie den Mönch nebenan den Stuhl zertrümmern. Als er zurückkam, zückte er ein Messer und begann, das Fleisch klein zu schneiden.
Dinah sah scheu zu ihm hinüber. Es stand ihr nicht zu, ihm Vorschriften zu machen oder seine Entscheidungen infrage zu stellen, aber sie musste es wissen. »Wann bringen Sie mich nach Hause?«
Er schaute nicht auf. »Morgen.«
»Sind wir hier sicher? Auch in der Nacht? Oben ist ein Fenster zerbrochen.«
»Bevor es dunkel wird, werde ich noch einige Vorsichtsmaßnahmen treffen.«
»Warum fahren wir nicht einfach zurück?«
Er hielt inne, und diesmal jagten seine mitleidlosen Augen ihr einen Schauder über den Rücken. »Weil ich es so entschieden habe.«
Dinah wollte protestieren, aber es war nicht gut, einem Mann der Kirche zu widersprechen, einem Mann, auf dessen Schutz sie heute Nacht angewiesen war.
Er nahm seine Arbeit wieder auf und Dinah schwieg. Es blieb ihr nur der Trost, dass er die Reaper getötet hatte, und die Hoffnung, dass er es wieder tun würde. Dazu war er erschaffen worden, um zu kämpfen und zu töten.
Jetzt schnitt er Fleisch wie eine Hausfrau. Wie schon beim Waschen des Wagens arbeitete er sorgfältig, fast andächtig. Er hatte davon gesprochen, dass er in der Armenküche und den Siechenräumen aushalf, nicht vom Wachdienst bei der Ernte und auf der Stadtmauer, obwohl dies zu den hauptsächlichen Pflichten der Mönche gehörte. Wurden Erwählte gefragt, ob sie in den Orden eintreten wollten? Dinah wusste es nicht. Eigentlich wusste sie fast nichts über Mönche, außer dass sie Erwählte waren, Telepathen, und dass nur sie einen Reaper besiegen konnten. Irgendwie bezweifelte Dinah, dass man ihnen eine Wahl ließ.
»Arbeit in der Küche macht Ihnen also nichts aus?«
Er säuberte die Klinge und steckte sie weg. Dann schaute er auf. »Im Gegenteil. Sie ist kontemplativ. Abgesehen davon sind wir Mönche angehalten, jede Arbeit gut zu tun. Es fällt leichter, wenn man sie gern tut.« Der Stuhl schabte über den Boden, als er aufstand.
»Gilt das auch für das Töten?«
Er hatte sich schon zum Gehen gewandt, doch der Satz hielt ihn auf. Er drehte den Kopf, schaute sie gerade an. Offenbar war er nicht der Mann, der einer solchen Frage auswich. »Das gilt ganz besonders für das Töten.«
Dinah hatte noch nie das Fleisch eines Reapers gegessen. Sie hätte nicht einmal sagen können, ob diese Wesen überhaupt aus Fleisch im eigentlichen Sinne bestanden. Jetzt stellte sie fest, dass es sich im Aussehen nicht sonderlich von dem unterschied, was sie von irdischen Lebewesen kannte. Der Geruch allerdings, der von den aufgespießten Stücken aufstieg, war streng und wenig appetitlich.
»Haben Sie das schon mal gegessen?«, fragte sie und drehte das Fleisch in den Flammen des Kamins. »Ist es nicht gefährlich?«
»Ihr Eiweiß und ihre Proteine können von unserem Körper verarbeitet werden – so, wie sie die Wesen unseres Planeten verwerten können.« Wie zur Demonstration zog er seinen Spieß aus dem Feuer und blies das dampfende Fleisch an, dann biss er ein Stück ab. Dinah sah, dass es zäh sein musste.
Sie versuchte es selbst, und nach den ersten Bissen war es nicht mehr so widerwärtig. Sie spürte ihren Hunger, und es dauerte nicht lange, bis sie das gare Fleisch vollständig aufgegessen hatte.
»Wie kann es sein«, fragte sie, während sie das nächste Stück aufspießte, »dass wir das Fleisch einfach so zerbeißen können? Sind sie nicht unverwundbar?«
Bruder Kaleb schien über seine Antwort nachzudenken. Schließlich stellte er eine Gegenfrage: »Sie wissen, dass ein Mönch Steinplatten mit der bloßen Faust zerschlagen kann? Dass er auf einer Lanzenspitze stehen kann, ohne sich zu verletzen?«
»Ich habe davon gehört, aber ich glaube es nicht.«
»Es ist wahr. Ein Mönch lernt, seine Kraft in einem einzigen Punkt seines Körpers zu bündeln. Es braucht Konzentration und viel Übung. Reaper tun es instinktiv.« Er wandte sich dem Feuer zu und schaute in die Flammen. »Das befähigt sie dazu, Klingen und sogar Kugeln abzuwehren, solange sie einen Augenblick haben, sich darauf vorzubereiten. Man kann einen Reaper nur erschießen, wenn die Entfernung nicht mehr als zehn Fuß beträgt. Und selbst dann ist es für einen Laien nicht möglich, denn Reaper erkennen jede Absicht in dem Moment, in dem man sie fasst.«
»Also keine Scharfschützen.«
»Keine Scharfschützen.«
Dinah betrachtete das Fleisch an ihrem Spieß. Drei. Es waren drei Schemen gewesen, die im Mondlicht auf dem Weg gelegen hatten. »Wie kann ein Erwählter die Reaper besiegen?«
»Wir kontrollieren unsere Gedanken.«
»Während des Kampfes?« Dinah dachte an den Angriff zurück, dachte daran, wie ihre eigenen Gedanken panisch umhergeflattert waren.
Sein Nicken war kaum mehr als ein Neigen des Kopfes.
Natürlich. Erwählte waren anders. Sie waren mehr als nur Menschen – ein Teil ihres Erbgutes war außerirdisch.
»Können Sie die Gedanken der Reaper lesen?«
Der Mönch zögerte. War es ein Geheimnis der Kirche? Oder suchte er nach der Möglichkeit, etwas zu sagen, für das die menschliche Sprache keine Worte hatte.
»Ich nehme Schwingungen auf«, sagte er schließlich. »Empfindungen, wenn ich einen Reaper berühre. Es ist schwer zu beschreiben.«
Berühren! Dinah schaute ihn erschrocken an. »Ist es das, was Sie heute Nacht tun wollen? Einen Reaper berühren? Um seine Gedanken zu lesen?« Natürlich musste er ihnen nahekommen, um sie zu töten, doch den Todesstoß hinauszuzögern, um in den Gegner hineinzuhorchen … »Ist das nicht zu riskant?«
»Wir werden sehen«, sagte er ausweichend. Dann, ohne Übergang, fragte er: »Diese Frau – Lucy – sie lebt ganz alleine außerhalb des Dorfes?«
Wieso interessierte ihn Lucy? Dinah zögerte, ihm zu antworten. Es gab Gerüchte, dass Lucy in Konflikt mit dem Klerus stand. Niemand wusste Einzelheiten, nur dass Lucy regelmäßig Kontakt zu Plünderern und anderen Ketzern hatte – aber wer hatte das nicht? Ohne die Plünderer wäre man darauf angewiesen, alles selbst herzustellen, jeden einzelnen Gebrauchsgegenstand, all die geheimnisvollen Ersatzteile, mit denen man die alte Technik am Laufen hielt.
Dinah schaute auf und begegnete seinem Blick, der klar und forschend war. Hatte sie zu lange geschwiegen? Sie wollte Lucy auf keinen Fall in Schwierigkeiten bringen. »Lucy war schon immer dort draußen. Sie braucht Platz für ihre Pflanzen.«
»Und die Reaper greifen sie nicht an?«
»Wir hatten schon seit fünf Jahren keine Reaper mehr in der Gegend.«
Er drehte den Fleischspieß. »Lucy ist ein Ketzername.«
»Nein.« Dinah schüttelte energisch den Kopf. »Es ist nur kein Name aus Dem Buch. Sie ist keine Ketzerin. Ihre Augen sind nicht rot. Nicht die Spur. Obwohl sie Nachtmilch in ihrer Medizin verarbeitet.«
»Wenn es keine Reaper in dieser Gegend gibt«, fragte der Mönch, »wie kann sie dann Nachtmilch besitzen?«
»Sie kauft sie von Plünderern und Ketzern, die weiter nördlich in den Wäldern leben.«
Zum ersten Mal sah sie eine Gefühlsregung in seinem Gesicht: Widerwillen. Vermutlich verstand ein Mann wie er nicht, warum sich Menschen das Reapersekret injizierten. Dinah hatte es nie versucht, aber sie konnte nachvollziehen, dass man gelegentlich einen euphorischen Trip dem kargen Leben in den Outlands vorzog.
»Ist es wahr«, fragte sie, »dass Reaper einen Ketzer nicht angreifen?«
»Nein.« Seine Antwort kam schnell – vielleicht ein wenig zu schnell. »Wenn sie im Blutrausch sind, hält sie nichts ab.«
»Ich habe von Ketzern gehört, die sich einem Rudel nähern konnten, ohne angegriffen zu werden.«
Sie musste auf seine Antwort warten, als widerstrebe es ihm, dieser Sünde eine positive Wirkung zuzugestehen. Er schaute in die Flammen und drehte langsam den Spieß.
»Es scheint, als ob Ketzer sich unter der Wahrnehmungsschwelle der Reaper bewegen«, sagte er schließlich. »Solange ein Ketzer nicht anderweitig Aufmerksamkeit erregt, werden sie ihn ignorieren.« Er hob den Blick, und in seinen Augen lag eine strenge Warnung. »Aber schon eine einzige Injektion kann zur Abhängigkeit führen. Und früher oder später fängt jeder Ketzer an, die Reaper für Götter zu halten.«
Sie lächelte bemüht. »Sehe ich etwa aus, als würde ich das für eine gute Idee halten?«
Die Strenge wich nicht aus seinen Augen. »Wir werden Ihrer Bekannten morgen einen Besuch abstatten.«
Die Selbstverständlichkeit, mit der er davon ausging, dass sie beide die Nacht überleben würden, hatte etwas Beruhigendes. Und doch zog sich ihr bei dem Gedanken, eine weitere Nacht außerhalb der schützenden Palisade von Selimsburgh zu verbringen, der Magen zusammen.
Die Kathedrale von Philadelphia. Schon als Kind hatte Timothy diesen Ort geliebt. Während der Messe folgte sein Blick den weißen Stuckelementen der Pfeiler in die Höhe. Er legte den Kopf in den Nacken und verlor sich in den Bögen und Rundungen der Deckengewölbe. An diesem ganz in Weiß und Gold gehaltenen Ort wurden Laien in Straßenkleidung nicht geduldet. Die Familien des Hochklerus feierten hier ihre Andachten, und gelegentlich waren auch niedere Erwählte willkommen – so wie heute.
Die Mönche füllten die Kathedrale mit ihren schwebenden, ziellosen Melodien, in deren dunkle Harmonien sich Timothy ebenso versenken konnte wie in die Betrachtung der Deckengewölbe. Als der Gesang endete, hallten die Klänge im Kirchenschiff und in Timothys Seele nach.
Der Junge senkte den Blick aus dem Gewölbe auf die Reihe der Mönche. Er fragte sich, ob Bruder Kaleb unter ihnen war. Wegen der tief gezogenen Kapuzen ließen sich keine Gesichter erkennen.
Auf der anderen Seite des Chores, den schwarz gekleideten Mönchen gegenüber, standen die Heiligen Mütter – ganz in weiß. Ihre Kleider waren unter den Brüsten gegürtet, so dass die schwangeren Bäuche prall und rund nach vorne ragten. Dichte Schleier machten die Mütter zu ebenso gesichtslosen Gestalten, wie die Mönche es waren.
Vor den Müttern, neben dem Altar, stand das Abbild, das in keiner Kirche fehlte: die Pieta. Timothy hatte sich schon oft im überirdisch schönen Antlitz der Heiligen Jungfrau verloren, die ihren toten Sohn in den Armen hielt. Dieser Mann war der Erste Erwählte gewesen, von dem alle späteren Erwählten abstammten, der Hochklerus ebenso wie die Mönche. Sie war die erste Heilige Mutter gewesen, von der alle Heiligen Mütter die Fähigkeit geerbt hatten, weitere Erwählte in die Welt zu setzen.
Auch auf der Seite der Mönche stand eine Statue: der heilige Georg, Schutzpatron der Mönche, seinen Fuß auf den Nacken eines besiegten Reapers gestellt. Obwohl dies eine alte Statue war, lange vor der Apokalypse gefertigt, hatte der unbekannte Künstler den Reaper erstaunlich gut getroffen. Lediglich der Hals war zu lang, und natürlich besaßen Reaper keine Flügel. Vielleicht waren die dargestellten Schwingen ein prophetischer Hinweis auf ihre Herkunft.
Hinter dem Altar, dem Halbrund des Chores folgend, reihten sich die Stühle des Hochklerus auf. Zu diesem Hochamt war jeder der Plätze unter den Wappenschildern besetzt. Die Lincolns hatten einen greisen Alten geschickt, während auf dem Sitz der Merryweathers ein vierzehnjähriger Knabe saß, der wohl zum ersten Mal nach der Firmung seine Familie in einer offiziellen Messe vertrat. Timothy dachte daran, wie stolz er selbst vor einem Jahr den Platz unter dem Schild seiner Familie eingenommen hatte. Heute allerdings wurde der Stamm der Brookstones von seiner Halbschwester Eunice vertreten.
Das vertraute Klacken des Weihrauchfasses zog Timothys Blick zur Sakristei hinüber. Sein Vater erschien im vollen Bischofsornat, dem Ort und dem Anlass entsprechend in Weiß und Gold, erhaben den vier Ministranten voranschreitend.
»Das ist Elijah Brookstone.« Das Flüstern des Mannes vor Timothy zerstörte die weihevolle Stimmung. Keinem Bürger von Philadelphia hätte man das erklären müssen. Jeder kannte Bischof Brookstones markantes Gesicht und die massige Silhouette, deren breite Brust mehr an einen antiken Gott als an einen Kirchenmann denken ließ. Der schwarze Vollbart, in den von oben herab erstes Silber einsickerte, verlieh dem Bischof etwas Würdevolles, Väterliches; darüber blitzten ausdrucksstarke Augen.
»Und wer ist die Schönheit auf dem dritten Stuhl links im Chor?«, fragte der Vordermann jetzt. Timothy zählte die Stühle. Der Mann meinte Eunice. Vermutlich war er ein Kleriker aus einer der anderen Städte und in Philadelphia auf Brautschau.
»Das ist Brookstones Tochter«, gab der andere Mann zurück, den Timothy als ein Mitglied der Familie Merryweather erkannte. Sein Vorname fiel Timothy nicht ein. Die Merryweathers gehörten zum niederen Klerus, waren zuständig für die Verwaltung der Schweinemast und nicht besonders einflussreich. Der Sekretär seines Vaters war ein Merryweather, ein alter, kinderloser Kanonikus.
Es ärgerte Timothy, dass er nicht auf den Vornamen des Mannes kam. Er würde sich die Genealogien und Familienverzeichnisse noch einmal vornehmen müssen, denn wenn Vater ihn abfragte, würde er mit Ausflüchten nicht davonkommen.
»Mein lieber Freund«, sagte der Merryweather jetzt zu seinem Nachbarn. »Sie werden Ihre Blutlinie nicht mit ihr gefährden wollen. Sie ist unfruchtbar.«
»Was für eine Verschwendung«, murmelte der Fremde bedauernd.
Eine helle Glocke erklang, als Brookstone die Wandlung vollzog. Die erste der Heiligen Mütter trat vor und hob den Stoff ihres Schleiers gerade weit genug, dass der Bischof ihr die Hostie auf die Zunge legen konnte. »Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes.« Brookstones tiefe Stimme trug bis ans Ende des hallenden Kirchenraums. Er wiederholte die Worte bei jeder der Frauen mit der gleichen Ernsthaftigkeit und Ruhe und zog damit sogar die beiden vor Timothy sitzenden Schwätzer in seinen Bann. Erst als die Hostien verteilt waren und der Bischof zum Altar zurückkehrte, ließ sich der Fremde wieder vernehmen. »Hat der Bischof nicht einen Sohn«, flüsterte er, »dem der Platz im Chor zusteht?«
»Eunice ist nur bei den Müttersegnungen hier – für alle Fälle. Sie ist die Hebamme der Heiligen Mütter.«
»Pikant«, erwiderte der Fremde. »Sie kann nicht gebären und hilft jenen, die nichts anderes tun.«
»Siebzehn«, sagte Elijah Brookstone, als er die Mitra vom Kopf nahm und sie Timothy reichte. »Früher haben bei einer Segnung Hunderte von Heiligen Müttern die Kathedrale gefüllt. Es ist schade, dass du das nicht mehr erlebt hast.«
Er betrachtete seinen Sohn, der den kostbaren Kopfschmuck umsichtig auf das Aufbewahrungsgestell setzte und Sorge trug, dass die Bänder glatt auf dem Bügel lagen. Ein widerspenstiger Wirbel ließ Tims Stirnhaare in die Höhe stehen, was immer einen unordentlichen Eindruck machte. Brookstone wusste, dass Tim sich Zuckerwasser in die Haare kämmte – vermutlich nicht, um sie zu glätten, sondern um den Wirbel zu verstärken.
»Warum eigentlich?«, fragte Tim, während er das letzte Band in Form zog. »Es gibt viel mehr Frauen im Mütterhaus.«
Brookstone wandte sich den Handschuhen zu, zog nacheinander an den weißen Fingern, um sie zu lockern. »Bis ihre Söhne erwachsen und zu Mönchen ausgebildet sind, ist die Zeit der gegenwärtigen Prüfung hoffentlich überstanden. Wir können es uns nicht leisten, Massen von nutzlosen Drohnen in den Städten zu beherbergen.« Er legte seine Handschuhe in eine Schublade. »Es werden gerade noch genug gezeugt, um den genetischen Pool zu erhalten – für alle Fälle.«
»Eunice wird sich wohl eine andere Arbeit suchen müssen. Vielleicht kann sie helfen, die Ornate zu besticken.« Tim grinste, doch Brookstone fand nichts Amüsantes an der Bemerkung. Eunice saß an der richtigen Stelle, und das würde sich nicht ändern, selbst wenn die Zuchtprogramme noch weiter reduziert werden sollten. In den Siechenräumen hielt Eunice den Kontakt zum einfachen Volk und erfuhr, wie die Stimmung unter den Laien war. Nicht zuletzt hielt sie so unauffällig die Kommunikation mit ihrer Schwester Berenice aufrecht, von deren Existenz geschweige denn Verbindung zum Hochklerus niemand wissen durfte.
»Übrigens«, fuhr Tim fort, während Brookstone stumm die Verschnürung des Kragens öffnete, »es ist mal wieder ein Priester auf Freiersfüßen in Philadelphia.«
»Ich weiß, einer der Bostoner Andersons. Er hat schon um eine Audienz gebeten.« Die Andersons verfügten über eine solide Machtbasis – einer ihrer Ältesten wurde sogar als der kommende Bischof gehandelt.
Brookstone würde dem jungen Gast Judith Lincoln schmackhaft machen. Sollte diese Verbindung zustande kommen, wäre ihr Vater ihm zu Dank verpflichtet. Eine Alternative wäre die Familie Merryweather. Keinesfalls durfte eine der Whitehead-Töchter das Rennen machen. Zu unverfroren hatte dieser Clan seine Finger bereits nach Brookstones eigenem Bischofsstuhl ausgestreckt.
»Findet dem Mann eine standesgemäße Braut.« Timothy stellte sich hinter seinen Vater, um ihm den steifen Kragen abzunehmen. »Eine Bewahrerin der Blutlinie und Mutter von Priestern – deren Brautpreis sich in einem erschwinglichen Rahmen hält.«
»Du hast keinen Grund zum Spott«, entgegnete Brookstone. »Dir steht in nicht allzu ferner Zukunft eine ähnliche Reise bevor.« Der Junge begriff einfach nicht, wie wichtig solche Beziehungen im politischen Geflecht waren. Tim war noch jung, aber das entschuldigte seine Naivität nicht. Brookstones Stimme gewann an Schärfe, als er sagte: »In der Gesellschaft hat jeder seine Rolle wahrzunehmen, und deine ist es nicht, mit den Novizen zusammen die Kampfkunst zu erlernen.«
Auf jeden Fall würde er mit dem Anderson über das Lehen Maplegrove sprechen. Der Grenzkonflikt schwelte seit Monaten, und vielleicht gelang es ihm, dem unerfahrenen, jungen Mann ein paar Informationen darüber zu entlocken, wie die Fronten im Rat von Boston verliefen. Während Brookstone die Verschnürung des Kragens löste, öffnete sich die Tür. Eunice trat ein und grüßte mit einem Nicken.
»Dallas?«, fragte Brookstone hoffnungsvoll.
»Du würdest es als Erster erfahren, wenn es Neuigkeiten gäbe, das weißt du.« Sie reichte ihrem Vater einen zusammengefalteten Zettel. »Das Ergebnis der Fruchtwasseruntersuchungen.«
Er nahm das Papier, ohne es zunächst zu beachten. Stattdessen ruhte sein Blick auf ihrem Gesicht. Jedes Mal, wenn er sie anblickte, sah er ihre Mutter in Eunice. Sie hatte das glatte, schwarze Haar der Ishigawa-Sippe geerbt, die mandelförmigen Augen, die zierliche Figur. Berenice, die Ältere, war nach seiner Familie gekommen. Niemand hätte die beiden jemals für Schwestern gehalten, und das war gut so. Im Exil war das für Berenice der beste Schutz.
Jetzt entfaltete Brookstone den Zettel. »Das Wesentliche?« Seine Lesebrille lag in seinem Arbeitszimmer, und so hielt er die Liste auf Armeslänge entfernt und überflog sie, während Eunice deren Inhalt zusammenfasste.
»Der biologisch empfangene Fötus ist gesund, ebenso die vier eingepflanzten Invitros. Von den Tryouts könnten höchstens zwei lebensfähig sein. Die Kandidatin der Whiteheads …« Eunice verstummte.
Brookstone fand die Zeile und den Eintrag dahinter. Seine Augen verengten sich, er schaute auf. »Ein Inquisitor?« Deren Zeugung hatte der Rat schon vor über einem Jahr untersagt.
»Offiziell ist es ein Experiment«, sagte Eunice, »aber der Zufall erscheint mir zu unwahrscheinlich. Die Werte sind denen eines Inquisitor-Invitros einfach zu ähnlich.«
Nachdenklich faltete Brookstone das Papier wieder zusammen, klopfte mit der Faltkante auf seine Handfläche. Dann steckte er die Liste ein. Er würde zu gegebener Zeit entscheiden, wie gegen diesen Verstoß vorzugehen war.
Tim beugte sich zur Seite und schaute an Brookstone vorbei zu Eunice hinüber. »Ich habe Kaleb nicht unter den Sängern gesehen. Ist er krank?«
Schon wieder dieses übermäßige Interesse an den einfachen Mönchen. Brookstone wollte Tim zurechtweisen, doch Eunices Antwort machte den Tadel unwichtig: »Es wurden Reaper bei einem der Lehen gesichtet. Der Abt hat Kaleb geschickt, die Sache zu untersuchen.«
»Reaper«, wiederholte Brookstone und zog die Verschnürung durch die letzte Öse seines Kragens. »Wo war das?« Als sie nicht antwortete, blickte er auf und sah Verlegenheit auf ihrem Gesicht. »Nun?«
»In Selimsburgh.«
Selimsburgh. Er hätte mehr Geistesgegenwart von ihr erwartet. Die Verbindung war zu leicht zu ziehen: Kaleb – Selimsburgh – Berenice. »Und das hast du zugelassen?«
»Es zu verhindern hätte mehr Aufmerksamkeit erregt als nötig. Ich habe ihm gesagt, dass er Berenice nicht aufsuchen soll.«
Brookstone hatte selten Grund, seine Tochter zu tadeln, und wenn, dann hing es unweigerlich mit diesem Mönch zusammen.
Als er Kaleb für den Konvent rekrutiert hatte, war Eunice noch jung und leicht zu beeindrucken gewesen. Brookstone hatte Kaleb in Selimsburgh entdeckt, auf der Suche nach einem Zufluchtsort für Berenice. Es kam nicht oft vor, dass Erwählte außerhalb eines Konvents geboren wurden, doch hin und wieder ergab es sich. Schuld waren zumeist Mönche, die außerhalb der Mauern ihre Ordensregeln nicht mehr ganz so strikt befolgten. Wer wollte es ihnen verdenken?
Um den fast zwanzigjährigen Erwählten noch in die mönchischen Formen biegen zu können, hatten Brookstone und der Abt den Jungen hart anpacken müssen. Das hatte Eunices Mitgefühl geweckt. Sie hatte seine Schrammen versorgt und sich über Gebühr um ihn bemüht. Eunice war sogar so weit gegangen, ihm Briefe seiner ehemaligen Geliebten zu übermitteln – über Berenice. Dabei wusste sie, wie wichtig es war, dass niemand den Aufenthaltsort ihrer Schwester erfuhr.
Und nun war Kaleb unterwegs nach Selimsburgh.
Aber es war geschehen, und Eunice hatte recht – manchmal war es besser, den Dingen ihren Lauf zu lassen, statt durch Taten die Aufmerksamkeit erst darauf zu lenken. Vielleicht war er zu besorgt. Kaleb hatte Berenice noch nie gesehen, er würde sie also auch nicht erkennen.
»Sag dem Abt, dass Kaleb direkt zu mir durchgestellt werden soll, sobald er sich meldet. Ich werde mich selbst um alles Weitere kümmern.«
In Selimsburgh herrschte seit Stunden angespannte Stille – seit die Kundschafter die Siedlung in den frühen Morgenstunden verlassen hatten. Als Rachel Rufe hörte, senkte sie ihre Handarbeit und lauschte. Jemand rannte an ihrem Fenster vorbei. Dann war da Dillon Brents Stimme: »Macht das Tor auf!«
Rachel legte das Strickzeug beiseite und stand auf. Ihre Sorge verstärkte sich zu einem Ziehen im Magen. Hatten die Männer John und Dinah gefunden? Waren alle sicher zurückgekehrt – insbesondere Sam?
Als sie die Tür öffnete, roch sie Staub, den viele Füße aufgewirbelt hatten. Sie blieb im Türrahmen stehen, verschränkte die Hände vor der Brust und beobachtete, wie die Leute auf dem Platz vor dem Tor zusammenliefen. Das hölzerne Innentor war bereits geöffnet und gab den Blick auf das massive, stählerne Außentor frei. Obadijah und Aaron betätigten die Winde und die vier Yards hohen Flügel ächzten in ihren Scharnieren, kamen langsam in Bewegung, ließen einen ersten Spalt entstehen. Schließlich waren sie weit genug geöffnet, um einen Truck und drei Reiter durch die Wehranlage zu lassen. Rachel suchte nach ihrem Sohn, und erst, als sie Sams blonde Haare entdeckte, beruhigte sich ihr Herzschlag. Dann erkannte sie, dass weder Dinah noch John unter den Heimkehrern waren.
Sam trieb seinen Braunen zu Dillon hinüber und meldete: »Der Pickup ist weg.« Seine Stimme trug weit genug, dass alle Umstehenden es hörten. »Die Spuren führen nach Norden. Kein Hinweis auf Dinah.«
»Und John?«
Sam schaute stumm zum Wagen hinüber. Über die Ladefläche war eine Decke gebreitet, unter der sich eine längliche Form abbildete – zu kurz für einen vollständigen Menschen.
Dillon fluchte. Er nahm seinen Hut ab und fuhr sich mit der Hand durch die schulterlangen, grauen Haare. Rachel hatte den Governor selten so beunruhigt gesehen. Zuerst diese Gerüchte über Dallas und jetzt das erste Reaperopfer seit Jahren. »Wie?«, fragte er.
»Reaper. Sie haben ihm den Brustkorb zerrissen.«
»Sie haben ihn nicht gefressen?«
»Sie wurden gestört. Wir haben drei Kadaver gefunden, sauber abgestochen, kein Hinweis auf Schusswaffen.«
Dillon stutzte und setzte den Hut wieder auf. »Das müssen Mönche gewesen sein. Aber warum sollten Mönche mit dem Pickup wegfahren und Dinah nicht nach Hause bringen?«
Tyler kam. Er nutzte die Krücken sonst sehr geschickt und kam trotz seines fehlenden Beines gut voran, doch heute machte die Hast seinen Gang unsicher. »Dillon!«, keuchte er, noch in der Bewegung. »Du musst einen Suchtrupp zusammenstellen! Wir müssen Dinah finden!«
Dillon wandte sich seinem Cousin zu. »Wir brauchen jeden Mann für die Ernte, Tyler. Wir können nicht noch einen Tag verlieren.«
»Und wenn sie deine Tochter wäre? Ich würde selbst losziehen, aber …« Tyler deutete auf sein linkes Bein, das kurz unter dem Knie aufhörte. Das Hosenbein war an der Hüfte festgesteckt.
»Ich suche sie«, sagte Sam. »Allein, wenn’s sein muss.«
Die Sorge stach schmerzhaft in Rachels Brust, und mit Erleichterung sah sie Dillons unwillige Handbewegung. »Du wirst nicht allein losziehen – jetzt, da wir wissen, dass tatsächlich ein Rudel in der Nähe ist.«
»Dann gib mir Männer mit!«
»Nein. Keine Diskussion.« Dillon wandte sich wieder an Tyler. »Falls sie wirklich bei einem Mönch ist, hat deine Tochter den besten Schutz, den sie haben kann. Und wenn nicht …« Er musste den Satz nicht beenden. Ohne den Schutz eines Mönches konnte Dinah die Nacht in den Outlands nicht überlebt haben.
Sam schüttelte den Kopf, sagte aber nichts. Stattdessen drückte er dem Braunen die Fersen in die Flanken und lenkte das Tier zum Stall hinüber. Im Vorbeireiten nickte er seiner Mutter zu und Rachel erwiderte die Geste verhalten. Noch konnte sie nicht beruhigt sein. Sie wusste, dass für Sam das letzte Wort noch nicht gesprochen war – nicht, solange die geringste Hoffnung bestand, dass Dinah lebte.
Kaleb entschied, dass Dinah die Nacht im Keller verbringen sollte. Dort unten, neben dem Vorratskeller, gab es ein Zimmer mit Bett, Schrank und Schreibtisch. Die schmalen Fenster unter der Decke waren vergittert und zugewuchert, kein Tageslicht drang durch das dichte Grün. Es gab Kerzen im Haus und Kaleb stellte einige davon auf den Schreibtisch.
Neben dem Bett lag Kleidung, achtlos zusammengeworfen: enge Jeanshosen und T-Shirts in verblassten Farben. »Ein Mädchenzimmer«, sagte Dinah und nahm eine abgegriffene Stoffpuppe vom Regal. Kaleb beobachtete, wie sie das verblichene Puppengesicht betrachtete und das Spielzeug zurück an seinen Platz setzte. Staub rieselte vom Bord auf das Bett.
»Egal was Sie hören«, sagte er, »bleiben Sie hier. Ich rufe Sie, wenn es vorbei ist.«
»Soll ich die Kerzen lieber auslassen?«, fragte Dinah. »Vielleicht das Regal vor die Tür schieben?«
Sie wollte tapfer sein, ihren Teil beitragen, aber wenn er die Reaper nicht aufhielt, dann würde nichts Dinah retten. »Es spielt keine Rolle, was Sie tun.«