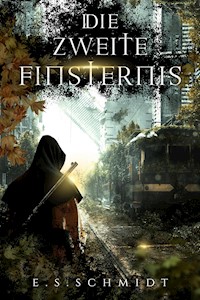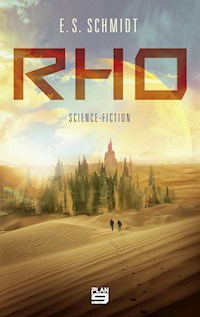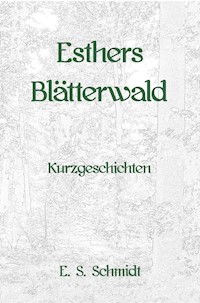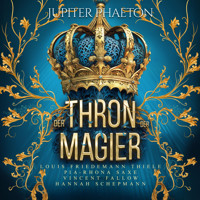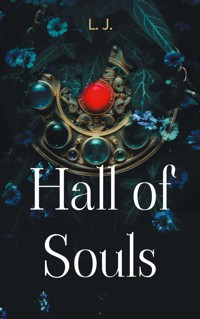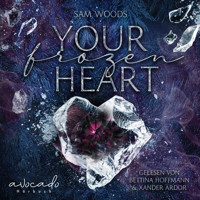4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chroniken der Wälder
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
In den Wäldern lauert eine uralte Macht: »Die Rückkehr der Elynn«, der zweite Band der »Chroniken der Wälder« von E. S. Schmidt, als eBook bei dotbooks. Die Welt der Menschen versinkt in Flammen und Chaos: Der Kaiser ist tot und um seine Nachfolge ist ein brutaler Bürgerkrieg entbrannt. Gegen ihren Willen sind auch der ehemalige Schwertsklave Daric und die anmutige Aroanída vom Volk der Elynn gezwungen, eine Seite in diesem Konflikt wählen. Während sich im ganzen Reich die Gerüchte über göttergleiche Wesen mehren, die angeblich unter den Menschen wandeln, muss sich Aroanída der Vergangenheit und dem Vermächtnis ihres Volkes stellen – und sie und Daric erkennen, wie eng ihr Schicksal mit scheinbar längst vergessenen Geheimnissen verbunden ist … Jetzt als eBook kaufen und genießen: » Die Rückkehr der Elynn «, der zweite Teil der epischen Fantasy-Saga »Die Chroniken der Wälder« von E. S. Schmidt. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Welt der Menschen versinkt in Flammen und Chaos: Der Kaiser ist tot und um seine Nachfolge ist ein brutaler Bürgerkrieg entbrannt. Gegen ihren Willen sind auch der ehemalige Schwertsklave Daric und die anmutige Aroanída vom Volk der Elynn gezwungen, eine Seite in diesem Konflikt wählen. Während sich im ganzen Reich die Gerüchte über göttergleiche Wesen mehren, die angeblich unter den Menschen wandeln, muss sich Aroanída der Vergangenheit und dem Vermächtnis ihres Volkes stellen – und sie und Daric erkennen, wie eng ihr Schicksal mit scheinbar längst vergessenen Geheimnissen verbunden ist …
Über die Autorin:
E. S. Schmidt wurde 1970 in Frankfurt am Main geboren und schreibt seit ihrer Kindheit Geschichten. Ihre Texte sind in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht worden und sind mehrfach preisgekrönt.
Bei dotbooks erscheint ihre Fantasy-Trilogie »Die Chroniken der Wälder«, die die folgenden Einzelbände umfasst: »Das Erwachen der Hüterin«, »Die Rückkehr der Elynn«, »Der Tod der Götter«.
***
Originalausgabe Januar 2020
Copyright © der Originalausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Sarah Schroepf
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Irina Alexandrovna, Carlos Amarillo, Tom Tom
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96148-748-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Chroniken der Wälder« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
E. S. Schmidt
Die Rückkehr der Elynn
Roman
dotbooks.
V
Kapitel 1
Stoffrascheln. Wasserplätschern. Seifenduft wehte heran. Geräusche und Gerüche – eine Welt, in der es nur das gab, war eine sichere Welt. Hier wollte er bleiben. Nicht sehen, nicht fühlen – sich nicht erinnern. Er dämmerte wieder weg.
Das nächste Mal summte jemand. Er kannte die Melodie. Seine Mutter hatte sie gesungen. Ein Loblied auf Nivernas Güte. Seine Gedanken folgten träge den Tönen, fanden die Worte dazu irgendwo in seiner Erinnerung. »Wir ehren die Göttin, die heilt und hilft …«
Er öffnete die Augen.
Holzbalken. Dazwischen Dachlatten. In der Ecke wob eine Spinne ihr Netz. War er zu Hause? Nein, der Boden unter ihm war hart. Kein Strohsack. Mühsam drehte er den Kopf.
Ein düsterer, weiter Raum mit schrägen Wänden aus Holz – Balken und Dachlatten. Ein Tisch und ein paar Schemel. Auf einem saß eine Frau und nähte. Niv Solena.
Erinnerung überflutete ihn – Aroanídas Gesicht, sein Verrat an ihr und an den Elynn, ein Kampf, eine Schwertspitze, die aus seinem Bauch ragte, entsetzlicher Schmerz. Er tastete. Da war eine Narbe, aber keine Wunde.
»Daric.« Solena klang überrascht. Sie trug nicht mehr die Tracht der Nivernen, verbarg ihr kurzes Haar unter einem Tuch. »Wie fühlst du dich?«
Dieser Schmerz, wenn er an sie dachte, diese Leere. Würde das jemals aufhören? Noch einmal schloss er die Augen und atmete, tief und langsam. Dann fragte er: »Wo sind wir?« Seine Stimme klang erstaunlich fest, dafür, dass man ihn aufgespießt hatte wie ein Stück Wildbret.
»In Woran-Sul. Hast du Hunger?«
Er war sich nicht sicher, nickte zögerlich. Woran-Sul, die Stadt der fünf Straßen. Sie hatten sich weit von Gath-Arum entfernt. Wo mochte Mara sein? Sicherlich irgendwo in der Nähe. Nach allem, was geschehen war, würde sie ihre Zofe und Vertraute nicht alleine zurücklassen.
Solena wickelte eine Decke von einem irdenen Topf. Es gab keinen Herd, keine Feuerstelle in diesem Raum, nicht einmal Betten. Nur den Tisch und die Schemel. Ein gewaltiger Abstieg für die Heilige Mutter aus Gath-Arum.
Ob Aroanída noch dort war? Sicher nicht. Wahrscheinlich hatte ihr Vater sie längst nach Slindáwen gebracht, wo sie unter ihresgleichen und in Sicherheit war. Daric hoffte es, schließlich hatte er genau das erreichen wollen. Zumindest bemühte er sich, das zu glauben, gestattete seinen Gedanken keinen Moment, in Zweifel abzugleiten. Aroanídas Leben, im Frieden der Wälder, das zählte mehr, musste mehr zählen als sein Wunsch, sie weiter bei sich zu behalten. Das wäre nichts als Eigenliebe. Doch er würde eher sterben, als sie in jene Dunkelheit und Einsamkeit zu stoßen, in die Mara gestürzt war. Selbst wenn der Schmerz, die Leere und die Kälte ihn vollkommen ausfüllen würden, er würde es ertragen – um ihretwillen.
Zudem: Würde sie je von seiner Finte erfahren, dann bliebe ohnehin nichts von ihrer Liebe. Dann gäbe es nur noch Hass für den Verräter. Nein, die Entscheidung war gefallen. Es gab kein Zurück. Nur es zu ertragen und zu hoffen, dass Aroanídas Leben einst wieder friedlich sein würde, dass diese unsichtbare Wunde heilte.
»Dein Plan ist aufgegangen.« Solena kam mit einer gefüllten Holzschale zu ihm herüber. »Die Leute des Freien haben sich in alle Winde zerstreut, und die Elynn haben unsere Spur verloren.«
Der Freie von Eldrin. Mit erhobenem Schwert hatte er über Daric gestanden. Und dann hatte Daric zum ersten Mal gesehen, was geschah, wenn eine Elynn sich nährte. Wie die Haut des Freien weiß und faltig wurde, wie der gesamte Körper zu vertrocknen schien, während das Anth, die Lebenskraft, ihn verließ.
Sie hat es einmal getan, sie wird es wieder tun. Hannos Worte. Damals hatte er es nicht glauben wollen.
»Den Freien zu töten – das war nicht klug von ihr.« Je öfter sie den Rukh’Enhi brach, umso schwerer würde es sein, die Vergebung ihres Volkes zu erlangen.
»Sie tat es, um dich zu retten.«
»Das weiß ich.« Er stemmte sich auf und hielt nach seinen Kleidern Ausschau. Im hinteren Teil des Dachbodens entdeckte er sie auf einer Leine.
Solena hielt ihm die dampfende Suppe hin. Als er nach der Schale greifen wollte, zitterte seine Hand. Er ballte sie zur Faust, öffnete sie wieder. Das Zittern blieb.
»Du bist fast gestorben. Vielleicht solltest du noch nicht zu viel erwarten.«
Die Tür wurde geöffnet, und Mara trat ein. Noch immer leuchtete die Lebenskraft des Freien von Eldrin aus ihren Zügen, jenes bezwingende Strahlen, das die Menschen einst hatte glauben lassen, die Elynn seien Götter. Offenbar war seit dem Tod des Freien noch nicht genug Zeit vergangen, damit sich dieser Glanz verflüchtigt hätte.
»Willkommen zurück unter den Lebenden.« Sie ließ den Mantel von ihrer Schulter gleiten. Auch sie trug nicht mehr die Tracht der Niv’Amá. Natürlich nicht. »Wie fühlst du dich?«
»Erstaunlich gesund.«
Solena sagte: »Seine Hände zittern.«
»Tatsächlich?« Mara trat näher und nahm seine Hand.
Er wappnete sich gegen den Schmerz, der die elynnische Lebenskraft stets begleitete, doch der blieb aus. Stattdessen durchströmte ihn ein Wohlgefühl, ein glattes, fast rauschhaftes Hoch, als sich das Anth wie Balsam in seinem Körper ausbreitete.
Woher kam das? Sollte er sie danach fragen? Er tat es nicht, fühlte sich seltsam schuldig, dass Maras Anth ihm leichter half, als es das von Aroanída jemals getan hatte.
Sie ließ ihn los. »Besser?«
Er sah auf seine Hände, nickte. »Ich danke dir. Wie lange sind wir schon hier?«
Solena reichte ihm die Suppe. »Drei Tage.«
Drei Tage, dachte er, während er behutsam trank. Vermutlich also vier, seit Mara das Leben aus dem Freien gesogen hatte. Das letzte Mal war der Glanz um Mara schneller vergangen, obgleich sie wesentlich mehr Anth in sich aufgenommen hatte. Ob es daran lag, dass sie auf irgendeine Weise »gesättigt« war?
Er ließ die Schale sinken. »Wie sind wir hergekommen?«
Mara zog einen Schemel neben Solena und setzte sich. »Du erinnerst dich an den Kampf?« Er nickte, und sie fuhr fort: »Einer der Söldner wurde von dir getötet, Eldrin von mir. Einer floh, und der Letzte hat sich mir ergeben. Er hat uns geholfen, dich hierherzubringen.«
Was mochte aus den Konventswachen und den Soldaten geworden sein? Das würde Mara auch nicht wissen. Nur Hedrons Schicksal stand fest. Hedron. Der älteste, kampferprobteste der Vigilias Nivernae. Seine gebrochenen Augen waren geradewegs auf Daric gerichtet gewesen.
Daric schüttelte die Erinnerung ab. Er stellte die leere Schale ab und schob die Decke zurück.
Die Narbe war größer, als er erwartet hatte, lang gezogen und unregelmäßig gezackt. Auch auf seinem Rücken ertastete er sie. Diese Klinge in seinem Körper, das sprudelnde Blut – nur drei Tage waren seitdem vergangen? »Aroanída hätte das nie geschafft.«
Mara lächelte. »Sie schöpft aus der falschen Quelle.«
Was immer das bedeuten mochte. Aber er wollte jetzt nicht über Aroanída sprechen – diese Wunde war noch nicht vernarbt.
»Warum sind wir hier? Gibt es in Woran-Sul kein Atrium Nivernae?« Kaum hatte er die Frage ausgesprochen, wurde ihm klar, wie unsinnig sie war. Bei den Nivernen würden die Elynn Mara zuerst suchen.
»Ich werde keine Niverne mehr sein.«
»Natürlich nicht, das war dumm von mir.«
Sie musste jetzt unerkannt bleiben, wenig Aufsehen erregen. Wie lang mochte es dauern, bis bei den Elynn eine Sache in Vergessenheit geriet? Jahrzehnte? Jahrhunderte?
Mara erhob sich und wandte sich an Solena. »Sag Urbun, er soll Daric nicht mit zur Arbeit nehmen. Er mag gesund erscheinen, aber das ist er nicht.«
»Ich fühle mich gut«, versicherte Daric.
»Vertrau mir. Ich weiß, wie es um dich steht.« Sie nahm ihren Mantel auf – offenbar war sie nur gekommen, um nach ihm zu sehen.
»Urbun«, sagte Daric. »Ist das Eldrins Söldner?«
»Er ist kein Söldner mehr. Er war eine verlorene Seele, unter Soldaten geboren, jeder seiner Tage voller Gewalt. In seinem Leben gab es nichts, woran er glauben konnte – bis jetzt.«
Sie ging. Aus den Geräuschen schloss Daric, dass sie draußen eine hölzerne Treppe hinabstieg. Er sah zu Solena hinüber. »Du vertraust diesem Söldner?«
Solena nahm ihre Näharbeit wieder auf. »Sie vertraut ihm. Das genügt mir.«
***
Aroanída war zu Hause. Wenigstens sagte sie sich das. Slindáwen war der Wald ihrer Kindheit. Ihre Eltern waren hier, ihre Familie.
Und doch – der Wald war ihr fremd geworden. Nicht nur Slindáwen mit seinen vertrauten Orten, Klängen und Düften. Der Wald an sich war fremd, das Leben darin. Die Bedeutungslosigkeit der Tage, die Belanglosigkeit der Gespräche, die dem Schweigen um kaum etwas nachstanden, das stundenlange Sitzen und Schauen – es genügte ihr nicht mehr.
Einige ihrer alten Freunde kamen und wollten von ihren Erlebnissen unter den Menschen hören, doch ihr Vater schickte sie alle fort. »Lasst sie heilen. Lasst sie vergessen. Es war eine unselige Zeit, über die man nicht mehr sprechen sollte.«
Dabei sehnte sich alles in ihr, darüber zu sprechen, über die Menschen und insbesondere über Daric. Sie wünschte sich, Worte zu finden, die sein Andenken erhalten würden: seine Fürsorge, seine Tatkraft, seine Sehnsucht nach dem Guten. Sie wollte von ihm erzählen, von ihm singen und um ihn weinen – doch nicht einmal das gestattete sie sich. Niemand hätte es verstanden. Um einen Urunen weinen? Wer weinte um eine Raupe, die vom Vogel gefressen wurde, oder um einen Baum, der dem Blitz zum Opfer fiel? Nicht einmal ihrer Mutter, die sie doch mit reiner Liebe umgab, konnte sie ihren Schmerz offenbaren. Nicht einmal sie hätte es verstanden.
Der Einzige, der von ihrem Vater nicht vertrieben wurde, war Kahásurath, der Mann, dem sie vor Jahren ihr Thaléth versprochen hatte – und den sie um dieses Versprechen betrogen hatte. Er suchte sie am dritten Tag nach ihrer Heimkehr auf, und gemäß der Sitte der Ilani setzte er sich zu ihr und schwieg. Auch Aroanída schwieg. Was hätte sie ihm auch sagen sollen?
In Slindáwen waren viele miteinander verwandt, aber falls eine familiäre Verbindung zwischen ihr und Kahásurath bestand, war die Blutlinie so verdünnt, dass seine Gedanken die ihren nicht erreichten. Daher war er ein geeigneter Kandidat gewesen. Sie hatten ein paar angenehme Sommer miteinander verbracht. Er war freundlich und zuvorkommend. Er hörte ihr zu, auch wenn sie manchmal den Eindruck hatte, dass er nicht wirklich verstand, was sie bewegte. Seine Ansichten waren eher traditionell, das hatte ihren Vater für ihn eingenommen, aber wenn sie hin und wieder ihr Anth an ein urunes Wesen verschenkte, ließ er sie gewähren ohne ein Zeichen der Missbilligung.
Sie mochte ihn, sie fühlte sich wohl in seiner Gegenwart. Damals hatte sie gedacht, dass das genügen würde. Ohnehin waren die Ilani nicht für die großen Gefühle geschaffen. Wie oft hatte Vater ihr das gepredigt, und warum hätte sie an der Wahrheit seiner Worte zweifeln sollen?
Doch dann war Daric gekommen. Daric, mit seinem Kampfeswillen und seiner Sehnsucht. Daric, der eintrat für einen Diener, einen Edlen, ein ilanes Kind. Der nicht aufgab und sich nicht fürchtete vor der Macht der Gefühle. Verstohlen legte sie die Hand über den Stoff, der um ihr Handgelenk geschlungen war. Das Tuch war durchtränkt von seinem Blut, von seinem letzten Anth. Ilani hatten keinen Besitz, benötigten keinen, doch von diesem Fetzen Stoff konnte sie sich nicht trennen.
Schweigend saß sie neben Kahásurath, eine ganze Nacht hindurch, doch die alte Vertrautheit wollte sich nicht wieder einstellen. Es war nicht seine Schuld. Sie selbst war eine andere geworden.
Erst als die Morgensonne den Tau zum Glitzern brachte, richtete Kahásurath das Wort an sie. »Du warst viele Monde in der Welt der Menschen. War es so, wie du es dir erhofft hattest?«
Was hatte sie erhofft, damals, als sie Slindáwen verlassen hatte, um ihren Vater in Geri-N’Gor aufzusuchen? Gute zwei Jahre lag das zurück, eine so kurze Zeit, aber wie viel war während dieser Jahre geschehen. Ihre Gedanken kehrten zurück nach Gath-Arum, zu Mara und den Nivernen. Davor lagen die Tage im Tross bei Brid. Davor wiederum zwei Jahre, die sie mit Daric in Áthon gelebt hatte. Das Feuer im Jorisgrund, die Zeit in Geri-N’Gor und Darics Kampf in der Arena, wie ein Abschluss ihrer gemeinsamen Flucht über den Hohen Kerren. Wie furchterregend ihr Daric erschienen war an jenem ersten Abend, mit seinen Ketten und seinen Narben.
Was hatte sie sich erhofft, als sie zum ersten Mal in ihrem Leben den Fuß auf ein Stück Boden gesetzt hatte, das nicht durchdrungen war von der Verbindung, nicht durchzogen von den Fäden und Wurzeln, die das Wesen Slindáwens formten?
Sie hatte ihren Vater wiedersehen wollen, der unter den Menschen gelebt hatte. Doch das war ein vorgeschobener Grund. Tatsächlich hatte sie versucht, das Unvermeidliche hinauszuzögern, das Leben als Gefährtin, als Mutter. Eine letzte Möglichkeit, noch einmal zu blühen, bevor die biegsamen Ranken ihres Lebens verholzen und versteifen würden. Ein Abenteuer. Eine Erfahrung. Etwas, von dem sie würde zehren können für den Rest eines langen, ereignislosen Lebens.
Und wie viel davon hatte sie gefunden! Wege, die sie nie zu betreten gewagt hätte – an Darics Hand hatte sie sie durchschritten. Höhen und Tiefen, mehr als manche Ilana in Hunderten von Jahren. Sie hatte einen Gefährten gefunden, den sie für den Rest ihres Lebens im Herzen tragen würde.
»Ja«, sagte sie. »Was ich gesucht habe, habe ich gefunden.«
Was nun noch kam, war nicht mehr von Bedeutung. Aber was immer es war, sie würde es nicht an Kahásuraths Seite erleben. Und es war nicht recht, ihn etwas anderes glauben zu lassen.
Sie atmete tief ein und wandte sich ihm zu. »Ich danke dir, dass du gekommen bist. Du bist freundlich und gutherzig, und eines Tages wirst du eine gute Gefährtin finden.«
Er blickte sie unsicher an. »Also ist es wahr, was dein Vater angedeutet hat?«
Kahásurath und seine Familie hatten ein Anrecht darauf, es zu erfahren – und danach würde es sich in den Wäldern nicht mehr verheimlichen lassen: dass sie ihr Thaléth einem Menschen geschenkt hatte. Das war seit über tausend Jahren nicht mehr geschehen. Nicht mehr seit Aëléanor und Tarmun, nicht mehr, seit die Ilani den neuen Weg, den Rukh’Enhi, beschritten hatten.
»Es ist wahr.« Sie sah ihm gerade in die Augen, während sie das sagte, denn sie schämte sich nicht für das, was sie getan hatte. Sie schämte sich nicht für Daric. Und sie bereute nichts.
***
Als Daric das nächste Mal erwachte, war er auf dem Dachboden alleine. Neben sich fand er seine Waffen und seine Kleidung. Die Uniformjacke hatte Solena gewaschen und ausgebessert, doch der Schatten eines riesigen Blutflecks war geblieben und zeigte deutlich, wie nahe er dem Tod gekommen war. Unter der Jacke lag, zusammengefaltet, der Freipass seines Hauptmanns, der es Daric erlaubte, sich einige Tage aus Gath-Arum zu entfernen. Das Papier war vom Blut schwarz und spröde geworden, und beim Auseinanderfalten brach es an einer Falz. Die Buchstaben waren nur noch schwer zu erkennen. Hoffentlich hatten sie für jemanden, der lesen konnte, trotzdem ihre Bedeutung behalten. Die angegebenen Tage waren längst überschritten, aber seine Verwundung rechtfertigte die Verzögerung sicherlich.
Aber war das überhaupt noch von Bedeutung? Wollte er wirklich zurück nach Gath-Arum, wo ihn alles an Aroanída erinnern würde – das Atrium Nivernae, in dem sie gewohnt hatten, die Straßen, durch die sie gegangen waren?
Aroanída! Er durchsuchte hektisch die Taschen der Jacke … bis er sie fand: die Locke dunkelbrauner Haare, zusammengehalten durch ein weißes Band. Solena musste sie zurück in die Tasche gesteckt haben, nachdem sie die Jacke gewaschen hatte.
Daric hob die Locke an seine Lippen, sog ihren Duft ein, und für einen Moment schwelgte er in der Erinnerung an Aroanída, ihr Lächeln, ihre Berührung. Die Sehnsucht wollte ihn überwältigen.
Der Grund! Denk an den Grund! Es half nichts, er musste seine Gedanken auf das richten, was vor ihm lag. Liebevoll rollte er die Haare zusammen und ließ sie zurück in die Tasche gleiten.
Wenn er hierblieb, war er ein Deserteur – aber er war schon viel zu weit von Gath-Arum entfernt, als dass die Rattenfänger ihn hier noch aufspüren würden. Ohne die Uniform war er einfach ein Bewohner von Woran-Sul, ein Bauer, den die Wirren des Krieges in die Stadt verschlagen hatten. Er durfte nur die Soldatenjacke nicht mehr tragen.
Daric steckte das Dokument in die Brusttasche der Uniform und wickelte diese um sein Schwert. Das alles legte er in die Dunkelheit unter den Dachsparren. Dann stand er auf.
Er sei noch nicht gesund, hatte Mara gesagt, aber er fühlte sich frisch und ausgeruht. Daher zog er sich an und erkundete die Unterkunft.
Außer seiner Lagerstätte gab es noch zwei weitere – auch sie nicht mehr als zusammengefaltete Decken auf dem Boden. Sie gehörten wohl Solena und Urbun. Mara hatte für sich sicherlich einen anderen Ort gefunden – einen Garten oder einen Park, wo sie sich zum Ausruhen in die In’kha eines Baumes zurückziehen konnte. Daric trat zu dem einzigen Fenster in ihrem kargen Zuhause: ein kreisrundes Loch in der Stirnwand. Es regnete. Tief unter ihm stapften Menschen durch den Morast, aber es waren keine Soldaten darunter. Gehörte Woran-Sul zum Kaiserbruder Korand oder zur Kaiserwitwe Draugh? Er wusste es nicht. Ein Grund mehr, die Uniform vorerst nicht zu tragen.
Die Häuser dieses Viertels waren alle drei- oder sogar vierstöckig, bis zur ersten oder zweiten Etage aus Stein errichtet, darüber billiger aus Holz. Sie alle wirkten heruntergekommen, geradezu baufällig. Entweder litt ganz Woran-Sul unter dem Krieg, oder aber Mara hatte keine bessere Unterkunft finden können. Hatte sie denn kein Geld auf ihre Flucht mitgenommen? Vermutlich nicht, denn dafür hätte sie ihren eigenen Konvent bestehlen müssen. Nivernen besaßen kein persönliches Eigentum, nicht einmal die Niv’Amá. Daric verstand ihre Beweggründe. Trotzdem war es dumm gewesen.
Ein energisches Klopfen ertönte, und er wandte sich um. »Ja?«
Jemand öffnete die Tür, ein Mann mit fleckigem Hemd. Das schüttere Haar hatte er nach hinten gekämmt, wo es von Schmutz und Fett gehalten wurde.
»Wo ist sie?«, blaffte der Mann.
»Wer?«
»Die Dame von und zu ohne Geldbeutel!«
Verwendete Mara noch ihren Namen aus Gath-Arum? Daric wusste es nicht. Also sagte er: »Ich bin allein hier.«
»Dann fang schon mal an zu packen. Es gibt genug Leute, die froh wären um so ein trockenes Plätzchen – und die es auch bezahlen können!«
***
Als Mara und Solena zurückkehrten, berichtete Daric vom Besuch ihres Hausherrn, doch das beunruhigte die beiden nicht. Auch Urbun kam – ein rotblonder Nolrenier mit Spitzbart – und zählte Solena einige Münzen hin. Offenbar musste seine Arbeit als Tagelöhner die kleine Gruppe versorgen. Entsprechend wässrig war die Suppe, die er mitbrachte.
Schwerfällig ließ Daric sich am Tisch nieder. Mara hatte recht behalten – dieser erste Tag auf den Beinen hatte ihn mehr geschwächt, als er erwartet hatte. Seine Hände zitterten wieder, aber statt es Mara zu sagen, verbarg er sie verstohlen unter dem Tisch und versicherte ihr, er fühle sich gut. Es war nur eine Schwäche, es würde von selbst vorübergehen, und Mara hatte ihm schon mehr als genug geschenkt. Wie oft hatte Aroanída nach ihren Gaben gesagt: »Dein Körper braucht Zeit.« Er benötigte nur ein paar Tage Ruhe.
All das waren triftige Argumente. Doch da war noch etwas anderes, das ihn schweigen ließ. Dieses rauschhafte Empfinden, wenn er ihr Anth empfing – es fühlte sich einfach nicht richtig an. Es zu erhalten, war … unbeschreiblich, aber es hinterließ auch ein unbestimmtes Gefühl von Scham und Schuld.
»Ich werde für einige Tage fortgehen«, kündigte Mara an. »Falls ihr hier nicht bleiben könnt, sucht eine Frau namens Ilgrid in der Gasse der Schreiner. Sie wird eine Unterkunft finden, wenn ihr sagt, dass die Verkünderin euch schickt.«
Die Verkünderin. Ein seltsamer Titel. Wen oder was verkündigte Mara? Daric sah zu Solena hinüber, doch sowohl sie als auch Urbun nahmen Maras Worte einfach hin, und so schwieg auch er.
Sie hatten gerade angefangen zu essen, als der Hausbesitzer erschien. »Da sind die Herrschaften also beim Speisen«, höhnte er. »Ich hoffe, es mundet!«
Mara machte eine auffordernde Geste. »Dürfen wir dich einladen, Ebron?«
»Du hast gesagt, dass du nach vier Tagen zahlen wirst. Nun? Wenn das Geld nicht da ist, könnt ihr das Haus sofort verlassen!«
Ob der Mann auch so sprechen würde, wenn Mara noch jenes erhabene Leuchten ausgestrahlt hätte? Doch die Wirkung des menschlichen Anth war verflogen. Mara sah nur noch wie eine menschliche Frau aus – wenn auch eine ausnehmend anmutige Frau, die sich nicht aus ihrer liebenswürdigen Ruhe bringen ließ. »Ich habe schweren Husten gehört. Ist jemand krank?«
»Dich muss nur die Miete kümmern!«
Mara schenkte Ebron ein warmes Lächeln. »Wer immer es ist, ich kann helfen.«
»Bist du eine Heilerin?«
»Die beste«, sagte Solena stolz.
Ebron zögerte. Tatsächlich flackerte so etwas wie Betrübnis über sein Gesicht. »Da kann niemand helfen.«
»Lass es mich versuchen«, bat Mara. »Wenn es gelingt, soll das meine Miete sein.«
Sofort kehrte der misstrauische Gesichtsausdruck zurück. »Und wie lange soll es dauern, bis deine Kur anschlägt?«
»Wenn du morgen früh noch darauf bestehst, werden wir gehen.«
Ebron schien mit sich zu ringen. Aber was kostete ihn eine weitere Nacht? Schließlich sagte er: »Komm mit.«
Daric stand auf. »Ich begleite Euch.«
»Nein, Daric. Du brauchst noch Ruhe.« Sorge lag in ihrem Blick, Mitgefühl und Bedauern. Einen Moment lang schien es, als wolle sie noch etwas sagen, doch dann ging sie, ohne noch einmal gesprochen zu haben.
Schweigen breitete sich aus, und nur das Schaben der Löffel war zu hören. Nach einer Weile sagte Daric: »Es ist nicht gut, was sie tut. Es wird sich herumsprechen, und wenn die Elynn von einer Wunderheilerin in Woran-Sul erfahren, werden sie kommen.«
Mit lautem Scheppern ließ Urbun seinen Löffel in den Teller fallen. »Sie weiß, was sie tut. Und sie müsste es nicht tun, wenn ich nicht der Einzige wäre, der hier für Geld sorgt!« Er sprang auf und ging. Man hörte seine schweren Schritte auf der Außentreppe.
Solena lächelte entschuldigend. »Seine Verehrung für sie gerät manchmal etwas überschwänglich.«
Urbun war nicht der, um den sich Daric sorgte. »Weißt du, wohin sie geht?«
»Es steht mir nicht zu, zu fragen.«
Eine seltsame Wortwahl. Waren sie nicht Freundinnen gewesen, Vertraute? Und nun, da sie ein Schicksal teilten, umso mehr? Mara war nicht mehr die Niv’Amá, die Heilige Mutter eines Ordens. Was mochte Solena nun in ihr sehen?
»Die Verkünderin«, sagte er nachdenklich. »Wen verkündigt sie?«
»Wen sie immer verkündigt hat – Niverna.«
Einen solchen Titel hatte er noch nie zuvor gehört. All dies war seltsam, fremd, fühlte sich falsch an – so falsch wie das Anth, das Mara verschenkte.
»Hast du schon einmal ihr Anth aufgenommen?«, fragte er.
»Natürlich, viele Male.«
»Und wie hat es sich angefühlt?«
»Scharf und beißend wie eine Flamme. Warum fragst du?«
Also lag es nicht an Mara, dass er ihr Anth so anders empfand. Hatte am Ende er selbst sich verändert?
Solena war offenbar mit sich und dieser Situation völlig im Reinen. Sie fuhr mit ihrer häuslichen Arbeit fort und summte dabei vor sich hin, begann schließlich sogar zu singen. Es war ein Lied in der alten Sprache, die nur noch die Priester und Gelehrten verstanden, aber ein Wort fiel Daric doch auf.
»Ilani«, sagte er. Solena verstummte und blickte fragend zu ihm hinüber. »Davon singst du. Ilani.«
»Es ist das alte Wort für die Götter.«
Es war das Wort, das die Elynn für sich selbst benutzten. Als Maras Vertraute musste Solena das wissen. »Sie nennen sich selbst Götter?«
Solena lächelte nachsichtig. »Sie nannten sich schon immer Ilani. Aber in der alten Zeit verehrten die Menschen sie als Götter, und darum wurde Ilan das Wort für Gottheit.«
In der alten Zeit. Vor Ahashora. Diese große Schlacht der Götter hatte die Welt fast völlig zerstört. Nach den Legenden hatten die Götter daraufhin die Welt verlassen, zuvor aber noch die Elynn als Hüter der Wälder und die Ilonari als Hüter der Menschen eingesetzt. Tatsächlich hatten sie sich in die Wälder zurückgezogen und waren selbst zu den Elynn geworden. Die Elynn wussten das noch, aber unter all den Menschen auf der Welt waren Solena und er vielleicht die Einzigen, die die Wahrheit kannten.
***
Urbun war erst spät zurückgekehrt, und er verließ die Unterkunft am nächsten Morgen sehr früh, nachdem er noch einmal deutlich gemacht hatte, dass er Daric für einen überflüssigen Esser hielt. Mara hingegen war nicht zurückgekehrt, sondern war wohl direkt nach ihrem Besuch bei Ebron zu ihrer angekündigten Reise aufgebrochen. Daric und Solena verbrachten den Morgen also in Unsicherheit darüber, ob sie diesen Ort würden verlassen müssen, bis ein Poltern auf der Treppe erklang. Solena öffnete die Tür, und ein keuchender junger Mann betrat rückwärtsgehend den Dachboden. Er trug das Kopfteil eines Bettes, und als sich dieses weit genug in den Raum geschoben hatte, kam auch dessen zweiter Träger zum Vorschein – es war Ebron.
»Wo sollen wir es hinstellen? Hier?«
Solena dirigierte die beiden Männer an eine Wand. Dort setzte Ebron schnaufend das Bett ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »So. Das sollte ein guter Anfang sein. Die Matratze ist zwar nur mit Stroh gefüllt, aber mehr können wir der Herrin leider nicht bieten.«
Solena lächelte. »Ich schließe aus deiner Freundlichkeit, dass wir das Haus nicht verlassen müssen.«
»Im Gegenteil! Ich wäre beleidigt, wenn ihr gehen würdet! Wo ist sie?« Ebron sah sich um, als könne Mara sich irgendwo in den Schatten ihrer kargen Unterkunft versteckt haben. »Sie könnte sich einmal das Bein meines Neffen anschauen. Und die Frau eines Nachbarn hat sich die Hand verbrüht, vielleicht weiß sie Rat.«
»Sie wird erst in einigen Tagen zurückkehren«, sagte Solena. »Auf mir liegt nicht der gleiche Segen wie auf meiner Herrin, aber ich werde mir die Verbrennung gerne ansehen.«
Kapitel 2
Kemina von Lurh, die Niv’Amá von Woran-Sul, entsprach in etwa dem Bild, das Mara sich von ihr gemacht hatte. Viele Jahre lang hatten sie einen regen Briefwechsel geführt, doch gesehen hatte Mara ihre Amtsschwester noch nie – bis heute.
Kemina wirkte ernst und hart. Nicht die Liebe Nivernas sprach aus ihren Zügen, sondern Strenge und Pflichtgefühl, und doch war sie gerade deshalb ein Segen für das Atrium Nivernae.
Der Konvent lag einen halben Tagesmarsch vor der Stadt und war schon immer bekannt gewesen für seine Heiltees und Tinkturen. Doch seit Kemina dort das Amt der Niv’Amá übernommen hatte, ließ sie ihre Nivernen akribisch Buch führen über die Wirksamkeit jeder Behandlung, den Verlauf jeder Erkrankung. Nicht die Wunder der Göttin, sondern die mess- und nachvollziehbare Wirkung von Heilpflanzen war die Grundlage für den Ruhm dieses Konvents.
In Maras Zeit als Niv’Amá von Gath-Arum hatten ihr Keminas Erkenntnisse oft gute Dienste geleistet, und Mara hatte den Ernst und die Hingabe, mit denen Kemina ihre Studien betrieb, immer respektiert. Doch heute erschwerte Keminas mangelnder Glaube an die Wunderkraft der Göttin Maras Vorhaben.
Natürlich hatte Mara sich nicht als Keminas langjährige Korrespondenzpartnerin und Niv’Amá von Gath-Arum vorgestellt. Seit sie sich zum ersten Mal genährt hatte, wirkte sie wieder wie eine junge Frau. Einen fast zwei Jahrzehnte währenden Briefwechsel würde sie nicht erklären können. Hier wie in der Stadt war sie die Verkünderin, so lange, bis sie endgültig entschieden hatte, wie es weitergehen würde.
»Mir ist schon zu Ohren gekommen«, sagte Kemina, »dass sich eine angebliche Wunderheilerin in Woran-Sul aufhält. Ich hätte allerdings nicht erwartet, dass sie die Unverfrorenheit besitzt, bei mir vorzusprechen.«
Es war erstaunlich, wie schnell sich solche Dinge verbreiteten. Vielleicht hätte sie nicht gleich am ersten Tag ihrer Ankunft und auf offener Straße diesem verletzten Maurer helfen sollen. Aber es war ihr inzwischen so zuwider, sich selbst zu verleugnen und ihre Kraft zu beschränken. Sie hatte ihn nicht einfach sterben lassen können.
»Warum hätte ich nicht kommen sollen?«, fragte sie. »Wir beide dienen der Göttin.«
»Zu oft habe ich Leute das sagen hören, die doch nur dem eigenen Geldbeutel dienten. Verzeih mir daher, wenn ich dir nicht sogleich Tempel und Schatzkammer öffne.«
»Ich erwarte weder das eine noch das andere. Ich bin nur die Verkünderin.«
»Und was verkündest du?«
»Die Göttin selbst wird herabsteigen und die Menschen heilen.«
Kemina schnaufte verächtlich. »Argkhan ist der Einzige der Götter, der noch herabsteigt – und das auch nur, wenn man seinen Dienern Glauben schenkt.«
Keminas Skepsis war durchaus gesund. Natürlich waren die Geschichten der Argkhanen nichts als geschickte Lügen, um die Ehrfurcht und die Spendenfreudigkeit der Gläubigen zu erhalten. Als Niv’Amá hatte Mara die Priester geradezu um das Geschick beneidet, mit dem sie diese Legende am Leben hielten. Doch heute gab es keinen Grund mehr, nicht das Gleiche zu versuchen.
Leider musste sie sich dazu ausgerechnet mit Kemina auseinandersetzen. Vielleicht hätte sie es mit ihrer Amtsschwester in Arawill leichter gehabt, doch diese Stadt lag noch weiter östlich, und wegen des Krieges waren die Straßen unsicher.
Mara versuchte es mit einer anderen Legende der Menschen. »Wandeln nicht auch die Verborgenen unter uns?«
Doch auch hier war Kemina nicht versöhnlicher. »Aberglaube des Volkes, um sich Dinge zu erklären, die es nicht versteht. Warum sollten die Götter die Welt verlassen, nur um unerkannt zurückzukehren?«
»Weil sie Mitleid kennen«, sagte Mara, »und Erbarmen. Geht mit mir in den Krankensaal. Ich fühle, dass die Göttin Euch ein Zeichen senden will.«
»Das werde ich auf keinen Fall tun. Die Menschen dort ertragen genug Leid, und ich werde sie nicht einer Betrügerin ausliefern. Wenn du mir also nichts anderes zu sagen hast, meine Zeit ist knapp.«
Vielleicht war es zu früh. Vielleicht musste sie mehr heilen, mehr Anhänger gewinnen, damit deren Stimmen sich mit der ihren vereinten. Mara erhob sich. Doch dann erinnerte sie sich an einen Namen aus Keminas Briefen. »Peramon.«
Kemina sah misstrauisch zu ihr auf. »Was ist mit ihm?«
»Ich weiß es nicht – die Göttin gab mir den Namen ein. Hat er eine Bedeutung für dich?«
Natürlich wusste sie es. Immer wieder hatte Kemina über den Sohn ihrer verstorbenen Schwester geschrieben. Er war als Kind infolge einer Krankheit erblindet und lebte heute als Diener im Konvent. Was hatte Kemina nicht alles versucht, um ihm das Augenlicht wiederzugeben: Tropfen, Augenbäder – selbst den Augenschnitt mit Entfernung der Linse, der von den Nivernen in Arawill so oft erfolgreich durchgeführt wurde. Doch nichts davon hatte ihn heilen können.
Schon früher hatte Mara nach Woran-Sul reisen wollen, um sich des jungen Mannes anzunehmen, einfach um der geschätzten Schwester willen. Doch nicht nur ihre Pflichten und der Krieg hatten sie davon abgehalten. Peramon war in sehr jungen Jahren erblindet und sein linkes Auge zudem jetzt ohne Linse. Würde sein Körper noch verstehen und die Kraft der Elynn richtig gebrauchen? Doch heute, mit dem richtigen Anth …
Es blieb ein Wagnis. Doch die Zeiten, in denen Mara sich in die sichere Welt der Elynn und später des Atrium Nivernae zurückgezogen hatte, waren vorbei. Sie würde bald schon größere Wagnisse eingehen als dieses.
»Die kommenden beiden Nächte«, sagte sie, »soll er betend im Tempel verbringen. Würdet Ihr ihm das erlauben?«
Kemina zögerte. Mara ahnte, was in ihr vorging. Ja, Kemina hatte ihr Leben der Erforschung der Natur gewidmet, aber sie diente auch der Göttin. Sie war keine Ungläubige. Gebet und Einkehr waren Teil ihres Lebens – und Peramon lag ihr am Herzen.
»Ich werde ihn anweisen, das zu tun. Aber ich werde ihm keine Hoffnung machen. Ich werde nicht von Heilung sprechen.«
Mara neigte zustimmend den Kopf. Ihr blieb ein Tag, um sich vorzubereiten. Das sollte ausreichen. Peramon würde sein Wunder bekommen.
***
Zuerst war da nur erneut das Zittern. Es bemächtigte sich Darics Hände und steigerte sich innerhalb eines Tages so sehr, dass er keinen Becher mehr halten konnte, ohne das Wasser zu verschütten. Und es wurde schlimmer – zuerst Tag um Tag, dann Stunde um Stunde. Es breitete sich in seinem Körper aus, bis er wie im Fieber schlotterte und kaum mehr die Kraft hatte, sich auf den Beinen zu halten. Schmerzen kamen hinzu – ein dumpfer Druck, dessen genauen Sitz er zuerst nicht ausmachen konnte und der sich schließlich zu einem schier unerträglichen Stechen hinter seinen Rippen steigerte. Mit jedem Atemzug quälte es ihn.
Solena wusste nicht, was sie tun sollte. Eine solche Krankheit war ihr fremd. Sie versuchte Tees, kalte und warme Wickel, doch alles brachte höchstens kurzfristige Linderung.
Inzwischen war Mara drei Tage fort. Niemand wusste, wo sie war und ob sie überhaupt zurückkehren würde. Daric hätte zu den Göttern um ihre Rückkehr gefleht, hätte er noch an diese geglaubt. Doch so konnte er nichts tun, außer zu warten und zu hoffen.
***
Mit einiger Mühe gelang es Mara, den Toten zum Wasser zu ziehen und in den Fluss zu rollen. Mit genügend Zeit konnte Wasser einen Körper völlig entstellen. Es würde ihre Tat verschleiern, selbst wenn man ihn fand.
Er war sicherlich kein guter Mensch gewesen – eine allein umherirrende Frau mit prallem Geldbeutel war für ihn nicht mehr als eine leichte Beute gewesen. Trotzdem bedauerte sie, dass sie es hatte tun müssen.
Sie hob die Hände und betrachtete prüfend ihre eigene In’kha. Das uruneAnth, das sie von ihm aufgenommen hatte, schimmerte in den Farben des Regenbogens. Sie wurde immer besser darin, es zu bewahren. Inzwischen konnte sie es über einen ganzen Tag hinweg mit sich tragen, ohne dass ihr Körper die menschliche Lebenskraft in ilanes Anth umwandelte.
Menschliches Anth. Das Wissen darum verdankte sie Daric. Als er vor ihr gelegen hatte, mit dieser Wunde, die seinen ganzen Körper durchdrang, hatte selbst sie nicht an Rettung geglaubt. Doch zu ihrem eigenen Erstaunen war es gelungen.
Erst später hatte sie verstanden. Die Anth-Rishara, von der alles Leben kam, hatte jedem ihrer Geschöpfe seine eigene Art von Anth zugeteilt, und nur die Ilani, ihre Kinder, konnten es nehmen und schenken. Aber wenn ein Lebewesen Anth einer anderen Art erhielt, musste dessen Körper es zuerst in seine eigene umwandeln. Das war der Grund für jenes Leuchten, das die Menschen an ihr sahen, solange sie das urune Anth noch ungewandelt in sich trug.
Damals, als sie versucht hatte, Daric zu heilen, war sie noch ganz erfüllt gewesen von der Lebenskraft des Freien von Eldrin, und das menschliche Anth hatte bewirkt, was ilanes niemals hätte bewerkstelligen können. Darics Körper hatte keine Zeit, keine Kraft benötigt, es umzuwandeln. Er hatte es mühelos aufgenommen.
Leider hatte sie nicht bedacht, wozu es noch führen würde. Sie hatte seine Schwäche gesehen, vor drei Tagen, obgleich er es zu verbergen versucht hatte. Aber an jenem Tag hätte sie ihm nicht helfen können, selbst wenn er sie darum gebeten hätte. Es würde anders sein, wenn sie dieses Anth bis zu ihrer Rückkehr bewahren konnte. Hoffentlich war es dann nicht zu spät.
Aber noch konnte sie nicht zurückkehren. Das hier, Peramon, war wichtig. Wenn es gelang, würde es viel mehr sein als einfach eine weitere Wunderheilung. Es wäre ein Zeichen für eine Niv’Amá, deren Wort nicht nur in ihrer Stadt Gewicht hatte. Darum musste sie alles daransetzen, ihm zu helfen – und menschliches Anth verbesserte ihre Möglichkeiten erheblich. Nur darum hatte sie diesen Dieb getötet.
Sie öffnete ihren Geldbeutel und ließ die Steine zu Boden fallen, die ihn so prall hatten wirken lassen. Dann füllte sie ihn mit den Münzen, die sie dem Toten abgenommen hatte. Dies waren schlimme Zeiten, und um sie zu verändern, musste auch sie schlimme Dinge tun. Das hatte sie ebenfalls von Daric gelernt.
Die Nacht war längst angebrochen, als sie über die schimmernden Wiesen zurück zum Atrium Nivernae wanderte. Die Silberzeit – so nannten die Elynn diese Stunden, in denen alle Lebewesen nur noch aus sich selbst heraus leuchteten. Sie hatte dieses Wort so lange nicht verwendet, denn Menschen würden es nicht verstehen. Menschen sahen die In’kha eines Lebewesens nicht. So bemüht war sie gewesen, sich den Menschen anzupassen, nicht aufzufallen, sie ihr Anderssein nicht merken zu lassen, dass sie fast vergessen hatte, wer sie wirklich war.
Aber war es nicht genauso bei den Elynn gewesen? Immer hatte sie sich verstellen, sich zurückhalten müssen, wenn Mitgefühl sie ergriffen hatte, oder Zorn. Elynn durften sich ihren Gefühlen nicht ergeben, durften sich nicht forttragen lassen von ihnen. Schon einmal hatte das die Welt zerstört. Was für ein Unsinn! Nicht ihre Gefühle hatten die Welt zerstört, sondern ihre Taten. Hätten sie daraus wirklich gelernt, dann könnten sie nun die Menschen führen, sie lehren und anleiten. Sie könnten verhindern, dass die Menschen die gleichen Fehler begingen wie sie selbst. Stattdessen zogen sie sich zurück und sahen zu, wie Kriege geführt und Städte geschleift wurden, wie Frauen Gewalt angetan und Männer wegen Nichtigkeiten gehenkt wurden.
Mara näherte sich einem einzeln stehenden Baum, von dem ein menschlicher Körper baumelte. Wie viele davon hatte sie auf dem Weg bereits gesehen! Dieser hier war vielleicht ein Deserteur, vielleicht ein Bauer, der sich den Soldaten entgegengestellt hatte, oder einfach nur ein Vagabund, der gestohlen hatte. Es war nicht mehr zu sagen, denn man hatte ihm die Kleider genommen. Nackt und namenlos, fern der Heimat, war er einen sinnlosen Tod gestorben. Kein Liebender würde ihn beweinen und seinen Körper bestatten. Nur die Krähen sangen für ihn mit ihren rauen Stimmen.
Und all das nahmen die Elynn einfach hin. Ilani. Sie nannten sich selbst Ilani. So fremd waren sie ihr geworden, dass Mara sogar in ihren Gedanken die menschliche Bezeichnung für sie verwendete. Sie war keine der Ihren mehr. Aber sie war auch kein Mensch. Sie war nur noch sie selbst, und was das bedeutete, musste sie erst herausfinden. Ein neugeborenes Wesen, so jung, dass sie noch nicht einmal einen Namen hatte. Weder Mara von Áthon noch Marathosahrúna jando Áthona fühlte sich richtig an. Darum nannte sie sich nur noch die Verkünderin. Sie würde einen anderen Namen erwählen. Wenn es an der Zeit war.
Die Tore des Konvents von Woran-Sul waren zu dieser Tageszeit lange geschlossen – natürlich. Doch die hohe Mauer um Gebäude und Kräutergärten war überwuchert von Efeu und wildem Wein – für eine Elynn kein Hindernis, sondern ein Pfad.
Sie trat an die Mauer und verschränkte ihre In’kha mit der des Weines. Dadurch verschwand sie nicht nur für menschliche Augen, sie wurde von der Pflanze auch gehalten und getragen. Mühelos kletterte sie auf die Mauer und sah sich um.
Die Gebäude waren dunkel. Die Mitternacht rückte näher, und die meisten Bewohner des Konvents lagen vermutlich in tiefem Schlaf. Nur aus einem Fenster drang ein schwacher Lichtschein. Wachte dort die Niv’Amá, beunruhigt von dem Gedanken, die Göttin könne tatsächlich herabkommen und ein Wunder wirken? Vermutlich weckte diese Aussicht Hoffnung und Sorge zu gleichen Teilen. Der Gedanke ließ Mara lächeln.
Sie lief aufrecht auf der Mauerkrone entlang. Sie musste sich nicht verbergen, denn es war eine dunkle Nacht – für Menschenaugen.
An einer Stelle grenzte ein Dach an die Mauer. Die hölzernen Schindeln gaben ihren Füßen guten Halt, und so lief sie weiter von Dach zu Dach dorthin, wo sich die Kuppel des Tempels erhob.
Er war ein wenig größer als »ihr« Tempel in Gath-Arum, hatte wohl doppelt so viele umlaufende Säulen, aber ansonsten war seine Form sehr traditionell. Alle der Niverna geweihten Heiligtümer glichen sich: frei stehend, rund, mit einer umlaufenden Säulenreihe und einer Kuppel versehen. Das letzte Gebäude davor war das Haupthaus, und auch hier rankte Efeu an den Wänden. Lautlos ließ Mara sich daran hinab.
Die Tür des Tempels war geschlossen und besaß weder Griff noch Riegel. Nicht nur die Argkhanen hatten ihre Zauberlegenden. Allein wenn Nivernas Kraft selbst die Tür öffnete, so hieß es, konnten die Gläubigen den Tempel betreten. Einer Betrügerin würde es kaum gelingen, dieses Wunder zu wirken – darauf zählte Kemina zweifellos.
Doch für die ehemalige Niv’Amá von Gath-Arum barg die Tür kein Geheimnis. Sie fand das bewegliche Ornament, schob es zur Seite und betätigte den dahinterliegenden Riegel. Mit einem leisen Schaben kam ihr das Türblatt entgegen, gezogen von Gewichten unterhalb des Tempels.
Im Inneren war es dunkel. Steinerne Wände verbreiteten kein Licht, nicht einmal für Elynn. Doch die kauernde Gestalt in der Mitte des Raumes schimmerte bläulich, fast weiß. Selten hatte sie einen Menschen so tief in Meditation versunken gesehen, dass all seine Gedanken und Empfindungen zur Ruhe gekommen waren. Doch ihr Respekt wandelte sich in Belustigung, als ein leises Schnarchen erklang, und sie musste lächeln. Schlaf statt Einkehr, aber auch das kam ihr entgegen.
Auf ihren bloßen Füßen glitt sie lautlos in den Raum hinein. Der Duft nach verbrannten Kräutern schwängerte die Luft, weckte Erinnerungen an Gath-Arum und an ihre Nivernen – Niv Lorena, Niv Hiluni. Es war eine gute Zeit gewesen, mit guten Menschen, trotz allem. Und doch lag dies nun hinter ihr.
Sie hatte erwartet, eine Lampe löschen zu müssen, aber natürlich hatte Peramon keine mitgebracht; was wäre sie einem Blinden nütze? Das Standbild der Göttin Niverna wurde nur von seiner In’kha schwach erleuchtet. Es zeigte ein nichtssagend schönes Gesicht, ein Idealbild, wie alle Götterbilder, unnatürlich lang gezogen, selbst für eine Elynn. Für die Menschen kenntlich wurde Niverna durch ihre Attribute – das Kräuterbündel und das kleine Abszess-Messer.
Mara kauerte sich vor Peramon nieder, prüfte das Schimmern der In’kha um seinen Kopf genauer. Feine Linien und Einschlüsse darin sprachen von seiner Erkrankung. Doch sie musste seine Augen in offenem Zustand sehen. Sachte berührte sie ihn an der Schulter.
Peramon schreckte hoch. Obgleich er blind war, riss er die Augen weit auf, bewegte sie hin und her. Er hatte einmal sehen können, früher. Sein Körper hatte es wohl nicht vergessen. Lauschend hob er den Kopf.
Sie flüsterte: »Hab keine Angst.«
Doch genau das ließ den Schrecken in seiner In’kha auflodern. Er wollte aufspringen, sie musste ihn beruhigen. Mara legte die Hände auf seine Schultern, stahl ihm seine Gefühle, indem sie sie in sich selbst hineinfließen ließ. Sie spürte seinen Schrecken, die Furcht vor dem Unbekannten, das nicht zu erklären war. Ihr Herz begann, heftig zu pochen. Peramon hingegen wurde ruhig. Regungslos kniete er vor ihr, das Gesicht gehoben, ließ es zu, dass sie seine Schläfen berührte, über seine Stirn strich und über den Bereich zwischen Augen und Brauen. Sie setzte das Anth behutsam ein.
»Wünschst du dir, wieder zu sehen?«, fragte sie.
»Mehr als alles andere.«
Es half, seine Gedanken und Gefühle auf die Heilung zu richten, das wusste sie. Jahrzehnte der Erfahrung mit menschlichen Gebrechen halfen ihr, zu erkennen und zu heilen. Jahrzehnte – wie wenig war das im Vergleich zu allem, was ihre Vorfahren einst besessen hatten. So viel Wissen war verloren gegangen. Heute lebte kaum noch jemand, der einen der Alten tatsächlich gesehen, geschweige denn, deren Wissen geteilt hatte. Und selbst wenn ein Elynn noch über einzelne Kenntnisse verfügte, so würde er dieses Wissen nicht mehr weitergeben, denn es entsprach nicht dem Rukh’Enhi, dem neuen Weg. Wie viel Weisheit, wie viel Erfahrung waren dem Vergessen anheimgefallen!
An die Altvorderen erinnerten sich die Menschen noch heute. Sie bauten ihnen Tempel, verehrten ihre Namen, sangen ihnen Lieder. Jedoch an die Elynn von heute würde sich niemand erinnern. Nicht die Menschen und nicht sie selbst. Sie wollten es nicht anders, und sie hatten es auch nicht anders verdient. Der neue Weg hatte die Elynn nicht weitergeführt. Im Gegenteil. Sie waren von einem großen, weisen Volk zu verschrobenen Waldbewohnern geworden.
»Es ist dunkel«, sagte Peramon auf einmal. Sie spürte seine freudige Aufregung und nahm sie ihm sofort. Seine Schultern sanken herab, aber seine Gefühle hallten in ihr nach, ließen ihre Finger vor Aufregung zittern.
»War es zuvor nicht auch dunkel?«
»Nein. Zuvor war einfach … nichts. Aber dies hier, die Dunkelheit … ich erinnere mich daran.«
Sie hatte es getan! Jubel erfüllte sie. Wer sagte, dass all das Wissen verloren sein musste? Sie konnten es aufs Neue finden. So vieles war wieder zu entdecken, eine ganze Welt!
Mara löste die Hände von ihm und erhob sich. »Ich werde nun gehen. Du wirst hierbleiben und das Lob der Göttin singen, bis die Sonne sich erhebt.« Wenn er sang, würde er nicht hören, wie sie hinter ihm die Tür schloss.
»Wer bist du?«, fragte er.
Sie zögerte. Sie hatte nach einem neuen Namen gesucht, aber Peramon fragte nicht nach einem Namen. Er fragte, wer sie war. Und diese Frage ließ eine Antwort in ihr aufleuchten, so klar und so eindeutig, dass es sie überwältigte. Sie wusste, wer sie war, wer sie immer gewesen war.
Sie richtete sich auf, und mit ruhiger Gewissheit sagte sie: »Ich bin Niverna.«
Kapitel 3
Daric war nie in Slindáwen gewesen. Trotzdem erinnerte selbst hier Aroanída jede Einzelheit an ihn. Äsende Rehe – nie hatte er aufgehört, den Frieden in ihrer Nähe zu empfinden. Dornenranken, die er so fantasievoll verwünscht hatte, dass es Aroanída immer wieder zum Lachen gebracht hatte. Sogar in der Ratshalle dachte sie an ihn, obwohl er diesen Ort niemals gesehen hatte.
Dass er im Rat von Áthon nicht hatte sprechen dürfen, darüber hatte Daric nie geklagt, aber dass er die Orte, die den Ilani so wichtig waren, nicht einmal hatte betreten dürfen, das hatte er immer wieder bedauert. »Ich habe sogar den Hain der Paten gesehen – ist das nicht viel tiefgreifender?«
Ja, es war tief greifend, aber auf andere Weise. Jeder Baumpate war gekeimt aus dem ersten Anth eines Kindes, das es im Augenblick der Geburt von sich gab wie ein Menschenkind seinen ersten Schrei. Ein solcher Baum blieb mit seinem Ilani verbunden, ein Leben lang, zeigte getreulich Gedeihen, Verletzung, Heilung – und Tod. Der Hain der Paten war ein Bild dessen, was die Ilani heute waren – verbunden mit dem Wald in tiefer, inniger Verflechtung.
Die Hallen hingegen waren die letzten Reste dessen, was die Ilani einst gewesen waren, damals, als sie noch unter den Menschen gewandelt waren als ihre Gottkönige. Hier folgten die Bäume nicht dem Wesen, sondern dem Willen der Ilani, und das war nicht ganz so getreu dem Rukh’Enhi, wie die Alten gerne glaubten. Allein das Wort »Halle« fand in der Sprache der Ilani keine andere Verwendung mehr als nur in diesen Verbindungen: Halle der Gebärenden, Halle des Rates, Halle des Gedenkens.
Aroanída hob den Blick und versuchte, diesen Ort so wahrzunehmen, wie Daric ihn gesehen hätte: Ein Rund aus Säulen, ganz ähnlich einem menschlichen Tempel. Tatsächlich war es umgekehrt: Noch immer imitierten menschliche Baumeister unwissend das, was ihre Vorfahren einst an den ilanen Palästen bewundert hatten. Aroanída hatte die Tempel der Menschen gesehen, diese unbeholfenen Versuche, das Lebendige aus Totem nachzubilden.
Die Bäume in der Halle des Rates waren nicht nur hoch und gerade, ihre Zweige waren auch untereinander verschränkt, sodass viele Ebenen entstanden, auf denen Ilani standen und saßen. Alle Bäume der Halle konnten erneut miteinander verwachsen, denn sie waren aus dem gleichen Stock gerieben und damit ein einziges Individuum. Das Gewölbe ihrer ineinander verflochtenen Kronen überschattete ein weites Rund und leuchtete grün im Sonnenlicht, während sich in der Mitte der Kuppel ein kreisrundes Loch dem Himmel öffnete.
Die Halle war schön – selbst für menschliche Augen, die doch meist nur das Geordnete und Gezähmte als schön empfanden. Daric hatte das Schöne auch im Wilden, Ursprünglichen sehen können, und die Halle des Rates verband beides miteinander: Gleichmaß und Eigentümlichkeit, gewachsene und geschaffene Formen.
Hätte Daric es so ausgedrückt? Vermutlich nicht. Er hätte ihren Erklärungen gelauscht und den Ort in sich hineinsinken lassen, hätte einfach dagesessen, staunend, hätte den Arm um ihre Schultern gelegt und geschwiegen.
Das Atmen wurde ihr schwer, und sie senkte den Blick auf den Redner. Worüber sprach er? Es kümmerte sie nicht. In Áthon noch hatte sie ihre Meinung im Rat mit Vehemenz vertreten, war zusammen mit Hannomáthenon gegen die Alten aufgestanden. Heute kümmerte es sie nicht mehr. Vater hatte ihr vorgeschlagen, ihn zur Halle des Rates zu begleiten, und sie hatte ihn nicht verletzen wollen.
Ihr Vater stand bei den anderen am Redestein. Ihr Deda, wie sie ihn als Kind zärtlich genannt hatte. Wie sehr musste er gelitten haben, als sie fortgegangen war. Wie sehr mochte er jetzt noch leiden, da sie noch immer nicht ganz zurückgekehrt war, es vielleicht niemals sein würde. Die Zeit unter den Menschen hatte sie verändert. Slindáwen konnte nicht mehr auf die gleiche Weise Heimat sein wie früher, die Ilani nie wieder auf die gleiche Weise ihr Volk – und das lag nicht nur an ihr.
Im Tross hätten die Menschenfrauen getuschelt; Ilani aber tuschelten nicht. Sie teilten ihre Gedanken stumm und warfen Aroanída Blicke zu. Doch sie würde sich nicht verstecken. Indem sie hier saß und den Blicken trotzte, sagte sie: Es gibt nichts, wofür ich mich schämen müsste.
Einige Schritte entfernt stand Kahásurath, und als sie ihm zunickte, grüßte er zurück, verlegen, wollte sich abwenden. Doch dann besann er sich eines Besseren und kam zu ihr. »Einige von uns laufen morgen zu den Sonnensteinen.«
Laufen. Wie gern hatte sie das früher getan, umso mehr, als Daric an ihrer Seite gewesen war. Die Elynn liefen wie Rehe: leichtfüßig, fast schwerelos. Darics Lauf hingegen glich dem eines Wolfs, war voller Kraft, zielstrebig, ohne Spielerei. Er war, wie alles, was er tat, von tiefem Ernst durchdrungen.
Tat – getan hatte. Sie senkte den Kopf. Nie wieder würde er an ihrer Seite die Wälder durchstreifen. »Ich danke dir, aber ...« Sie sprach nicht weiter, und Kahásurath fragte nicht. Er stand noch einen Moment lang bei ihr, unschlüssig, zögernd. Dann ging er und gesellte sich zu einer Gruppe von Freunden.
Freunde. Waren sie das wirklich? Wie anders waren sie als Brid, die sie – die Fremde – mit zupackender Freundlichkeit im Tross aufgenommen hatte. Wie anders war es, wenn Niv Hiluni nach ihrem Ergehen fragte – und dann auch tatsächlich die Antwort hören wollte. So kurz war die Zeit mit ihnen gewesen, und doch würde Aroanída eher ihnen ihr Herz öffnen als den Ilani, mit denen sie ihre Jugend verbracht hatte. Diese beiden würden sich nicht belästigt fühlen von ihrem Kummer und ihren Tränen.
Ilani sind nicht geschaffen für die tiefen Gefühle. Vielleicht war das eine Lüge. Vielleicht fürchteten sie sich bloß davor.
Ein Klang erwachte in ihrem Geist. Aroanída schloss die Augen und lauschte. Die Stimme ihrer Mutter, Niebeléanor. Ein Gast war eingetroffen. Aus Áthon!
Sie sprang auf, sah zu ihrem Vater hinüber, der in der Gruppe am Redestein stand. Er drehte sich zu ihr um und hob die Hand. Auch er hatte Niebeléanors Ruf vernommen.
Als er zu ihr herüber kam, griff sie unwillkürlich nach seiner Hand, wie sie es als kleines Mädchen getan hatte, und drückte sie sanft. Er verstand die Geste und lächelte, doch es schien ihr, als geschähe das mehr zu ihrer Aufmunterung als zu seiner.
Jorándelar und Niebeléanor. Nicht mehr oft trafen sich die beiden in den Weiten Slindáwens. Das Thaléth verband sie noch immer, natürlich; nur der Tod konnte es zerbrechen. Und doch stand etwas zwischen ihnen: der Schatten eines kleinen Jungen. Aroanídas Bruder Garisbárian, der vor so vielen Jahrzehnten gestorben war.
Seit jener Zeit war das Schweigen in Aroanídas Familie eingezogen, und sie, die immer folgsame Tochter, hatte ebenfalls geschwiegen. Hätte sie nur früher gewusst, was sie durch Daric gelernt hatte: wie heilend das Reden war. So viele Begebenheiten aus seinem alten Leben hatte er ihr erzählt, so viel Grauen und Schuld mit ihr geteilt. Und auch wenn sie in den zwei Jahren in Áthon sicherlich nicht alles erfahren hatte, was sein Herz quälte, so hatte es doch dazu beigetragen, seine Seele gesunden zu lassen.
Doch ihre Eltern sprachen nicht über ihren Schmerz. Stattdessen war ihr Vater für viele Jahrzehnte in den Wald von Terénitham gegangen und später sogar zu den Menschen nach Geri-N’Gor. All das, um Garisbárians Schatten zu entfliehen. Doch einen Schatten vermochte nur das Licht zu vertreiben.
Inzwischen war es zu spät. Das Schweigen in ihrer Familie war zu einem Felsen geworden, der zwischen ihnen stand und den doch niemand zu beachten schien.
»Weißt du, wer der Gast ist?«, fragte sie, während sie die Halle des Rates verließen.
»Es ist wohl Hannomáthenon.«
Kein anderer Gast aus Áthon hätte Aroanída mehr Freude bereiten können. Er war Darics Freund gewesen, auch er empfand Schmerz über seinen Tod. Als sie ihn erblickte, wollte sie auf ihn zulaufen und ihn umarmen – doch da war etwas in seinem Gesicht, in seiner In’kha, das sie zögern ließ. Sein Gruß wirkte befangen, kaum sah er sie dabei an. Stattdessen wechselte er einen raschen Blick mit ihrem Vater. Auch als er dann über die vergangenen Tage berichtete, schien er nur zu ihren Eltern zu sprechen.
Nach Darics Tod und Maras Flucht waren die anderen Ilani nach Áthon zurückgekehrt. Aroanída erkundigte sich nach Darics Familie. Hatte man seine Schwester wissen lassen, was geschehen war? Nein, niemand hatte das für nötig gehalten. Nicht einmal Hannomáthenon, der doch sein Freund gewesen war.
Ein seltsamer Schmerz erwachte in Aroanídas Brust. Vielleicht war es Kummer.
»Ich war nicht in Áthon«, sagte Hannomáthenon. »Ich bin Marathosahrúnas Fährte gefolgt, bis ich sie auf einer menschlichen Steinstraße verloren habe.« Dennoch wollte er weiter nach ihr suchen. Er war ihr Bruder. Es war seine Aufgabe.
»Sie wird sich unter die Menschen mischen, und ich werde das Gleiche tun. Dabei hoffe ich auf deinen Rat, Jorándelar. Du hast unter Menschen gelebt.«
Doch Jorándelar hatte dies als Ilan getan. Er hatte sich nicht als einer der Ihren ausgegeben. Vermutlich hatte Aroanída ein tieferes Verständnis für die Welt der Menschen erlangt als er. Doch das sagte sie nicht. Der seltsame Schmerz hatte sich gesteigert, war zu einem Brennen unter ihren Rippen geworden. Verstohlen legte sie die Hand über die Stelle, bemühte sich, flacher zu atmen. Sie sah zu ihrer Mutter, zu ihrem Vater, doch keiner von beiden schien ihre Empfindung zu teilen. Völlig unbefangen sprachen sie mit Hannomáthenon.
War dies etwa nicht ihr eigener Schmerz? Aber auch den Schmerz eines anderen Familienmitglieds hätte einer von ihnen gefühlt. Sie wandte sich ab, die Hand weiter auf ihre Seite gepresst. Das war falsch. Schrecklich falsch. Ilani wurden nicht krank.
Die Empfindung war nicht sonderlich stark, wirkte seltsam entfernt. Aroanída hatte Schlimmeres durchlitten, seinerzeit, als sie noch Darics Empfindungen geteilt hatte. Doch damals hatte sie gewusst, was sie fühlte. Dies jedoch kam aus dem Nichts und suchte nur sie allein heim. Das konnte es nicht geben: eine Empfindung solcher Intensität, die sie mit niemandem teilte. Was geschah nur mit ihr?
Im Atrium Nivernae hatte sie die Krankheiten und Leiden der Menschen gesehen – vielleicht war etwas davon bei ihr geblieben. Oder dies war die Strafe dafür, dass sie ihr Thaléth einem Menschen geschenkt hatte. So musste es sein. Sie hatte das Geschenk der Anth-Rishara, der Lebensspenderin, entweiht, und nun entzog diese Aroanída ihre Gunst.
»Aroanída?« Ihr Vater sah zu ihr herüber, fragend, beunruhigt. Sie streckte die Hand nach ihm aus. »Vater! Hilf mir!«
***
Daric würgte, obwohl sein Magen schon lange nichts mehr hergab. Sein gesamter Körper schien zu brennen – innerlich und äußerlich. Er hatte in seinem Leben schon oft Schmerzen ertragen, hatte sich für zäh und hart gehalten, doch dies hier zermürbte seine Kräfte. Es gab kein Entkommen, keine Körperhaltung, die auch nur noch so kurzfristige Erleichterung schenkte. Und immer wenn er dachte, es könne nun nicht mehr schlimmer werden, schienen die Schmerzen sich noch einmal zu steigern. Wäre Solena nicht hier gewesen, er hätte geweint wie ein Kind.
Die ganze Nacht hindurch hatte sie neben ihm gewacht, hatte seine Stirn gekühlt, ihm Wasser eingeflößt, das er doch nicht bei sich behielt. Sie hatte Urbun geschickt, nach Mara zu suchen, und Daric hoffte verzweifelt, dass der Söldner sie aufspüren würde. Wohin war sie gegangen, und warum kehrte sie nicht zurück? Würde sie ihm überhaupt helfen können? Sie hatte ihn so seltsam angesehen, als sie gegangen war. Womöglich wusste sie, was ihm fehlte – wusste, dass selbst sie ihm nicht helfen konnte. Aber sie hatte ihm geholfen, und sie würde es wieder tun, musste es einfach tun. Ohne sie würde er sterben.
Urbun kehrte allein zurück. »Ich habe herumgefragt, niemand hat sie gesehen.« Er gab Solena eine Flasche, so klein, dass er sie in einer Hand hätte verbergen können.
»Das ist zu wenig«, sagte Solena.
»Hat mich alles gekostet, was wir hatten.«
Sie seufzte und setzte Daric den Flakon an die Lippen. »Das wird deine Schmerzen mildern.«