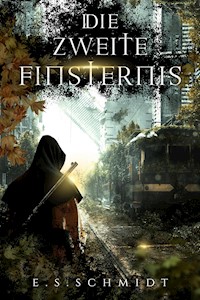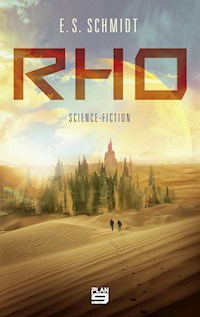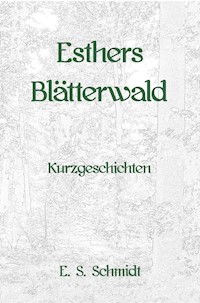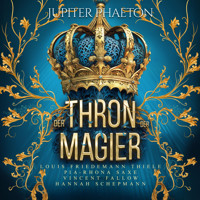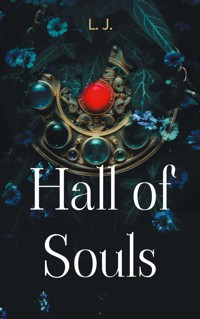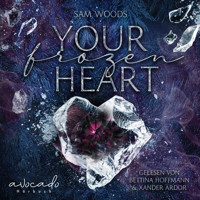4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chroniken der Wälder
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ein atemberaubendes Fantasy-Epos: »Das Erwachen der Hüterin«, der erste Band der Trilogie »Die Chroniken der Wälder« von E. S. Schmidt als eBook bei dotbooks. Seit Jahrhunderten schon lebt das Elfenvolk der Elynn zurückgezogen in den Wäldern, denn in der Welt der Menschen begegnet ihnen nur Misstrauen und blanker Hass. Doch als der junge Daric auf die Elynn Aroanída trifft, verändert sich beider Leben für immer, obwohl sie verschiedener nicht sein könnten! Er ist ein Schwertsklave – zu Unrecht wegen Mordes verurteilt, wurde Daric in der Kunst des Kämpfens geschult, um zur Unterhaltung des Volkes in der Arena einen grausamen Tod zu finden. Als die sanfte wie selbstbewusste Aroanída ihm hilft, aus der Gefangenschaft zu fliehen, geschieht schon bald das Unvorstellbare: Sie können ihre Liebe füreinander nicht länger leugnen. Doch die Elynn bewahren im Dunkel der Wälder ein uraltes Geheimnis, das bald alles in Frage stellt, was die Menschen zu wissen glauben… Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Das Erwachen der Hüterin«, der Auftakt der epischen Fantasy-Saga »Die Chroniken der Wälder« von E. S. Schmidt. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Ähnliche
Über dieses Buch:
Seit Jahrhunderten schon lebt das Elfenvolk der Elynn zurückgezogen in den Wäldern, denn in der Welt der Menschen begegnet ihnen nur Misstrauen und blanker Hass. Doch als der junge Daric auf die Elynn Aroanída trifft, verändert sich beider Leben für immer, obwohl sie verschiedener nicht sein könnten! Er ist ein Schwertsklave – zu Unrecht wegen Mordes verurteilt, wurde Daric in der Kunst des Kämpfens geschult, um zur Unterhaltung des Volkes in der Arena einen grausamen Tod zu finden. Als die sanfte wie selbstbewusste Aroanída ihm hilft, aus der Gefangenschaft zu fliehen, geschieht schon bald das Unvorstellbare: Sie können ihre Liebe füreinander nicht länger leugnen. Doch die Elynn bewahren im Dunkel der Wälder ein uraltes Geheimnis, das bald alles in Frage stellt, was die Menschen zu wissen glauben…
Über die Autorin:
E. S. Schmidt wurde 1970 in Frankfurt am Main geboren und schreibt seit ihrer Kindheit Geschichten. Ihre Texte sind in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht worden und sind mehrfach preisgekrönt.
Bei dotbooks erscheint ihre Fantasy-Trilogie »Die Chroniken der Wälder«, die die folgenden Einzelbände umfasst: »Das Erwachen der Hüterin«, »Die Rückkehr der Elynn«, »Der Tod der Götter«
***
Originalausgabe Januar 2020
Copyright © der Originalausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Sarah Schroepf
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Irina Alexandrovna, Carlos Amarillo, Tom Tom
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96148-747-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Chroniken der Wälder« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
E. S. Schmidt
Das Erwachen der Hüterin
Roman
dotbooks.
I
Kapitel 1
Mit klirrenden Ketten folgte Daric seinem Herrn in den Dunst des Gasthauses, in dem es nach Bier und gekochtem Kohl roch. Der Schankraum bot genug Platz für eine Handvoll Tische. Bauern und Handwerker der Gegend saßen daran: einfache Männer in grober Kleidung, die kaum die Blicke von ihren Krügen hoben. In dieser Ortschaft am Fuße des Hohen Kerren waren Fremde nichts Besonderes.
Skrimm zerrte an der Kette, und die Eisenschellen an Darics Handgelenken ruckten schmerzhaft. An der linken Seite des Raumes waren einige Tische zu einer langen Tafel zusammengeschoben worden. Die Gäste dort boten einen ganz anderen Anblick: Farbige Stoffe mit breiten Borten, die Frauen trugen rotes Puder auf den Wangen, die Männer hatten die Bärte nach der Mode gestutzt, der auch viele von Skrimms Freunden neuerdings folgten. Dieser Reisegruppe würden sie sich auf dem Weg über den Hohen Kerren anschließen, denn mehr Wagen bedeuteten auch mehr Sicherheit vor den Ghulen, die dort in Schluchten und Höhlen hausten. Als sie den Hohen Kerren das letzte Mal überquert hatten, hatte Daric die Ghule nicht einmal zu Gesicht bekommen.
Skrimm zog sich einen Schemel vom Nebentisch heran. Daric setzte sich nahe der Wand auf den Boden und versuchte, die Blicke der anderen Gäste nicht zu beachten. Natürlich hatten sie es alle längst gesehen: das Brandzeichen auf seiner Wange. Der durchkreuzte Kreis wies ihn als Mörder aus, und der hölzerne Ring um seinen Hals zeigte, zu welcher Strafe ihn der Richter verurteilt hatte.
»Handelt Ihr mit Schwertsklaven?«, wandte sich einer der Gäste an Skrimm. »Oder besitzt Ihr eine Schule?«
Skrimm lächelte geschmeichelt. Er streckte sich, und das seidene Hemd spannte sich über seinen Bauch. »Um ehrlich zu sein, es ist mehr ein Zeitvertreib. Ich bin Kaufmann in Allan-Ten und auf dem Weg zu meinem Sohn in Geri-N’Gor.« Skrimm ließ Darics Ketten klirren. »Der hier ist ein Geschenk für ihn.« Stolz fügte er hinzu: »Man nennt ihn den Panther von Therbin, seit er dort den Flammenläufer besiegt hat. Sogar in Arag-Nor und Peronat hat er schon gekämpft. Aber ein Schwertsklave auf der Höhe seiner Kraft sollte in der Hauptstadt auftreten, wo man seine Kampfkunst zu schätzen weiß.«
»Und wo die Wetteinsätze höher sind«, fügte Skrimms Gegenüber an.
»Ganz recht. So ist es.«
Geri-N’Gor. Ob Emaret wohl noch dort war? Es würde gut sein, den alten Kämpen wiederzusehen.
Skrimm ruckte an der Kette und machte eine auffordernde Handbewegung. »Zieh dein Hemd aus!«
Daric zögerte, aber nach einem erneuten Ruck erhob er sich, knöpfte seine Jacke auf und ließ sie über die Schultern gleiten – ausziehen konnte er sie wegen der Ketten nicht. Er spannte die Muskeln an und blickte herausfordernd in die Runde, wie man es von einem Schwertsklaven erwartete. Er spielte das Spiel, wie Emaret es nannte. Schon morgen konnten diese Menschen Zuschauer sein und über sein Leben und Sterben entscheiden. Also ertrug er Skrimms Berührungen, die neidvolle Bewunderung der Männer, das schlecht verhohlene Begehren der Frauen. Sie mochten einen beeindruckenden Kämpfer in ihm sehen, aber tatsächlich unterschied er sich kaum von den kleinwüchsigen Possenreißern, die in den Pausen närrische Scheingefechte mit ihren dressierten Hunden zeigten. Sie immerhin wussten, dass sie die Arena auf eigenen Füßen verlassen würden.
Die Gäste fanden beifällige Worte: das übliche Lob über seinen starken Körper. Sie stellten Fragen zu seinen Narben, die Skrimm nur zu bereitwillig und mit einiger Übertreibung beantwortete. Nur dreimal war Daric bisher besiegt worden. Dreimal hatte er auf das Urteil der Menge gewartet, die Klinge des Gegners an der Kehle. Emaret hatte ihn die wichtigste Regel der Arena gelehrt: Sie erwarten nicht nur, dass du tapfer kämpfst, sondern auch, dass du tapfer stirbst. Nun, die Menge hatte ihm das Leben geschenkt. Offenbar hatte er ihre Erwartungen erfüllt.
»In der Tat habt Ihr da ein prächtiges Exemplar«, sagte einer. »Vielleicht findet sich im hiesigen Kerker ein Verurteilter, mit dem man einen Schaukampf veranstalten kann.«
Unwahrscheinlich, dass es in einem kleinen Ort wie diesem überhaupt einen Kerker gab, noch viel weniger einen Verurteilten, bei dessen Verbrechen Blut geflossen war. Andererseits – in einem Provinznest wie diesem wurden die Gesetze vielleicht nicht ganz so streng befolgt. Zum Ergötzen der Zuschauer irgendeinen Dieb zu erschlagen, der vielleicht nur aus Hunger oder Not gestohlen hatte, der Gedanke gefiel Daric nicht. Aber wenn man es von ihm verlangte, würde er es tun – schnell und schmerzlos. Ohne den ungleichen Kampf in die Länge zu ziehen. Ein Ärgernis für Skrimm. Nicht zum ersten Mal.
Doch so weit kam es nicht. Ein Stuhl scharrte über die Dielen: Eine der Damen am Tisch erhob sich. Die Kapuze ihres Mantels fiel zurück, und für einen Moment verstummte jedes Gespräch im Raum vor ihrer ergreifenden Schönheit: ihre Haut so rein wie die eines Kindes, ihre kastanienbraunen Locken so glänzend, dass sich das Licht der Flammen darauf brach. Wie konnte es sein, dass er sie erst jetzt bemerkte? Jeder hier im Raum schien sich die gleiche Frage zu stellen.
In ihrem Blick lag … Daric konnte es nicht gleich deuten. Vielleicht war es Ungläubigkeit, vielleicht Missbilligung – womöglich sogar Verachtung. »Ich wünsche erholsamen Schlaf«, sagte sie und verließ den Tisch. Unter ihrem Mantel – warum trug sie im Gastraum einen Mantel? – blitzte ein Kleid auf, so weiß wie frisch gefallener Schnee. Skrimms Frau hatte einmal ein Tuch von solcher Reinheit gekauft. Skrimm hatte wochenlang über den Preis geschimpft.
Im Gastraum blieb es still, bis die Dame ihn verlassen hatte. Erst danach wurden die Gespräche zögernd wieder aufgenommen, Stühle gerückt, Bierkrüge gehoben oder wieder abgestellt.
»Wer war das?«, fragte Skrimm, die Stimme gedämpft, als fürchtete er, sie könne ihn noch hören.
»Sie kam gestern hier an«, erwiderte ein Mann mit zurückweichendem Haaransatz, »sie nennt sich Aroanída jando Slindáwen.«
Seine Frau, eine rundliche Matrone mit geäderten Wangen, fügte an: »Sie ist eine Elynn!«
Jemand am Tisch lachte auf, aber er verstummte, als ihn nur ernste Blicke trafen.
Eine Elynn. Ja, das konnte man tatsächlich meinen. Ihre geradezu überirdische Schönheit, ihre schlanke, hohe Gestalt – fast wie die Götterbilder, die stets mit übermäßig verlängerten Gliedmaßen und Gesichtern dargestellt wurden.
Die Anderen – so hatte Darics Mutter die Elynn genannt. Während der dunklen Winterabende hatte sie all die alten Legenden erzählt: davon, wie die Götter die Elynn als die Hüter der Wälder eingesetzt hatten, bevor sie die Welt vor über tausend Jahren verließen; davon, dass die Elynn den Frühling brachten und die Früchte reif werden ließen. Aber auch davon, wie sie ihren Schabernack mit Reisenden trieben oder Waldfrevler grausam straften, die ihre Axt in uralte Bäume geschlagen hatten.
»Aber das ist doch Unsinn«, sagte der Mann, der gelacht hatte. »Wir leben im zwölften Jahrhundert! Diese Hüter der Wälder sind doch nichts als fromme Legenden des einfachen Volkes.«
»Ganz und gar nicht.« Die Matrone war sich ihrer Sache sehr sicher. »Als ich noch ein Kind war, sind einige von ihnen bei uns in Woran-Sul gesichtet worden. Sie sind an der Stadt vorbeigewandert und wieder in einem ihrer Wälder verschwunden.«
»Das werden fahrende Handwerker gewesen sein, vielleicht Gaukler, oder fremdländische Söldner.«
»Haltet Ihr uns für so einfältig? Diese Leute trugen Kleider so weiß wie die Sommerwolken am Himmel. Und ein Kirschbaum, an dem sie vorbeigewandert waren, trug reife Früchte. Mitten im Saatmond!«
Nun wusste jeder etwas zu erzählen. Von einem Wald bei Berowin, in dem man die Wege nicht verlassen sollte. Wer es tat, würde nicht wieder gesehen. Oder von seltsamen Klängen, die in besonderen Nächten die Wälder bei Nyr-Amrat füllten.
Elynngesang – Daric erinnerte sich ebenfalls an seltsame Klänge, in einer Vollmondnacht im Sommer. In den Städten mochten Elynn nur noch Legenden sein, wie geflügelte Pferde oder die Götter selbst. Daric aber war in einem Dorf zwischen weitläufigen Wäldern aufgewachsen. Seine Mutter hatte Opfergaben zur Quelle getragen, und seine Schwester hatte geschworen, im Abendnebel tanzende Gestalten gesehen zu haben.
Mutter, Zelia, der Jorisgrund. Seit Jahren hatte Daric nicht mehr an sie gedacht. Mit einem Mal fiel ihm das Atmen schwer.
Nun sah Skrimm bedeutungsvoll in die Runde. »Mein Sohn schrieb mir, in den Mauern von Geri-N’Gor habe sich eine ganze Gruppe von ihnen angesiedelt.« Er senkte verschwörerisch die Stimme. »Sie kleiden sich wie Menschen, aber sie zahlen alles mit purem, ungeprägtem Gold.«
»Was wollen sie in Geri-N’Gor?«
»Den Kaiser sprechen«, vermutete einer. »Vielleicht sind sie Abgesandte des Elynnkönigs.«
»Haben die Elynn überhaupt einen König?«
Niemand wusste eine Antwort auf diese Frage.
»In Geri-N’Gor«, fuhr Skrimm fort, »geben sie sich wie große Herren. Viele bemühen sich um ihre Gunst, aber die Gesellschaft der meisten Menschen ist ihnen offenbar nicht gut genug.«
Nicken reihum, und die Blicke dorthin, wohin die Elynn gegangen war, schienen eine Spur weniger freundlich geworden zu sein.
***
Aroanída stieß die Fensterflügel weit auf und atmete die milde Nachtluft ein. Unter ihr, im Hof der Herberge, verbreitete ein Ahorn als einziges Lebewesen sein Licht. Wie viel lieber hätte sie die Nacht im Schutz seiner In’kha verbracht. Stattdessen schlief sie hier oben, umgeben von zersägten Bäumen und geschnittenem Gras, als Polster in Säcke gestopft. Ihr Vater hatte recht – die Menschen töteten alles, worauf sie stießen.
Einmal hatte sie gemeint, zwischen all dem Lärm seine Stimme zu hören, doch sie hatte nicht die Ruhe gefunden, darauf zu lauschen. Nun schickte sie ihre Gedanken in die Nacht hinaus. In der Fülle an Neuem, das ihren Geist füllte, war es auch jetzt nicht einfach, seine Stimme zu finden. Ihr fehlte die Ruhe der Bäume.
Sie schloss die Augen und atmete ruhig und gleichmäßig, um sich zu sammeln. Schließlich fand sie ihn. Seine Liebe füllte sie mit Wärme und Zuversicht. Aber sie spürte auch seine Sorge. Er hatte ihr von der Reise abgeraten, und auch jetzt wäre noch Zeit, nach Slindáwen zurückzukehren. Doch das würde sie nicht tun. Bevor sie ihr Thaléth verschenkte und sich für den Rest ihres Lebens an Kahásurath band, wollte sie diese Möglichkeit nutzen, einmal die Welt außerhalb der Wälder zu sehen.
Sie war eine Ilana, und Ilani verließen die Wälder nicht oft. Noch seltener lebten sie jenseits von deren Grenzen. Die Menschen verwendeten für sie die Bezeichnung Elynn, das alte Wort für »anders«, und das war sehr treffend. Ilani waren tatsächlich anders als jedes andere Lebewesen auf der Welt, so grundlegend verschieden, dass sie selbst all die anderen Wesen – Menschen, Tiere und Pflanzen – unter dem Wort urun zusammenfassten. Unter den Urunen waren die Menschen etwas Besonderes: besonders gefährlich, besonders gewalttätig, besonders unwissend. Jedes Tier des Waldes hätte in ihr sofort und ohne Frage die Elynn erkannt, »die andere«, doch die Menschen dort unten stritten sich darüber, ob sie nicht vielleicht doch eine von ihnen war, ein Mensch unter Menschen.
Diese Gelegenheit, sie zu beobachten, bot sich ihr vielleicht erst wieder in Jahrhunderten – und vermutlich niemals mehr an der Seite ihres Vaters. Jorándelar jando Slindáwen war ein Respekt einflößender Mann, vorausschauend und klug. Unter seiner Obhut würden ihr die Menschen nichts tun.
Noch ein paar Tage, dann war diese Reise beendet, die sie notgedrungen alleine durch die Welt der Menschen führte. Der morgige Tag war der gefährlichste, denn noch schlimmer als die Menschen waren die Ghule. In der steinernen Wüste der Berge gab es für Ilani keine Sicherheit, kein Versteck. Nur deshalb hatte Aroanída sich den Menschen angeschlossen – es war der einzige Schutz, der ihr zur Verfügung stand.
Nie zuvor war sie den Menschen so nah gewesen. Andere urune Wesen waren ihr vertraut – die Tiere und Pflanzen des Waldes. Seit frühester Jugend hatte sie deren Leben beobachtet, hatte voller Neugier ihr Werden, Wachsen und Vergehen verfolgt. Doch Menschen hatten den Wald von Slindáwen nur vereinzelt durchquert. Auf den Feldern jenseits des Waldrandes hatten sie gearbeitet oder Schlachten geschlagen. Schon früh hatte Aroanídas Vater ihr verboten, sich ihnen zu nähern. Dabei waren sie bei Weitem die interessantesten der Urunen. Allein, dass ihre Gestalt der ilanen so sehr glich, machte sie zu etwas Besonderem. Und doch war das Urteil ihres Vaters zutreffend gewesen: Die Menschen waren grob und grausam. Ob sie tatsächlich heute Nacht noch zwei der Ihren gegeneinanderhetzen würden?
Der Kämpfer trug Narben. Der Anblick hatte Aroanída seltsam berührt. Ilani verletzten sich nicht oft, und wenn doch, dann ließen sie ihre Wunden spurlos verheilen. Doch die Haut dieses Mannes war von Narben übersät.
Wollte er etwa diese Zeichen ausgefochtener Kämpfe tragen? Immerhin hatten die anderen Menschen ihn dafür bewundert. Doch Aroanída hatte seinen Widerwillen gegen den Vorschlag des Kutschers gesehen. Der Sklave hatte nicht kämpfen wollen.
Sie hob den Blick zu den beiden silbrigen Monden.
Warum versklavten und töteten die Menschen ihresgleichen? Die Menschen sind eine Missbildung in der Welt. Das waren die Worte ihres Vaters. Die Geburt des Menschengeschlechtes war ein Unglück, das niemals hätte geschehen dürfen. Sie waren urun und doch schlau, Tiere mit dem Geist von Ilani, doch ohne ihre Seelen.
Das hatte man Aroanída bereits als Kind gelehrt, zusammen mit den eindringlichen Ermahnungen, sich stets vor den Menschen zu verbergen, sich niemals in ihre Angelegenheiten einzumischen. Aber wie konnten es die Menschen selbst ertragen, so zu leben, so zu sein?
***
Daric kam zu sich. In seinem Schädel hämmerte das Blut, und steiniger Felsboden stach in seinen Rücken. Über ihm war Holz … Bretter … die Bodenbretter eines Wagens.
Er erinnerte sich, dass sie am Morgen aufgebrochen waren. Die Reisegesellschaft war mit gerade einmal fünf Wagen eher klein ausgefallen, aber doch groß genug, dass die Ghule sie meiden würden.
Ghule! Er lauschte und hörte das Grunzen der Räuber. Sie waren plötzlich da gewesen, waren förmlich aus den Felsen gewachsen: ein ungewöhnlich großes Rudel.
Hatte er gekämpft? Er war sicher, dass er sich verteidigt hatte, aber er erinnerte sich nicht mehr. Vermutlich hatte er einen Schlag auf den Kopf bekommen und war dann unter den Wagen gerollt. Oder hatte der Ring ihn kaltgestellt?
Die Furcht drängte ihn, sofort zu verschwinden, aber er musste ruhig bleiben Was hätte Emaret ihm geraten? »Schätze deinen Gegner ein. Werde dir klar, was seine Stärken sind – und seine Schwächen.«
Behutsam zog er die Beine unter das Versteck. Er umfasste die Ketten, damit sie nicht klirrten, drehte sich auf den Bauch und spähte zwischen den hölzernen Speichen der Räder hindurch.
Die Wagen standen noch in einer Reihe hintereinander, doch die Pferde waren tot oder abgeschirrt. Eine aufgeschlitzte Tasche lag auf dem Weg, ein Hemd flatterte in einem Busch. Daric schloss kurz die Augen, als Erinnerung ihn durchflutete, an einen anderen Überfall, der ein halbes Leben zurücklag. Nein. Nicht jetzt. Er durfte sich nicht überwältigen lassen.
Sie waren noch da: massige, kaum behaarte Körper, grau wie der Fels. Er beobachtete, wie sie die Wagen durchsuchten und knurrend die Leichen der Erschlagenen fortschleiften. Sie würden die Kadaver später fressen – und zwar gleichgültig, ob es sich um Tote der eigenen oder einer fremden Art handelte. Tiere waren sie, die mit aufrechtem Gang, grober Kleidung und plumpen Waffen die Menschen nachahmten.
Aber gefährliche Tiere. Er musste weg, bevor sie ihn entdeckten.
Er schob sich vorwärts, und die Eisenglieder an seinen Füßen klirrten. Daric verfluchte sie. Die Ketten verdankte er nicht nur Skrimm, der es genoss, einen muskelbewehrten, narbenübersäten Schwertsklaven hinter sich herzuziehen, sondern auch den Gesetzen: einen Gebrannten, einen verurteilten Mörder, musste man in der Öffentlichkeit gesichert halten.
Zumindest um Skrimm musste Daric sich keine Sorgen mehr machen. Ein Ghul zerrte ihn gerade an den Beinen davon. Etwas Dunkles schleifte hinter seinem Körper her – eine Darmschlinge, die aus dem aufgeschlitzten Bauch hing.
Aber frei war Daric darum noch lange nicht. Da waren die Ketten, da war dieses Brandzeichen auf seiner Wange, und da war auch noch dieser Ring um seinen Hals. Aber darum konnte er sich später Sorgen machen. Zuerst einmal musste er weg von den Ghulen, denen der Blutgeruch noch in den Nüstern lag. Trotzdem übereilte Daric nichts. Aus seinem Versteck heraus beobachtete er das Rudel und versuchte, die Lage einzuschätzen.
Der Weg war an dieser Stelle breit. Zwei Manneslängen entfernt fiel das Gelände steil ab; auf der anderen Seite, und den Wagen viel näher, erhob sich ein felsiger Hang. Wenig Deckung, soweit Daric es mit seiner eingeschränkten Sicht beurteilen konnte, aber durchaus zu besteigen.
Der Wagen über ihm geriet in Bewegung, als einer der Ghule die Kutsche bestieg. Gepäckstücke polterten zu Boden, und Kleidung wehte davon. Daric wartete, hörte den Ghul über sich rumoren. Dann ein Grunzen und ein dumpfer Ton. Zwei krallenbewehrte, graugrüne Füße wirbelten Staub auf, keine Elle von Darics Nase entfernt. Doch jetzt schützte ihn das herabgeworfene Raubgut zusätzlich vor Blicken. Der Ghul stapfte davon.
Soweit Daric es überblicken konnte, hielten sich die Ghule auf der freien Fläche auf, die meisten von ihnen am vorderen Ende der Kolonne. Vorsichtig robbte er zum Hang hinüber und kroch unter dem Wagen hervor. Da die Fußketten durch den Mittelring mit den übrigen Ketten verbunden waren, konnte er sie hochheben und so die meisten Geräusche vermeiden. Er schlich die Reihe der Kutschen entlang zum hinteren Ende des Zuges und hielt dabei die Sinne weiter auf seine Feinde gerichtet – bis eine Bewegung direkt vor seinen Füßen ihn innehalten ließ. Was er sah, zerstreute seine letzten Zweifel an der Natur der jungen Frau in dem Elynnkleid.
Sie kauerte unter einem der mageren Sträucher, die zwischen den Felsen wuchsen. Man sagte, dass Elynn sich unsichtbar machen konnten, und er hätte sie auch nicht gesehen, wenn sich bei ihrem Versuch, seinen Füßen zu entgehen, kein Stein gelöst hätte. Es war keine wirkliche Unsichtbarkeit. Es war eher so, dass man sie nicht bemerkte.
Doch nun, da er sie bemerkt hatte, sah er sie auch – wenn er sie nicht anblickte. Wollte er sie sehen, musste er an ihr vorbeischauen und sich auf die Wahrnehmung am Blickfeldrand konzentrieren. Sobald er den Blick direkt auf sie richtete, verschwamm ihre Form ins Diffuse, löste sich in der Mittagssonne auf.
Er forderte sie mit einer knappen Kopfbewegung auf, ihm zu folgen. So, wie er es sah, waren sie die einzigen Überlebenden, und vielleicht würden sie zu zweit mehr Glück haben als jeder für sich allein – der Weg aus dem Gebirge würde kein Spaziergang werden.
***
Aroanída folgte dem Menschen stumm durch das Geröll. Sie kletterten über große Felsen, zwischen denen Spalten klafften – so tief und dunkel, dass ein Boden nicht zu erkennen war. Hier gab es keinen Pfad, den Hufe oder Pfoten bereits gebahnt hätten, keine Wege, die seit Generationen genutzt wurden. Wie seltsam zu denken, dass vor ihnen nicht ein einziges Wesen seinen Fuß auf diese Steine gesetzt haben mochte.
Zudem gab es keine Pflanzen, in deren In’kha sie sich hätte verbergen können. Der karge, trockene Strauch hatte sie nicht einmal vor dem Blick des Menschen zu schützen vermocht.
Und nichts rührte sich. Im Wald gab es immer Bewegung – die Blätter und Zweige wiegten sich, Blüten wandten sich der Sonne zu, selbst die Bäume schwankten im Wind. Hier jedoch war alles starr und leblos. Selbst die Luft roch nach Stein – staubig und tot. Noch nie hatte Aroanída eine Landschaft gesehen, die so völlig bar jeden Lebens war.
Nur sie selbst bewegten sich, und das musste weithin sichtbar sein. Ihre Füße lösten dabei Steine, die klickernd und klackernd über die Felsen rollten, sprangen, bis sie in eine der Spalten fielen – überlaut in dieser Steinstille. Dazu die Ketten dieses Menschen, die bei jedem Schritt klirrten. Vielleicht wäre es für sie beide besser, wenn sie ihn davon befreite. Andererseits: Er trug diese Ketten nicht grundlos. Er war nicht bloß ein Mensch, sondern einer, der getötet hatte. Womöglich war er noch gefährlicher als die Ghule. Vielleicht sollte sie, statt ihm zu folgen, lieber alleine einen Weg über die Berge suchen.
Doch der Gedanke, diese völlig leblose Einsamkeit alleine durchqueren zu müssen, kam ihr unerträglich vor. Seine In’kha war der einzige Schimmer des Lebens hier, wenn auch ungeordnet und undeutbar, durchsetzt von üblen, vielleicht gar gefährlichen Gefühlen. Diese In’kha war ebenso verwirrend wie sein Geruch nach Schweiß und Blut und anderen Dingen, die ihr fremd waren. So roch kein Tier. Nicht eins.
Zumindest würde dieser Geruch den Ghulen verbergen, dass auch eine Ilana in ihr Reich gekommen war. Wenn sie dennoch kamen, würde er sich sicher zur Wehr setzen, und das gab ihr eine zweite und letzte Gelegenheit zur Flucht. Bis dahin würde sie sich in Acht nehmen, wie sie sich immer vor Menschen in Acht nahm.
***
Daric machte erst Rast, als er hoffen konnte, dass sie genug Raum zwischen sich und das Rudel gebracht hatten. Er warf den verzweigten Ast fort, den er von einem der Sträucher gebrochen hatte, um ihre Spuren im Steinstaub zu verwischen. Inzwischen gab es weder Staub noch Sträucher, nur noch nackten, zerklüfteten Fels.
Er wusste nicht viel über die Graufratzen. Womöglich konnten sie ihm schon anhand des Geruchs folgen. Aber vielleicht würden sie es nicht der Mühe wert finden. Sie hatten fette Beute gemacht und schlugen sich vermutlich gerade die Bäuche voll. Allerdings: Sicher war man bei ihnen nie. Er hatte es auch für unwahrscheinlich gehalten, dass sie die Wagen angreifen würden, und doch hatten sie es getan.
Daric setzte sich auf einen Felsbrocken und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Elynn ließ sich ein paar Schritte entfernt von ihm zu Boden sinken. Es beeindruckte ihn, dass sie seinem straffen Tempo ohne Klage gefolgt war – noch dazu in ihrem knöchellangen Kleid, das zum Klettern kaum geeigneter war als seine Ketten.
»Wir brauchen Wasser«, sagte er und sah sich um. Die Felsen warfen das Sonnenlicht zurück und verstärkten die trockene Hitze.
Die Elynn erwiderte nichts, sah ihn nur scheu an.
»Man sagt, Elynn könnten Bindungen lösen. Dinge, die uns Menschen fesseln. Stimmt das?«
Sie wich seinem Blick aus; blickte den Abhang hinunter.
Daric hielt ihr die schweren Eisenfesseln hin. »Macht sie auf.«
Jetzt wandte sie sich ihm zu. »Wieso sollte ich dir trauen, wenn es nicht einmal deine eigenen Leute tun?«
Genauso erzählten es die alten Geschichten: Ein Gespräch mit Elynn bestand im Wesentlichen aus Gegenfragen. Daric mahnte sich zur Geduld. »Die Ketten waren nie mehr als Prahlerei. Womit Skrimm mich wirklich in der Gewalt hatte, ist das hier.« Er tippte an den Ring, der sich um seinen Hals legte. Das Holz war völlig glatt gedrechselt, ohne Verschluss, ohne Verzahnung. Ein Zauber der Argkhanen, der Priester des Kriegsgottes, hatte es ihm direkt um den Hals gelegt.
Mit Unbehagen erinnerte sich Daric an den lichtlosen Raum in den Tiefen des Tempels, in dem man die Schwertsklaven angekettet hatte. Es hieß, Gott Argkhan selbst würde zu ihnen herabsteigen. Darauf warteten sie in absoluter Dunkelheit, in der jedes Räuspern, jedes Rascheln seltsam laut widerhallte. Dann Schritte. Jemand – vielleicht der Hohepriester – bewegte sich mit ruhiger Sicherheit durch die Schwärze, ging von einem der gefesselten Sklaven zum Nächsten, erreichte schließlich Daric, ergriff sein Kinn und hob es an, als wolle er in sein Gesicht sehen. Eine Berührung an seinem Hals, eine seltsame Hitze. Das war alles.
Als die Argkhanen mit Licht zurückgekehrt waren, hatte jeder der Schwertsklaven einen hölzernen Ring um seinen Hals getragen – nur einer nicht. Er war tot gewesen. Ein Opfer, das der Gott jedes Mal einforderte.
»Das ist ein Argkhansreif«, erklärte er.
»Argkhan?«, wiederholte die Elynn verständnislos.
»Der Gott des Krieges.« Ihm waren die Kämpfe in den Arenen geweiht. »Der Ring zieht sich zusammen und drückt mir die Luft ab, sobald ich jemanden angreife – es sei denn, derjenige trägt ebenfalls einen. So sichert man Schwertsklaven – nicht mit denen hier.« Er ließ die Ketten klirren.
Sie musterte ihn wachsam. »Dieser Ring hält dich davon ab, mich anzugreifen?«
»Warum sollte ich Euch angreifen? Wir brauchen einander.« Entsprach dies der Wahrheit? Brauchte sie ihn? Nun, dass sie ihm gefolgt war, sprach immerhin dafür. »Ich schlage Euch einen Handel vor: Ihr löst meine Fesseln, und ich helfe Euch, nach Geri-N’Gor zu kommen. Und wenn wir dort sind …« Er zögerte. Ob sie vielleicht sogar den Argkhansreif lösen konnte? Üblicherweise endete jeder Versuch, ihn zu zerschneiden, zu zerbrechen oder zu verbrennen, tödlich. Der Reif zog sich so schnell zusammen, dass er seinem Träger das Genick brach. Aber sie war eine Elynn. Wer wusste schon, wie groß ihre Macht war?
»Wenn wir dort sind«, wiederholte er, »öffnet Ihr den Argkhansreif.«
»Das klingt nach einem guten Handel.«
Auch das sagten die Legenden über Elynn: Niemals sprachen sie offen und direkt. »Habe ich also Euer Wort?«
»Ich weiß nicht, ob ich über die Macht verfüge, die du mir zugestehst. Ich habe noch nie einen Argkhansreif gesehen.«
»Dann versucht es.«
Sie schien darüber nachzudenken. »Vielleicht gelingt es mir, vielleicht auch nicht. In beiden Fällen wärst du nicht mehr an mich gebunden.«
»Dann befreit mich, sobald wir in Sichtweite von Geri-N’Gor sind. Versprecht mir das.«
»Wie kann ich etwas versprechen, das ich vielleicht nicht halten kann?«
Er unterdrückte ein Knurren. »Versprecht wenigstens, dass Ihr es versuchen werdet.«
»Das kann ich versprechen.«
Er atmete auf. Zumindest das. »Dann fangt hiermit an.« Wieder hielt er ihr seine Handgelenke entgegen und hoffte, dass diese Verhandlung nicht ebenso zäh verlaufen würde wie die vorangegangene.
Sie zögerte, doch dann stand sie auf und ging zu dem Ast hinüber, den er fortgeworfen hatte. Sie streifte die Blattreste von einem der Zweige und schob dessen Spitze in das Schloss der eisernen Schelle an Darics rechtem Handgelenk. Und dann geschah – nichts. Daric wartete, während sie nur regungslos dasaß, den Zweig in der Hand, die Augen wie zur besseren Konzentration geschlossen. Gerade wollte er etwas sagen, als es vernehmlich knackte. Der Mechanismus öffnete sich, die Kette glitt herab und wäre scheppernd zu Boden gefallen, hätte er nicht rasch zugegriffen. Verblüfft schaute er auf die offene Schelle. Es sah aus, als wäre der Zweig im Schloss gewachsen und hätte es schließlich gesprengt. »Ihr könnt es tatsächlich.« Das machte ihm Hoffnung.
Sie öffnete auch die Schelle der linken Hand. Dazu nahm sie einen anderen Zweig, denn der erste steckte im Schloss fest. Als sie auch die Eisen an den Fußgelenken gelöst hatte, rückte sie scheu von ihm ab – ganz offensichtlich hatte sie Angst vor ihm. Sollte sie ruhig.
Es tat gut, die Glieder zu strecken, was er ausgiebig tat, ehe er die schweißnassen Haare zurückstrich und die Umgebung in Augenschein nahm.
Nirgendwo war ein Hinweis auf die Graufratzen zu entdecken, aber das musste nichts heißen. Schließlich waren ihre unförmigen Gestalten kaum von den Felsen zu unterscheiden.
»Zu Fuß brauchen wir bestimmt zwei Tage bis zum Pass«, erklärte er. »Dort müssen wir wieder auf die Straße zurück – und dort könnten uns die Ghule abfangen.«
»Planen sie so weit voraus?«
Er zuckte mit den Schultern. »Wer weiß schon, was in diesen hässlichen Schädeln vor sich geht?« Er stemmte sich hoch. »Können wir weiter?«
Sie hob den Blick und sagte: »Mein Name ist Aroanída jando Slindáwen.«
»Ich weiß.« Der Name war entschieden zu lang für seinen Geschmack. Er würde ihn abkürzen. Aroa – das war so ziemlich das Längste, was er ihr zugestand.
»Und wie ist dein Name?«
Er klopfte sich den Staub von den Händen. »Daric.«
»Nur Daric? Nichts weiter?«
»Ich bin ein Sklave.«
»Auch ein Sklave hat eine Familie und eine Heimat.«
Heimat. Das war ein Wort, angefüllt mit Schmerzen. »Das ist wohl so.« Er drehte sich um und setzte den Aufstieg fort.
Kapitel 2
Sie erreichten einen Gipfelgrat, aber so weit Daric auch blickte, in alle Richtungen erstreckte sich die graue Steinwüste. Nur hier und dort verriet ein grüner Schimmer, dass sich genug Staub in einer Vertiefung gesammelt hatte, um Gras gedeihen zu lassen.
Daric hielt sich nicht lange mit Betrachtungen auf. Er verschaffte sich einen Überblick, schätzte anhand der Bergspitzen, wo der Pass liegen musste, und marschierte weiter, sobald die Elynn aufgeschlossen hatte.
»Wenn du Wasser suchst, sollten wir in diese Richtung gehen.« Sie war stehen geblieben und zeigte auf der anderen Seite des Grates hinunter.
»Ihr kennt diese Gegend?«
»Nein, aber riechst du es nicht?«
Das Erstaunen in ihrer Stimme ärgerte ihn, aber er stapfte an ihr vorbei in die Richtung, die sie gewiesen hatte. Wasser war wichtig, doch sie hatten nichts, um es zu transportieren. Vielleicht fanden sie einen Wasserlauf, dem sie folgen konnten. Auf jeden Fall brauchten sie einen Rastplatz für die Nacht und etwas zu essen.
Es dämmerte schon, als sie auf einen Bach stießen. Der Wasserlauf fiel in ein natürliches, aus dem Stein gewaschenes Becken und bildete einen ansehnlichen Teich. Die Elynn hatte tatsächlich Wasser gefunden, und das aus beträchtlicher Entfernung. Sie erwies sich als nützlicher, als Daric erwartet hatte.
Am Ufer des Teiches warf Daric sich auf den Bauch und sog das Wasser mit tiefen Zügen ein. Dann schaufelte er es mit den Händen über seine schweißverklebten Haare. Erfrischend kalt rann es über Kopfhaut und Nacken, tränkte den schweißfeuchten Jackenkragen.
Er sah zu seiner Begleitung hinüber: Die Elynn kauerte einige Schritte entfernt am Ufer und wusch sich das Gesicht. »Sagt bloß«, spottete er, »Eure Art schwitzt nicht.«
»Nein, tun wir nicht«, gab sie kühl zurück, »aber auch an uns haftet der Schmutz der Welt. Und Ghule sind …« Sie sprach nicht weiter, sondern blickte angewidert hinter sich. Dann stand sie auf und griff nach dem Ausschnitt ihres Kleides, als wolle sie es öffnen. Daric konnte es nicht glauben – sie wollte sich tatsächlich ausziehen, direkt hier vor seinen Augen! Kannte sie überhaupt keine Scham? Oder rechnete sie damit, dass er sich anstandshalber umdrehte?
Dann begriff er. Für sie war er kein Mann, nicht Ihresgleichen. Er war nur ein Mensch – und vermutlich noch weniger als das, er war ein Sklave. Welche Frau würde sich vor ihrem Schoßhund zieren oder ihren Körper vor den Augen einer Katze verbergen? Für sie war er nicht mehr als ein Tier! Zorn stieg in ihm auf – und etwas anderes. Der Gedanke an ihren nackten Körper ließ ihn nicht unberührt.
Die Elynn, Aroa, wie er sie längst in Gedanken nannte, öffnete das Kleid, indem sie den Stoff behutsam auseinanderzog. Wie lange, dünne Finger lösten sich dickliche Fasern und blieben doch einander zugekehrt. Was für ein seltsamer Stoff war dies? Sie enthüllte ihre Brüste, die schmale Taille und lange, schlanke Beine, legte das Kleid schließlich auf den Boden. Es fiel nicht ganz in sich zusammen, sondern behielt einen Teil seiner Form, wie eine leere Insektenhülle. Aroa hob die Arme, um mit den Fingern durch ihre Locken zu fahren, und streckte sich dabei, sodass sich Hüfte und Rippen unter der weißen Haut abbildeten. So stand sie einen scheinbar endlosen Moment, und ihre Schönheit verschlug ihm den Atem. Als sie anmutig einen Fuß ins Wasser setzte und in den Teich stieg, wünschte er, seine Hände könnten sie berühren, wie das Wasser es tat. Wie weich wäre diese samtene Haut unter seinen rauen Fingern. Aber dann ließ sie sich ganz in den Teich hineingleiten und war nur noch als heller Schemen unter der Wasseroberfläche auszumachen.
Ein Kuss. Er würde ihr nicht wehtun, konnte es vermutlich nicht einmal, aber nach allem, was sie hier tat, schuldete sie ihm zumindest einen Kuss.
Er öffnete seine Jacke, während sie sich mit einem kraftvollen Stoß durch das Wasser gleiten ließ und nahe dem gegenüberliegenden Ufer wieder auftauchte. Dort atmete sie kurz, ohne angestrengt zu wirken, und tauchte ebenso schnell wieder zurück.
Als sie den Kopf aus dem Wasser hob, war er da. Er stand hüfttief im Teich, griff nach ihrem Arm und zog sie zu sich heran. Bevor sie reagieren konnte, hatte er ihren nackten Körper gegen den seinen gepresst und seinen Mund auf ihre weichen, vollen Lippen gelegt. Sie ließ einen erstickten Laut hören, stemmte ihre Hände gegen seine Schultern, aber er war stärker als sie. Er schloss die Augen, fühlte ihre kühlen, weichen Brüste auf seiner Haut, ihre Beine an den seinen entlanggleiten, als sie hilflos strampelnd versuchte, sich loszumachen. Und er fühlte den Argkhansreif, der sich enger und enger um seinen Hals schloss. Verfluchtes Ding!
Daric kostete es aus bis zum letzten Moment, bis der Ring ihm gänzlich die Kehle zudrückte. Als er Aroa losließ, merkte er kaum, wie ihre Ohrfeige seinen Kopf zur Seite warf. Stattdessen taumelte er aus dem Wasser, ging am Ufer in die Knie, den Mund weit geöffnet doch ohne Möglichkeit, zu atmen oder auch nur einen Ton hervorzubringen. Er konnte die Luft lange anhalten, er hatte es trainiert, abends, wenn er zwischen den anderen Sklaven auf seiner Pritsche gelegen hatte.
Er musste Ruhe bewahren, abwarten, durfte nicht erlauben, dass Panik das wenige verbrauchte, das ihm geblieben war. Er schloss die Augen, unterdrückte den schmerzhaften Impuls der Lungen, sich zu weiten. Endlich, nach endlosen Momenten, lockerte sich der Ring, und Daric holte stöhnend Luft. Nackt und hustend kauerte er am Ufer und nahm seine Umgebung langsam wieder wahr, spürte das Brennen auf seiner Wange, leckte sich über die Lippen und schmeckte Blut. Offenbar konnte sie hart zuschlagen, wenn es darauf ankam.
Aus den Augenwinkeln sah er, dass sie, noch immer völlig nackt, ihn mit blitzenden Augen ansah. »Beherrsche dich!«
Offenbar war sie eher wütend als verängstigt. Keine schwache Frau. Aber wie weich ihre Lippen gewesen waren!
Er hob den Blick. »Du hast es herausgefordert!«
»Ich habe was? … Oh!« Der Ausdruck in ihrem Gesicht änderte sich schlagartig, wandelte sich in Verlegenheit. Sie bückte sich nach ihrem Kleid, legte es um. Mit der Hand fuhr sie den Riss entlang, und die seltsamen weißen Finger griffen ineinander, verwoben sich, schienen zusammenzuwachsen, bis sich nicht einmal mehr erkennen ließ, dass der Stoff dort einmal geteilt gewesen war. »Ich glaube, ich muss dich um Verzeihung bitten. Bei uns ist der Körper nichts, das wir verbergen. Nacktheit ist nicht mit Scham verbunden. Ich habe einfach für einen Moment vergessen, dass du nur ein Mensch bist.«
»Nur ein Mensch«, wiederholte er grimmig, und sie senkte den Blick.
»Und schon wieder habe ich dich beleidigt.«
»Die Worte einer Elynn können mich nicht beleidigen«, gab er zurück. Es klang härter, als er beabsichtigt hatte, trotzdem nahm er es nicht zurück.
***
Es gab kein Holz, mit dem Daric hätte Feuer machen können, und ohnehin hätte das nur die Ghule angelockt. So kauerten sie sich neben dem Teich in den Windschutz einer Felswand und beobachteten die sich verdichtende Dämmerung. Nur das beständige Säuseln des Windes war zu hören, der den Hohen Kerren in unermüdlicher Arbeit blank fegte.
Aroa saß abseits von Daric, die Arme um die angezogenen Knie gelegt. Wahrscheinlich fror sie in ihrem dünnen Kleid, aber es war ebenfalls wahrscheinlich, dass sie nach der Begebenheit am Teich keinen großen Wert auf seine Nähe legte.
Erstaunlich, dass sie so furchtlos reagiert hatte – andererseits: Gab es nicht unzählige Geschichten, in denen Wanderer von badenden Elynn verführt wurden? Einige dieser Legenden endeten damit, dass der Wanderer im Tümpel ertrank. Vielleicht hatte der Argkhansreif nicht sie gerettet, sondern ihn.
Immerhin hatte sie jetzt erfahren, wie der Reif reagierte. Es musste ihr daher auch klar sein, dass Daric im Ernstfall keine große Hilfe darstellte. Der Reif unterschied nicht zwischen Menschen, Elynn und Ghulen. Selbst ein Kaninchen würde Daric rasch töten müssen, um dem verdammten Reif keine Zeit für eine Reaktion zu lassen.
Bei dem Gedanken an einen brutzelnden Braten meldete sich der Hunger, doch es gab wenig Hoffnung, in dieser kargen Gegend etwas zu finden. In dem windgeschützten Einschnitt hatte sich Erde spärlich angesammelt, und ein kurzer, harter Rasen bedeckte den Boden. Nicht genug Boden, um Kaninchen Platz für ihre Bauten zu geben. Ohnehin hatte Daric keine Schlinge, mit der er sein Abendessen hätte erlegen können. Er würde sich wohl mit dem Gedanken anfreunden müssen, einige Tage ohne Nahrung auszukommen, bis sie an den Südhängen des Kerren wieder die Baumgrenze erreichten. Es war nicht das erste Mal in Darics Leben, dass er hungern musste, und er machte sich nicht allzu viele Sorgen darüber. Hauptsache, sie hatten ausreichend Wasser.
»Du hast Schmerzen.« Aroas Stimme schreckte ihn aus seinen Überlegungen.
»Was?«
»Etwas tut dir weh. Bist du verwundet?«
Er sah zu ihr hinüber und fragte sich, was sie auf den Gedanken gebracht haben mochte. Und weshalb kam sie gerade jetzt darauf zu sprechen? Dann wurde ihm klar, dass es tatsächlich schmerzte – wenn auch sicher nicht so, wie sie es gemeint hatte.
»Du hast wohl keinen Hunger?«
Sie betrachtete ihn mit mitleidigem Erstaunen. »Doch«, antwortete sie. »Ich spüre, dass meine Kraft sich verringert. Aber es schmerzt mich nicht.«
»Wie schön.« Er schaute wieder auf die dunkler werdende Steinwüste hinaus.
Doch für sie schien das Thema interessant zu sein. »Auch der Durst hat dich geschmerzt, zuvor. Was für ein schreckliches Leben, in dem das Fehlen der einfachsten Güter mit Schmerz verbunden ist.«
Ihre Art zu fragen, als wäre seine menschliche Natur seltsam und bemitleidenswert, machte ihn wütend. »Wieso denkst du, dass es mich schmerzt?«
»Deine In’kha zeigt es deutlich.«
»Meine was?«
»Deine In’kha. Das Lebenslicht, das jedes Wesen ausstrahlt.« Es schien, als suche sie in seinem Gesicht nach einem Zeichen des Verstehens, einen Hinweis darauf, dass er begriff, wovon sie sprach. »Du kannst es nicht sehen? Das Licht?«
Er schnaubte nur und wandte sich wieder ab.
»Das erklärt es«, sagte sie mehr zu sich.
»Was?«
»Alles. Na ja, nicht alles, aber doch vieles.«
»Müßig, von einer Elynn einen klaren Satz zu erwarten.«
Sie schwieg einen Moment. Dann fragte sie zögernd: »Warum hasst du uns Ilani?«
Er hob die Brauen. »Ilani?«
Sie wurde verlegen, als sei ihr unbeabsichtigt ein Wort entglitten, das er nicht hätte hören dürfen. »So … nennen wir uns selbst.« Da lag Unsicherheit in ihrem Blick, als erwarte sie, dass dieses Wort ihm ein Geheimnis offenbare. Aber er hatte es noch nie zuvor gehört.
»Und wer sagt, dass ich euch hasse?«
»Du.«
Er hob die Brauen. »Kein Wort hab ich darüber gesagt!«
»Nicht mit deinen Worten. Aber mit deinen Blicken.«
»Und meiner In’kha?«
Sie lächelte. »Ja, auch das.«
Dieses Lächeln machte sie freundlich, gab ihr etwas Warmes, als wäre sie eine menschliche Frau. Mit einem Mal war da nicht mehr viel von der kalten, elynnischen Schönheit.
Daric wandte sich ab. Sie zu begehren war eine Sache, aber er wollte sie nicht mögen. »Dann wird es wohl stimmen.«
Sie wartete auf weitere Ausführungen, aber als er schwieg, fragte sie noch einmal: »Was können Elynn dir angetan haben?«
Er spürte die Anspannung seiner Muskeln, während Bilder seiner Vergangenheit auftauchten aus dem dunklen See des Vergessen-Wollens. Seit fast zehn Jahren hatte er sie erfolgreich darin versenkt, und auch jetzt wollte er sie nicht betrachten. Es war zu schmerzhaft.
»Nichts«, antwortete er schließlich. »Sie haben gar nichts getan.«
***
Der Mensch, der sich Daric nannte, war eingeschlafen. Aroanída hörte seinen gleichmäßigen Atem, sah das blaue Schimmern seiner In’kha. Doch sein Schlaf war leicht und unruhig – zu unsicher war ihre Zuflucht, zu gefährlich die Gegend.
Sie verschränkte fröstelnd die Arme. Es war nicht die Kälte der Nacht, die sie zittern ließ. Es war der Mangel an Leben in dieser Steinwüste. Mit der Linken strich sie langsam den Arm hinab, und unter ihren Fingern wuchsen die Fäden, aus denen ihr Kleid bestand. Sie umsponnen ihren Arm, indem sie sich verlängerten, verzweigten und miteinander verwoben. So wuchs der Ärmel des Kleides weiter bis zum Handgelenk.
Bisher hatte Aroanída nichts anderes gekannt als ihren heimatlichen Wald, wo eine Handvoll dunkler Erde mehr Wesen beherbergte als dieser Einschnitt hier. Noch nie hatte sie eine so dunkle Nacht erlebt. Nur das Gras und ein paar Flechten auf den Felsen verströmten einen leichten Schimmer, dazu die wenigen Pflanzen, die das klare Wasser des Teiches bevölkerten. Die hellste In’kha schimmerte um den Menschen, der neben ihr lag.
Doch sie wagte nicht, noch näher an ihn heranzurücken. Sie wusste nicht, ob er auch das als eine Aufforderung verstehen würde, so wie zuvor ihre Nacktheit. Als er sie berührt hatte, hatte sie – überrumpelt – seine Gefühle gespürt, bevor es ihr gelungen war, sich davor zu verschließen. Sie hatten sich geradezu in ihren Geist hineingepresst. Urune Empfindungen waren stark, man musste vorsichtig sein, wenn man sich ihnen öffnete. Sie konnten einen Ilan überwältigen.
Sein stärkstes Gefühl war nicht Gewalt oder Macht gewesen – er hatte Lust empfunden, Begehren. Und sie musste sich eingestehen, dass auch sie ihn begehrenswert fand.
Aroanída hatte nie zu denen gehört, die einen Wanderer in die Irre führten, um sich mit ihm zu vergnügen. Die wenigen Menschen, die sie in ihrem Leben zu Gesicht bekommen hatte, waren ihr wenig begehrenswert erschienen. Doch dieser war anders. Sein Körper war kraftstrotzend, sein Geist selbstbewusst. Hätte er sie schlicht gefragt, wäre sie seinem Wunsch vielleicht entgegengekommen.
Ilani pflegten die körperlichen Freuden mit Hingabe, und solange sie nicht durch das Thaléth gebunden waren, das erst die Fruchtbarkeit schenkte, so lange gab es nur wenige Beschränkungen ihrer Lust. Doch sie suchten in der Vereinigung Genuss und Entspannung, nicht Gewalt und Zwang.
Doch was hatte sie erwartet? Menschen waren gewalttätige Wesen, natürlich waren sie es auch in diesem Bereich ihres Lebens. Darin unterschieden sie sich nicht von den anderen Urunen. Aroanída dachte an die Schreie der Wildkatze, wenn der Kater seine Zähne in ihren Nacken schlug. Auch Rehe ließen den Bock nur kurz aufsteigen, bevor sie ihm wieder zu entkommen suchten. Offenbar paarten Menschen sich auf ähnliche Weise.
Doch wenn sie jetzt daran zurückdachte – da war auch Wut gewesen, und darauf hatte der Ring reagiert. Seltsam. Wie konnten die Menschen einen Reif erschaffen, der auf die In’kha reagierte, ohne dass sie die In’kha überhaupt sahen? Waren sie tatsächlich blind für alles, was über das Leibliche hinausging? Es war kaum vorstellbar, dass ein vernunftbegabtes Wesen so unwissend durch das Leben ging, aber was wusste sie schon über die Menschen? Nur das, was andere ihr erzählt hatten, von ihrer Bosheit und Grausamkeit, von Habgier und Niedertracht.
»Aroanída!«
In ihrem Nachdenken hatte sie die Stimme ihres Vaters fast überhört. Nun, da sie ihn vernahm, überkam sie eine Welle von Sehnsucht. Vater! Es tat so gut, ihn zu hören.
Sie hatte ihn gerufen, als die Ghule angriffen, doch ihre Gedanken waren nicht zu ihm durchgedrungen. Er war einer von dreien in Geri-N’Gor, und er musste mit vielen Wäldern in Verbindung bleiben.
Natürlich war er besorgt, wollte wissen, ob sie den Pass überquert hatten. Die Erinnerung an den Überfall schickte ein heißes Gefühl des Entsetzens durch ihren Körper, und der Schrecken kehrte wie ein Echo aus den Gedanken ihres Vaters zu ihr zurück.
Immerhin, sie war nicht verletzt und noch immer in der schützenden Nähe eines Menschen namens Daric. Eines Menschen, der … ein Krieger war, der sie schützen konnte.
Und die anderen? Aroanída dachte an die Schreie der Sterbenden, an ihre Angst und ihren Schmerz – gewiss hatte niemand außer ihnen beiden überlebt.
Doch ihren Vater berührte dies kaum. Es waren nur Menschen gewesen. Aroanída allein zählte für ihn, ihre Sicherheit und ihr Überleben. Er würde aufbrechen und ihr entgegenkommen, so schnell er konnte.
Die Stimme ihres Vaters verstummte. Es war beruhigend, dass er ihr entgegenreiste, und doch auch beschämend. Niemand hatte ihr zugetraut, diese Reise zu unternehmen, alle hatten ihr davon abgeraten – und sie hatten recht behalten. Womöglich verdankte sie ihr Überleben dem Menschen, der neben ihr lag. Selbst jetzt, im Schlaf, war seine In’kha schwer zu lesen, flirrte und flackerte in vielen Farben. Deutlicher als zuvor leuchtete das Rot des Schmerzes.
Verstohlen rückte sie näher an seine Wärme. Die Versuchung war groß, ihn noch einmal zu berühren, die urunen Gefühle zu teilen. Alle Ilani taten das. Man sprach nicht darüber, und es war auch nicht immer ungefährlich, und doch wusste Aroanída, dass selbst ihr Vater sich gelegentlich daran ergötzte: Am Siegesrausch des Platzhirsches, an der Hingabe der Wolfsmutter. Wie sehr unterschied sich das Leben der urunen von der ereignislosen Sicherheit, in der die Ilani ihre Tage verbrachten. Und menschliche Empfindungen, so hieß es, waren von allen urunen die gefährlichsten. Vielleicht, weil sie den ilanen so sehr ähnelten.
Die Gefühle, die Daric in seinem Schlaf heimsuchten, waren eindeutig keine glücklichen. Es war nicht nur der Hunger, der in seiner In’kha glühte. Da war noch etwas anderes, eine tiefe Trauer, fast Verzweiflung, die er während des Tages verbarg. Nun lag sie offen wie eine Wunde und ließ ihn leise stöhnen.
Wovon mochte er wohl träumen? Von den Kämpfen, die er ausgefochten hatte? Oder von der Zeit davor? Er hatte ihr nicht einmal den Namen seiner Familie nennen wollen. Sein Schicksal musste ein schweres gewesen sein, schwer und traurig – und gerade darum umso verlockender.
Niemand würde sie sehen. Es war nur ein kleines, verstohlenes Kosten, um ihre Neugier zu befriedigen. Sie legte die Hand auf die seine und öffnete behutsam ihren Geist, ließ einen winzigen Teil seiner Verzweiflung in sich hineinfließen. Es war bitter, schmerzte, presste ihr Innerstes wie mit eiserner Hand zusammen – ein fremdes und gerade darum verlockendes Gefühl.
Ein erleichterter Atemzug hob seine Brust, und sein Schlaf wurde ruhiger. Ilani teilten die Gefühle der urunen nicht bloß, sie stahlen sie. Erstaunlich, wie schnell er darauf reagierte. Vielleicht waren Zorn und Gewalt nicht immer seine Natur gewesen. Vielleicht ließ sich seine Seele heilen.
Kapitel 3
Als Daric erwachte, war Aroa schon auf den Beinen. Er sah sie am Teich stehen und ihre Haare mit den Fingern kämmen. Gähnend setzte er sich auf und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Sie drehte sich zu ihm um und lächelte. Widerwillig stellte er noch einmal fest, wie bezaubernd dieses Lächeln war.
»Du machst komische Geräusche, wenn du schläfst«, sagte sie fröhlich.
Er knurrte missmutig. »Ist das die elynnische Art, mir vorzuwerfen, dass ich schnarche?«
»Schnarchen.« Sie wiederholte das Wort, als sei es neu für sie. Ihre Munterkeit am frühen Morgen war kaum zu ertragen. Er stemmte sich hoch und schlurfte zum Teich. Trotz des Sommers war die Nacht kalt gewesen, und er hatte schlecht geschlafen. Wenigstens erwartete ihn heute nicht der Übungshof.
Das kalte Wasser weckte ihn endgültig. Seine Gedanken setzten in etwa dort wieder ein, wo er sie gestern beim Einschlafen zurückgelassen hatte: Zu Fuß würden sie bestimmt den ganzen Tag bis zum Pass brauchen. Um ihn zu überqueren, würden sie zurück auf die Straße müssen. Ob die Ghule sie dort erwarteten?
Vielleicht wäre es besser, den Pass nachts zu überqueren. Der Wagenzug war am hellen Tag angegriffen worden, und die Ghule mussten an das grelle Gleißen der Hochgebirgssonne auf den Felsen gewöhnt sein. Er verfluchte es, dass er so wenig über sie wusste. Waren sie nächtliche Jäger oder am Tage unterwegs?
Und dann war da wieder diese Idee, die kurz vor dem Einschlafen aufgetaucht war. »Diese In’kha«, er wandte sich so unvermittelt an Aroa, dass sie zusammenzuckte, »siehst du die auch nachts?«
»Nachts besser als am Tage. Die Sonne kann sie überstrahlen.«
»Und die Ghule? Können die sie auch sehen?«
»Ich weiß es nicht. Aber wenn schon ihr Menschen blind dafür seid, dann nehme ich an, sind es die Ghule erst recht.«
»Das bedeutet, wir sind nachts im Vorteil. Für die Ghule ist die Nacht dunkel, aber für dich leuchten die Graufratzen wie eine Laterne bei Neumond. Wir können sie sehen, bevor sie uns entdecken.«
Aroa nickte langsam. »Und uns verstecken.«
»Wir sollten den Pass also nachts überqueren. Ich bin mir sicher, dass sie ihn bewachen. Schließlich muss jede Reisegesellschaft da durch.«
»Wenn der Pass so gefährlich ist – vielleicht gibt es einen anderen Weg. Einen, der uns nicht so nah an die Ghule führt.«
»Vielleicht«, stimmte er zu. »Aber ich kenne mich in diesen Bergen nicht aus. Du etwa?«
»Ich könnte meinen Vater fragen. Er kann es für uns herausfinden.«
Die Ernsthaftigkeit in ihrem Gesicht ließ ihn die Bemerkung herunterschlucken, die ihm auf der Zunge lag. Sie konnte sich nahezu unsichtbar machen, und sie konnte Wasser riechen. Vielleicht sollte er nicht vorschnell abtun, was sie anzubieten hatte. »Wie willst du ihn fragen?«
»Er ist mein Vater«, antwortete sie.
Da war sie wieder, die elynnische Verworrenheit. »Und?«
Sie schaute ihn verständnislos an. »Bist du mit deiner Familie nicht verbunden?«
Nicht nur, dass sie zu keiner klaren Aussage fähig war, ihre Fragen weckten ein ums andere Mal schmerzhafte Erinnerungen, die er nur mit Mühe wieder verdrängen konnte. »Wenn du ihn fragen kannst«, sagte er schlicht, »dann tu es.«
Sie schloss die Augen und verfiel in Schweigen.
Er wartete, beobachtete sie. Ob sie tatsächlich auf geheimnisvolle Weise mit ihrem Vater in Kontakt stand? Und ob der alte Elynn ihnen wirklich helfen konnte?
Schließlich schlug sie die Augen auf, und das Sonnenlicht ließ das Blau ihrer Iris leuchten. Verdammt, es war nicht zu übersehen: Nicht nur ihr Lächeln war bezaubernd.
Von Darics Erkenntnis unberührt, sagte sie: »Es gibt nicht viele Karten von dieser Gegend. Mein Vater wird versuchen, eine zu finden.«
Er starrte sie an. »Du kannst mit ihm sprechen.«
»Meine Gedanken erreichen ihn in Geri-N’Gor.«
»Durch all die Wälder und Berge, die zwischen uns liegen?«
Wieder dieser Ausdruck von Verwirrung in ihrem Gesicht. »Welche Rolle spielen Felsen, wenn es um Gedanken geht?«
»Keine, wie es scheint.« Er schüttelte das Wasser aus den Haaren und stand auf. »Aber bis er eine Karte gefunden hat, werden wir hier nicht untätig herumsitzen.«
Also brachen sie auf und suchten sich ihren Weg über das Geröllfeld des Kerren-Plateaus. Sie waren etwa zwei Stunden in der gleißenden Sonne marschiert, als Aroa Daric bedeutete, anzuhalten. Als er sich zu ihr umdrehte, hatte sie die Augen erneut geschlossen und stand ganz ruhig.
In ihrem weißen, bodenlangen Kleid, mit den offenen Haaren, die sich in der Brise bewegten, erinnerte sie ihn an eine Niverne. Einmal hatten diese heiligen Frauen seine Heimat besucht, waren mit Kerzen und Fackeln zum Elynnwald gepilgert. Sie hatten so viel Würde und Reinheit ausgestrahlt, so viel Gelassenheit.
Wieder eine Erinnerung an zu Hause, an den Jorisgrund. Mehr und mehr von ihnen sickerten durch den Damm, den er so mühsam errichtet hatte. Sie würden ihn früher oder später einreißen.
»Im Osten«, sagte Aroa, und Daric schreckte hoch. »Da gibt es einen weiteren Pass, der aber von Wagen nicht befahren werden kann. Darum wird er kaum genutzt. Er wird uns an die Quelle des Par-Geri führen, und von dort aus können wir dem Fluss dann bis nach Geri-N’Gor folgen.«
»Sehr gut.« Ein kaum benutzter Pass. Vielleicht beachteten die Ghule ihn nicht – oder zumindest weniger als die breite Straße. »Hoffen wir, dass die Karte nicht zu alt und der Pass noch offen ist. Kannst du ihn finden?«
»Wenn wir uns östlich halten, müssten wir auf einen Pfad treffen, der uns direkt dorthin führt. Es gibt nicht viele Wege in diesen Bergen.«
Das klang nicht schwierig. »Richte deinem Vater meinen Dank aus.«
Sie erwiderte sein Lächeln. Es kam ihm vor, als sei sie nicht mehr ganz so zurückhaltend wie am Vortag. Wenn er sich am Teich nicht wie ein Idiot benommen hätte, dann hätte er am Ende der Reise diese Lippen vielleicht einmal so küssen dürfen, wie sie es verdienten.
Was waren das nur für sinnlose Gedanken! Es war nicht einmal sicher, dass sie diese Reise überhaupt überleben würden. Er sollte seine Gefühle besser im Zaum halten.
***
Sie stießen tatsächlich auf einen Pfad, der so schmal war, dass sie nur hintereinandergehen konnten. Dennoch wurde das Gehen leichter, und in Daric keimte neue Hoffnung. Aroa hatte also tatsächlich mit ihrem Vater gesprochen, wie auch immer das möglich war.
Obwohl der Hunger inzwischen so quälend war, dass er sich kaum noch ignorieren ließ, marschierte Daric beherzt voran. Erst nachdem die Sonne den Zenit überschritten hatte, flaute das schmerzhafte Gefühl ab, als habe es sein Körper aufgegeben, ihn an die Notwendigkeit einer Mahlzeit zu erinnern.
Aroa ließ keinen Laut der Klage hören, weder blieb sie zurück, noch bat sie um Rast. Seine Achtung vor ihr stieg. Es steckte mehr Kraft in ihr, als ihrem zierlichen Körper anzusehen war.
Sie kamen gut voran, und in der Abenddämmerung ragten die Gipfel schon rechts und links von ihnen auf. Rasch fiel die Nacht, und sie war dunkel. Noch zeigte sich kein Mond am Himmel. Das Licht der Sterne reichte kaum aus, um die Schwärze des Bodens von der Schwärze des Himmels zu unterscheiden. Als auch der letzte Rest Tageslicht erloschen war, bewegte Daric sich wie ein Blinder Schritt für Schritt den schmalen Pfad entlang. Mit den Füßen ertastete er den Verlauf des Weges und orientierte sich gleichzeitig an Aroa vor ihm. Nicht dass er sie sah; er hörte nur ihre Schritte.
Selten war Daric so auf seine übrigen vier Sinne angewiesen gewesen. Andererseits hatte er in der Arena gelernt, sich nicht alleine auf seine Augen zu verlassen.
»Wie viel kannst du sehen?«, flüsterte er. In der nächtlichen Ödnis wirkte selbst das noch zu laut. Allein der Klang ihrer Schritte und das Klickern der Steine, gegen die er gelegentlich stieß, konnten die Ghule auf sie aufmerksam machen.
»Nicht viel«, gab Aroa ebenso leise zurück. »Das meiste Licht verbreiten wir beide – und ein paar Flechten auf den Felsen.«
Wie seltsam das sein musste, sich selbst als lebende Fackel zu sehen.
Sie folgten dem Pfad durch ein Meer spitzer Steine, und er dachte daran, dass dieser Weg vermutlich von unzähligen harten Ghul-Füßen ausgetreten worden war. Er hoffte nur, dass die Graufratzen jetzt alle schliefen. Ohne Waffe würde er ihren Klauen und Zähnen nicht viel entgegenzusetzen haben. Langsam breiteten sich Müdigkeit und Erschöpfung in seinen Gliedern aus. Sie waren seit dem Morgen unterwegs, den zweiten Tag ohne Nahrung und mit wenig Wasser.
»Ghule!«, flüsterte Aroa.
Er blieb stehen. »Wo?«
Unvermittelt war sie neben ihm, und ihr Atem brandete heiß gegen sein Ohr. »Einige Schritte voraus. Sie schlafen direkt auf dem Weg.«
»Kein Tier würde direkt auf einem Pfad schlafen«, raunte er.
»Sie tun es. Vielleicht wollen sie ihn bewachen.«
»Dann wissen sie, dass wir hier sind.« Es war keine Frage, sondern eine Feststellung. Einen Moment lang schwiegen sie beide. Daric hatte keine Waffen, und der vermaledeite Reif um seinen Hals würde im Falle eines Kampfes einen schnellen Sieg erzwingen. Aber es half nichts, sich darauf zu konzentrieren, was sie nicht hatten. Was stand auf ihrer Seite?
Der größte Vorteil war zweifellos Aroas Fähigkeit, in dieser Schwärze zu sehen. Sie würde ihn führen können – aber nicht über das Geröllfeld. Der Pfad war ihre einzige Möglichkeit.
Der zweite Vorteil war der Überraschungseffekt. Die Ghule würden in der Dunkelheit nicht wissen, was sie getroffen hatte und wie viele Gegner sie vor sich hatten. Wenn sie ihre Waffen ziellos einsetzten, konnten sie sich gut gegenseitig verletzen.
Ihre Waffen! Ihm wurde klar, wie sie vorgehen mussten.
»Aroa, haben die Ghule Waffen?«
»Ich glaube, ja.«
»Ich brauche ein Schwert oder ein Messer. Kannst du mir eines von ihnen besorgen?«
Schweigen antwortete ihm, aber sie war noch da. Er spürte sie deutlich neben sich. Dann driftete ihre Stimme wie ein Hauch zu ihm herüber. »Du kannst nicht kämpfen, mit diesem Ring um deinen Hals. Können wir sie nicht umgehen?«
»Blind über die Steine klettern? Nein, sie würden aufwachen. Du musst mich nur anleiten, mir sagen, was du siehst. Ich werde sie im Schlaf erstechen.«
Er hörte, wie sie scharf einatmete. Sie war es sicher nicht gewohnt zu töten – oder auch nur dabei zu helfen. Aber Menschen entwickelten ungeahnte Fähigkeiten, wenn es sein musste, und er hoffte, dass das bei Elynn nicht anders war.
»Du kannst das«, flüsterte er. »Du bist stark genug.«
Ihr Schweigen dauerte lange. Schließlich sagte sie: »Ich werde sehen, was ich ihnen entwenden kann.«
Obwohl er Aroa weder sah noch hörte, wusste er doch, dass sie sich von ihm entfernte. Er wartete und lauschte in die Dunkelheit.
Kein Laut erfüllte die Schwärze, nicht einmal der Wind machte das geringste Geräusch. Dann meinte Daric, ein leises Grunzen zu hören, gefolgt von einem Schmatzen. Offenbar träumten die Ghule. Doch was war mit Aroa? Ihre Schritte waren verstummt, und die Stille in seinen Ohren erschien wie Taubheit.
Heiß wurde ihm klar, dass Aroa nicht auf ihn angewiesen war. Sie sah mehr als die Ghule und er zusammengenommen, und sie bewegte sich nahezu lautlos. Wenn sie ihn hier zurückließ, als Beute für die hungrigen Mäuler, hatte sie gute Chancen, alleine zu entkommen. War das am Ende gar ihr Plan?
Noch angestrengter horchte er in die Finsternis und zuckte zusammen, als er neben sich ein Knirschen hörte. Etwas Kühles berührte seinen Arm, und er keuchte auf.
»Aroa?«, flüsterte er.
»Ja!«
Erleichterung. Das Kühle war ihre Hand gewesen, die jetzt seine Rechte ergriff und etwas hineinlegte. Er schloss die Finger um einen hölzernen Griff. Vorsichtig tastete er mit der anderen Hand die Klinge entlang. Sie war so lang wie sein Unterarm, nur einseitig geschliffen mit gebogener Schneide. Trotz einiger Scharten schien sie scharf zu sein. »Sehr gut«, flüsterte er.
»Und jetzt? Ich kann nicht kämpfen, Daric. Das wäre gegen den Rukh’Enhi.« Ein Zittern lag in ihrer Stimme.
»Das musst du auch nicht. Gib mir deine Hand.«
Er öffnete die Hand, und als er ihre Finger darin fühlte, drückte er sie leicht als beruhigende Geste. »Was hast du gesehen? Wie liegen sie?«
»Der Erste liegt auf dem Pfad, den Rücken links gegen einen Felsen gelehnt. Die anderen beiden in ähnlichen Stellungen nach rechts gelehnt dahinter.«
Er schob die Klinge in den Hosenbund, dann streckte er tastend die Hände nach ihr aus. »Deine Schultern.«
Sie griff nach seinen Händen und führte sie. Als er ihre Schultern ertastete, drehte er Aroa mit sanftem Druck um, sodass sie von ihm weg zu den Ghulen blickte. »Führe mich hin. Und sage mir, wenn etwas geschieht.«
In der schwarzen, betäubenden Leere hatte Daric jedes Gefühl für Zeit oder Entfernung verloren. Nur eines war klar: Sie bewegten sich vorwärts mit kleinen Schritten, regelmäßig wie ein Mühlrad – und irgendwann hielt Aroa an. Sie mussten die Ghule erreicht haben.
Er gab ihr ein Zeichen, hinter ihn zu treten und Abstand zu halten. Dann machte er einen weiteren Schritt vorwärts, sodass er dort stand, wo eben noch sie gestanden hatte. Obwohl es bezüglich der Helligkeit keinen Unterschied machte, schloss er die Augen. Er zog das Messer, hielt es mit beiden Händen vor sich und lauschte.