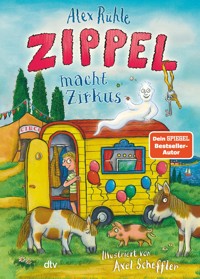12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Panorama eines Kontinents und seiner Menschen Ein Beben geht durch die Welt, als Alex Rühle zu einer großen Rundreise durch die EU aufbricht: Der Ukrainekrieg verschiebt die gesamte Tektonik Europas. Was eint und was trennt uns Europäer? Mit Interrailticket, Rucksack und Notizblock macht Alex Rühle sich auf die Suche nach Antworten. Klar ist: Die Europäische Union war die vielleicht kühnste Erfindung der Politikgeschichte – und ein großes Versprechen. Aber was davon wird eingelöst und kommt hier draußen an, in den Dörfern Kalabriens, an der estnisch-russischen Grenze, in der Altstadt von Lissabon? »›Ist das nicht eine schöne Definition für Europa?‹, fragt der Lyriker Aleš Šteger. ›Man fühlt sich angekommen, selbst an Orten, an die man gar nicht hingehört.‹«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Ein Beben geht durch die Welt, als Alex Rühle zu seiner großen Rundreise aufbricht: Der Ukrainekrieg verschiebt die gesamte Tektonik Europas. Mit Zügen, Bussen und zu Fuß durchmisst er den Kontinent, befragt Künstler und Klimaforscher, Bürgermeisterinnen und Armenärzte, Separatistinnen und Generäle, Stadt- und Landbewohner: Wie kann man in Vielfalt vereint sein? Wer gehört dazu und wer muss draußen bleiben? Was lässt sich von den anderen lernen?
Er trifft auf flammende Befürworter und zornige Skeptiker der EU, auf Europasehnsucht und neu erstarkenden Nationalismus. Alex Rühle reist in einer krisenhaften Zeit, in der sich Europa gerade neu findet. Und doch bringt es der Lyriker Alex Steger auf den Punkt: »Ist das nicht eine schöne Definition für Europa? Man fühlt sich angekommen, selbst an Orten, an die man gar nicht hingehört.« Auf die Frage jedenfalls, wo es am schönsten war, sagt Alex Rühle am Ende dieser langen Reise: »Überall.«
»Erkundung eines Kontinents, mit (…) den weit aufgerissenen Augen dieses warmherzigen Reporters und hellwachen Feuilletonisten.« Zeit Online
Alex Rühle
Europa – wo bist du?
Unterwegs in einem aufgewühlten Kontinent
Aufbruch
Ein Zittern geht durch die Welt, tief unter uns allen, ein riesiges Beben. Während ich am Abend des 9. März 2022 meinen Rucksack packe, ist es gerade mal zwei Wochen her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Wie fundamental die allgemeine Verunsicherung ist, kann man auch daraus ersehen, dass in den Zeitungen das Genre der Globalprognosen und Grundsatzresümees Hochkonjunktur hat: Der bulgarische Politikwissenschaftler Ivan Krastev sieht die liberale Weltordnung am Ende, der polnische Schriftsteller Szczepan Twardoch nennt den deutschen Pazifismus dumm und unmoralisch, die amerikanische Historikerin Anne Applebaum prangert die europäische Blauäugigkeit dem russischen Despotismus gegenüber an. Alle mahnen die EU zur Geschlossenheit. Und ich bin beeindruckt, wie gut die alle selbst im dichten Nebel des Krieges den Überblick behalten.
Ich weiß ja nicht mal genau, was diese EU überhaupt ist. Stimmt, was Bernard-Henri Lévy mal sagte: Europa sei »kein Ort, sondern eine Idee«? Wenn ja, welche denn? Und trägt die noch? Sehen sich die Bewohner der einzelnen Länder überhaupt als EUropäer? Tun sie das vielleicht sogar stärker als vor zehn Jahren? Wer fühlt sich abgehängt? Wem ist es egal, weil er eh nie Teil davon sein wollte?
Lange Zeit war die Europäische Union ein so großes wie diffuses Versprechen: Mag alles durcheinandergehen, diese kleine, große Gemeinschaft wächst und leuchtet, stabil, gerecht und wohlhabend. Eine Art Fahrstuhl für ganze Volkswirtschaften, der langsam und stetig aufwärtsschwebt. Natürlich müssen eventuell auftretende Probleme von kompetenten Polittechnikern bis ins Detail besprochen werden, aber dann fährt die gesamte Union auch schon wieder weiter in ein immer noch besseres Morgen. Was es mit den Details genau auf sich hat, wollte keiner so genau wissen, wichtig war doch vielen von uns nur, dass man mit Interrail rumreisen konnte, um sich schon mal die mit EU-Geldern sanierten Innenstädte anzuschauen, in denen man später mit Erasmus semesterweise wohnen und nebenher sogar studieren könnte.
Wie lange das her ist! Heute kämpft die EU mit sich selbst ums Überleben, die existenziellen Momente scheinen seit der Staatsschuldenkrise 2010 immer schneller aufeinanderzufolgen: Die völlig konträren Vorstellungen darüber, wie man als Gemeinschaft mit zwei Millionen Migranten und generell mit Themen wie Zuwanderung oder Integration umgeht, führten zu so schweren Verwerfungen, dass manche Staatsoberhäupter und Beamte der Kommission nicht mehr miteinander redeten. Diese Krise war noch nicht ansatzweise bewältigt, da beschlossen die Briten, aus dem fahrenden Zug auszusteigen. Die Tinte unter dem Brexit-Vertrag war gerade erst getrocknet, da rollte Corona an. Jetzt herrscht Krieg in Europa, und die Gewitterwand am Horizont ist so breit, dass es schwer ist, sich eine mitteleuropäisch mild temperierte Zukunft auch nur vorzustellen. Von der alles überwölbenden Erderwärmung haben wir da noch gar nicht geredet.
Momentan ist nahezu jeden Tag zu hören, die EU sei eine »Wertegemeinschaft«. Aber welche Werte sind damit gemeint? Und was die Devise der EU angeht – In Vielfalt geeint – stimmt die denn? Das mit der Vielfalt auf jeden Fall, aber was eint »uns«? Momentan würde ich sagen, wir sind eine Angstgemeinschaft, Putins Angriff schweißt zusammen. Und darüber hinaus? Fühlt sich derjenige Teil, der vom Westen hartnäckig als Osteuropa bezeichnet wird, obwohl beispielsweise Prag westlicher liegt als Wien, fühlen sich also die Mittel- und Osteuropäer als gleichberechtigte Partner? Welche Narben haben die Länder davongetragen, die 2010 unter den Rettungsschirm mussten? Was ist mit all jenen, die auf dem Balkan im Wartesaal sitzen?
Genug gefragt. Weiterpacken. Und dann los: Europa in einem Zug. Mit Interrail. Ein großer Rucksack für den Kram, ein kleiner für Rechner und Notizblock. Eine ungefähre Ahnung von der Route, das muss erstmal reichen, Hauptsache auf ins Ungewisse, mit möglichst offenem Blick. Teils an den Außengrenzen der EU entlang, oft auch mitten hindurch.
Anfangs werde ich an einigen Stationen auf meinen eigenen Spuren unterwegs sein: Ich habe im Juni 2021 schon mal eine Rundfahrt gemacht, drei Wochen, für das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Um zu erkunden, welche Auswirkungen die Pandemie in den verschiedenen Ländern hatte. Während dieser Reise erwachte in mir der Wunsch, nochmal loszufahren, aber viel länger und weiter. Zum einen, weil ich in jedem Land, bei fast jedem Gespräch irgendwann dachte: Ist ja interessant, so hab ich das noch nie gesehen. Aber auch, weil ich schlichtweg überwältigt war von der reichen, widersprüchlichen Vielfalt dieses Kontinents.
Der Text wird Krisentagebuch, Essay und Reisemitschrift in einem, es geht durch weite Landschaften und fremde Sprachen, großartige Städte und kleine Cafés, gastfreundliche Wohnzimmer und durch sehr viel Geschichte.
Aber so weit ich dabei auch kommen mag, am Ende ist auch die längste Reise nur ein Strich in der Landschaft, eine viel zu schmale empirische Basis, als dass man darauf stabile Großthesen über die Verfasstheit eines Kontinents zimmern könnte. Insofern werde ich mich hüten, im Folgenden den Europameister oder das Politorakel zu geben. Ich werde in jedem Land, an jedem Ort versuchen, ein Thema zu finden, das mit der Europäischen Union zu tun hat. Die einzelnen Kapitel sind also nie vollständige Länder- oder Stadtporträts, sondern beschreiben jeweils Ausschnitte, die in der Summe als europäisches Mosaik gedacht sind. Ob das am Ende freilich ein kohärentes Bild ergibt, so richtig schön mit Zentralperspektive? Mal sehen. Morgen früh geht’s los, das Fernweh pocht erwartungsfroh, und ich frage mich kurz, ob ich eine Hängematte einpacken soll, vielleicht kann ich ja ab und zu draußen schlafen, unter dem europäischen Sternenhimmel?
AthenUnd allem Anfang wohnt eine Krise inne
Langzeit-Covid, Langzeit-Elend: Die rigide Sparpolitik hat Griechenland krank gemacht. Der Kardiologe und Armenarzt Giorgos Vichas praktiziert seit Jahren dagegen an.
Schnee in Athen, dicke schwere Flocken. Und ich bin losgefahren mit nur einem Paar Turnschuhe und einer leichten Lederjacke, weil ich dachte, wird doch Frühling jetzt. Außerdem fang ich ja ganz im Süden an – so kann man sich täuschen in Europa, im März 2022.
Mein Freund Prodromos Tsinikoris hat mir seine Wohnung in der Innenstadt überlassen, und ich sitze hier, eingehüllt in die beiden Wolldecken, die ich finden konnte, Heizung gibt es nämlich nur zwei Stunden morgens und zwei Stunden abends, und auch dann nur so in Richtung Handwärme. In der Kammer stand ein Paar Winterstiefel, die hab ich gerade an. Immerhin, die Aussicht ist großartig, ich schaue vom vierten Stock aus auf die Akropolis und den Lykavittós-Hügel. Also theoretisch. Momentan herrscht da draußen nur ein beeindruckend dichter grauweißer Wirbel.
Im Deutschlandfunk verteidigt Bundeskanzler Olaf Scholz die hundert Milliarden für die Bundeswehr und spricht von einer »Zeitenwende für Europa«. Ursula von der Leyen sagt, in Sachen europäischer Sicherheitspolitik habe sich »in den vergangenen sechs Tagen mehr getan als in den zwei Jahrzehnten davor«. Und in der Erklärung, die die 27 EU-Staaten gestern in Versailles unterschrieben haben, heißt es: »Der russische Angriffskrieg ist eine tektonische Verschiebung in der europäischen Geschichte.« Es wäre schon schön, wenn Europa selbst entscheiden würde, wo es hindriftet. Wenn der Kontinent aus eigener Kraft einen neuen Kurs einschlagen und nicht, wie bei der Plattentektonik, nur von unterirdisch brodelnden Konvektionsströmen irgendwohin geschoben würde.
Plötzlich komm ich mir hier, auf der kleinen griechischen Erdplatte, ziemlich fehl am Platz vor. Die Reise habe ich geplant in den Winterwochen vor Putins Überfall, denkend, der blufft doch nur, also fahr ich erstmal andersrum, Italien, Frankreich, Spanien, und bis ich dann über Skandinavien nach Osteuropa gelange, hat sich die ganze Situation wieder entspannt. Stattdessen kamen gestern allein in Berlin 13 000 Geflüchtete an, die Stadtverwaltung von Mariupol sagt, bei den russischen Angriffen seien bisher mehr als tausend Menschen gestorben, und das ukrainische Verteidigungsministerium schreibt auf Twitter, die russischen Truppen planten einen »terroristischen Anschlag auf die Nuklearanlage von Tschernobyl«, der danach den Ukrainern in die Schuhe geschoben werden solle. Maria, eine Athener Freundin, die mir bei meinen Treffen als Übersetzerin helfen wird, hat vor ein paar Tagen recherchiert, wo es hier im Zentrum öffentliche Luftschutzbunker gibt, man kann ja nie wissen.
Ich dachte immer, eine Europareise muss in Athen anfangen, der Stadt, in der Perikles einst die Demokratie beschrieb als die Staatsform, in der »die staatlichen Angelegenheiten nicht das Vorrecht einiger, sondern das Recht vieler sind«. Oder um es mit dem Bonmot zu sagen, das hier auf dem Höhepunkt der Staatsschuldenkrise die Runde machte: »Man kann uns gar nicht aus Europa rauswerfen, wir haben es nämlich erfunden.«
Diese damalige Krise ist der eigentliche Grund dafür, dass ich hier beginne: Athen war der Ort, an dem das neue »Europa« erstmals dramatischen Schiffbruch erlitt. Genauer gesagt erlitten die Griechen Schiffbruch, und die EU – nun ja, es kommt wahrscheinlich auf die Perspektive an, wie sich die europäische Gemeinschaft verhalten hat. In ein paar Wochen werde ich mir in Brüssel anhören, wie man dort die griechische Tragödie im Nachhinein beschreibt. Hier jedenfalls wurden die Auswirkungen mit denen eines Krieges verglichen, freilich mit weniger Toten.
Angela Merkel sagte 2011 auf einer CDU-Regionalkonferenz in Magdeburg, Griechenland solle sich nicht so anstellen, auch Ostdeutschland habe nach der Wende einen radikalen Strukturwandel bewältigen müssen. Finanzminister Wolfgang Schäuble assistierte: »Wir können nicht in ein Fass ohne Boden zahlen. Deswegen müssen die Griechen endlich den Boden einziehen. Dann können wir auch etwas reintun.« Und der Chef des ifo Instituts, Hans-Werner Sinn, forderte, eine EU-Aufsicht müsse bei den Griechen nun »sicherstellen, dass sie den Gürtel enger schnallen«. Dazu kam die Hetze des Boulevards, faule, dreiste Griechen, Hängemattenmonopolisten, verkauft doch eure Inseln! Einige griechische Medien keilten ähnlich plump zurück, Merkel mit Hitlerbart, Schäuble mit Hakenkreuz. Es war unheimlich, wie schnell und massiv damals auf beiden Seiten die schäbigsten nationalen Klischees und Vorurteile wiederbelebt wurden.
Die Troika – je ein Vertreter der Europäischen Zentralbank, des Internationalen Währungsfonds IWF und der Europäischen Kommission – gab den Griechen dann drei Vorgaben: kürzen, kürzen, kürzen.
Ich erinnere mich noch gut an die drei Mathematikstudenten in Thessaloniki, die nachmittags in den Mülltonnen nach Gemüse wühlten. Das war im März 2012. Auf meine Frage, warum sie containern, antwortete einer, Containern sei ein freiwilliger Akt der Konsumverweigerung, sie aber hätten einfach zu wenig Geld für Essen. Dimitra Kanellopoulou, damals Vorsitzende des griechischen Prostituiertenverbandes, erzählte mir bei einer Reportage-Rundreise durch diese gesamtgesellschaftliche Katastrophe, dass ihre Kunden selbst beim Sex an ihre Kreditrate dächten. »Die armen Kerle kriegen entweder gar keinen mehr hoch oder sie sind betonhart, der Stress ums Geld hat sie jedenfalls alle mehr am Wickel als früher die Moral der Kirche.« Überall in Athen machten Armenküchen auf. Vor der Stromversorgerfirma DEI gab es jeden Tag lange Schlangen, weil Leute, die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen konnten, darum bettelten, wenigstens für ein paar Stunden am Tag Elektrizität zu bekommen. Über Europa wurde gesprochen wie über einen fernen, reichen Onkel, den irgendein sadistischer Teufel reitet und der an Griechenland seinen Frust auslässt. Und an einer 600-Quadratmeter-Wand in der Innenstadt tauchten Albrecht Dürers Betende Hände auf. Verkehrt herum. Sie zeigten also nicht gen Himmel, sondern in den Abgrund. So als würde nicht der Mensch zu Gott beten, sondern umgekehrt Gott aus seinen Höhen herab uns Menschen um Gnade bitten. Oder abtauchen, weil er das griechische Unglück nicht mehr mit ansehen kann.
Aber dann gab es da diesen Kardiologen, Giorgos Vichas. Dem fiel auf, dass viele seiner chronisch kranken Patienten nicht mehr zu ihren Untersuchungsterminen kamen.
Als Folge der Sparmemoranden durch die Troika verloren damals bis auf wenige Ausnahmen alle ihre Krankenversicherung, die länger als zwölf Monate arbeitslos waren. Was wiederum zur Folge hatte, dass man Medikamente und Behandlungen in einem öffentlichen Krankenhaus selbst bezahlen musste. Was dann drittens dazu führte, dass gerade chronisch Kranke oft zu Hause blieben, obwohl sie dringend hätten behandelt werden müssen.
Im Herbst 2011 war Giorgos Vichas auf einem Konzert von Mikis Theodorakis. Der 86-jährige Komponist hielt zwischen zwei Stücken eine kurze Ansprache und sagte, dass jeder in der Pflicht sei, etwas zu tun, »genau dort, wo er gerade steht«. Vichas schaute sich um, genau dort, wo er gerade stand, auf dem Gelände des ehemaligen Athener Militärflughafens Ellinikó und sah all die leeren Baracken. Drei Monate später eröffnete er in einem dieser Gebäude mit vier Kolleginnen und Kollegen eine Armenpraxis.
Ich habe Vichas in den Krisenjahren mehrfach besucht, und er hat mich jedesmal beeindruckt mit seiner ruhigen Kraft des Weitermachens. Er sah die Griechen nie nur als arme Opfer, im Gegenteil, der Selbstviktimisierungsdiskurs vieler seiner Landsleute ging ihm genauso auf die Nerven wie die rigorose Sparpolitik. Die oligarchischen Strukturen. Der Machtmissbrauch. Die Gängelung der Medien. Die außer Landes gebrachten Milliarden. Und wenn er von den Verwaltungsstrukturen und der Ineffizienz der Behörden sprach, klang das eher nach Ostblock 1988 als nach einem modernen Staat. »Aber«, fragte er dann in Richtung Troika, »ist es deshalb sinnvoll, unser Gesundheitssystem zu zerstören?«
Oft wurde damals von den Befürwortern der Austeritätsprogramme die Metapher von der »bitteren Medizin« benutzt, die ja implizit die Behauptung transportiert, dass der Patient nach dem unangenehmen Schlucken davon am Ende doch profitieren werde. Vichas sagte, dass der Austeritätscocktail keine Medizin sei, sondern im Gegenteil reines Gift, schließlich gebe es keinen besseren Nährboden für chronische Krankheiten als Arbeitslosigkeit und Armut.
In Griechenland stiegen seit 2008 stressbedingte Erkrankungen. Eigentlich hätte der Gesundheitsetat damals angehoben werden müssen, er wurde stattdessen fast halbiert. Der IWF gab vor, dass die Ausgaben zwischen 2009 und 2015 jährlich um neun Prozent gekürzt werden, am Ende konnte die griechische Regierung nur noch weniger als fünf Prozent des ohnehin kargen Bruttosozialproduktes dafür freigeben. Deutschland gab 2019 für die Gesundheit 11,9 und im Jahr darauf sogar 13,1 Prozent des Bruttosozialprodukts aus.
Durch die Zunahme der Erkrankungen stiegen die Krankenhauseinweisungen dramatisch – durch die Sparpolitik fielen nach 2010 aber 35 000 Klinikstellen weg. 2012 beorderte die griechische Sektion der Ärzte der Welt all ihre Ärzte aus Ländern wie Afghanistan, Bolivien oder Uganda ab. Schließlich war Griechenland laut offiziellem Kriterienkatalog mittlerweile selbst zum Katastrophengebiet mutiert: Die Kindersterblichkeit war zwischen 2008 und 2010 um 43 Prozent gestiegen, die Suizide hatten sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt, ganze Krankenhausstationen hatten schließen müssen.
Und heute? Wie geht es den Griechen? Ist die Krise vorbei? Das unsägliche Gesundheitsgesetz, das dazu führte, dass Millionen Griechen ihre Versicherung verloren, wurde kassiert. Die Hilfsprogramme sind ausgelaufen, und es gab zwischendurch, so um 2019 herum, auch mal gute Nachrichten in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen.
Als der Schneesturm aufhört, holt mich Maria mit dem Auto ab. Sie hat mir Stiefel mitgebracht, die ihr Ex-Mann bei ihr stehengelassen hat. Maria unterrichtet an Grundschulen Theaterklassen und ist einer der freundlichsten Menschen, die auf diesem Kontinent herumlaufen. Würde ein Vogel den Entschluss fassen, in ihrem Haar sein Nest zu bauen, sie würde sich sanft hinsetzen und warten, bis er fertiggebrütet hat. »Bist du bescheuert«, antwortet sie, als ich ihr das sage, »ich hab keine Zeit, mich sanft hinzusetzen. Wenn ich einen Tag nicht in der Arbeit auftauche, krieg ich massiven Ärger.« Sie sagt all das, während sie ihr Auto durch den Athener Verkehr lenkt. Und da sie ein sehr zugewandter Mensch ist, schaut sie permanent beim Reden zu mir herüber. Da sie außerdem einen spektakulären Fahrstil hat und so was wie Spurführung keine Geltung für sie zu haben scheint, bereue ich sofort den Vergleich, sage: »Saudumm, verzeih« und umklammere den Haltegriff. Es scheint aber eine geheimnisvolle Aura um ihr Auto herum zu existieren, wir kommen jedenfalls unfallfrei durch die Stadt, vorbei an Dürers Händen, die nach zehn Jahren immer noch im freien Fall nach unten weisen, und landen irgendwann in Giorgos Vichas’ Klinik.
Vichas sieht genauso aus wie damals, die weichen Augen, der dunkle Teint, der schwarze Borstenschnitt, nur auf das dichte Gestrüpp seiner Augenbrauen hat sich mittlerweile erster Altersschnee gelegt. Immer wenn ich in den Tagen nach unserem Treffen die weiß überpuderten Hügelkuppen rings um Athen sehe, denke ich, das ist Giorgos Vichas, der über seine Stadt wacht.
Das Areal, auf dem die Armenklinik einst stand, wurde mittlerweile verkauft, da, wo er früher arbeitete, steht heute ein Casino. Kalyvia liegt sehr viel weiter draußen, und die neue Armenklinik ist auch kleiner als die alte. Sie bekommen weniger Spenden als damals, die griechische Mittelschicht ist weiter verarmt, und alle sind erschöpft von den grauen Jahren. Außerdem ist Griechenland aus dem Fokus der europäischen Öffentlichkeit gerutscht. Die meisten Spenden kommen zwar weiterhin aus dem Ausland, »Deutschland vorneweg«, wie er sagt. Aber es wurde doch weniger, und jetzt geht ohnehin das meiste in die Ukraine. Was er richtig findet, er hat selbst gerade eine große Lieferung Medikamente Richtung Lwiw geschickt. An diesem Samstag machen sie wieder zehn Kisten mit Insulin fertig. Außerdem plant er mit einigen Freiwilligen eine Plakataktion, mit der die Regierung aufgefordert werden soll, all jenen, die Geflüchtete aufnehmen, wenigstens die Energiekosten zu erlassen.
Und? Wie geht’s?
»Das ganze Land ist kränker geworden«, sagt Vichas. »Wir reagieren empfindlicher auf Covid als Nordeuropa. Weil viele vorher schon stark geschwächt waren.«
Auf der Anrichte neben seinem Schreibtisch liegt ein riesiger Stapel Krankenakten, zweihundert Fälle von Long Covid, »und das sind ja längst nicht alle, ich habe nur keine Zeit, mehr Menschen zu untersuchen.«
Covid traf hier auf ein ausgezehrtes System. Die Krankenhäuser sind völlig unterbesetzt, weil so viel Personal ins Ausland gegangen ist, Ärztinnen und Ärzte genauso wie Schwestern und Pfleger. Maria wird auf der Rückfahrt in die Stadt von ihrer 62-jährigen Cousine und Taufpatin erzählen, einer Radiologin, spezialisiert auf Brustkrebs, die alle zwei Tage eine 24-Stunden-Schicht ableisten muss. »Die lebt auf Rhodos, schwimmt für ihr Leben gern und war im gesamten letzten Jahr nur einmal im Meer. Keine Zeit, zu erschöpft.«
Vichas lässt in dem zweistündigen Gespräch immer wieder seine Hand schräg über dem Schreibtisch schweben, Sinkflug, abwärts.
Aber war die Krise nicht irgendwann vorüber, hat sich nicht alles konsolidiert, wenn auch auf niedrigem Niveau? »Von 2016 bis 2020 sah es so aus«, sagt er. »Wir haben damals immer wieder überlegt, ob wir eines Tages die Sozialklinik schließen können.«
Nach dem Auslaufen des dritten Hilfspakets kehrte Griechenland an den Kapitalmarkt zurück, der Leitindex der Athener Börse war 2019 der erfolgreichste weltweit. Doch dann kam eben Corona, Vichas’ Handwinkel fällt wieder ab, der Sinkflug wird noch steiler als zuvor. »Und jetzt, wo wir hofften, dass wir damit durch sind, die Ukraine.«
Das Schlimmste, so Vichas, das Schlimmste an diesem jahrelangen kollektiven Niedergang sei aber nicht, dass die Zahl der psychiatrischen und kardiovaskulären Erkrankungen genauso gestiegen sei wie die der Krebsfälle.
»Als wir durch die Krise gegangen sind, gab es noch kämpferischen Geist, Hoffnung, trotzigen Optimismus. Ein großer Teil der Gesellschaft war aktiv, probierte sich zu organisieren. Syriza symbolisierte und kanalisierte diese Hoffnung.«
Es gab auf dem Höhepunkt der Krise viele Beispiele für neu erwachte Solidarität, einige wirkten wie beflügelt von einer Art Not-Enthusiasmus. Junge Leute, die auf die Inseln zurückzogen, um den vernachlässigten Ackergrund der Großeltern neu zu bestellen. Alte Schulfreunde, die versuchten, gemeinsam Olivenöl zu produzieren. In Marathon und auf einigen Inseln wurden Selbstversorgerdörfer gegründet. Zuweilen schwangen im Erzählen über das solidarische Engagement politische Erlösungs- und Freiheitsphantasien mit: Jetzt wird der Mensch zum Menschen. Weg mit dem Staat und aller Bürokratie, in Zukunft regieren wir uns selber! Das klang vielleicht ein Quäntchen zu rosig. Aber insgesamt hatten diese Initiativen was von Selbstwirksamkeit und konstruktiver Auflehnung.
Vichas ging damals einen anderen Weg. Da war beispielsweise diese Familie mit zwei kleinen Kindern. Der Athener Wasserkonzern hatte ihnen die Leitung zugedreht, die Eltern waren arbeitslos und konnten die Gebühren nicht bezahlen. Vichas forderte die Leute auf Facebook dazu auf, so lange bei dem Konzern anzurufen, bis diese Familie nicht mehr auf dem Trockenen saß. Nach ein paar Tagen meldete sich die Geschäftsführung des Konzerns bei ihm, man werde das Wasser wieder anstellen, aber Vichas solle unverzüglich aufhören mit seinen illegalen Aktionen.
Er startete immer wieder solche Initiativen, die rechtlich, nun ja, problematisch waren, schließlich nannte er in seinen offenen Briefen die angestellten Konzernmitarbeiter beim Namen. Als ich ihn damals darauf ansprach, zuckte er mit den Achseln und sagte: »Kennen Sie die Antigone? Kreon verbietet seiner Nichte, ihren eigenen Bruder zu bestatten. Nach dem Gesetz hat Kreon Recht. Aber Antigone hat trotzdem die Verpflichtung, ihren Bruder zu beerdigen. Wir Ärzte müssen unseren Patienten helfen. Also mache ich weiter.«
Damals wurde sein Auto demoliert. Kurz danach gab es einen Einbruch in seinem Büro in der Klinik, sein Laptop verschwand. Er hatte Angst, klar, wer hätte da keine, aber er sagte ganz ruhig: »Was soll ich machen? Heimgehen und fernsehen?« Rückblickend könnte man sagen: Immerhin gab es damals einen Feind.
Vichas zeigt wieder auf die Mappen mit den Long-Covid-Fällen. »In den Leuten haben sich derart viele negative Gefühle aufgestaut, dass sie keinen Sinn mehr in Gesundheitsprävention sehen. Es gibt viel mehr Raucher und Trinker als früher, die Fettleibigkeit hat zugenommen. Die Krankheit, die hier am schlimmsten wütet, ist die Hoffnungslosigkeit.« Seine Patientinnen und Patienten hätten viel zu elementare Sorgen im Kopf, als dass sie noch Kraft zur Selbstfürsorge hätten. Wie soll man jemandem sagen, er muss sich gesünder ernähren, wenn er nicht weiß, wie er die Heizkosten zahlen soll? »Bei vielen Leuten, die hier zum Check-up erscheinen, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll mit der Behandlung, so viele Symptome und Krankheiten haben sich da aufgehäuft.« Und so viel Lebensschmerz. Fast jede Familie hat Kinder ins Ausland verloren, »letzte Woche saß hier ein Großvater, der weinte wie ein kleiner Junge, weil er noch nie seine Enkel zu Gesicht bekommen hat, die irgendwo in Deutschland leben.«
Und er selbst? Wird er nie krank? Doch, sagt er, einmal ist er kurz krank geworden: Als Syriza 2015 das Referendum zur Sparpolitik abhielt, stimmte Vichas gegen eine Fortführung der Austerität, so wie 61,3 Prozent der Griechen. Als sich Tsipras kurz darauf dennoch den Gläubigern in Brüssel beugte und das dritte Hilfspaket unterschrieb, fiel Vichas mit Fieber um. »Aber am nächsten Tag ging’s wieder.«
Giorgos Vichas muss jetzt weitermachen, draußen wartet ein altes Ehepaar, darum nur noch eine Frage: Er arbeitet täglich acht Stunden regulär im Krankenhaus, als Kardiologe, dann kommt er hierher und macht fünf, sechs Stunden unentgeltlich weiter – trägt seine Familie das mit? »Zum Glück ja.« Plötzlich muss er kurz lachen. 2016, als hier viele Geflüchtete in Lagern festsaßen, hat er von einer Syrerin gehört, die gerade ein Kind bekommen hatte. Das Baby war in einem furchtbaren Zustand, völlig verdreckt, die Mutter entkräftet. »Da hab ich diese Mutter kurzerhand mit nach Hause genommen, zusammen mit ihrem Neugeborenen und einem Brüderchen.« Einfach damit die Mutter sich und ihren Sohn mal gründlich waschen konnte, während er sich medizinisch um das Baby kümmerte. Als Vichas nach Hause kam, fragte seine Frau ihn leise: Moment, behalten wir dieses Baby? »Sie schien es mir immerhin zuzutrauen.«
Man könnte auch sagen, das war prophetisch. Auf meine Abschlussfrage, wie er mit seinem enormen Arbeitspensum bei Kräften bleibe, kommt nämlich eine überraschende Antwort. Nichts mit Yoga, Radfahren oder Netflix. Nein, anscheinend ist es seine Arbeit selbst, aus der er seine Kraft bezieht: Als sich 2016 vorübergehend die Situation entschärfte, fing er an, in seinen Ferienwochen nach Äthiopien zu fliegen, um dort in einem Waisenheim in Addis Abeba Kinder mit Herzproblemen zu versorgen. Seit einer dieser Reisen sind sie bei den Vichas’ zu fünft. Sie haben ein äthiopisches Mädchen adoptiert: Artemis, die früher Nardos hieß, ist mittlerweile sechs und kommt im Herbst in die Schule.
Draußen wartet das Ehepaar, das Grau des Alters sitzt in jeder Falte ihrer Kleidung, Vichas bittet sie rein. Die beiden scheinen ihre Körper wie schwere Taschen hinter sich herzuziehen, und Vichas streichelt dem Mann den Rücken, während er ihn sanft in sein Behandlungszimmer schiebt.
AthenLeben mit der Austerität
Wie die Lehrerin Artemis Kliafa mit 1250 Euro im Monat über die Runden kommt – und warum sie damit noch zu den Besserverdienenden gehört.
Parallel zu den Hiobsbotschaften entstand während der Krisenjahre ein zweites Narrativ, das der Krise ein kreatives Potenzial ablauschen wollte. Der viele Leerstand mitten in der Stadt, die politische Umbruchzeit, die vielen Initiativen, die versuchten, auf eigene Faust etwas zu entwickeln. Das ZEIT-Magazin behauptete, Athen sei das neue Berlin. Der Bayerische Rundfunk fand das dann auch – absolut, neues Berlin. Andere sekundierten; Athen, das neue Berlin, nickte die New York Times, außerdem kam ja noch die Documenta nach Athen. Die Athener, denen man den Neues-Berlin-Satz versuchsweise hinhielt, schauten einen freilich immer nur an, als sei man der neue Vollidiot. Oder in den damaligen Worten meines Freundes Prodromos: »Athen? Soll das ein Witz sein? In Berlin gibt es Jobs, und du wirst trotzdem für drei Euro satt. Hier gibt es nichts, aber alles kostet ein Schweinegeld.«
Ich zog mit Maria drei Tage lang quer durch die griechische Gesellschaft, sprach mit Restaurantbesitzern und Professorinnen, Obstverkäufern, Politikwissenschaftlerinnen, Kulturveranstaltern. Am eindrücklichsten war aber das Gespräch mit der Lehrerin Artemis Kliafa, kam da doch am besten raus, wie es den Griechen heute wirtschaftlich so geht.
Artemis Kliafa wurde 1967 in Hamburg geboren, ihr Vater arbeitete da als Schweißer, ihre Mutter als Näherin. Nach einigen Jahren bekam der Vater wegen des Hamburger Wetters so schlimme Depressionen, dass die Familie zurück nach Griechenland zog. »Migration ist nicht das Beste für die Menschen«, sagt Kliafa. Die einzige Erinnerung, die sie noch aus den frühen Kindheitsjahren an Deutschland hat, ist das Bild der zugefrorenen Elbe.
Es ist Sonntag, das Fest der Orthodoxie, stundenlang läuten die Glocken scheppernd durch die Stadt, irgendwann scheint die ganze Luft zu schwingen. Wir treffen uns in einem Café in Pangrati, einem bürgerlichen Viertel, in dem Kliafa unterrichtet. Wobei – was heißt noch bürgerlich, wenn man sich die Heizung nicht mehr leisten kann?
Auf dem riesigen Bildschirm über dem Tresen des Cafés läuft angeblich eine Nachrichtensendung zum Ukrainekrieg. Der Ton ist abgestellt, das Ganze wirkt wie ein Egoshooter mit Kommentatoren am Rand, die immergleichen Bilder von abgeschossenen Panzerabwehrraketen und Hubschraubern, teils mit Helmkameras aufgenommene Straßenkämpfe. In den anderthalb Stunden unseres Gesprächs wird diese dekontextualisierte Dauerschleife nur von Werbung unterbrochen, Joghurt, Waschmittel, BMW, dann wieder der muskulöse Mann, der kniend sein Riesenrohr nachlädt und eine Rakete ins Dunkel schießt.
Kliafa fragt: »Alltag? Mein Alltag als Lehrerin? Wo soll ich da anfangen?«
Vielleicht mit dem Geld.
»Gern«, sagt sie und streicht über den Tisch, als würde sie da jetzt Dokumente ausrollen. Artemis bekommt als Beamtin mit 22 Jahren Berufserfahrung 1250 Euro netto. Sie ist damit ungefähr wieder auf dem Gehaltsstand von 2011. Damals haben die verschiedenen Regierungen im Zuge der Krise die Staatsausgaben um über 30 Prozent gesenkt, das hat kein Industrieland davor oder danach je gemacht. Für Artemis Kliafa hatte das zur Folge, dass ihr Gehalt auf 900 Euro zusammenschmolz. »Das war …«, sie macht eine Pause und setzt das folgende Wort leise auf den Tisch wie einen Spielstein, »… entsetzlich.« Sie und ihr Mann, der bei der Stadt arbeitet, hatten plötzlich für sich und ihre zwei Kinder 700 Euro weniger. Mehrmals wiederholt sie, sie wolle sich nicht über ihr Schicksal beklagen, schließlich sei sie enorm privilegiert als festangestellte Lehrerin. Wenn sie an damals denkt, sieht sie alle mit Mütze und Schal vor sich, die Schulen konnten die Klassenräume nicht mehr heizen. Zehn Jahre lang wurden frei werdende Lehrerstellen nicht nachbesetzt, stattdessen gab es Verträge, die Jahr für Jahr verlängert werden müssen.
Auf dieser Basis arbeitet meine dolmetschende Freundin Maria. Sie sagt, sie darf einfach nicht krank werden, weil sie als freie Grundschulmitarbeiterin sonst sofort nur noch die Hälfte verdient. Und sie muss jedes Frühjahr hoffen, dass sie im Herbst weiterarbeiten darf.
»Wir haben die Verarmung Griechenlands in unseren Klassenzimmern miterlebt«, sagt Artemis Kliafa, »Kinder, die im Unterricht umkippten wegen Mangelernährung. Kinder, die wegen Schulfusionen viele Kilometer zu ihrer Schule laufen mussten. Ganze Klassen, in denen die Eltern arbeitslos waren. Familien, die zu den Großeltern zogen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen konnten.«
Aber was sie sagt, klingt nach Vergangenheit. Und die Zeit der Hilfspakete ist ja auch vorbei. Als das dritte im August 2018 auslief, sagte der damalige deutsche Finanzminister Olaf Scholz, alle Untergangspropheten seien eines Besseren belehrt worden. »Der Abschluss des Griechenlandprogramms ist ein Erfolg.« Die Bürgerinnen und Bürger Griechenlands hätten große Anstrengungen auf sich genommen, wofür ihnen Respekt gebühre. Das klingt doch schön. Wurde es besser seither?
Artemis Kliafa stutzt kurz und ich glaube zu sehen, wie über ihrem Kopf eine Gedankenblase auftaucht: Wie bescheuert ist dieser Deutsche eigentlich?
Dann sagt sie: »Nichts wurde besser. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Familien vom Geld der Großeltern leben, das ganze Land hängt am Tropf der Rentenkasse. Man zahlt hier 500 Euro Miete für 50 Quadratmeter, das ist für die meisten mehr als die Hälfte des Gehalts. Und jetzt der Krieg, der zu explodierenden Heizkosten führt. Auf den Inseln kostet der Liter Benzin schon zwei Euro fünfzig. Ich mit meinen 1250 bin ja Großverdienerin. Junge Lehrer fangen mit 560 Euro an. Wie soll man davon leben? Was soll besser werden?!?«
Man sollte vielleicht noch ergänzen, dass die Lebensmittelpreise schon bisher eher den deutschen Preisen glichen. Jetzt wird alles vom Öl bis zu den Nudeln geradezu sprunghaft teurer. Nicht zu vergessen die Steuersätze wie in Skandinavien, nur leider ohne den dazugehörigen Sozialstaat.
Ich will Artemis Kliafa meinen Stift reichen und sage, das ist kein Stift, sondern ein Zauberstab, und sie hat drei Wünsche frei. Sie schaut mit verschränkten Armen meinen Stift an und sagt: »Ein würdiges Leben. Das ist mein einziger Wunsch. Dass wir wieder in Würde leben können. Aber leider ist das nur ein Stift.«
Während im Hintergrund das stumme Bildschirmgeballer immer weitergeht, die Szene mit der Panzerabwehrrakete kam mittlerweile bestimmt achtmal, sagt sie, sie komme nicht mehr an die Kinder ran, die seien in ihren elektronischen Geräten verschwunden, der Rechner sei Elternersatz. Und die größeren wüssten eh, dass das Leben ihnen nichts zu bieten hat. »Wie soll man sie da motivieren, wirklich zu lernen?«
Ihre kräftigen Nasenflügel beben. Für einen kurzen Moment hängt eine seltsame Atmosphäre im Raum, ein aggressives Knistern. Ich frage mich, ob ihre Wut auch mir als Deutschem gilt, und sage dann, fast wie in einer Übersprungshandlung, Angela Merkel habe ja in einem der Interviews zum Ende ihrer Amtszeit auf die Frage, was sie bereue, gesagt, man sei zu hart zu Griechenland gewesen.
Artemis Kliafa lächelt kurz. Na ja, es sieht eher aus, als würde jemand ihre Mundwinkel gewaltsam hochziehen. Dann reibt sie sich mit den Händen energisch das Gesicht und sagt: »Ich könnte kotzen, wenn ich das höre. Wir haben dieses Sprichwort: Mit der Erfindung der Entschuldigung ging das Ehrgefühl verloren. Frau Merkel hat nicht ein Memorandum diktiert, sondern drei, das dritte Mal in Verbindung mit den härtesten Drohungen. Millionen leben im Elend, wir werden noch Jahre daran tragen. Und jetzt tut es ihr leid? Ich wäre für eine Auflösung der EU. Der Graben zwischen Nord und Süd hat sich doch nur vertieft, wir müssen da raus.« Meine Bedenken, dann würden die Chinesen, Amerikaner oder Russen das Land kolonisieren, wischt sie beiseite: »Kolonisiert sind wir jetzt auch schon.«
Maria und ich waren bei einem Medienwissenschaftler, der ein verheerendes Bild der griechischen Medienlandschaft gezeichnet hat. Wir waren beim ehemaligen Präsidenten der Internationalen Föderation für Menschenrechte (FIDH), Dimitris Christopoulos, einem Politologen, der sich über die Zuschreibungen und Projektionen wunderte, die bis heute nicht aufhören. »Wir haben ein disproportionales Image im Guten wie im Schlechten. Warum waren wir jahrelang im Fokus der Berichterstattung, aber Portugal kaum? In Bulgarien sagte ein Kollege zu mir: ›Ihr habt’s gut, über euch wird wenigstens berichtet, schau uns an, wir hatten immer schon Krise und sind viel ärmer als ihr.‹ Und als ich in Mali war, in meiner Funktion als Präsident des FIDH, der IS hatte gerade Tausende getötet, nahm mich der malische Präsident beiseite wie ein krankes Kind und sagte, wirklich furchtbar, was gerade in Ihrem Land passiert!«
Wir waren bei dem Psychoanalytiker Nikos Sideris, einem wunderbaren älteren Herrn im feinen Wollpulli, der Athen seit dreißig Jahren den Puls fühlt. Er hat ein Diagramm für mich vorbereitet, das den kollektiven Stimmungswandel seiner Patienten verdeutlichen soll, gerade in Bezug auf Europa. Vier Komponenten hat sein Diagramm: Hoffnung, Angst, Schulden und Versprechen. Zu Beginn der EU seien die Angst und die Hoffnung sehr groß gewesen, Schulden, nun ja, irgendwie gab’s welche, aber kein Problem. Die vier Linien schlängeln sich so durch die Zeit, bis um 2009 herum die Eurokrise kommt. Seither sind Hoffnung und Versprechen im Sinkflug, Angst und Schulden nehmen in gleichem Maß zu. Nikos Sideris zeigt auf das Tal am Ende seines Zeitpfeils, Hoffnung und Versprechen sind 2022 am Nullpunkt, und sagt: »Mir selbst geht es gut. Sehr gut. Verstehen Sie das also nicht als Larmoyanz. Ich stelle nur fest: So kann keine Gesellschaft auf Dauer leben.«
In den Interviews war Europa oft so weit weg, als gehörte Griechenland gar nicht dazu. Europa sagt … Europa will … Die Europäer denken so und so, wir Griechen hingegen … Dazu kommen immer wieder Zuschreibungen über den Norden Europas und die ach so besonders wohlsortierten Deutschen, die in den Gesprächen mal kümmerlichen Aktenordnern auf zwei Beinen gleichen, mal einer Klasse Hochbegabter, aber immer supersouveräne Organisationsgenies sind.
Mich können sie nicht gemeint haben. Am Samstagabend will ich die Weiterfahrt über Thessaloniki nach Belgrad organisieren und finde keine Zugverbindungen. Auf dem ganzen Balkan nicht. Moment, das kann nicht sein. Ich bin da doch im Sommer vor dem Abitur mit dem Zug durchgefahren, von München nach Athen. – Ja nun, das war 1987. Der Akropolis-Express wurde 1991 wegen der Jugoslawienkriege eingestellt und seither nie wieder in Betrieb genommen. Momentan gibt es eine sogenannte Pandemie und deshalb, weiß der Himmel, was das eine mit dem anderen zu tun haben soll, fahren nun gar keine Züge mehr. Sondern nur Busse. Und zwar am Dienstag. Vierzehn Stunden Fahrzeit. Ab der mazedonischen Grenze. »Sie sind dann Mittwochmorgen um eins in Belgrad«, erklärt mir die Frau am Bahnhof. »Nein, am Montag nicht. Wirklich nicht. Kann schon sein, dass damit Ihr Reiseplan durcheinandergerät. Trotzdem: montags nicht.«
Ich lasse wochenendliche Verzweiflungsbeschreibung, viel zu späte nächtliche Internetrecherchen und Telefonate mit Maria aus, um hier zu gestehen: Ich muss nach Belgrad fliegen. Sonst platzen all meine Termine dort und in Sarajevo. Eine Niederlage, gleich zu Beginn der Reise.
Das Schlusswort aber soll Maria haben, die mir zum Abschied noch Pangrati und Mets zeigt, Reste des alten Athen, die ahnen lassen, was für eine schöne Stadt das gewesen sein muss, bevor in den Fünfzigerjahren in ganz Griechenland die Landflucht einsetzte und in der Hauptstadt ein unkontrollierter Bauboom begann, mit dem Resultat, dass man an einigen Stellen der Stadt heute denkt, irgendein urbanistisches Planungsungeheuer habe eines Nachts auf den Bergen ringsum eine monströs große Betonmischmaschine ausgekippt und das ganze Tal mit Architekturmatsch geflutet. Hier in Mets aber gibt es stille Gassen mit kleinen Treppen und Orangenbäumen, zweistöckiges Häusergewürfel in freundlichem Gehügel. Zu den tristgrauen Bildern, die Giorgos Vichas und Artemis Kliafa von Griechenland entwarfen, bildet diese Straßenszenerie das bunte Kontrastprogramm: schicke Wohnungen, schnuckelige Shops, Gentrifizierungszauber, schöne junge Menschen unter Heizpilzen.
Maria träumt eigentlich davon, als Autorin zu leben, und sitzt momentan an einem Theaterstück über Paarbeziehungen in Zeiten der Pandemie. Nichts liebt sie so wie das Theater, sie war früher selbst Schauspielerin und erzählt, wie sie zu Beginn der Krise manchmal abends ins Onassis-Theater gegangen sei. »Ich habe damals achtzehn Stunden gearbeitet. Das Onassis hat großartige Inszenierungen aus der ganzen Welt eingeladen. Aber egal was kam, Behinderte aus Australien, ein kleinwüchsiger Hitler, Marthalers Truppe – sobald das Licht ausging, bin ich in einen steinschweren Erschöpfungsschlaf gefallen. Irgendwann hab ich’s gelassen. Ich kann mein weniges Geld nicht fürs Schlafen ausgeben.«
Maria ist ein grundoptimistischer Mensch, sie kümmert sich seit Jahren um ihre Mutter, jammert nie. Umso bemerkenswerter, als sie zum Abschied sagt, der Arzt Giorgos Vichas und der Analytiker Nikos Sideris hätten ihrer Meinung nach Recht mit dem, was sie über die Hoffnungslosigkeit sagen. »Ich hatte früher viele Träume. Zur Zeit lebe ich nur noch im Jetzt. Keine Hoffnung, keine Kraft. Es geht heute noch. Und heute noch. Und heute noch.« Während der letzten Dreiwortsätze schneidet sie mit der Handkante unsichtbare Tage einzeln aus der Luft ab, wie dünne Wurstscheiben. Nein, Moment, sie ist Vegetarierin, also eher wie sehr dünnen Gegenwarts-Feta. Dann sagt sie: »Komm, wir müssen für deine Reise Nüsse und Trockenobst kaufen, du musst dich gut ernähren unterwegs.«
BelgradValues, you know?
Wie kann man gegen eine Regierung Wahlkampf machen, die die Medien in der Hand hat und nicht vor Rufmord zurückschreckt? Ein Erfahrungsbericht von Saša Janković.
Auf der Busfahrt vom Belgrader Flughafen in die Innenstadt lese ich zwei Texte dazu, ob Putin wohl den Atomschlag wagt. Beide Texte wägen ernsthaft ab, ziehen dann aber den Schluss, wohl eher nein. Während ich google, wie ich am schnellsten heimkomme, wenn der Krieg tatsächlich auf EU-Gebiet rüberschwappt, fährt der Bus an vier, fünf englischen Slogans vorbei, die alle recht vehement darauf beharren, dass der Kosovo untrennbar zu Serbien gehört, Ausrufezeichen. Überall Plakate der regierenden Serbischen Fortschrittspartei, am 3. April werden hier ein neues Parlament und ein neuer Staatschef gewählt, wahrscheinlich wird es wieder der alte.
Aleksandar Vučić begann seine politische Karriere 1993 bei der ultranationalistischen Serbischen Radikalen Partei (SRS), die damals ein Großserbien propagierte, das Montenegro, den Kosovo, Mazedonien und fast ganz Kroatien mitumfasst (Bosnien-Herzegowina natürlich sowieso). 1995 ereiferte er sich im serbischen Parlament, man werde für jeden getöteten Serben 100 Muslime töten – und rekurrierte damit auf die deutsche Wehrmacht, die 1941 in Jugoslawien angekündigt hatte: »Für einen toten deutschen Soldaten töten wir 100 Zivilisten.« Wenige Tage vor seiner Rede hatten serbische Milizen die ostbosnische Stadt Srebrenica erobert und mehr als 8000 Bosniaken ermordet. Als Propagandaminister von Milošević verhängte Vučić dann gern Strafgelder gegen Journalisten, die es wagten, kritisch über die Regierung zu schreiben. Heute ist er Serbiens Präsident, und so wie es aussieht, wird er in knapp drei Wochen wiedergewählt.
Graue Häuser, graue Autos, sehr bunt scheint es hier nicht zuzugehen, aber Fahnen haben sie überall, das ist ja schon mal was. Man wird klug, wenn man sie ansieht, und sie tragen zur Herzensbildung bei. Vor dem Palata Srbije, in dem früher die gesamte jugoslawische Regierung saß, der aber heute nur eines der zahlreichen serbischen Regierungsgebäude ist, einem langgestreckten Riegel aus den Fünfzigerjahren, stehen zwei Reihen von Fahnenmasten. Links hängt am ersten Mast eine serbische Fahne. Am zweiten Mast hängt eine serbische Fahne. An den Masten drei bis dreizehn hängen serbische Fahnen. Am vierzehnten Mast hängt dann eine serbische Fahne. Auf der anderen Seite in konsequenter Symmetrie: vierzehn serbische Fahnen. Da es windstill ist, baumeln sie alle so kümmerlich von ihren Masten wie benutzte Präservative. Auf dem Flachdach des Parlaments steht zentral eine serbische Fahne. Gerahmt wird das Gebäude von zwei serbischen Fahnen. Auf der anderen Straßenseite hat ein origineller Geist eine serbische Fahne an eine Wand gemalt. Vor uns eine leere Verkehrsinsel, da könnte man eigentlich gut eine serbische Fahne platzieren.
Als ich diese ganzen rot-blau-weiß gestreiften Fahnenlappen sehe, fällt mir eine Meldung aus dem vergangenen November ein. Da gab es in der bosnischen Stadt Zenica ein Fußballspiel zwischen Bosnien und der Ukraine. Bosnien und die Ukraine haben keinerlei großhistorischen Fehden miteinander. Ein ukrainischer Fan hatte eine russische Fahne dabei, die er kopfüber an den Stadionzaun hängte, um Putin zu verhöhnen. Putin wird davon nichts mitbekommen haben, die bosnischen Fans aber hielten den Ukrainer für einen Serben, der sie provozieren will: Wenn man die russische Fahne umdreht, sieht sie aus wie die serbische Flagge, weiß-blau-rot statt rot-blau-weiß. Es kam zu einer Massenschlägerei zwischen bosnischen und ukrainischen Fans, wegen eines verletzten Nationalstolzes, der gar nicht verletzt werden sollte.
Das Café Green an der Milutina Milankovića, einem riesigen Boulevard in Novi Beograd, ist um fünf Uhr nachmittags menschenleer. Ich bin etwas früher da und der einzige Gast. Wie üblich bei Interviews setze ich mich nach hinten, an den äußersten Tisch. Kurz vor fünf kommt ein junger Mann im Trainingsanzug rein, durchquert den Raum und setzt sich an den Nebentisch, mit dem Rücken zu mir.
Saša Janković ist auf die Minute pünktlich. Lederjacke, verspiegelte Sonnenbrille, dicker Schal, cooler Auftritt. Janković hatte geschrieben, er treffe sich eigentlich nicht mit Journalisten, wolle aber eine Ausnahme machen, weil sein Freund, der Athener Politologe und Menschenrechtler Dimitris Christopoulos, mich empfohlen habe. Nach einer Stunde kann ich verstehen, warum er Journalisten gegenüber erstmal skeptisch ist.
Janković, ein Jurist, war von 2007 bis 2017 Ombudsmann der serbischen Regierung und versuchte in dieser Funktion, den wüst wuchernden Filz zu bekämpfen. Vergeblich, wie er selbst sagt. »Kleine Fische, das ja. Aber wann immer es um Machtmissbrauch und Korruption ging, wurde von allen Seiten gemauert.« Als beispielsweise seine Recherchen ergaben, dass der Militärgeheimdienst VBA illegal die Opposition, Richter und Gewerkschafter ausspionierte, reagierte das Parlament nicht, indem es einen Untersuchungsausschuss einsetzte, sondern indem es Janković zum Verhör vorlud. Die verschiedenen Hetzkampagnen serbischer Medien gegen ihn waren so heftig, dass die OSZE, die Europäische Kommission und Amnesty International immer wieder ihrer »Sorge« respektive »großen Sorge« Ausdruck verliehen. Janković ließ sich nicht einschüchtern, im Gegenteil: Er trat 2017 als Präsidentschaftskandidat an gegen Aleksandar Vučić, der zu dem Zeitpunkt noch Ministerpräsident war. »Von da an war ich so gut wie jeden Tag auf den Titelseiten der Boulevardblätter.« Man dichtete ihm die Schuld am Selbstmord eines Freundes an und diffamierte ihn als verkommenen Staatsfeind. Bei einer Fernsehdebatte sagte der damalige Innenminister, er spreche jetzt mal nicht als Minister, sondern als Privatperson, und als Privatperson müsse er leider sagen, dass Saša Janković ein Verräter sei, der mit ausländischen Mächten unter einer Decke stecke. »In derselben Nacht ordnete er dann als Innenminister Personenschutz für mich an, weil er sehr genau wusste, was das für Konsequenzen haben kann, wenn er mich im Fernsehen zum Staatsfeind erklärt. Ich habe den Personenschutz abgelehnt. Aber meine Frau, die im Ministerium arbeitet, wurde danach auf die unterste Stufe degradiert. Und wir haben unseren Sohn außer Landes geschickt. Es wurde einfach zu gefährlich.«
Angela Merkel empfing Aleksandar Vučić 2017 kurz vor dem Wahltermin in Berlin. »Das war großartige Werbung für ihn, Bilder von der mächtigsten Frau Europas, Seite an Seite mit unserem Präsidenten.« Merkel lobte Vučić für seine Reformbemühungen, die europäischen Standards entsprächen.
In Jankovićs Augen noch schlimmer: Einen Monat vor der Wahl wurde das Parlament geschlossen. Janković vermutet, »Vučić wollte einfach keinerlei Kritik mehr zulassen, da die Debatten live übertragen werden.« Die offizielle Begründung lautete, die parlamentarische Opposition könnte die demokratische Ordnung destabilisieren. Als dann aber die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini kurz vor der Wahl auf Besuch kam, wurde das Parlament für einen Tag aufgemacht und eine Fakesitzung veranstaltet. Vučić ließ seine schlimmsten Extremisten von der Kette, die Mogherini beschimpften. Auftritt Vučić, der sich im Parlament vor Mogherini und die Werte der EU stellte und seine faschistischen Clowns in die Schranken wies. Mogherini sprach danach vom »eindrucksvollen Fortschritt«, den das Land gemacht habe. Janković zuckt mit den Schultern, als hätte er gerade einen kinderleichten Zaubertrick vorgeführt: »So inszeniert man sich als integrer Garant europäischer Werte. Und so hat sich Mogherini zum Teil einer Inszenierung gemacht, an die sie wahrscheinlich in dem Moment selbst geglaubt hat.«
Vučić bekam 55 Prozent der Stimmen, in mehreren Städten gingen die Menschen auf die Straßen, um gegen den »Diktator« Vučić zu demonstrieren und den Behörden Wahlfälschung vorzuwerfen. Außenminister Sigmar Gabriel gratulierte ihm zum Präsidentenamt, betonte, wie »demokratisch« die Wahl gewesen sei, und nannte Serbien einen »Stabilitätsanker in der ganzen Region«. Vučić bedankte sich am Wahlabend ausdrücklich bei Merkel und Putin.
Janković wurde Zweiter, mit 16 Prozent. (Dritter wurde übrigens ein Comedian, der mit Freunden die Satirepartei »Sarmu probo nisi« gegründet hatte, zu Deutsch: »Du hast die Krautwickel noch nicht probiert«.) Als Jankovićs Leute stichprobenartig eine Urne nachzählten, fanden sie darin nicht, wie im offiziellen Wahlprotokoll behauptet, 4000, sondern 1000 Stimmen für Vučić. Daraufhin sagte Vučić, er werde dieselbe Urne am kommenden Tag live im Parlament auszählen lassen. Da waren es dann wieder 4000 Stimmen für ihn. »Allerdings«, so Janković, »waren 3000 Wahlzettel nicht gefaltet, wie sie es wären, hätten Wähler sie unter Aufsicht eingeschmissen.«
Draußen vor dem Café fährt ein hupender Autokorso mit Russlandfahnen vorbei. Einige haben das Z der russischen Truppen mit schwarzem Klebeband groß über ihre Autos geklebt. Putin ist gleich in mehreren serbischen Städten Ehrenbürger, in den Boulevardmedien wird er seit Jahren als moderner Herkules im einsamen Kampf gegen den bösen Westen gefeiert. Bislang gab es hier in Belgrad seit dem Angriff auf die Ukraine bereits zwei große prorussische Demonstrationen, auf denen die Leute mit Z-Schildern, russischen Flaggen, Putin-Bildern und Holzkreuzen durch die Straßen zogen. »Wäre Putin ein Kandidat in Serbien, würde er mehr als 70 Prozent der Stimmen erhalten«, sagt der serbische Politikwissenschaftler Orhan Dragaš am Tag meines Treffens mit Janković in einem Interview.
Serbien bezieht nahezu seine komplette Energie aus Russland. Gleichzeitig aber will Serbien in die EU, die jetzt schon wichtigster Handelspartner und Geldgeber ist. Serbien hat in den vergangenen fünfzehn Jahren allein aus dem EU-Heranführungsfonds knapp drei Milliarden Euro erhalten und ist damit der größte Nutznießer in der Region. Vučić hat diesen Schlingerkurs bislang fein ausbalanciert. Beziehungsweise es war überhaupt nicht fein, sondern ziemlich plump, dreist und verlogen, aber Europa hat die ganze Zeit mitgemacht.
Es gibt denn auch nur eine Sache, über die Janković sich mehr ereifert als über Vučićs Machenschaften – und das ist die EU. »Ich habe Carl Bildt gesagt, ihr könnt nicht mit eurem Geld ein kleines Monster anfüttern in der Hoffnung darauf, dass dann ein Prinz daraus wird.« Bildt, der ehemalige Hohe Repräsentant des UN-Sicherheitsrates für Bosnien-Herzegowina, habe ihm geantwortet, er solle sich beruhigen, die UN und die EU hätten das alles unter Kontrolle. Janković zuckt die Schultern und schüttelt den Kopf. »Schöne Kontrolle ist mir das.« Sein Kinn zittert, als würde Starkstrom durch seine Nervenbahnen fließen. Als er zu einer Art Schlussmonolog anhebt, scheint die Luft um ihn herum zu vibrieren: »Unsere Medien werden unterdrückt und sind praktisch gleichgeschaltet, und während unser Rechtsstaat zerstört wurde, klatschte die EU Applaus und sprach von Fortschritt.« Er holt nochmal Luft und dann rauscht es geradezu aus ihm heraus: »Wir wollten in die EU aufgrund der Werte, die immer wieder als deren Fundament bezeichnet werden. Genau diese Werte teilen wir doch im Privaten. Und wir haben uns danach gesehnt, einen Staat darauf aufzubauen. Es ist ja nicht so, dass wir in der Vergangenheit gar nichts hatten, Jugoslawien war ein prosperierendes, ernstzunehmendes Land. Die jugoslawische Monarchie hatte glanzvolle Zeiten. Wofür wir nach der Zerstörung während der Milošević-Periode wirklich Hilfe gebraucht hätten: ein voll funktionierender Verfassungsstaat zu werden, der demokratische Strukturen ermöglicht. Wir wollten in die EU wegen Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit, wegen der großen Prinzipien. Regierungsverantwortung, Rechtsstaat, Gleichheit vor dem Gesetz, Pressefreiheit – mein Gott, freie und faire Wahlen! Alles andere kommt dann schon. Aber ohne dieses Fundament macht das ›andere‹ keinen Sinn. Es ist dann einfach nur zynisch.«
Er merkt selbst, dass er gerade eine Art Grundsatzrede in ein leeres Café gehalten hat, räuspert sich, schiebt sein Handy hin und her, murmelt: »Values, you know?«, und hält die Handflächen vor sich, als schwebten darin die vielbeschworenen Werte. Oder als wolle er sagen: Ist doch nicht so viel verlangt, davon redet ihr doch die ganze Zeit in euren Ansprachen. Er wundere sich, mit welch billigen Rhetoriktricks sich die EU immer wieder auskontern lässt: »Orbán, Kaczyński, Vučić, all die neuen Autokraten haben die Statuten der EU genau gelesen, und jetzt bescheißen sie euch. Streuen alle Schlüsselwörter in ihre Statements, sprechen von LGBTQ+, sagen ›Person, die ihrer Freiheitsrechte beraubt wurde‹ statt Gefängnisinsasse und spucken gleichzeitig auf die letzten Reste von Demokratie, Würde und Freiheit.«
Okay. Verstanden. Und was soll Europa seiner Meinung nach machen?
»Seid authentisch. Haltet endlich die Werte hoch, die in der europäischen Verfassung stehen. Statt so ein schmieriges Schachspiel zu spielen, bei dem ihr selbst die Regeln nicht kennt, weil es keine gibt.«
Ist das Naivität vonseiten der EU?
»Aber nein, das ist schiere, bornierte Arroganz.« Er reckt das Kinn vor wie ein professioneller Bescheidwisser und macht dazu eine Handbewegung, als verscheuche er entnervt ein paar unappetitliche Tiere: »Was wollen die kleinen Balkankläffer.« Merkel sei oft als Garantin der Stabilität gefeiert worden, »aber auf lange Sicht hat sie die Fundamente der EU zerstört mit ihrem Pragmatismus.«
Heute arbeitet Janković als unabhängiger Berater zu Menschenrechtsthemen, mal in Osteuropa, mal in Nordafrika oder dem Nahen Osten. In Serbien hat er seit seiner Kandidatur vor fünf Jahren nie wieder einen Job bekommen. Im Verlauf des Gesprächs hat er sich zweimal als Flüchtling im eigenen Land bezeichnet. Deshalb frage ich ihn am Ende, ob er nie überlegt habe auszuwandern. »Hätte ich mit Anfang Zwanzig machen können, als der Krieg begann und ich eingezogen wurde. War schon alles organisiert, Fluchtroute, Helfer, Auto. Am Ende bin ich geblieben. Also bleibe ich auch jetzt.«
Der seltsame junge Mann im Trainingsanzug hat fünf Minuten vor Ende unseres Gesprächs das Café verlassen. Abends schickt Janković noch eine Mail und will wissen, ob der Mann schon vor mir dagewesen sei.
Nein, der kam kurz nach mir rein.
»Tja. So ist das hier. Schlafen Sie gut!«
Nach dem Lesen dieser Mail lasse ich beide Rollläden runter und sperre doppelt ab.
BelgradWir waren schon mal viel weiter
Was die EU verspielt, wenn sie die Balkanländer noch länger im Wartesaal schmoren lässt.
Am nächsten Mittag treffe ich Igor Štiks, einen Politologen und Autor, im Café Majestic. An einem automatischen Klavier werden wie von Geisterhand Tasten gedrückt, dazu knödelt aus einem Lautsprecher ein italienischer Tenor ein Arienpotpourri. Igor Štiks’ Frau Jelena Vasiljević, Philosophin, Anthropologin und politische Aktivistin, hat an diesem Tag keine Zeit, ich habe sie später per Zoom interviewt und schneide dieses separate Interview hier rein, weil es sich oft so gut ergänzt, was die beiden zu sagen haben.
Štiks hat vor zwei Jahren einen wütenden Text im Roar Magazine veröffentlicht: Eine Europäische Vereinigung habe nie stattgefunden, es habe nur eine Ausweitung der EU nach Osten gegeben, und der »formale Integrationsprozess, der darin bestand, die EU-Gesetze anzunehmen und dem ›Club‹ beizutreten, wurde von allen Beteiligten als Einigung Europas verkauft und akzeptiert.«
In Paraphrasierung eines berühmten Satzes von Jean Baudrillard über den ersten Irakkrieg schreibt Štiks: »Da diese europäische Vereinigung schon im Vorhinein erzielt wurde, werden wir nie erfahren, wie sie vonstattengegangen wäre, hätte es einen wirklichen Einigungsprozess gegeben.« Das Foto einer riesigen Menge junger Männer, die 2020 am Flughafen der rumänischen Stadt Cluj-Napoca trotz eigentlich geltender Covid-Restriktionen auf eine Maschine nach Deutschland warten, wo sie zur Spargelernte hinwollen, symbolisiert für ihn, was schiefgelaufen ist: Die osteuropäischen Länder sind nie zu gleichberechtigten Partnern geworden; nach dem Zusammenbruch ihrer maroden Wirtschaften und dem Totalausverkauf der letzten Strukturen an westliche Firmen sind sie eher Zuliefergegenden für Arbeitskräfte – was die Länder selbst demografisch wie intellektuell völlig auszehrt. Und mittendrin in diesem Hinterhof als nochmal dunklerer Fleck der Balkan, die sechs Kandidatenländer, die so lange schon darauf warten, reingelassen zu werden, dass die meisten sich mittlerweile enttäuscht abgewendet haben.
Jelena Vasiljević gehörte zwei Jahre der Balkans in Europe Policy Advisory Group (BiEPAG) an, einer an der Universität Graz angesiedelten Forschungsgruppe zur politischen und sozialen Lage in den Balkanstaaten. BiEPAG hat kürzlich eine Umfrage gemacht unter den Bürgerinnen und Bürgern der verschiedenen Balkanstaaten. Dabei stellte sich heraus, dass es in keinem anderen Land der Region so wenig Vertrauen in westliche Länder gibt wie hier in Serbien. Die Befragten hatten deutlich mehr Vertrauen in die russische und chinesische Regierung als in die EU, der nur zehn Prozent zutrauten, die Covidkrise am besten zu lösen. In allen Balkanstaaten ist das Vertrauen in die EU geschwunden, die Studie ist ein ziemlich eindrücklicher Beleg dafür, wie richtig Štiks mit seiner Diagnose liegt. Wie kann das sein? Was hat die EU hier verspielt?
»Na ja«, sagt Vasiljević, »Mazedonien hat sich auf Drängen Griechenlands umbenannt in Nordmazedonien, sie haben dafür die Verfassung geändert – einen größeren Schritt kann ein Land kaum gehen. Aber danach kam vonseiten der EU immer noch nichts als Indifferenz und Blockadepolitik, erst durch Frankreich, dann durch Bulgarien. Das kriegen alle Länder in der Umgebung mit und fühlen sich gemeinsam verschaukelt und im Stich gelassen. In unserer Umfrage wollten wir auch wissen, ob die Leute daran glauben, dass ihr Land irgendwann aufgenommen wird. Über die Hälfte gibt immer noch an, dass sie es begrüßen würden, wenn ihr Land der EU beitritt, aber kaum jemand glaubt daran, dass das noch passieren wird.«
Zur Enttäuschung über Europas kühle Indifferenz kommt insbesondere in Serbien die gezielte Desinformation durch die Regierung. »Kaum jemand weiß, dass die EU hier der mit Abstand größte Investor ist«, so Vasiljević. »Die Medien verschweigen es oder behaupten sogar fälschlich, die Chinesen seien die großen Heilsbringer.« Während der Pandemie hingen einige Monate lang im ganzen Land chinesische Flaggen, zum Lobpreis Pekings. Vasiljević sagt, dem Journalismus geht es noch schlechter als in den Neunzigerjahren während der Kriege. »Natürlich gibt es ein paar freie Internetportale und letzte Zeitungen, aber außerhalb einer kleinen Blase in den Städten kriegt keiner mit, was die aufdecken. Die allermeisten Menschen in diesem Land haben keine Ahnung von all den Skandalen, die es gibt, weil ihre einzige Informationsquelle das Fernsehen ist, und da läuft Staatspropaganda und sonst gar nichts.« Ihr Mann sagt ganz ähnlich, es gebe keine wirkliche Öffentlichkeit, auch nicht in den sozialen Medien. »Wie soll auf Twitter eine öffentliche Debatte entstehen, wenn Vučićs Leute dort 12 000 Bots am Laufen halten.« Twitter hat irgendwann die Hälfte der Bots gelöscht. Aber das sind dann immer noch 6000. »Und du kannst ja am nächsten Tag einfach neue programmieren«, so Igor Štiks.
Um etwas zu bewirken, kandidiert Jelena Vasiljević jetzt für den Stadtrat, der am kommenden Sonntag parallel zur Präsidentschaftswahl stattfindet. Vasiljević ist Mitglied der Bürgerbewegung Ne da(vi)mo Beograd, was – die Klammer deutet es auch optisch an – ein Sprachspiel ist, es heißt zugleich »Lassen wir Belgrad nicht absaufen« und »Lassen wir Belgrad nicht im Stich«. Die Initiative wurde gegründet, nachdem mitten in der Stadt, am Ufer der Save, einfach ein ganzes Viertel mit Bulldozern plattgemacht worden war. Die Aktion fand statt in der Nacht der Parlamentswahl 2016, wahrscheinlich weil am nächsten Tag alle auf die Wahlergebnisse schauten und nicht so sehr auf die Tatsache, dass gerade zweihundert Familien ihre Bleibe verloren hatten, ohne dass die Polizei interveniert hätte.
Danach entstand dort unter Umgehung aller Auflagen und Gesetze Belgrade Waterfront, ein glamouröser neuer Stadtteil, der teils von der serbischen Regierung und teils von dubiosen Investoren mit Sitz in Abu Dhabi gebaut wurde, 100 Hektar Baugrund, extrem teure Apartments, eine riesige Shopping mall und der mit 168 Metern höchste Turm des Landes, in dem heute ein Luxushotel residiert. Die Brutalität, mit der die nächtlichen Trupps vorgingen – schwarz maskierte Männer, die protestierende Bewohner fesselten, während die Bulldozer deren Straßenzüge abreißen konnten, ohne dass sich die Polizei blicken ließ –, »es war eindeutig, dass da die Regierung Vučić mit Mafiagruppen unter einer Decke steckte«, sagt Jelena Vasiljević.
Igor Štiks wurde in Sarajevo geboren. Zu Beginn der Belagerung seiner Heimatstadt, da war er vierzehn, floh er erstmal nach Kroatien. Jelena Vasiljević kommt aus Belgrad, wo die beiden heute leben, sie forscht hier am Institut für Philosophie und Sozialwissenschaften der Universität Belgrad, er an der Universität von Ljubljana, in Slowenien. Die beiden sind also aus ihrer Biografie heraus »echte Jugoslawen«, wie er es ausdrückt, und wenn man ihnen zuhört, kommen sie einem vor wie diplomatische Lebenskuriere zwischen den fragmentierten Welten.
»Wir waren mal viel weiter«, sagt Igor Štiks. Vor zehn Jahren hatte eine Theaterfassung seines Romans Die Archive der Nacht hier im Nationaltheater Premiere, ein Buch von 2006 über das Grauen der Belagerung und die Fragen nach Identität und Herkunft, das 2008 auch in deutscher Übersetzung erschien. Die Hauptdarstellerin war aus Sarajevo, der Premierminister kam, das Stück war auch hier ein großer Erfolg. »Heute wäre solch eine Aufführung undenkbar«, so Štiks. »Bosnienkrieg? Welcher Bosnienkrieg? Srebrenica? Nie gehört. Der ganze Krieg fängt heute offiziell an mit der Bombardierung durch die NATO 1999, und Serbien war immer nur Opfer dieses Krieges.«
Absurderweise erscheinen Štiks’ Bücher in jedem der ex-jugoslawischen Länder in einem anderen Verlag. Könnte man das einfach als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder Indiz für eine blühende Verlagslandschaft verbuchen, wäre es ja in Ordnung. Es hat aber tiefere Gründe.
Pušenje ubija. Das ist kroatisch und bedeutet »Rauchen tötet«. Auf Bosnisch heißt derselbe Satz Pušenje ubija. Also haargenau, Buchstabe für Buchstabe dasselbe, inklusive Hatschek auf dem s. Auf Serbisch heißt der Satz Pušenje ubija, nur dass man es da in kyrillischen Buchstaben schreibt – das sieht dann so aus: Пушење убија, man spricht es aber genauso aus wie auf Kroatisch oder Bosnisch. Der Satz steht in den drei Sprachen auf jeder Zigarettenschachtel, die in Bosnien verkauft wird. Und er illustriert sehr gut den ganzen Sprachenstreit, der seit über dreißig Jahren in den ex-jugoslawischen Ländern tobt und in Bosnien die so absurde wie papierverschwendende Folge hat, dass jedes staatliche Dokument in allen drei Landessprachen existiert.
Polemisch verkürzt: Serbische Sprachwissenschaftler werden seit Jahren dafür bezahlt, wissenschaftlich zu beweisen, dass es nur eine serbische Sprache gibt und die anderen Balkansprachen irgendwelche kümmerlichen Derivate oder Bauerndialekte sind. Die staatlich bezahlten kroatischen Linguistinnen hingegen legten 1991 mit Erklärung der kroatischen Unabhängigkeit all ihre Kraft in die Aufgabe, die Sprache zu »rekroatisieren« und von allen serbischen Elementen zu befreien, weil es ihrer Lesart zufolge natürlich genau umgekehrt ist: Das Kroatische ist das Quellwasser der Wahrheit, das Serbische irgendein trüber Nebentümpel. Das eine ist genauso großer Quatsch wie das andere, »wir sprechen alle eine Sprache«, so Štiks, »vielleicht zehn Prozent Abweichung.« »Der beste Beweis«, so seine Frau, »sind wir beide, wir kommen aus unterschiedlichen Teilen des ehemaligen Jugoslawien, aber sprechen genau dieselbe Sprache.«
Es gab in allen Ländern immer wieder Spott über diesen Sprachnationalismus. 2014 tauchten beispielsweise auf einer Demonstration Schilder auf mit dem Slogan: »Gladni smo na sva tri jezika!« (Wir haben Hunger in drei Sprachen!)
2017 hat Štiks die Declaration on the common language mitformuliert. Diese Erklärung, die 8000 bosnische, kroatische, serbische und montenegrinische Intellektuelle unterschrieben haben, war als Statement gegen die Segregation gemeint und stellte einfach nur fest, dass die Menschen in Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Montenegro und Serbien »eine plurizentrische gemeinsame Sprache sprechen, also eine Sprache, die von mehreren Völkern in mehreren Ländern gesprochen wird und erkennbare Varietäten aufweist – so wie sie auch im Deutschen, Englischen, Arabischen, Französischen, Spanischen, Portugiesischen und vielen anderen Sprachen vorkommen.« Auf dem Balkan ist es mittlerweile umgekehrt, es gibt aufgrund des ganzen Provinznationalismus Namen für jede einzelne Sprachvarietät, die eigentliche Sprache aber, das Serbokroatische, hat ihren offiziellen Namen verloren. »Die Declaration war deshalb wichtig, weil sie sich gegen dieses Kidnapping der Sprache wandte«, so Štiks.
Wenig überraschend fielen damals sofort Nationalisten aller vier Länder über die Declaration her, richtet sie sich doch gegen den nationalistischen Mythos, dass wahres Volk und wahre Sprache am selben unverfälschten Urgrund des Seins beheimatet sind. Josip Bozanić, der Erzbischof von Zagreb, hetzte in seiner Osterpredigt: »Dies ist ein Angriff auf die kroatische Sprache, der einem weiteren Angriff den Weg bereiten soll« – womit er einen bevorstehenden Krieg insinuierte. Der serbische Linguist Miloš Kovačević sah das Ganze als Verschwörung gegen sein Heimatland: »Diese Erklärung ist für Kroaten viel günstiger, aber auch für Muslime und Montenegriner, weil sie ihnen jetzt alles ermöglicht, was sie von Serben genommen haben. Diese Deklaration wurde im alten kommunistischen Stil gemacht, dass jeder in allem gleichberechtigt ist … Es ist gefährlich, wenn sie sagen, dass keine Variante wertvoller ist als die andere. Ihnen zufolge ist die bosnische oder montenegrinische Variante des Serbischen nicht weniger wertvoll als unsere rein serbische.«
Jelena Vasiljević sagt zu diesen Attacken der kroatischen und serbischen Nationalisten, man könne daran schön den kategorischen Unterschied zwischen dem sezessionistischen Nationalismus der kroatischen Regierung und dem hegemonialen Nationalismus Serbiens sehen: »Die Serben denken, ihnen gehört im Grunde eh alles auf dem Balkan, also auch die Sprache, die immer schon serbisch war. Die Kroaten wollen mit den anderen radikal nichts mehr zu tun haben und sagen, das sind zwei komplett differente Sprachen.«
Und wie könnte eine Lösung aus diesem nationalistischen Schlamassel aussehen?