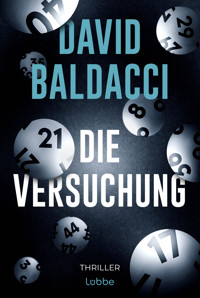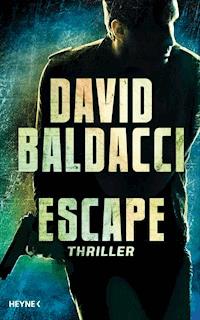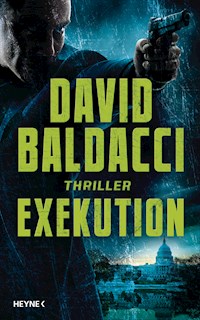
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Memory-Man-Serie
- Sprache: Deutsch
Ein Mord direkt vor dem FBI-Hauptquartier – ein neuer Fall für den einzigartigen Memory Man
Washington, D.C.: Mitten am helllichten Tag zieht ein Mann vor der FBI-Zentrale eine Beretta. Er erschießt zielgerichtet eine Passantin – und anschließend sich selbst. Der Mann ist ein absolut unbescholtener Mitbürger und Familienvater, sein Opfer eine sozial engagierte Hilfslehrerin. Und es scheint keinerlei Verbindung zwischen den beiden zu geben. Amos Decker, der Memory Man, hat das Verbrechen durch Zufall beobachtet und steht vor einem kompletten Rätsel. Gemeinsam mit seinem Spezialermittlerteam vom FBI beginnt er die Lebensläufe der beiden Toten zu durchsuchen. Schnell stößt er auf zahlreiche Ungereimtheiten. Doch dann fordert ihn plötzlich die DIA, der militärische Nachrichtendienst, auf, sich sofort aus dem Fall zurückzuziehen: Es bestehe Gefahr für die nationale Sicherheit. Ein Grund mehr für Amos Decker weiterzuermitteln ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DAVID BALDACCI
EXEKUTION
THRILLER
Aus dem Amerikanischen von Uwe Anton
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Fix bei Grand Central Publishing / Hachette Book Group Inc., New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Columbus Rose, Ltd.
Copyright © 2020 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Shutterstock / ostill / Steve Heap
Redaktion: Wolfgang Neuhaus
Herstellung: Helga Schörnig
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-22085-3V003
www.heyne-verlag.de
Zum Buch
Die Sache war glasklar. Dabney hatte eine Waffe gezogen, hatte erst Berkshire erschossen, dann sich selbst. Keine weiteren Fragen. Bis auf die nach dem Warum.
Amos Decker, der Mann mit dem perfekten Gedächtnis, wird zufällig Zeuge eines Mordes: Direkt vor dem FBI-Hauptquartier zieht ein Mann eine Waffe und richtet sie gegen eine Passantin, anschließend gegen sich selbst. Der Memory Man beginnt gemeinsam mit seinen Kollegen der FBI-Sondereinheit zu ermitteln. Zunächst stößt er aber nur auf Rätsel. Die beiden Toten hatten scheinbar keinerlei Verbindung zueinander und waren absolut unauffällige und unbescholtene Mitglieder der Gesellschaft. Erst genauere Recherchen zeigen viele weitere Ungereimtheiten in ihren Biografien, die schließlich ein ganz neues Bild ergeben. Doch da schaltet sich mit einem Mal Harper Brown von der DIA ein, dem militärischen Nachrichtendienst. Sie will die Ermittlungen komplett an sich ziehen, weil die nationale Sicherheit betroffen sei. Dafür habe Amos Decker nicht die nötigen Freigaben. Aber jetzt ist sein Ehrgeiz erst recht angestachelt. Zudem beginnt auch er zu ahnen, welche enorme Gefahr für die USA hinter dieser Exekution steckt. Er muss den Fall lösen, bevor es zu spät ist.
Zum Autor
David Baldacci, geboren 1960 in Virginia, arbeitete lange Jahre als Strafverteidiger und Wirtschaftsjurist in Washington, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Sämtliche Thriller von ihm landeten auf der »New York Times«-Bestsellerliste. Mit über 130 Millionen verkauften Büchern in 80 Ländern zählt er zu den weltweit beliebtesten Autoren. »Exekution« ist nach »Memory Man« und »Last Mile« der dritte Band in seiner neuen Bestsellerserie.
Für Jamie Raab, eine großartige Verlegerin und wunderbare Freundin. Danke für deine Unterstützung in den letzten zwanzig Jahren. Mögen auch deine zukünftigen Unternehmungen dir Freude und Erfolg bringen.
Ich bin und bleibe dein größter Fan!
1
Normalerweise war die FBI-Zentrale einer der sichersten Orte auf Erden.
Nicht an diesem Tag.
Das J. Edgar Hoover Building, Hauptquartier des »Bureau«, war keineswegs in Ehren gealtert. Nach mehr als vierzig Jahren war es zu einem schäbigen, häuserblockgroßen Kasten mit pissgelben Honigwabenfenstern aus bröckeligem Beton geworden, mit rostigen Alarmsirenen, die beharrlich schwiegen, und schmuddeligen Toiletten, die nie funktionierten. Am Dachrand hatte man ein Sicherheitsnetz gespannt, das abbrechende Betonklötze auffangen sollte, bevor sie in die Tiefe stürzen und jemanden erschlagen konnten.
Seit Langem schon wollte das FBI für seine elftausend Mitarbeiter eine neue Zentrale erbauen lassen; allerdings war bis jetzt nicht einmal ein möglicher Standort ausgewählt worden. Deshalb lag die Eröffnung eines neuen Hauptquartiers ungefähr zwei Milliarden Dollar und sieben Jahre in der Zukunft. Der hochgewachsene Mann, der zwischen den Baumreihen über den Bürgersteig schlenderte, hieß Walter Dabney. Eine dreiviertel Stunde zuvor hatte er sich von einem Uber-Taxi an einem Coffeeshop ein Stück die Straße hinunter absetzen lassen und etwas zu essen bestellt. Nun ging er den Rest des Weges zu Fuß. Dabney war in den Sechzigern und trug sein schütteres, grau meliertes Haar gescheitelt. Es sah frisch geschnitten aus; hinten war ein kleiner Wirbel. Dabneys Anzug war teuer und saß dank einer geschickten Schneiderhand wie angegossen an seinem dicklichen Körper. Ein buntes Einstecktuch zierte die Vorderseite des dunklen Jacketts. Am Schlüsselband um seinen Hals hingen Ausweiskarten, die ihm Zugang zum Allerheiligsten des Hoover Building erlaubten. Seine grünen Augen blickten wachsam, während seine Schritte, die den Aktenkoffer rhythmisch hin- und herschwingen ließen, Entschlossenheit verrieten.
Aus der Gegenrichtung kam eine Frau. Anne Berkshire hatte die U-Bahn genommen. Sie war Ende fünfzig und zierlich, mit grauem Haar und ovalem Gesicht. Als sie sich dem Hoover Building näherte, schien sie zu zögern. Ihr hing kein Schlüsselband um den Hals, und ihr einziger Ausweis war der Führerschein in ihrer Handtasche.
Es war später Vormittag. Die morgendliche Rushhour hatte sich aufgelöst, doch immer noch waren Scharen von Fußgängern unterwegs, und auf den Straßen brodelte der Verkehr, da um diese Uhrzeit viele FBI-Mitarbeiter die Tiefgarage in der Nähe des Hoover Building ansteuerten.
Dabney legte in seinen teuren Allen-Edmonds-Brogues einen Schritt zu und pfiff dabei eine fröhliche Melodie. Er schien nicht die geringsten Sorgen zu haben.
Die Frau, Anne Berkshire, ging jetzt ebenfalls schneller. Ihr Blick huschte nach rechts, nach links, als wollte sie alles auf einmal in sich aufnehmen.
Ungefähr zwanzig Meter hinter Dabney stapfte Amos Decker über den Bürgersteig. Er war ein Hüne von eins fünfundneunzig und so wuchtig gebaut wie der Footballverteidiger, der er einst gewesen war. Seit Monaten auf Diät, hatte Decker ordentlich an Gewicht verloren, doch es gab noch reichlich Luft nach unten. Der Saum seiner Khakihose war fleckig, und der lange Pullover mit dem Logo der Ohio State Buckeyes verhüllte seine Wampe ebenso gründlich wie seine Pistole, eine Glock 41 Generation 4, die im Gürtelholster am Hosenbund steckte. Voll geladen mit ihrem Dreizehn-Patronen-Standardmagazin wog sie genau ein Kilo. Deckers Schuhe, Größe achtundvierzig, knallten im Rhythmus seiner Schritte auf das schmutzige Pflaster. Sein Haar war, freundlich ausgedrückt, zerzaust.
Amos Decker, Angehöriger einer Spezialeinheit des FBI, war an diesem Morgen auf dem Weg zu einer Besprechung im Hoover Building. Er freute sich nicht darauf, denn irgendeine Veränderung bahnte sich an, er hatte es im Urin, und Decker mochte keine Veränderungen. In den vergangenen zwei Jahren hatte er so viele davon erlebt, dass es für den Rest seines Lebens reichte. Er hatte sich gerade erst an einen neuen Tagesablauf gewöhnt und wollte, dass es so blieb. Doch wie es schien, hatte er keinen Einfluss darauf.
Er wuchtete seinen schweren Körper um eine Absperrung herum, die ihm auf dem Bürgersteig im Weg stand und ein Stück weit auf die Straße ragte. Eine orangerote Netzbarriere umschloss eine Kanalöffnung. In der Nähe lungerten ein paar Arbeiter herum. Ein Mann mit Schutzhelm stieg aus der Öffnung, ein anderer gab ihm ein Werkzeug. Die meisten standen untätig herum. Einige tranken Kaffee, andere plauderten.
Netter Job, überlegte Decker.
Ein Stück voraus sah Decker einen Mann, Walter Dabney, schenkte ihm aber kaum Aufmerksamkeit. Und die Frau, Anne Berkshire, fiel ihm deshalb nicht auf, weil sie zu weit vor ihm war.
Decker stapfte an der Garageneinfahrt vorbei und nickte dem FBI-Sicherheitsbeamten in seinem kleinen Wachhäuschen flüchtig zu. Der Mann hinter dem winzigen Fenster erwiderte das Nicken, ehe er den Blick pflichtbewusst über die Straße schweifen ließ. Seine rechte Hand lag am Holster, in dem seine Dienstwaffe steckte, eine Neun-Millimeter, geladen mit Speer Gold Dot G2-Munition, die das FBI wegen ihrer Durchschlagskraft benutzte. Das Motto dieser buchstäblich umwerfenden Munition hätte lauten können: »Wo ich treffe, wächst kein Gras mehr.« Andererseits galt das für die meiste Munition, solange man das Ziel richtig erwischte.
Ein Vogel flatterte vor Decker vom Himmel herab, ließ sich auf einer Straßenlampe nieder und beäugte mit einem Ausdruck, den man als Neugier hätte deuten können, die Passanten. Die Luft war kühl, und trotz seines dicken Pullovers fröstelte Decker. Die Sonne hatte sich hinter eine dichte Wolkendecke verkrochen, die den Potomac River ungefähr eine Stunde zuvor überquert und sich wie eine graue Kuppel über Washington gestülpt hatte.
Walter Dabney, noch immer ein gutes Stück vor Decker, näherte sichnun dem Ende des Straßenzuges, wo er links abbiegen musste, um zum Geschäftseingang des FBI zu gelangen. Vor Jahren hatte eshier öffentliche Besichtigungstouren gegeben; die Besucher konntensich das berühmte FBI-Labor anschauen und auf dem Schießplatz den Special Agents beim Training zusehen. In Zeiten des internationalen Terrorismus gab es so etwas nicht mehr. Immerhin wurden seit 2008 die Rundgänge wieder veranstaltet, die nach dem 11. September ebenfalls eingestellt worden waren. Das FBI hatte sogar ein Informationszentrum für Besucher eröffnet. Eine Besuchserlaubnis musste allerdings einen Monat im Voraus beantragt werden, damit das FBI einen gründlichen Hintergrundcheck des Besuchsaspiranten vornehmen konnte. Hier war es wie bei den meisten Regierungsgebäuden, die heutzutage Festungen ähnelten: Das Hineinkommen war schwierig, das Herauskommen noch schwieriger.
Als Dabney sich der Gebäudeecke näherte, wurden seine Schritte langsamer, während Anne Berkshire schneller ging.
Decker trottete weiter. Seine langen Schritte fraßen Meter um Meter, bis er sich nur noch zehn Schritte hinter Dabney befand. Anne Berkshire warfünf Meter von Dabneys anderer Seite entfernt. Kurz darauf hatte sie den Abstand halbiert; keine drei Schritte mehr trennten sie von Walter Dabney.
Jetzt, da Berkshire in unmittelbare Nähe Dabneys war, sah Decker die Frau. Er selbst war nun drei Meter hinter dem Paar und bog ebenfalls ab.
Berkshire warf Dabney einen Blick zu und schien ihn zum ersten Mal bewusst wahrzunehmen. Dabney hingegen beachtete die Frau nicht. Erst Sekunden später bemerkte er Berkshires Blick und lächelte. Hätte er einen Hut getragen – er hätte ihn aus Höflichkeit gelüftet.
Berkshire erwiderte Dabneys Lächeln nicht. Stattdessen griff sie nach dem Verschluss ihrer Handtasche.
Dabney wurde langsamer.
Decker wurde abgelenkt, als er auf der anderen Straßenseite einen Mann entdeckte, der aus einem Imbisswagen Frühstücksburritos verkaufte. Kurz fragte er sich, ob die Zeit reichte, sich vor der Besprechung eines der fetttriefenden Dinger zu Gemüte zu führen, schaute dann aber schweren Herzens wieder nach vorn, als er einsah, dass es seinem Bauchumfang nicht guttun würde.
Beiläufig registrierte er, dass der Mann und die Frau sich nun auf gleicher Höhe befanden, dachte sich aber nichts dabei. Wahrscheinlich kannten sich die beiden und trafen sich hier.
Decker warf einen Blick auf die Uhr. Halt dich ran, sagte er sich. Wenn du dein Leben verändern willst, musst du pünktlich sein.
Als er den Blick wieder hob, erstarrte er.
Der Mann war nun zwei Schritte hinter die Frau zurückgefallen. Ohne dass sie etwas ahnte, zielte er mit einer kleinen, klobigen Beretta auf ihren Hinterkopf.
Bei Decker schrillte die Alarmglocke. Blitzartig griff er nach seiner Waffe, spannte jeden Muskel an.
In diesem Moment betätigte Dabney den Abzug.
Die Frau wurde nach vorn gerissen, als die Kugel in schrägem Winkel in ihren Nacken einschlug. Das Geschoss zertrümmerte mehrere Halswirbel, drang in den Schädel ein, prallte von der Schädeldecke ab und trat durch die Nase aus. Die aufgebaute kinetische Energie bewirkte, dass die Kugel ein Austrittsloch hinterließ, das dreimal so groß war wie die Eintrittswunde.
Anne Berkshire stürzte vornüber auf den Bürgersteig. Von ihrem Gesicht war nicht mehr viel übrig. Der Beton war mit ihrem Blut und Gewebe bespritzt.
Die Pistole in der Faust, stürmte Decker los, während die Passanten schrien und die Flucht ergriffen.
Dabney stand da, hielt noch immer seine Beretta.
Deckers Herz raste, als er auf den Mann zielte. »FBI!«, brüllte er. »Die Waffe runter!«
Dabney drehte sich zu ihm um, ohne die Beretta auch nur einen Millimeter zu senken.
Decker hörte schnelle Schritte im Rücken, warf einen hastigen Blick über die Schulter und sah, dass der Mann aus dem Wachhäuschen mit gezogener Waffe herbeigerannt kam. Mit der freien Hand hob Decker seinen FBI-Ausweis und rief: »Der Kerl da hat die Frau erschossen!«
Dabney rührte sich noch immer nicht.
Decker ließ das Schlüsselband los und nahm den Beidhandanschlag ein. Die Mündung seiner Glock zielte auf Dabneys Brust.
»Weg mit der Waffe!«, hörte Decker den Uniformierten rufen, der Augenblicke später neben ihm stehen blieb und die Pistole ebenfalls auf Dabney richtete. »Wird’s bald!«
Jetzt standen zwei Waffen gegen eine. Dabney hatte keine Chance. Decker war sicher, dass der Mann aufgab und die Beretta fallen ließ.
Weit gefehlt.
Dabney blickte zuerst den Wächter an. Dann Decker. Dann lächelte er.
»Nein!«, brüllte Decker.
Dabney drückte sich die Pistolenmündung unters Kinn und drückte den Abzug zum zweiten und letzten Mal.
2
Dunkelheit, ging es Decker durch den Kopf, als er auf dem Stuhl saß und im Dämmerlicht die Leiche der Frau betrachtete. In unseren letzten Augenblicken wartet sie auf uns alle.
Anne Berkshire lag in der Leichenhalle der Gerichtsmedizin des FBI auf einem Tisch aus rostfreiem Stahl. Die Leiche war vollständig entkleidet worden; ihre Sachen hatte man in Beweismitteltüten verstaut, um sie später zu untersuchen. Ein grünes Tuch verhüllte den nackten Körper. Das verwüstete Gesicht der Frau war ebenfalls bedeckt, allerdings hatte ihr Blut den Stoff rot und fleckig werden lassen.
Auch wenn es nicht den leisesten Zweifel gab, was den Tod der Frau verursacht hatte, musste eine Autopsie vorgenommen werden. Das Gesetz verlangte es so.
Im Unterschied zu Anne Berkshire hatte Dabney wie durch ein Wunder überlebt. Bis jetzt. Die Ärzte in dem Krankenhaus, in dessen Notaufnahme er eingeliefert worden war, hatten keine Hoffnung, dass er jemals wieder das Bewusstsein erlangte. Die Kugel hatte einen Teil seines Gehirns zerstört. Unfassbar, dass er nicht auf der Stelle tot gewesen war.
Alex Jamison und Ross Bogart, zwei Kollegen aus Deckers Spezialeinheit, die aus Zivilisten und FBI-Agenten bestand, hielten sich derzeit bei Dabney im Krankenhaus auf. Falls er wider Erwarten zu Bewusstsein kam, wollten sie festhalten, was er von sich gab, da es möglicherweise erklären würde, weshalb er Berkshire auf offener Straße erschossen und dann versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Doch den Ärzten zufolge würde Dabney sich nie so weit erholen, dass er vernommen werden konnte.
Während seine Kollegen im Krankenhaus Däumchen drehten, saß Decker im Dämmerlicht der Leichenhalle und starrte auf das blutige Tuch, das Anne Berkshires Überreste bedeckte.
Obwohl, dämmrig war die Leichenhalle nicht. Nicht für Amos Decker. Für ihn leuchtete sie in einem metallischen Blaugrün. Es war ein Phänomen, das er einem beinahe tödlichen, Jahre zurückliegenden Sportunfall auf dem Footballplatz verdankte. Der Zusammenprall mit einem Gegenspieler hatte Deckers Gehirn binnen eines Sekundenbruchteils dramatisch verändert. Die Wucht der Kollision hatte Myriaden von Nervenbahnen gewaltsam verknüpft, neue neuronale Schaltkreise hergestellt und einen Zustand herbeigeführt, der als »Hyperthymesie« bezeichnet wird und der nichts weniger als ein perfektes Gedächtnis umschrieb. Decker brauchte keine Notizzettel, keine Karteikarten. Er behielt alles im Kopf, jede noch so winzige Kleinigkeit. Aber das war noch nicht alles. Eine zweite, nicht weniger gravierende Veränderung seines Gehirns hatte eine sogenannte Synästhesie hervorgerufen, ein Phänomen, das sich darin äußert, dass der Betroffene Zahlen, Personen, sogar Empfindungen mit bestimmten Farben verknüpft.
Der Tod und das Sterben beispielsweise besaßen für Decker verschiedene Blautöne. Deshalb war die Straße himmelblau erstrahlt, als Dabney die Frau erschossen hatte. Und deshalb leuchtete die Leichenhalle jetzt in schimmerndem Blaugrün.
Decker hatte seine Aussage beim FBI und der Washingtoner Polizei gemacht, genau wie der Sicherheitsbeamte, der ihn am Tatort unterstützt hatte. Es hatte nicht viel zu sagen gegeben. Die Sache war glasklar. Dabney hatte eine Waffe gezogen, hatte erst Berkshire erschossen, dann sich selbst. Keine weiteren Fragen.
Bis auf die nach dem Warum.
Die Deckenlampe flammte auf, und eine Frau in einem weißen Laborkittel, allem Anschein nach die Gerichtsmedizinerin, kam in den Obduktionssaal. Sie stellte sich als Lynne Wainwright vor, eine Frau in den Vierzigern, deren Gesicht die leicht gequälten Züge eines Menschen zeigte, der in seinem Leben schon jede Art von Gewalt gesehen hatte.
Decker stand auf, zückte seinen Ausweis, erklärte seine Zugehörigkeit zur FBI-Spezialeinheit und verkündete, dass er Zeuge des Mordes gewesen sei.
Todd Milligan, das vierte Mitglied der Spezialeinheit, kam in die Leichenhalle. Es hatte mal ein fünftes Mitglied gegeben – Lisa Davenport, eine Psychologin. Doch sie war nicht bei der Gruppe geblieben, sondern nach Chicago übergesiedelt, um eine Privatpraxis zu eröffnen.
Milligan war Mitte dreißig, eins achtzig groß, hatte militärisch kurz geschnittenes Haar und einen durchtrainierten Körper. Milligan und Decker hatten sich anfangs nicht besonders leiden können, kamen mittlerweile aber so gut zurecht, wie Amos Decker mit einem Mitmenschen zurechtkommen konnte.
Im Umgang mit anderen hatte Decker große Probleme. Das war nicht immerso gewesen, aber der Sportunfall und die Hirnverletzung hatten seine Persönlichkeit tiefgreifend verändert und aus einem geselligen Mann einen Eigenbrötler gemacht, verschlossen und in sich gekehrt. Diesem anderen Decker war die Fähigkeit abhandengekommen, das soziale Verhalten seiner Mitmenschen und die Zeichen stummer Interaktion zu entschlüsseln und einzuordnen, was den meisten Menschen angeboren war. Viele Leute, denen Decker das erste Mal begegnete, hielten ihn für einen Autisten und lagen damit gar nicht so falsch.
»Wie geht’s, Decker?« Wie immer trug Milligan einen dunklen Anzug mit makellos weißem Hemd und gestreifter Krawatte. Neben ihm sah der notorisch schlampige Decker beinahe wie ein Penner aus.
»Besser als ihr.« Decker zeigte auf Berkshires Leiche. »Was wissen wir bis jetzt über die Frau?«
Milligan holte ein kleines Tablet aus der Innentasche seines Mantels und scrollte den Bildschirm herunter. Währenddessen beobachtete Decker, wie Wainwright das Tuch von der Leiche zog und die zur Autopsie erforderlichen Instrumente vorbereitete.
»Anne Meredith Berkshire«, las Milligan vor. »Neunundfünfzig, unverheiratet, Aushilfslehrerin an einer katholischen Schule in Fairfax County. Sie wohnt … wohnte in Reston.«
»Verwandte?«, fragte Decker.
»Bis jetzt haben sich noch keine gemeldet, aber wir suchen noch.«
»Was wollte sie im Hoover Building?«
»Wir haben keinen blassen Schimmer. Wir wissen nicht mal, ob das FBI-Gebäude überhaupt ihr Ziel war. Auf jeden Fall war sie heute nicht zum Unterricht eingeteilt.«
»Und Dabney?«
»Einundsechzig, verheiratet, vier erwachsene Töchter. Führt ein erfolgreiches Zuliefererunternehmen für Regierungsaufträge. Arbeitet im Auftrag des FBI und verschiedener Geheimdienste. Davor war er zehn Jahre für die NSA tätig. Wohnt in einer schicken Villa in McLean. Der Mann kommt sehr gut zurecht.«
»Kam sehr gut zurecht«, verbesserte ihn Decker. »Was ist mit seiner Ehefrau? Den Kindern?«
»Wir haben mit der Frau gesprochen. Sie ist verständlicherweise völlig von der Rolle. Die vier Töchter wohnen in alle Himmelsrichtungen verstreut. Eine lebt in Frankreich. Sie kommen alle her.«
»Hat eine von denen eine Erklärung dafür, weshalb Dabney das getan haben könnte?«
»Wir haben noch nicht mit allen gesprochen, aber bis jetzt gibt es keinen Hinweis. Die Familie steht noch unter Schock.«
Deckers nächste Frage zielte auf das Offensichtliche. »Gibt es eine Verbindung zwischen Dabney und Anne Berkshire?«
»Bisher hat sich nichts ergeben, aber wir fangen ja auch gerade erst an. Glaubst du, der Mann wollte einfach nur jemanden erschießen, irgendeinen x-Beliebigen, bevor er Selbstmord beging? Und Berkshire hatte bloß das Pech, die Erstbeste zu sein?«
»Möglich«, erwiderte Decker. »Aber warum eine Unschuldige töten, wenn man sich umbringen will? Wozu?«
»Vielleicht ist der Typ verrückt geworden. Möglicherweise finden wir etwas in seiner Vorgeschichte, das erklärt, warum er durchgedreht ist.«
»Dabney hatte einen Aktenkoffer und einen Ausweis dabei. Anscheinend wollte er ins Hoover Building. Hatte er dort einen Termin?«
»Ja. Wir haben herausgefunden, dass er eine Besprechung hatte. Es ging um ein Projekt, das seine Firma im Auftrag des FBI übernehmen sollte. Reine Routine.«
»Wenn der Mann durchgedreht ist – wieso hat er sich dann in Schale geschmissen und ist für eine Routinebesprechung in die Stadt gekommen?«
Milligan nickte. »Ungereimtheiten. Trotzdem, möglich ist es.«
»Alles ist möglich«, murmelte Decker und trat an Lynne Wainwrights Seite. »Die Mordwaffe war eine Beretta, Kaliber neun Millimeter. Kontaktwunde im Nacken mit aufwärts gerichteter Flugbahn. Die Frau starb beim Einschlag der Kugel.«
Die Gerichtsmedizinerin bereitete eine Stryker-Säge vor, mit der sie Berkshires Schädel öffnen wollte. »Passt definitiv zu den äußeren Verletzungen.«
»Falls Dabney stirbt, machen Sie dann auch bei ihm die Autopsie?«, wollte Decker wissen.
Wainwright nickte. »Da Dabney für uns gearbeitet hat und die Sache sozusagen auf unserer Türschwelle passiert ist, übernimmt das FBI die Leitung der Ermittlungen. Deshalb bin ich ab sofort ganz die Ihre.«
Decker wandte sich wieder Milligan zu. »Hat das FBI schon ein Team auf den Fall angesetzt?«
Milligan nickte.
»Wer gehört dazu? Kennst du die Leute?«
»Sehr gut sogar.«
»Und? Wer ist es?«
»Wir.«
Decker blinzelte. »Wir?«
»Bogarts Team wurde auf den Fall angesetzt. Und das sind nun mal wir.«
»Aber wir kümmern uns um kalte Fälle!«
»Darum ging es bei der heutigen Besprechung. Sie wollten unseren Aufgabenbereich ändern. Von den kalten zu den heißen Fällen. Und weil du am Tatort warst, Amos, lag es auf der Hand, uns diesen Fall zu übertragen. Also, legen wir los.«
»Ich war Zeuge des Verbrechens!«
»Ich weiß. Aber es ist ja nicht so, als gäbe es Zweifel in Bezug auf die Ereignisse. Außerdem gab es eine Reihe von Augenzeugen. Deine Aussage wird also nicht benötigt.«
»Aber ich bin hier, um alte, ungelöste Fälle aufzuklären«, protestierte Decker.
»Das entscheiden nicht wir, Amos, sondern die da oben.«
»Die können uns einfach den Boden unter den Füßen wegziehen, ohne zu fragen?«
Milligan wollte lächeln, ließ es aber, als er Deckers gereizte Miene sah. »So arbeitet die Bürokratie, Amos. Wir müssen Dienstanweisungen befolgen, zumindest Ross und ich. Du und Alex, ihr könntet es euch wahrscheinlich erlauben, den Krempel hinzuschmeißen, aber meine Karriere ist mit dem FBI verbunden.« Er hielt inne. »Außerdem ändert sich ja nichts. Wir fangen noch immer die Bösen, nur dass die Bösen jetzt aktuelle Verbrechen begangen haben. Du darfst also weiterhin das tun, was du so gut kannst.«
Decker nickte, doch Milligans Worte schienen ihn nicht beschwichtigt zu haben. Wieder schaute er auf Berkshires Leiche. Augenblicklich bestürmte ihn das unheilverkündende, irisierende Blaugrün. Übelkeit stieg in ihm auf.
Wainwright warf ihm einen Blick zu. Erst jetzt bemerkte sie den Namen auf Deckers Ausweis. »He, Moment mal … Amos Decker? Sind Sie der Mann, der nichts vergisst?«
Als Decker stumm blieb, sagte Milligan rasch: »Ja, das ist er.«
»Ich habe gehört, dass Sie in den letzten Monaten ein paar alte Fälle gelöst haben. Vor allem die Melvin-Mars-Geschichte.«
»Das war das ganze Team«, sagte Milligan. »Doch ohne Decker hätten wir’s nicht geschafft.«
Mit einem Mal regte sich Decker. Er zeigte auf einen purpurnen Fleck auf Berkshires Handrücken. »Was ist das?«
»Werfen wir einen näheren Blick darauf«, meinte Wainwright. Sie griff nach einem Vergrößerungsglas an einem Schwenkarm, zog es auf die von Decker angezeigte Stelle, schaltete eine Lampe ein und richtete sie auf die Hand der Toten. »Hm. Scheint eine Art Stempel zu sein …«
Decker warf einen Blick durch die Lupe und las: »Dominion Hospice.« Er schaute zu Milligan, der bereits auf sein Tablet eintippte.
»Ich hab’s.« Milligan las vom Bildschirm ab. »Das Dominion Hospice liegt in der Nähe vom Reston Hospital. Offensichtlich kümmern sie sich dort um Kranke im Endstadium.«
Decker betrachtete Berkshires Leiche. »Der Stempel ist noch auf ihrer Hand, also war sie vermutlich heute dort. Eine Dusche hätte die Tinte abgewaschen.«
»Ob sie dort jemanden besucht hat?«, fragte Milligan.
Decker zuckte mit den Schultern. »Gut möglich. Sie war ja nicht dem Tode geweiht, bis Dabney sie erschossen hat.«
Ohne ein weiteres Wort drehte Decker sich um und verschwand aus der Leichenhalle.
Wainwright schaute mit erhobenen Brauen zu Milligan hinüber.
»Oh, so was tut er oft«, sagte Milligan. »Ich hab mich irgendwie daran gewöhnt.«
»Dann haben Sie mehr Verständnis für ein solches Verhalten als ich.« Wainwright hielt die Stryker-Säge hoch. »Wenn der Kerl mich weiterhin einfach so stehen lässt, ziehe ich ihm das Ding hier über den Schädel.«
3
Walter Dabney lag im Sterben.
Seine Brust hob und senkte sich im Rhythmus seiner unregelmäßigen, krampfhaften Atemzüge. Es schien, als wäre seine Lunge die erschöpfte Nachhut, die mühsam Schritt hielt, während sich der Geist bereits darauf vorbereitete, den Körper zu verlassen.
Alex Jamison, das einzige weibliche Mitglied in Deckers FBI-Spezialeinheit, war Ende zwanzig, hochgewachsen, schlank und hübsch, mit langem brünettem Haar. Sie saß rechts neben dem Bett auf der Intensivstation. Der andere Kollege Deckers, FBI Special Agent Ross Bogart, ein Mann Ende vierzig, dessen perfekt gekämmtes dunkles Haar von markanten grauen Strähnen durchzogen wurde, stand links von ihr, die Hand am Sicherheitsgitter des Bettes.
Dabney war an ein Gewirr von Überwachungskabeln und Schläuchen für intravenöse Medikamente angeschlossen. Sein rechtes Auge war ein leerer Krater, weil die Kugel, die er sich ins Kinn geschossen hatte, dort ausgetreten war, nachdem sie Teile seines Gehirns durchpflügt hatte. Wo seine Haut nicht angeschwollen und von Blutergüssen verunstaltet wurde, zeigte sie ein hässliches Grau. Seine Atmung ging stockend, und der Monitor ließ erkennen, dass seine Werte heftigen Schwankungen unterworfen waren.
Die Ärzte, die den ganzen Tag ein und aus gegangen waren, hatten bestätigt, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis das Hirn dem Herzen befahl, die Arbeit einzustellen. Und es gab nichts, was sie dagegen tun konnten. Die Verletzungen waren so schwer, dass kein Medikament und keine OP den Mann retten konnten. Die Mediziner dokumentierten nur noch den Countdown bis zum Tod.
Mrs. Eleanor Dabney, allgemein als Ellie bekannt, war dreißig Minuten nachdem das FBI sie informiert hatte im Krankenhaus eingetroffen. Man würde sie noch befragen müssen, doch im Augenblick war Ellie eine trauernde Witwe in spe. Derzeit hielt sie sich in dem kleinen Bad neben dem Krankenzimmer auf, wo sie sich würgend übergab; eine Krankenschwester war bei ihr.
Bogart musterte Jamison. Sie schien es zu spüren und hob den Blick.
»Haben Sie etwas von Decker gehört?«, fragte er leise.
Jamison schaute auf ihr Handy und schüttelte den Kopf. »Er wollte zu Berkshires Leiche in der Gerichtsmedizin.« Sie tippte eine SMS an Decker und schickte sie los. »Ich habe Todd eine Kopie geschickt.«
Bogart nickte. »Gut. Er wird Decker auf der richtigen Spur halten.«
Decker war eine mittlere Katastrophe, wenn es um Kommunikation ging, das wussten alle, die ihn kannten.
Bogart richtete den Blick wieder auf den Sterbenden. »Nichts in der Akte dieses Mannes deutet darauf hin, dass so etwas hätte passieren können. Und es gibt nicht die kleinste Verbindung zu Anne Berkshire.«
»Solange es keine willkürliche Tat war, muss es irgendetwas geben«, meinte Jamison. »Aber selbst das würde uns keine schlüssige Erklärung liefern, nehme ich an.«
Bogart schaute zum Monitor, auf dem die Lichtpunkte, die Herzschlag und Atmung des Sterbenden anzeigten, wie nackte Füße auf glühenden Kohlen hüpften.
»Ich fürchte, er stirbt uns weg, ohne noch ein Wort zu sagen«, murmelte er.
»Aber wenn er etwas sagt, sind wir zur Stelle«, erklärte Jamison.
Die Badezimmertür öffnete sich, und die Krankenschwester kam mit Ellie Dabney heraus. Ellie war Anfang sechzig, groß und langbeinig, mit schlanker Taille und schmalen Hüften. Ihre Züge waren attraktiv, die Wangenknochen hoch und fest, die Augen groß, die Pupillen von anziehender hellblauer Farbe. Sie trug ihr graues Haar lang und offen. Allem Anschein nach war sie in ihrer Jugend eine gute Sportlerin gewesen. Jetzt aber schien die Mutter von vier erwachsenen Töchtern mit drei Enkeln und einem sterbenden Ehemann selbst dem Jenseits nahe zu sein.
Bogart stellte ihr einen Stuhl neben das Bett, während Jamison aufstand und der Krankenschwester half, Ellie zum Bett zu führen, wo sie sich erschöpft auf den Stuhl sinken ließ.
Die Schwester überprüfte den Monitor, verzog das Gesicht und ging. Leise schloss sie die Tür hinter sich. Ellie griff durch das Bettgitter, nahm die Hand ihres Mannes und drückte die Stirn auf die Querstange des Gitters, wobei sie leise weinte.
Bogart und Jamison tauschten einen Blick.
»Mrs. Dabney«, sagte Bogart schließlich, »wir könnten dafür sorgen, dass man Ihre Kinder herbringt, sobald sie eingetroffen sind. Wie sieht es damit aus?«
Zuerst zeigte Ellie keine Reaktion; dann nickte sie stumm.
»Wissen Ihre Kinder schon Bescheid?«, fragte Bogart. »Oder sollen wir jemanden kontaktieren?«
Ellie hob den Kopf und sagte, ohne ihn anzuschauen: »Meine Tochter Jules.« Sie zog ein Handy aus der Tasche, drückte auf ein paar Tasten und hielt es Bogart so hin, dass er auf das Display schauen konnte. Bogart notierte sich die Nummer, nickte Ellie zu und verließ das Zimmer.
Jamison legte der älteren Frau eine Hand auf die Schulter. »Es tut mir sehr leid, Mrs. Dabney.«
»Hat Walter … hat er tatsächlich jemanden erschossen? Das FBI … sie behaupten …«
»Wir müssen jetzt nicht darüber reden.«
Ellie wandte Jamison ihr tränennasses Gesicht zu. »Walt kann das unmöglich getan haben. Sind Sie ganz sicher, dass nicht jemand anders auf die Frau geschossen hat? Walter könnte so etwas nicht. Er … er …« Sie verstummte und ließ die Stirn wieder auf das Gitter sinken.
Der Monitor fing an zu piepsen. Beide Frauen schreckten auf, aber das Gerät verstummte wieder.
»Wir sind uns sicher, Mrs. Dabney, dass Ihr Mann geschossen hat. Ich wünschte, ich könnte etwas anderes sagen, aber es gab Zeugen.«
Ellie putzte sich mit einem Taschentuch die Nase. »Er wird nicht wieder gesund, oder?«
»Ich fürchte, nein. Die Ärzte sind pessimistisch.«
»Ich begreife es einfach nicht. Ich wusste nicht einmal, dass Walter eine Waffe besitzt.«
Jamison musterte die ältere Frau ein paar Sekunden lang, ehe sie fragte: »Ist Ihnen in letzter Zeit eine Veränderung im Verhalten Ihres Mannes aufgefallen?«
»Inwiefern?«, fragte Ellie abwesend.
»War er launisch? Hatte er berufliche Sorgen? Hat sein Appetit sich verändert? Hat er mehr getrunken als üblich? Gab es Anzeichen von Depressionen?«
Ellie lehnte sich gegen die Stuhllehne, zerknüllte das Taschentuch, starrte in ihren Schoß und schwieg.
Die plötzliche Stille war bedrückend, denn auf der Intensivstation herrschte eine unheilvolle Anspannung, als würde nur das plötzliche warnende Kreischen eines Monitors die Lebenden von den Toten trennen.
Draußen vor dem Zimmer waren Schritte zu hören; hin und wieder rannte jemand über den Flur, als irgendwo ein Monitor Alarm schlug; aus einem Lautsprecher kam blechern eine Durchsage, untermalt vom surrenden Geräusch der Hartgummiräder, als Apparate und Patienten durch die Flure gerollt wurden. Die Luft roch antiseptisch wie in allen Krankenhäusern und war unangenehm kühl.
Schließlich sagte Ellie: »Walt hat zu Hause nicht über die Geschäfte gesprochen. Er hat auch so gut wie nie getrunken … nur bei Geschäftsessen, Veranstaltungen und dergleichen. Ich habe ihn öfters begleitet. Natürlich trank er schon mal ein Gläschen, aber immer nur genug, um gesellig zu sein, Abschlüsse zu tätigen, Kontakte zu knüpfen. Sie wissen schon.«
»Verstehe. Gab es finanzielle Sorgen?«
»Nicht dass ich wüsste, obwohl … Walter hat sich um das Geld gekümmert. Aber bei uns standen nie Schuldeneintreiber vor der Tür, wenn Sie das meinen.«
»Litt er unter Stimmungsschwankungen?«
Ellie tupfte sich die Augen ab, blickte auf ihren sterbenden Ehemann und schaute schnell wieder weg. Sie zögerte; es schien ihr unangenehm zu sein, einer Fremden etwas über ihren Mann anzuvertrauen. »Er arbeitete hart, und wenn das Geschäft gut lief, war er glücklich. Lief es schlecht, war er deprimiert, wie jeder andere.«
»Also gab es nichts Außergewöhnliches?«
Ellie ballte das Taschentuch noch fester zusammen und warf es in den Papierkorb. Die Bewegung hatte etwas Endgültiges.
Jamison wartete geduldig. Die Zusammenarbeit mit Amos Decker hatte sie vor allem eines gelehrt: Geduld.
»Vor ungefähr einem Monat war er verreist«, sagte Ellie schließlich.
»Wohin?«
»Er hat es mir nicht gesagt. Das war ja das Ungewöhnliche. Sonst hat er mich immer ins Vertrauen gezogen.«
»Wie lange war er weg?«
»Etwa vier Tage. Könnte auch länger gewesen sein. Walt war wegen irgendeiner Sache in New York, ist dann aber von da aus weitergereist. Er rief mich an und sagte, es hätte sich etwas Unerwartetes ergeben, um das er sich kümmern müsse, und er wisse nicht genau, wie lange er wegbleiben würde.«
»Hat er ein Flugzeug genommen? Den Zug? War er im Ausland?«
»Ich weiß es nicht. Er sagte nur, es gehe um einen möglichen Kunden. Er müsse irgendetwas aus der Welt schaffen. Aber wie Walter es darstellte, schien die Sache nicht von großer Bedeutung zu sein. Vermutlich hat sein Büro sich um die Reisevorbereitungen gekümmert.«
»Nach seiner Rückkehr hat er nichts über die Reise erzählt?«
»Nichts. Ich nehme an, es war geschäftlich. Aber von diesem Tag an war etwas … ich weiß nicht … irgendetwas war anders.«
»Wann war das, sagten Sie?«
»Vor ungefähr einem Monat.«
»Ihr Mann besitzt eine Firma, die Regierungsaufträge übernimmt?«
Ellie nickte. »Dabney and Associates. Die Firma hat ihren Sitz in Reston. Ihre Arbeit unterliegt größtenteils der Geheimhaltung. Am Anfang war mein Mann allein, aber jetzt arbeiten dort ungefähr siebzig Angestellte. Walter hat Partner, aber er ist der CEO und besitzt die Kontrollmehrheit.« Ihre Augen weiteten sich. »Mein Gott … vermutlich besitze ich sie jetzt!« Sie warf Jamison einen beinahe panischen Blick zu. »Bedeutet das, ich muss jetzt die Geschäfte übernehmen? Aber … ich verstehe nichts davon. Ich habe nicht mal eine Sicherheitsfreigabe.«
Jamison nahm die Hand der Frau. »Ich glaube nicht, dass Sie sich derzeit über derartige Dinge Sorgen machen müssen, Mrs. Dabney.«
Ellie entspannte sich und konzentrierte sich wieder auf ihren Mann. »Wie hieß diese Person noch mal? Diese Frau, die Walter angeblich … Man hat mir den Namen gesagt, aber ich erinnere mich nicht. Im Augenblick ist alles verschwommen.«
»Anne Berkshire. Sie war Aushilfslehrerin an einer katholischen Highschool in Fairfax. Kennen Sie die Frau?«
Ellie schüttelte den Kopf. »Nie von ihr gehört. Und ich wüsste nicht, warum Walter sie kennen sollte. Eine Highschool-Lehrerin? Walt und ich haben unsere Kinder ziemlich früh bekommen. Jules, unsere Älteste, ist siebenunddreißig. Und unser ältestes Enkelkind ist auch schon in der ersten Klasse. Außerdem wohnt es nicht mal in Virginia. Und wir sind nicht katholisch, sondern Presbyterianer.«
»Danke für diese Informationen. Sie waren sehr hilfreich.«
»Brauche ich einen Anwalt?«, fragte Ellie geradeheraus.
Jamison blickte unbehaglich drein. »Da bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Falls Sie oder Ihr Mann einen Anwalt beschäftigt haben oder kennen, sollten Sie lieber den fragen.«
Ellie nickte wie betäubt, griff durch das Bettgitter und packte wieder die Hand ihres Mannes.
Kurz darauf kam Bogart zurück ins Zimmer. »Es ist für alles gesorgt, Mrs. Dabney. Ihre Tochter sagte mir, dass heute Abend alle da sind. Bis auf Natalie.«
»Natalie wohnt in Paris. Ich habe versucht, sie zu erreichen, aber es hat sich niemand gemeldet. Und was ich ihr sagen wollte, konnte ich ihr unmöglich auf die Voicemail sprechen.«
»Ihre Tochter Jules hat sie erreicht und ihr alles erklärt. Natalie versucht, so schnell wie möglich einen Flug zu bekommen.«
»Ich kann nicht glauben, dass das alles wirklich geschieht«, sagte Ellie leise. »Als Walt heute Morgen das Haus verließ, war die Welt noch in Ordnung. Und jetzt …« Sie schaute zu Jamison und Bogart. »Alles ist zerstört. Einfach so.«
Einfach so, dachte Jamison.
4
Sie fuhren von einem Ort der Toten zu einem Ort der Sterbenden.
Nachdem Decker und Milligan sich am Empfang vorgestellt hatten, waren sie an die Leiterin des Dominion Hospice verwiesen worden. Sally Palmer war geschockt, als sie von Anne Berkshires Tod erfuhr.
»Mein Gott, sie war heute Morgen noch hier!« Palmer saß hinter dem Schreibtisch in ihrem kleinen, beengten Büro.
»Das hatten wir bereits vermutet«, sagte Decker. »Deshalb sind wir gekommen. Der Name dieses Hospizes war auf Mrs. Berkshires Hand gestempelt.«
»Ja, das gehört zu unseren Sicherheitsmaßnahmen.«
»Sind hier viele Sicherheitsmaßnahmen erforderlich?«, wollte Milligan wissen.
Palmer nickte. »Unsere Patienten bekommen starke Medikamente. Sie können sich nicht selbst verteidigen. Das ist unsere Aufgabe, und wir nehmen sie sehr ernst. Alle Besucher müssen durch den Vordereingang. Der Handstempel ist leicht zu sehen, und wir wechseln jeden Tag die Farbe. Auf diese Weise weiß unser Personal sofort, ob der Besucher hier sein darf.«
»Ist einer von Mrs. Berkshires Familienangehörigen Patient bei Ihnen? War sie deshalb heute Morgen bei Ihnen?«, fragte Decker.
»Nein. Anne war freiwillige Helferin. Sie hat verschiedenen Patienten Gesellschaft geleistet. Oft wohnen die Familien nicht in der unmittelbaren Umgebung, deshalb sind Besuche von ihnen selten. Und da kommen unsere Freiwilligen ins Spiel, die natürlich sorgfältig ausgesucht werden. Sie kommen her und reden mit den Patienten, lesen ihnen vor oder leisten ihnen einfach nur Gesellschaft. Sterben ist nicht leicht, und allein zu sterben erst recht nicht.«
»Mit wem hat Mrs. Berkshire heute gesprochen?«, fragte Milligan.
»Das kann ich herausfinden. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick.«
Palmer stand auf und verließ ihr Büro.
Milligan holte sein Handy hervor und checkte die Nachrichten. »Dabneys Frau ist bei ihrem Mann im Krankenhaus. Jamison schreibt, dass er das Bewusstsein nicht wiedererlangt hat und dass es wohl auch nie mehr der Fall sein wird.«
»Konnte Dabneys Frau irgendwelche Informationen geben?«
»Sie kannte Anne Berkshire nicht und war sich ziemlich sicher, dass sie ihrem Mann ebenfalls unbekannt war. Sie weiß auch nichts über die Geschäfte ihres Mannes und hatte keine Ahnung, warum er auf Berkshire geschossen hat. Aber sie sagte, ihr Mann habe vor einem Monat eine Reise mit unbekanntem Ziel gemacht und sei nach der Rückkehr verändert gewesen.«
»Inwiefern?«
»Seine Stimmung war gedrückt. Und er wollte ihr nicht sagen, wohin er gereist war.«
»Verstehe.«
Milligan schaute sich in dem kleinen Büro um. »Glaubst du wirklich, wir finden hier eine Spur?«
»Viele Menschen werden von Wildfremden getötet, aber die meisten Opfer kannten ihren Mörder.«
»Ein tröstlicher Gedanke«, sagte Milligan missmutig.
Die Männer schwiegen, bis Palmer ein paar Minuten später zurückkehrte.
»Annie war früh am Morgen bei drei Patienten. Dorothy Vitters, Joey Scott und Albert Drews.«
»Hat sie diese drei auch sonst besucht?«, fragte Decker.
»Ja.«
»Sie sagten, Mrs. Berkshire sei heute früh da gewesen. War das ihre übliche Zeit?«
»Eigentlich nicht. Normalerweise kam sie gegen Mittag. Unsere Patienten sind dann in der Regel ein bisschen ansprechbarer.«
»Können wir mit den Patienten reden?«
Die Direktorin starrte ihn entsetzt an. »Ich wüsste nicht, was sie Ihnen sagen sollten. Sie sind sehr krank. Und schwach.«
Decker erhob sich. »Das ist mir klar, aber Mrs. Berkshire wurde heute Morgen kaltblütig erschossen, und es ist unser Job, diesen Mord aufzuklären. Falls Anne, wie Sie sagen, zu einer für sie ungewöhnlichen Zeit hier war, bevor sie in die Stadt fuhr und ermordet wurde, ist das eine mögliche Spur, der wir nachgehen müssen. Ich hoffe, Sie verstehen das.«
»Wir werden so diskret wie möglich vorgehen«, fügte Milligan hinzu.
»Müssen Sie den Patienten denn sagen, dass Anne ermordet wurde? Das würde sie schrecklich aufregen.«
»Wir werden unser Bestes tun, jede Aufregung zu vermeiden«, versicherte Milligan.
Decker schwieg. Sein Blick war bereits auf den Flur gerichtet.
Dorothy Vitters war Ende achtzig und lag zerbrechlich und eingefallen in dem letzten Bett, in dem sie auf Erden liegen würde. Wegen des Patientengeheimnisses hatte Palmer die beiden Agenten nicht darüber informiert, unter welcher Krankheit Mrs. Vitters litt. Sie ließ die beiden Männer an der Tür zurück und verschwand wieder in ihrem Büro.
Decker blieb an der Türschwelle stehen und sah sich in dem kleinen, spärlich möblierten Zimmer um.
»Alles in Ordnung?«, fragte Milligan mit leiser Stimme.
Doch bei Decker war nichts in Ordnung, gar nichts.
Denn diesmal sah er nicht das irisierende Blaugrün, das er mit dem Tod assoziierte, sondern ein tiefes, beinahe schwarzes Marineblau. Das war neu für ihn. Doch als er dann die todkranke Frau sah, erkannte er den Grund dafür. Anscheinend nahm sein Verstand den nahenden Tod bei jedem Individuum durch eine andere Blauschattierung wahr.
Mein demoliertes Gehirn hat doch immer wieder nette Überraschungen für mich.
Er wollte nicht hier sein, wenn Vitters starb, denn er wollte nicht erleben, wie aus dem Marineblau plötzlich das alarmierende Blaugrün wurde.
»Mir geht’s gut«, sagte er schließlich.
Er betrat das Zimmer, nahm sich einen Stuhl und setzte sich ans Bett. Milligan blieb neben ihm stehen.
»Mrs. Vitters, ich bin Amos Decker, und das ist Todd Milligan. Wir sind gekommen, um mit Ihnen über Anne Berkshire zu sprechen. Soviel wir wissen, hat Anne Sie heute Morgen besucht …«
Dorothy Vitters richtete ihre tief in den Höhlen liegenden Augen auf die Männer. Ihre Haut war hellgrau, ihr Atem ging flach. In der Nähe ihres Schlüsselbeins lag ein Zugang für die schmerzstillenden Medikamente.
»Anne war da«, sagte sie schleppend. »Ich war überrascht, weil sie früher als gewöhnlich kam.«
»Wissen Sie noch, worüber Sie gesprochen haben?«
»Wer sind Sie?«
Decker wollte der alten Dame seinen Ausweis zeigen, doch Milligan hinderte ihn mit einer raschen Bewegung daran. »Wir sind Freunde von Anne«, sagte er. »Sie hat uns gebeten, bei Ihnen vorbeizuschauen, weil sie es nicht schafft, heute noch einmal zu Ihnen zu kommen.«
Die wässrigen Augen blickten alarmiert. »Ist alles in Ordnung mit ihr? Sie ist doch nicht krank?«
»Sie hat keine Schmerzen«, antwortete Decker wahrheitsgemäß. Er verließ sich darauf, dass die Medikamente, unter denen die alte Dame stand, deren Verstand trübten; anderenfalls hätte Mrs. Vitters klar sein müssen, dass nichts von dem, was ihre Besucher sagten, irgendeinen Sinn ergab.
»Ach, es war das Übliche«, sagte die alte Frau. »Das Wetter … ein Buch, das sie las und von dem sie mir erzählt hat … und meine Katze.«
»Ihre Katze?«, fragte Milligan.
»Sunny ist tot. Ach, das muss mindestens zehn Jahre her sein. Aber Anne mochte Katzen.«
»War sonst noch etwas?«, wollte Decker wissen.
»Nein, ich kann mich nicht erinnern. So lange war sie auch gar nicht hier.«
»War Anne anders als sonst? Oder wie immer?«
Mrs. Vitters’ Stimme wurde härter, artikulierter. »Sind Sie sicher, dass es Anne gut geht? Warum sind Sie hier und stellen alle diese Fragen? Ich mag ja im Sterben liegen, aber ich bin nicht dumm.«
Decker sah ein stählernes Funkeln in den wässrigen Augen, das sofort wieder erlosch.
»Wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, Anne ist …«
Milligan unterbrach ihn: »Wir wissen, dass Sie keineswegs dumm sind, Mrs. Vitters. Anne ist heute hingefallen und hat sich den Kopf angeschlagen. Sie kommt wieder ganz in Ordnung, ist aber ziemlich durcheinander. Sie kann sich nicht mal an die Zugangscodes von ihrem Handy, der Alarmanlage in ihrer Wohnung und ihrem Computer erinnern. Deshalb hat sie uns hergeschickt. Wir sollen herausfinden, worüber sie mit Ihnen gesprochen hat, damit wir es ihr erzählen können. Die Ärzte meinen, das könnte Annes Erinnerung wieder auf Trab bringen.«
Mrs. Vitters schien erleichtert. »Ach so … ja, gut. Tut mir leid, dass Anne hingefallen ist.«
Decker warf Milligan einen raschen Blick zu, bevor er sich wieder an die alte Dame wandte. »Jedenfalls … wir sind für jede Information dankbar, die Sie uns geben könnten.«
»Wie schon gesagt, wir haben nicht viel gesprochen. Allerdings … Anne schien mit den Gedanken woanders zu sein. Normalerweise geht das Gespräch von ihr aus, aber heute musste ich sie mehrmals ansprechen.«
»Haben Sie Anne gefragt, ob etwas nicht in Ordnung ist?«
»Ja. Anne sagte, es gäbe da etwas, das sie beschäftigt, aber sie hat nicht gesagt, um was es sich handelt.«
»Hatte Anne heute noch andere Patienten besucht, bevor sie zu Ihnen kam?«
»Ich glaube, ich war die Letzte. Anne sagte allerdings, sie müsse noch irgendwohin, als sie gegangen ist.«
»Hat sie gesagt, wohin?«
»Nein.«
Decker stand auf und wandte sich zum Gehen.
Milligan sagte hastig: »Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mrs. Vitters. Können wir irgendetwas für Sie tun?«
Die alte Dame lächelte grimmig. »Legen Sie bei dem Mann da oben ein gutes Wort für mich ein.«
Als sie gingen, raunte Milligan Decker zu: »Du musst mit diesen Leuten behutsamer umgehen, okay? Sie liegen im Sterben.«
Er ging an Decker vorbei, der sich noch einmal umdrehte und zu Dorothy Vitters blickte. Sie hatte jetzt die Augen geschlossen. Decker ging zurück zu der alten Dame und schaute auf sie hinunter. Das ruhige Marineblau vor seinen Augen verwandelte sich immer wieder für Sekundenbruchteile in schimmerndes Blaugrün. Decker glaubte nicht, den Tod eines Menschen vorhersehen zu können, aber sein Verstand vollzog bei dieser todkranken Frau offensichtlich den logischen Sprung.
Er beugte sich vor und richtete das Kopfkissen der alten Dame, damit sie bequemer lag. Seine Hand strich über das weiße Haar, und leise sagte er: »Es tut mir leid, Mrs. Vitters.«
Er bemerkte nicht, dass Todd Milligan ihn von der Tür aus beobachtete.
Milligan eilte davon, bevor Decker sich umdrehte.
5
Joey Scott war ein noch traurigerer Fall als Dorothy Vitters.
Decker und Milligan standen zusammen mit Sally Palmer, der Direktorin, an der Tür des Zimmers. Scott war gerade einmal zehn Jahre alt, aber sein kurzes Leben näherte sich dem Ende.
Palmer, die sie hergeführt hatte, verzichtete nach den mitleidvollen Blicken der beiden Männer auf das Patientengeheimnis. »Leukämie«, sagte sie. »Die Art, die man nicht behandeln kann.«
»Warum hat Anne Berkshire ihn besucht?«, fragte Milligan schließlich. »Kommen seine Eltern nicht?«
Palmer reagierte gereizt. »Er sollte adoptiert werden, nachdem er aus dem Waisenhaus rausgekommen war. Als er krank wurde, haben seine sogenannten Adoptiveltern einen Rückzieher gemacht.« Angewidert fügte sie hinzu: »Vermutlich wollten sie ein gesundes Exemplar. Anne hat den Jungen mindestens zweimal die Woche besucht. Sie war alles, was Joey hatte.«
Abrupt drehte Palmer sich auf dem Absatz um und ging, einen Ausdruck der Verzweiflung auf dem Gesicht.
Decker betrachtete den kleinen Jungen, der im Bett lag, und seine Gedanken wanderten zurück zu der Tochter, die er gehabt hatte. Molly war vor ihrem zehnten Geburtstag ermordet worden. Decker hatte ihre Leiche und die seiner Frau in seinem alten Haus gefunden. Und dank seiner Hyperthymesie würde er sich nun für alle Ewigkeit an jedes Detail dieser Tragödie erinnern, als wäre sie eben erst geschehen.
Decker wusste, ihm konnte nichts Schlimmeres mehr zustoßen. Nichts könnte schrecklicher und deprimierender sein, als seine Familie ermordet aufzufinden. Aber was er nun vor sich hatte, kam dem schon sehr nahe.
Er setzte sich neben den Jungen, der langsam die Augen öffnete. Sein eingefallener Körper war mit Überwachungskabeln und intravenösen Zugängen übersät.
»Hallo, Joey, ich bin Amos«, sagte Decker. »Das ist mein Freund Todd.«
Joey hob eine Hand und winkte schwach.
»Wie ich hörte, war deine Freundin Anne heute hier.«
Joey nickte.
»Habt ihr euch nett unterhalten?«
»Sie hat mir vorgelesen«, sagte Joey mit leiser Stimme.
»Ein Buch?«
Er nickte. »Harry Potter und der Gefangene von Askaban. Es steht da im Regal. Sie sagte, sie kommt morgen wieder und liest mir den Rest vor.«
Decker griff nach dem Buch und blätterte darin, bis er zu dem Lesezeichen ungefähr zehn Seiten vor Schluss kam. »Das ist toll. Hat sie nur gelesen? Oder hat sie sonst auch noch was getan?«
Joey schüttelte den Kopf. »Wir haben uns nur noch ein bisschen unterhalten.«
»Worüber?«
»Sind Sie Freunde von Anne?«
»Ich bin ihr heute Morgen begegnet«, sagte Decker. »Sie ist der Grund, weshalb wir dich besuchen. Sie wollte, dass wir ihre Freunde hier kennenlernen.«
»Oh … okay.«
»Wie lange bist du schon hier, Joey?«, fragte Milligan.
Der Junge sah ihn blinzelnd an. »Weiß ich nicht.«
Milligan trat einen Schritt zurück, stützte sich mit einer Hand an der Wand ab und schaute Decker hilflos an.
»Weißt du noch, worüber du mit Anne gesprochen hast?«, fragte Decker weiter. »Über das Buch?«
»Sie hat mich gefragt, ob ich den Sonnenaufgang gesehen habe.«
Decker richtete den Blick auf das große Fenster, das nach Osten zeigte. Langsam wandte er sich wieder Joey zu. »Und? Hast du?«
Joey nickte. »Ja. Es war schön.«
»Als ich noch ein Kind war, bin ich immer ganz früh aufgestanden und hab mir auch den Sonnenaufgang angeschaut«, fuhr Decker fort, worauf Milligan ihm einen erstaunten Blick zuwarf. »Ich bin in Ohio groß geworden, deshalb ging die Sonne später auf als hier.«
Auf dem Nachttisch neben dem Bett stand ein gerahmtes Foto. Decker hob es hoch. Es war ein Bild des Footballstars Peyton Manning.
»Bist du ein Fan von Peyton?«
Joey nickte. »Ich hab viel Football gesehen.Bevor ich krank wurde, hab ich sogar gespielt.« Sein Blick schweifte über Deckers massigen Körper. »Sie sehen wie ein Footballspieler aus. Vielleicht wäre ich auch so groß geworden wie Sie.«
Milligan rieb sich die Augen, fasste sich aber wieder. »Amos hat in der NFL gespielt, Joey«, sagte er. »Für die Cleveland Browns.«
Die Augen des kleinen Jungen wurden groß, und die Andeutung eines Lächelns erschien auf seinen müden Zügen. »Echt?«
Decker nickte. »Meine Karriere war allerdings kurz und ziemlich schmerzhaft.« Er stellte das Foto zurück. »Vor meiner Zeit in Cleveland hab ich bei den Ohio State Buckeyes gespielt. War ’ne tolle Zeit. Ein paar der schönsten Jahre meines Lebens.«
»Wow«, sagte Joey. »Kennen Sie Peyton Manning?«
»Nein, aber Peyton war einer der Größten.« Decker lehnte sich zurück. »Hast du dich mit Anne noch über etwas anderes unterhalten?«
Das Lächeln verblich. »Eigentlich nicht.«
»Hat sie dir erzählt, wohin sie wollte, als sie gegangen ist?«
Joey schüttelte den Kopf.
Decker stand auf. »Danke, Joey, du warst uns eine große Hilfe.«
»Gern geschehen.«
Milligan blickte auf den Jungen hinunter. »Wie wär’s, wenn ich dich noch mal besuche?«
»Klar. Vielleicht können Sie mit Anne zusammen kommen.«
»Mal sehen.« Milligan zog eine Visitenkarte aus der Tasche und legte sie neben das Foto von Peyton Manning auf den Nachttisch. »Wenn du etwas brauchst, sag den Leuten hier, sie sollen mich unter dieser Nummer anrufen, okay?«
»Okay.«
»Nochmals vielen Dank.«
Joey sah Decker an. »Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Ich hab noch nie einen echten NFL-Spieler gesehen.«
Decker nahm langsam die Hand des kleinen Jungen. Es sah aus, als würde ein Wal einen kleinen Fisch verschlingen.
»War mir eine Ehre, dich kennenzulernen, Joey.« Decker stellte das Buch zurück ins Regal und verließ das Zimmer.
Milligan folgte ihm.
»Scheiße, Mann«, sagte der FBI-Agent mit rauer Stimme. »Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder lächeln kann.«
»Das wirst du«, meinte Decker. »Aber wenn du wieder mal glaubst, die Dinge stünden schlecht für dich, dann denk an Joey, und alles sieht viel besser aus.«
Albert Drews war in den Vierzigern und erzählte jedem ungefragt, dass sein Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium sei. Drews war blass und dünn; seine Haut wirkte brüchig und gelb.
»Als sich die ersten Symptome gezeigt haben, war es schon zu spät, verdammt«, schimpfte er, nachdem die Agenten sich vorgestellt und ihre Ausweise gezeigt hatten. »Die Chemo, die Bestrahlung … das alles hat mich ganz schön fertiggemacht. Wenigstens hatte sich mein Zustand gebessert, aber nur ungefähr zwei Monate, dann kam die Scheiße zurück wie ein Hurrikan, und diesmal war’s das.«
Er verstummte und atmete plötzlich schwer, als hätten die paar Worteihn erschöpft. Nachdem er wieder zu Atem gekommen war, fuhr er fort: »Sie haben Glück, mich jetzt zu erwischen. Sobald die Schmerzmittel wirken, bin ich total weggetreten. Morphium. Ich weiß nicht, was ich ohne das Zeug machen würde. Die Schmerzen … sind verdammt beschissen«, fügte er resigniert hinzu.
»Es tut mir wirklich leid, Sie stören zu müssen, Mr. Drews«, sagte Decker.
Drews winkte ab. »Es ist ja nicht so, als hätte ich was anderes zu tun, als hier zu liegen und auf den Abgang zu warten.«
»Anne Berkshire hat Sie heute besucht, nicht wahr?«
»Ja, heute Morgen. Warum?«
Decker beschloss, dem Mann die Wahrheit zu sagen. »Sie wurde heute Morgen erschossen. In Washington. Kurz nach ihrem Besuch.«
»Was?« Drews stemmte sich auf den Ellbogen hoch und fing an zu husten. Milligan schenkte ihm aus einer Karaffe auf dem Nachttisch ein Glas Wasser ein und half ihm beim Trinken. Ehe er mit dem leeren Glas zurücktrat, warf er Decker einen vorwurfsvollen Blick zu.
Als Drews sich halbwegs beruhigt hatte, blickte er die beiden Agenten hilflos an. »Anne … erschossen?«, fragte er mit matter Stimme. »Wie? Warum?«
»Den Grund kennen wir nicht. Deshalb sind wir hier.«
»Aber ich weiß nichts.«
»Sie könnten mehr wissen, als Sie ahnen«, sagte Decker. »Worüber haben Sie und Anne sich heute unterhalten?«
Drews konzentrierte sich, runzelte die Stirn. »Sie war eine nette Lady. Besucht mich seit ungefähr vier Wochen. Wir haben uns über alles Mögliche unterhalten. Nichts Besonderes. Nichts Wichtiges. Einfach nur, um die Zeit zu vertreiben, um mich … von meiner Situation abzulenken.«
»Hat sie von sich erzählt?«
»Manchmal. Sie ist Lehrerin, hat sie gesagt. Ledig. Keine Kinder.«
»Was haben Sie gemacht, bevor Sie erkrankt sind?«, wollte Milligan wissen.
»Ich war Softwareingenieur bei einer Firma hier in der Nähe.« Drews schloss die Augen, atmete tief ein.
»Alles okay?«, fragte Milligan.
Drews schlug die Augen auf. »Nein! Gar nichts ist okay!«, fauchte er. »Ich bin unheilbar krank! Ich sterbe!«
»Tut mir leid, Mr. Drews, das habe ich nicht gemeint. Tut mir ehrlich leid«, sagte Milligan zerknirscht.
»Haben Sie sich mit Mrs. Berkshire je über Ihre Arbeit unterhalten?«, fragte Decker.
»Nein. Wozu?«
»Nur so.«
»Nein. Außerdem scheint das ein ganzes Leben her zu sein. Ich kann mich kaum erinnern.«
»Sie sind unverheiratet, nicht wahr?«
»Woher wissen Sie das?«
»Kein Ring am Finger. Und keine Abdrücke, die erkennen ließen, dass dort mal ein Ring gesteckt hat.«
Drews schwieg. Dann sagte er resigniert: »Liegt wohl daran, dass ich nie die richtige Frau kennengelernt habe.«
»Leben Ihre Eltern noch?«
Drews schüttelte den Kopf. »Ich habe nur noch einen Bruder, aber der lebt in Australien. Als ich krank wurde, kam er zu Besuch und blieb ’ne Weile. Aber er musste zurück. Er hat fünf Kinder.« Drews hielt inne. »Er kommt zur Beerdigung. Er ist mein Testamentsvollstrecker. Ich werde verbrannt, das macht es für alle einfacher.«
Drews’ Lippen zitterten. Für einen Moment schloss er die Augen, öffnete sie wieder und seufzte. »Ich hätte nie gedacht, so offen über den eigenen Tod sprechen zu können. Aber wenn man keine Wahl hat, tut man’s einfach.«
»Was sagen die Ärzte?«, fragte Decker.
Drews schüttelte den Kopf. »An manchen Tagen fühlt es sich an, als wäre es so weit. An manchen Tagen hoffe ich, dass es so weit ist.«
»Tut uns leid, Sie gestört zu haben, Mr. Drews. Vielen Dank für Ihre Hilfe.«
Als Decker aufstand, streckte Drews die Hand aus und ergriff Deckers Finger. Die Haut des Mannes fühlte sich eiskalt an.
»Anne war wirklich nett. Ich meine … Sie hätte ja nicht herkommen brauchen und tun, was sie getan hat, aber sie wollte es. Ich hoffe, Sie finden den, der’s getan hat.«
»Wir haben ihn bereits gefunden, Mr. Drews«, sagte Decker. »Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, warum er es getan hat.«
6
»Eine Aushilfslehrerin?«, sagte Decker.
Er schaute sich in Anne Berkshires Eigentumswohnung in der obersten Etage eines Luxusgebäudes um, das in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Upperclass-Viertel namens Reston Town Center lag.
Milligan nickte. »So stand es in ihrer Akte.«
»Nicht übel. Du kennst dich in dieser Gegend besser aus als ich, Todd. Was glaubst du, was so eine Wohnung kostet?«
Milligan blickte sich um. Es gab getönte Fenster, hohe Decken, Parkettboden – alles in allem zweihundertachtzig Quadratmeter erstklassig ausgestatteter Wohnraum in bester Lage mit Panoramablick, Whirlpool und einem großen abgeschirmten Balkon.
»Zwei Millionen. Eher mehr.«
»Und der Hausverwaltung zufolge hatte Berkshire einen Mercedes SL 600, der in der Tiefgarage parkt.«
»Der kostet mehr als hundert Riesen«, sagte Milligan.
»Hat sie geerbt?«
»Keine Ahnung. Das müssen wir checken.«
»Wie lange war sie Lehrerin?«
»Aushilfslehrerin war sie seit vier Jahren.«
»Und davor?«
»Hat sie drei Jahre in Atlanta gelebt.«
»Was hat sie da gemacht?«
»Haben wir nicht rausfinden können. Nur eine Adresse.«
»Und davor?«
»War sie in Seattle.«
»Und da gab es auch keinen Job?«
»Wir konnten nichts finden.«
»Und vor Seattle?«
»Keine Ahnung. Wir haben nichts weiter über sie herausgefunden.«
»Wie weit geht ihre Akte zurück?«
»Ungefähr zehn Jahre, wenn man alles zusammenrechnet.«
»Anne war fast sechzig. Das wären dann ihre späten Vierziger gewesen. Was ist mit der Zeit davor? Was hat sie mit dreißig gemacht?«
»Wir konnten nichts finden. Ich muss aber dazu sagen, dass wir noch nicht viel Zeit hatten, tiefer zu graben. Es wird schon noch was auftauchen. Sicher auch eine Erklärung für das Geld. Vielleicht wurde sie bei einem Unfall verletzt und bekam eine fette Abfindung. Oder es war eine Klage wegen eines ärztlichen Kunstfehlers. Zum Teufel, sie könnte sogar im Lotto gewonnen haben.«
Decker schien nicht überzeugt.
»Sie ist sehr ordentlich«, bemerkte Milligan.
»Ich glaube, das richtige Wort ist ›minimalistisch‹«, meinte Decker und ließ den Blick über die spärliche Möblierung schweifen. Er betrat das Hauptschlafzimmer und schaute in die begehbaren Wandschränke.
»Vier Paar Schuhe, ein paar Handtaschen. Schmuck kann ich nicht entdecken. Ich sehe auch nicht, wo ein Safe sein könnte.« Er warf Milligan einen Blick zu. »Wir waren wirklich nicht reich, aber meine Frau hatte mindestens zehn Paar Schuhe und genauso viele Handtaschen. Und ein bisschen Schmuck.«
Milligan nickte. »Genau wie meine Angetraute. Glaubst du, Berkshire tanzt irgendwie aus der Reihe? Oder geht es hier um was ganz anderes?«
Decker zuckte die Achsel. »Gute Frage. Ich habe hier kein einziges Foto entdeckt. Jedenfalls keines von ihr. Auch nicht von Freunden oder Familie. Nichts. Es sieht hier aus wie in einer Vorführwohnung. Ich wette, Berkshire hat dieses Apartment möbliert gekauft, und dass es hier nichts gibt, das sie mitgebracht hat.«
»Was sagt uns das?«
»Dass sie vielleicht nicht diejenige war, die sie zu sein schien.«
»Ob Dabney sie gekannt hat?«
»Möglich. Hat sich bestätigt, dass sie ins FBI-Gebäude wollte? Das war nämlich bloß ’ne Vermutung von mir, weil sie sich in der Nähe aufgehalten hatte. Aber jetzt brauchen wir mehr als Vermutungen.«
»Wir konnten bestätigen, dass sie keinen Termin im Hoover Building hatte. Und Besucher, die sich das Gebäude einfach nur ansehen wollen, müssen vorher einen Antrag stellen, damit das FBI ihren Hintergrund überprüfen kann. Es gibt aber keine Unterlagen, dass Berkshire einen Antrag eingereicht hätte.«
Decker setzte sich aufs Bett und ließ den Blick durch das Zimmer schweifen. »Sie verlässt die Wohnung, geht zum Hospiz, anschließend in die Innenstadt. Sie hatte eine U-Bahn-Karte in der Brieftasche, der zufolge sie zehn Minuten vor ihrem Tod an der Metrostation Federal Triangle ausgestiegen ist.«
»Ja. Auf einer der Überwachungskameras ist zu sehen, wie sie die Station verlässt.«
»Und dann knallt Dabney sie über den Haufen.«
Milligan runzelte die Stirn. »Wie konnte er wissen, um welche Zeit Anne wo sein würde? Oder dass sie überhaupt dort sein würde?«
»Vielleicht war er der Grund, weshalb sie dort war«, meinte Decker.
»Du meinst, er hat sie gebeten, ihn vor dem FBI-Gebäude zu treffen?«
»Könnte doch sein?«
»Wir überprüfen Telefon, E-Mail, SMS, Fax und alle anderen Kommunikationsportale, um festzustellen, ob wir eine Verbindung finden.«
»Vielleicht haben sie sich mündlich verabredet. Dann können wir auch keine Aufzeichnungen finden. Falls Dabney es nicht irgendwie arrangiert hat, dass Berkshire zum Hoover Building kommt, ergeben nur zwei andere Erklärungen Sinn. Entweder wusste er aus irgendeiner Quelle, dass Berkshire dort sein würde …«
»Oder es war Zufall«, vollendete Milligan den Satz. »Und er hätte ebenso gut jemand anderen als Berkshire töten können.«
»Aber wieso? Warum grundlos eine wildfremde Frau erschießen? Dafür gibt es keine Erklärung, es sei denn, der Kerl ist verrückt.«
Milligan schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Ahnung.«
Decker stand vom Bett auf und hielt Wagenschlüssel in die Höhe. »Die gehören zum Mercedes. Sie lagen in einer Schublade im Schrank. Sehen wir uns den Wagen an.«
Anne Berkshires Mercedes war ein silbernes Cabriolet, das auf einem der begehrten Plätze neben den Fahrstühlen stand. Decker öffnete den Wagen mit der Fernbedienung. Milligan begann mit der Durchsuchung, denn das Wageninnere war für den stämmigen Decker zu beengt, als dass er sich ausreichend hätte bewegen können.
Milligan reichte ihm ein paar Gegenstände, die er im Handschuhfach entdeckte, und führte die Suche dann weiter. Fünf Minuten später stieg er aus und schüttelte den Kopf. »Nichts. Der Wagen riecht, als käme er frisch vom Autohändler.«
Decker hielt einen Umschlag hoch, den Milligan ihm gegeben hatte. »Laut Zulassung ist er gerade mal drei Jahre alt. Schau mal nach dem Kilometerstand.«
Milligan tat wie geheißen. »Fünftausend Meilen.«
»Also hat sie den Wagen kaum gefahren. Wie ist sie zur Arbeit gekommen? Öffentlicher Nahverkehr?«
»Es gibt keinen U-Bahnhof, der von hier bequem zu Fuß zu erreichen wäre, und auch keinen in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Warum überhaupt mit dem Bus fahren, wenn man dieses Baby hier besitzt?«
»Eine weitere seltsame Frage, die wir zu den Akten legen müssen, weil es im Moment keine Antwort gibt.«
Milligan schloss die Fahrzeugtür, und Decker verriegelte sie mit der Fernbedienung.
»Es wird spät«, sagte Milligan bei einem Blick auf die Uhr. »Wohin jetzt?«
»Besuchen wir noch einen Sterbenden«, sagte Decker.
7
Die Atemzüge waren jetzt so langsam, dass man befürchten musste, der nächste würde der letzte sein.
Decker betrachtete Walter Dabney, während sein Verstand zum Morgen des Tages zurückspulte, als er diesen Mann gesehen hatte, wie er scheinbar sorglos den Bürgersteig hinuntergeschlendert war, bis er eine Waffe gezogen und Anne Berkshire vor Dutzenden entsetzter Zeugen erschossen hatte. Deckers perfektes Gedächtnis ging dieses Szenario Schritt für Schritt durch, doch am Ende war er so klug wie zuvor.
Ellie Dabney saß auf demselben Stuhl wie vor Stunden und hielt noch immer die Hand ihres Mannes. Milligan stand neben der Tür. Bogart und Jamison hatten sich auf der anderen Seite des Bettes postiert.
Die Agenten hatte mittlerweile erfahren, dass der schwer verletzte Mann keinen Mucks von sich gegeben hatte. Er hatte nicht einmal das Bewusstsein wiedererlangt.
Decker kniete sich neben Ellie Dabney. »Eine Frage, Mrs. Dabney …«