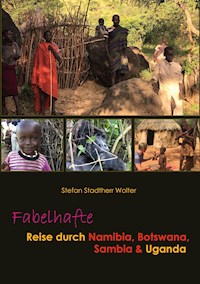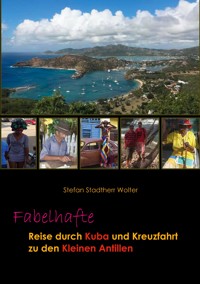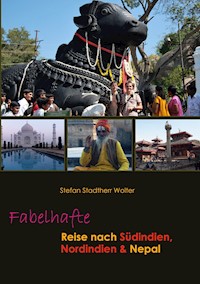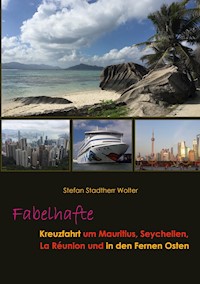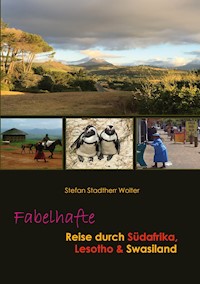
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Fabelhafte Reisen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wo blühen Bäume und Blumen blauviolett? In Südafrika! Jacarandabäume, Afrikalilien, imposante Berge und unendliche Weiten wecken die Entdeckerfreude. Prächtige Weingüter sorgen für Genuss. Ausgangspunkt ist das feine Kapstadt und die sensible Kapregion. Auf inspirierenden Wegen gehts auf den stolzen Tafelberg hinauf und ans "Kap der Guten Hoffnung" hinab, in herrschaftliche Villen und bunte Townships hinein und in die sonnenbeschienene Karoo hinaus. Die Drakensberge und der Kruger Park bieten Natur pur. Doch pssst! Elefanten und Giraffen lassen nicht lange auf sich warten. Was für eine Vielfalt an Leben, an Sprachen, an Geschichte! 2006/16 gehts quer durchs Land. Zunächst von West nach Ost, dann nach Nord gen Namibia. Abstecher führen ins "Königreich im Himmel" (Lesotho) und nach Swasiland. Vor allem aber in der Kapregion lässt es sich leben wie "Gott in Frankreich", sorry ... in Südafrika! Fabelhaft! Jedes Buch hilft Bäume pflanzen für das Weltklima!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fabelhaft!
Jedes Buch hilft Bäume pflanzen für das Weltklima!
Hinweis:
Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte Dritter wurden die Namen der mitreisenden Personen sowie deren Herkunftsorte geändert. Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Die Darstellungen erfolgen aus dem Blickwinkel des Autors. Trotz aller Sorgfalt kann keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen werden.
Um zu verdeutlichen, dass es sich bei „Schwarzen“ um ein ethnisches sowie politisches Konstrukt, zumeist mit dem Hintergrund von Rassismuserfahrungen, und nicht um eine biologisch klassifizierbare Gruppe handelt, wird in diesem Buch „Schwarz“ auch in adjektivischer Verwendung groß geschrieben.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Von Kapstadt nach Lesotho & Swasiland (2006)
Von der Kapregion nach Namibia (2016)
„Wenn es etwas gibt, das ich nochmals erleben wollen würde, dann wäre es eine Safari.“
Karen Blixen, dänische Schriftstellerin
Vorwort
Fabelhaft- dass es noch gibt, was selten geworden ist in Zeiten von Blogs und Social Media. Auch ich bin up to date und bediene mich der Kanäle, die im Hier und Jetzt verbinden. Doch abgesehen davon, dass vieles von dem noch gar nicht existierte, als ich mit Michael (M2) durch die Welt zu reisen begann, hatte ich immer das Ziel, Gesehenes und Erlebtes nachhaltiger zu reflektieren und weiterzugeben. Dies um so mehr, als sich die Möglichkeiten des Mitteilens in den letzten drei Jahrzehnten drastisch änderten. Saß man Anfang der 1990er Jahre noch geduldig in einer „Bilder-Runde“ zusammen, mit (mitunter auch ermüdenden) Erzählungen, so änderte sich das einerseits mit der Bilderflut der Digitalkameras, andererseits mit den immer günstiger werdenden Kurztripangeboten. Nicht nur immer mehr Bilder wurden produziert, auch gereist wurde häufiger. Und als wir 2009 erstmals auf einer der AIDA‘s übers Meer schipperten, riet der Kapitän bereits recht uncharmant: „Verschonen Sie Ihre Angehörigen mit Ihren Bildern, die werden mit den eigenen schon nicht mehr fertig!“
Kaum einen Wirtschaftszweig traf die Pandemie schließlich so sehr ins Herz wie den Tourismus. Die vieldiskutierte „Klimakrise“ legt obendrein offen, auf welch fragilen Füßen der Reisesektor steht. Reisen wird teurer und exklusiver.
Noch im 19. Jahrhundert als „die schönste und unschuldigste Leidenschaft des Menschen“ bezeichnet, hat das Reisen inzwischen viel von seiner Unschuld verloren. Zumindest sind wir unterwegs mit Notizblock und Laptop – mit offenen Augen und Ohren. Dabei notiere ich so viele Kleinigkeiten wie möglich – sind diese es doch, die das Leben bunt und auch herausfordend machen. Sie kommen der Realität näher als das bloße Nachzeichnen der großen Linien.
Auch Reiseberichte, wie sie in dieser Reihe vorliegen, sind längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Vor hundert Jahren noch eine beliebte literarische Gattung, begann sich am Anfang des 20. Jahrhundert der Kartengruß durchzusetzen, dem die Botschaft genügte „Ich war hier“. Die Entwicklungen seit dem Aufkommen der Neuen Medien kennen wir alle.
Möge die Fabelhaft -Reihe größere Kreise inspirieren, Land und Leute mitzuerleben – und darüber hinaus mitzuwirken am Bemühen, unsere Welt wieder grüner und bunter werden zu lassen.
Fabelhaft- dass mit dieser Reihe eine Möglichkeit gefunden ist, landschaftliche Schönheiten, kulturelle Vielfalt und geschichtliche Hintergründe einzufangen und bei all dem zu erkunden, was etwa den Hochglanz-Reisekatalog von der Realität unterscheidet.
So ungeschminkt wie kaum anderswo setzen die Reiseberichte das Miteinander der Reisenden ins Licht, unterwegs vielfach in Gruppe. Das sind Zeitdokumente von hohem Wert. Zugleich demonstrieren sie, inwieweit im heutigen Reisetempo Land und Leute wirklich erfahren werden können. Eine aufwändigere Nachbereitung ist unerlässlich. Trotz aller Sorgfalt bleibt hier und da eine Diskrepanz zwischen dem, was tatsächlich ist und war und wie es wahrgenommen und verstanden wird. Manch eine Frage bleibt offen, die zur weiteren Erkundung motiviert. Auch diese bleibenden Lücken gehören zur abgebildeten Realität.
Fakt ist: Wir erfahren auf den Reisen mehr, als die Medien uns vermitteln. Und die oft genug aufgezeigten Ambivalenzen schützen vor voreiligen Schlüssen und einfachen Bewertungen.
Inspiriert wurde ich von den Reiseaufzeichnungen meines Ururgroßvaters Ernst Robert Pietsch (1850-1928), die ich kurz vor der Jahrtausendwende in die Hände bekam und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machte. Meine Ururgroßeltern begaben sich rund hundert Jahre vor uns auf große Fahrt – damals noch beschränkt auf Europa.
M2 und ich brachen erstmals im Jahr 2004 auf: ins Land der Pharaonen und Pyramiden. 2006 folgte unsere erste Gruppenreise nach Südafrika. Erst 2016 sahen wir dieses zauberhafte Land wieder – auf der hier in Worte gesetzten Genussreise. Im Anschluss an diesen Urlaub in der Kapregion ging es abermals mit Gruppe weiter, nach Namibia und Botswana, bis hinauf nach Sambia. Eine Herausforderung, wie der vorliegende Band ankündigt.
Die „inspirierende Vielfalt“, mit der Südafrika wirbt, hat auch uns voll und ganz in ihren Bann gezogen. Vieles lässt sich mit uns entdecken, doch unendlich mehr hält das Land bereit. Fabelhaft bringt das die südafrikanische Sängerin und Menschenrechtsaktivistin Miriam Makeba auf den Punkt: „Afrika hat seine Geheimnisse und selbst ein weiser Mensch wird diese nie verstehen. Er kann sie aber respektieren“. Und Ernest Hemingway, dem wir in Uganda und Kuba (Bde. 2 und 3) näher kommen werden, schwärmte:
„Ich kann mich an keinen Morgen in Afrika erinnern, an dem ich aufgewacht bin und nicht glücklich war.“
Von Kapstadt nach Lesotho & Swasiland 07.02.06 – 28.02.06
Kulturelle Vielfalt vor zauberhafter Kulisse: Kapstadt
07.02.06: „Wir setzen zur Landung an!“ Ich stupse M2 in die Seite und klammere mich an den wieder geschlossenen Gurt. Spürbar drosselt das Flugzeug die Geschwindigkeit. Es sinkt. Zur Linken tauchen hunderte orangefarbene Lichterketten aus dem Dunkel auf. Sie winden sich unter uns durch die Nacht und rücken näher und näher. Schon erblicken wir hell erleuchtete Straßenzüge und mancherlei Hausbeleuchtungen. Ich meine, auch das Meer zu erkennen und Schiffe zu sehen. Es ist ein Morgen wie jeder andere – am anderen Ende der Erde.
Für uns sind diese Minuten etwas ganz Besonderes. Wir landen in Kapstadt, einer der südlichsten Städte des afrikanischen Kontinents, mehr als 9.000 Flugkilometer von zuhause entfernt. Was wird uns in der Fremde erwarten? Wie werden unsere Mitreisenden auf uns wirken? Drei Wochen werden wir mit den unterschiedlichsten Charakteren durchs Land reisen, insgesamt rund 5.000 Kilometer. Bis jetzt kennen wir nur deren Namen. Die Vornamen deuten auf ein vom Alter her gemischtes Publikum hin, die Nachnamen lassen auf einen Großteil Singles schließen. Wer kann sich auch sonst solch eine Reise leisten? Sie wird uns am Ende knapp 3.000 € pro Person kosten, und das ist noch günstig. Südafrika kann man gut für das doppelte Geld in der Gruppe bereisen, wobei nicht unbedingt mehr Programmpunkte in der Reise enthalten sein müssen. Wir dürfen auf unseren Urlaub gespannt sein.
In der Reihe von M2 und mir sitzt eine goldbehängte ältere Dame aus Südafrika. Ich versuche mir vorzustellen, welchen Gesinnungswandel sie im Zuge der Neugestaltung des Landes wohl hinter sich gebracht hat. Für viele ältere Menschen wird es nicht ganz leicht gewesen sein, Privilegien aufzugeben. Das Ende der Apartheid, die „Rassentrennung“, ist gerade mal 15 Jahre her. Ich bin gespannt, was wir in dieser Hinsicht erleben und erfahren werden. Neugierig sind wir zunächst auf unsere Reisekameraden, die sich irgendwo hier im großen Flugzeug aufhalten müssen.
Aufs Aussteigen müssen wir ein wenig warten, denn wir sind fast eine Stunde zu früh gelandet. „Dass es so etwas gibt, dass ein Flugzeug zu schnell fliegt“, sollte sich wenig später unser Reiseleiter wundern. Der wartet mit schwarzem Hut als Erkennungszeichen im Terminal auf uns, während wir zunächst die Einreiseformalitäten über uns ergehen lassen müssen.
Ich lasse den Flug noch einmal Revue passieren: Eben beim Aussteigen warf ich einen Blick in die First Class des Flugzeugs. „Hauptsache wir kommen gut wieder runter, in welcher Klasse ist doch egal“, hatte dort gestern Abend ein grauhaariger Mann hinter uns gesagt, als ich M2 lautstark auf diesen Luxus aufmerksam gemacht hatte. Einige ältere reiche Weiber stießen mit Sekt an.
Die Reise verlief erfreulich ruhig; wie ein ICE glitt unser Gefährt durch die Nacht. Geschlafen habe ich allerdings kaum, viel zu interessant war das Display an der Rückenlehne meines Vordersitzes. Auf dem kann man die Flugroute nachvollziehen und die Verschiebung von Tag und Nacht auf der Erdkugel beobachten. Als wir einstiegen, stand die Sonne wunderschön über Südamerika, während über Australien die Nacht Einzug hielt. Bei unserer Ankunft am Morgen genossen die Australier bereits ihr Abendessen, Alaska aber schlummerte in tiefster Nacht. Dieser Blick auf die Welt beschäftigte mich in meinem Sessel, tausende Kilometer unter mir das weite afrikanische Land mit seinen Naturschönheiten, aber auch Elend, Hunger, Krieg und Tod. Stundenlang flogen wir über Algerien dahin, über die weite Sahara, die wir ein bisschen von Ägypten her kennen. Vor dem geistigen Auge sah ich den roten Sand, der nun in kalter Dunkelheit lag und auf die warmen Sonnenstrahlen des nächsten Tages wartete. So, wie auch wir.
„Wir werden im Sommer landen, ist das nicht herrlich?“, freute ich mich gegenüber M2: „So mitten im Winter in den Sommer auszusteigen, ist das nicht der pure Luxus?“
Unser relativ bescheidenes Abendessen wurde uns bald nach dem Start serviert: Bratwurst, Kartoffelbrei und Sauerkraut, also etwas typisch Deutsches. Dazu gab es ein Fläschchen ausgesprochen guten Rotwein. Das Etikett mit der Aufschrift „The African Horizon“ erwärmte das Herz, während der Wein an sich gekühlt war – typisch für Südafrika, wie wir später erfahren werden. Eigentlich wollten M2 und ich ja mit Sekt anstoßen, aber bitte schön, was heißt „Sekt“ auf Englisch? Da wir uns nicht verständlich genug ausdrückten, erhielt M2 eine Apfelschorle. Es ging also „gut“ los mit unseren Sprachkenntnissen. Denen haben wir es auch zu verdanken, dass wir uns nun am falschen Einreiseschalter anstellen. Immerhin werden wir dadurch relativ schnell abgefertigt und gelangen als die Ersten der Reisegruppe in die Empfangshalle. Dort erblicken wir einige Schalter zum Geldumtausch.
„So’n Scheiß“, hören wir eine junge schmächtige Frau mit „Basecape“ vor einem der Fensterchen schimpfen. „Die sind ja bescheuert hier, sieben Euro Gebühren für den Umtausch, nee, ich geh’ an den Automaten“. „Was“, fragen wir, „sieben Euro, da musst Du Dich aber verhört haben“.
„Nein wirklich, das ist die pure Frechheit!“ ärgert sich unsere künftige Weggefährtin, ins Innere der weiten Halle verschwindend, die auch wir nun aufsuchen. Hinter einer Absperrung erblicken wir zwischen all den in die Höhe gehaltenen Pappen mit aufgedruckten Namen von Reisegesellschaften unseren Veranstalter „Djoser-Reisen“ – aufgekritzelt auf einem Blatt Papier in der Hand eines jungen Mannes. Das also ist unser Reiseleiter Uwe: Dunkel gebräunt, einen schwarzen Hut auf dem Kopf, lebenslustig auf den ersten Blick. Doch die Begrüßung fällt distanziert aus. Nahezu jede Frage, die wir neugierig stellen, kommentiert er: „Da sage ich nachher noch was dazu, wenn dann alle da sind.“
Verlegen lächelnd stehen wir nebeneinander und warten auf unsere Mitreisenden. Da steuert die kleine, schwarzgelockte drahtige Biene von vorhin auf den Leiter zu. „Hallo, ich bin Susanne, die haben ja hier wohl ’n Knall, so viel Geld beim Umtausch abknöpfen zu wollen.“ Uwe erklärt, dass es besser ist, das Geld am Automaten zu ziehen. „Geht wegen der Kriminalität nur ja nie allein dorthin“, rät er mit ernstem Gesicht.
„Ist die hier wirklich so hoch“, interessiere ich mich, schon in Deutschland von vielen eher bemitleidet als beneidet bezüglich des bevorstehenden Südafrika-Trips.
„Da sage ich gleich noch was dazu“, antwortet Uwe.
„Hallo“, wendet sich nun Susanne an uns: „Kommt mal mit rüber zum Automaten, um mich zu beschützen!“
Oh, was für eine anstrengende Person. Da wir aber ebenfalls Geld benötigen, gehen wir mit, und während M2 sich mit dem Gerät vertraut macht, traue ich mich schon mal durch die große Glasschiebetür, um den anbrechenden Sommertag zu begrüßen.
Was für ein Grün! Und wie glutrot leuchtet der Sonnenball links neben den Bergen am Horizont. Es riecht nach frischer Erde, nach Laub und nach Stadt. Vor mir fahren zahlreiche Taxis auf und ab. Trotz Kriminalitätsstatistik wage ich mich drei Schritte allein aus dem Terminal. Alle Menschen scheinen mich anzublicken, sie winken mich zu ihren Autos. Rasch drehe ich wieder um und fliehe in die Arme der Reisegruppe, die sich allmählich um Uwe versammelt. 18 Leute sollen wir werden und zwei Paare sind bereits eingetroffen. Die Frauen kommen mir bekannt vor, ich kenne sie aber nicht. Die Pärchen wirken ungleich. Einmal scheint er älter und reifer als seine Frau zu sein, dann ist es wieder umgekehrt. Weitere Reisende finden sich ein. „Hallo ich bin Roswitha! Hallo ich bin Horst! Hallo ich bin die Ilona!“
„Ach, Ilona sieht doch ganz nett aus“, flüstere ich M2 zu. Ilona dürfte etwa sechzig sein und Roswitha nicht viel jünger, während Susanne Ende dreißig sein wird und die Paare ebenfalls in den 30ern sein dürften. „Wie ist denn so der Altersdurchschnitt?“ frage ich Uwe, der ja nun gleich mal was dazu sagen könnte, schließlich sind inzwischen fast alle Mitreisende eingetroffen. Doch da gesellt sich noch ein älteres Ehepaar mit kleinem Köfferchen und großem Fotoapparat hinzu: Almuth und Rüdiger.
„Die Leute sind zwischen Ende zwanzig und Anfang siebzig“, sagt Uwe.
„Ende zwanzig, das bist Du“, stupse ich M2 an und erwidere laut: „Na, das ist ja eine interessante Mischung!“ Währenddessen treffen nun wirklich die Letzten ein: ein Pärchen. Er vielleicht Mitte vierzig, sie Mitte zwanzig – und ein blonder, etwas blasser Einzelreisender in hellgrün leuchtenden Turnschuhen, außerdem ganz in grün gekleidet. Uwe hat sich inzwischen durchgerungen seine einführenden Worte loszuwerden: „Ja, die Kriminalität ist extrem hoch. Bitte niemals allein irgendwohin gehen, schon gar nicht nachts“. „So’n Scheiß“ empört sich Susanne wieder, „sind wir jetzt die ganze Zeit aneinandergekettet?“.
„Es ist, wie ich’s sage“, erwidert Uwe unwirsch und Susannes energische Gesichtszüge werden bitter.
„Oh je, und ich war eben schon allein vor der Tür“, stichele ich, während mich alle mit einem Blick mustern, der sagen könnte: „Und was bist Du für ein Vogel?“
Uwe erbittet sich Ruhe, um fortzufahren: „Ja, und die HIV-Rate liegt bei rund viieerzig Prozent.“ Das betont er so, als könne sich die Krankheit auch über die Luft übertragen. „Trotzdem ist es ein extrem schönes Land, ich habe bereits eine solche Tour hinter mir, bin aber auch zum ersten Mal in Südafrika“.
„Und ich hoffte, er könnte etwas mehr über Land und Leute erzählen“, flüstere ich M2 zu, während wir zu unserem Bus schlendern, der vor dem Terminal für uns bereitsteht und uns durchs gesamte Land bringen wird.
Der Flughafen liegt ziemlich weit vom Stadtzentrum entfernt, und so erhalten wir auf der Fahrt nach Kapstadt bereits einen Eindruck vom frischen Grün rund um die Stadt. Ich stelle mir die Schiffe vor, die im frühen 17. Jahrhundert am Kap geankert haben. Die erste Siedlung hier entstand dann Mitte des 17. Jahrhunderts. 1662 war Kapstadt bereits ein Ort mit vier Straßen und rund zweihundert weißen Einwohnern; die Auseinandersetzungen mit den Schwarzen Ureinwohnern nahmen ihren Lauf. Rasch wurde die Zahl der Weißen größer. 1681 deportierte man politisch Verbannte aus Indonesien nach Kapstadt, die später die Gruppe der sogenannten Kap-Malaien bildeten. Auch Hugenotten trafen in Kapstadt ein; 146 sollen es im Jahr 1688 gewesen sein.
Während Uwe uns die Namen der umliegenden Berge erklärt und auf den „Löwenkopf“ hinweist, der den Seefahrern als wichtiger Anhaltspunkt diente, fahren wir an einem riesigen Township vorbei, das mich jetzt viel mehr interessiert. Unzählige Hütten reihen sich aneinander, bis an den Fuß der Berge. Um diese fahren wir halb herum und erblicken in der Ferne die modernen Hochhäuser von Kapstadt. Links nehmen wir ein großes abschüssiges Steinfeld wahr. Uwe erklärt, hier habe sich bis in die zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts hinein ein riesiges Township, Heimat für Tausende Schwarze, befunden. In dem quirligen Wohngebiet war der Jazz zuhause. Diesem sogenannten „District Six“ wurde jedoch die City-Nähe zum Verhängnis. Um die Gegend zu „bereinigen“, hat man den Menschen ihre Heimat genommen. Sie wurden vertrieben und die Gebäude zusammengeschoben. Nicht etwa, um den Menschen dort angemessenere Wohnverhältnisse zu bieten; Platz sollte vielmehr für die Weißen geschaffen werden. Doch die neue Bebauung kam aus dem Anfangsstadium nicht hinaus. Eine pulsierende Lebensader der Stadt bleibt unwiederbringlich zerstört.
In einer kleinen Straße zwischen Bahnhof und Stadtpark, dem einstigen Gemüsegarten der holländischen Seefahrer, halten wir vor dem Hotel Cape Diamond.
„Die Zimmer sind leider erst ab 14 Uhr frei“, erklärt Uwe, während ich so müde bin, dass ich mir kaum vorzustellen vermag, wie ich den Tag bis dahin überstehen soll. Immerhin hat Uwe zwei Zimmer zum Umziehen besorgt, eines für die Frauen, eines für die Männer. Dort können wir auch unsere Gepäckstücke bis 14 Uhr abstellen.
Wie in einem Ferienlager angekommen, ziehen wir uns nun in dem kleinen Zimmer um und machen uns frisch, dann treffen wir uns wieder am Empfang des Hotels, um einen ersten kleinen Spaziergang in heller Sommerkleidung zu unternehmen. Wie grell leuchten die weißen Gebäude der Stadt im Sonnenlicht!
Eines dieser hellen Häuser, die über ihre Geschichte hinwegtäuschen können, ist das alte Sklavenhaus (Abb. S. → unten). Hier wurde über Menschen verhandelt und mit Menschen gehandelt. Nicht weit davon öffnet sich der erwähnte sogenannte „Company’ s Garden“, ein heute herrlicher Park, dessen Land die „Niederländische Ostindien-Kompanie“, eine Handelsgesellschaft von Kaufleuten, im 17. Jahrhundert als Gemüsegarten nutzte. Der Garten, der damals eine fast dreimal so große Ausdehnung wie heute hatte, wird um diese Zeit gefegt und bewässert.
Das Gartenlokal, in dem wir uns niederlassen wollen, öffnet erst um acht. Auf dem Weg in den Garten streifen wir ein schmuckes Gebäude mit mächtigem neoklassizistischem Eingangsportal in viktorianischem Stil. Interessiert wende ich mich an Uwe.
„Das sage ich jetzt mal gleich für alle“, antwortet unser Reiseleiter daraufhin lautstark: „Ich werde nicht dafür bezahlt, Stadtrundgänge zu organisieren. Das darf ich gar nicht, dafür gibt es in Südafrika lizenzierte Führer. Aber klar gebe ich gern so viel Auskunft, wie möglich. Nur darf das keiner von mir erwarten!“
Der Gebäudekomplex „Houses of Parliament“, der diese Belehrung auslöst, erinnert an die Blütezeit Kapstadts im 19. Jahrhundert. Kapstadt war Hauptstadt der damals recht großen Kapprovinz.
Nach einem kleinen Spaziergang, begleitet von dem Kreischen und Singen der Vögel, lassen wir uns unter blühenden Bäumen nieder, die Augen auf den übermächtigen Tafelberg gerichtet (Abb. S. → oben). Gänzlich frei von Wolken leuchtet er im hellen Morgenlicht. Das erste bestellte Getränk geht auf die Rechnung der Reiseorganisation.
Ich genieße einen „Milkshake“, der mit Eiscreme serviert wird. Neu für mich! Indessen strömt eine Schulklasse mit kleinen Schwarzen und weißen Kindern in blau-weißer Uniform in den Park hinein und lässt sich lärmend nicht weit von uns nieder. Uwe erläutert den Reiseablauf, M2 schreibt fleißig mit und ich genieße meinen Shake, während ich mich umsehe und empört aufhorche, als Uwe eröffnet, dass alle Ausflüge, die ja nicht mitgebucht wurden, etwa um ein Viertel teurer geworden seien: „Mit den veranschlagten 220 € pro Woche für Essen und Ausflüge werdet ihr nicht auskommen, mit 300 müsst ihr mindestens rechnen“.
Susanne und ich maulen, und ich ernte strafende Blicke von M2, weil man sich doch anfangs besser etwas bedeckt hält. Schließlich dürften ja auch Leute in der Gruppe sein, für die Geld weniger ein Thema ist. Es ist eben keine Reisegemeinschaft auf einem finanziellen Level, wie ich es aus Jugendzeiten her kenne.
Die Instruktionsstunde wird allmählich ermüdend, und die von Uwe angeregte Vorstellungsrunde mündet in eine Selbstdarstellung: „Ich bin Uwe, 32 Jahre, unverheiratet, kinderlos“ – „wie wahrscheinlich die meisten hier“, füge ich leise hinzu. Auf allgemeinem Wunsch hin wollen wir uns erst am Abend bekannt machen, wofür Uwe einen Tisch in einem „Wildrestaurant“ reservieren wird. Wir gehen nun in die verschiedensten Richtungen auseinander. Während einige gleich auf den Tafelberg hinauffahren wollen, sehnen wir uns nur nach einem: Schlafen! Zurück zum Hotel suchen wir zunächst eine Absa-Bank, um noch etwas Geld zu tauschen – 1 Euro (€) etwa 7 Rand (R). Überraschung: In die Bank wird man hier durch eine Schleuse eingelassen und der Umtausch gestaltet sich viel umständlicher als am Automaten.
Glücklicherweise ist unser Zimmer vorzeitig hergerichtet, sodass wir gegen elf Uhr einziehen können. Ein großes Eckfenster führt zur Straße hinaus, die ein Stockwerk unter uns in der Sonne glänzt. Das Bad, abgetrennt vom Zimmer durch eine Schiebetür, Fliesen aus Natursteinen, wirkt heimelig.
Wir sinken auf die bequemen Betten und schlafen bis zum frühen Nachmittag, dann beginnen wir mit unserem kleinen Stadtspaziergang.
Unser Ziel ist zwar die „Waterfront“, doch wir gelangen nicht weiter als bis zu einer großen Verkehrsstraße bzw. einem riesigen Sheraton-Hotel, vor dem wir in Sandalen plötzlich zwischen der Geschäftswelt herumschlappen. Weiterzugehen scheint keinen Sinn zu machen, denn hier beginnt ein Industriegebiet und mit etwa 300 € im Rucksack – M2 misstraut den Hotelsafe und will das Geld stets mit sich führen – fühlen wir uns nicht mehr sicher. Also gehen wir die Buitengragt hinauf und gelangen an einem Geschäft voll kostbarster Harley-Davidson vorbei ins Malaienviertel.
Die Malaien sind Nachkommen jener Menschen, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus Asien ins südliche Afrika gebracht wurden und beim Bau ihrer kleinen pastellfarbenen Häuser auf Bauelemente des kapholländischen und englischen Stils zurückgriffen.
In der bunten Häuserzeile entdecke ich sogar das Heimatmuseum, das 16 Uhr leider schon geschlossen wird. Nun ist es bereits viertel vor vier. So schlendern wir noch ein wenig weiter – die Berge hinauf, uns mühsam ins hiesige Klima und die Stadt einfindend. Ermüdung und Strapazen, resultierend schon allein aus dem Wunsch, möglichst viel auf einmal aufnehmen zu wollen, werden von der überwältigenden Freude überdeckt, an einem Ort zu weilen, von dem es nicht selbstverständlich ist, dass man ihn in seinem Leben je einmal betritt. Und Kapstadt ist wirklich eine Augenweide (Abb. S. → oben). Besonders von hier oben, mit Blick über eine kleine Moschee auf den gegenüberliegenden Tafelberg. Im Moment zieht eine Wolkendecke über ihn hinweg. „Der Teufel breitet sein Tischtuch aus“, pflegt man dieses eindrucksvolle Schauspiel hier zu kommentieren.
Unterwegs treffen wir hin und wieder jemanden aus unserer Reisegruppe. Und auch der grauhaarige Mann, der mit mir im Flugzeug in die First Class geschaut hatte, läuft uns über den Weg. „Na, zufrieden mit dem Hotel?“, ruft er uns entgegen. „Ja danke, alles okay, und selbst?“
„Bestens danke, wir haben es wirklich gut getroffen!“ So ziehen wir heiter unserer W ege.
Das Meer und weite Teile der Stadt glänzen noch immer unter der Sonne. Es ist wirklich heiß geworden. Wieder zurück im Zentrum ruhen wir in einem legeren Café auf einem Sofa aus und ich genieße einen weiteren „Milkshake“. Dann ist es 17 Uhr. Es wird Zeit, noch etwas von der Altstadt zu sehen. Dazu schlendern wir an unserem Hotel vorbei zum „Paradeplatz“, der von kräftigen Palmen umgeben ist und in Richtung des Tafelbergs vom imposanten Rathaus, eine Mischung aus britisch-kolonialem und italienischem Renaissance-Stil, begrenzt wird. Vom Balkon des 1905 erbauten Hauses hatte 85 Jahre später Nelson Mandela seine berühmte Rede gehalten, die mit den Worten begann: “Amandla! Afrika! Mayibuye!“ (Macht dem Volk!) Hunderttausend Menschen jubelten ihm auf dem Marktplatz “Grand Parade” zu, wo wir nun fast allein im schönsten Sonnenschein des späten Nachmittags sitzen; den Blick auf die über den Berg quellenden Wolken gerichtet. Oh, wie gut es uns geht, hier in der Wärme. Wir telefonieren mit zu Hause.
Plötzlich steht Susanne vor uns. „Na, da hatten wir ja Glück“, meint sie auf den Tafelberg weisend. „Wer weiß, ob wir in den nächsten zwei Tagen noch mal solch eine Sicht über Kapstadt haben wie heute. Ach, ihr seid gar nicht oben gewesen? Also das war ja heute die Gelegenheit. Ansonsten hat ja Kapstadt nicht viel zu bieten. Ich suche die ganze Zeit die Altstadt!“
Wir schwärmen vom Malaienviertel mit den bunten Häuschen, aber da ist Susanne natürlich auch bereits gewesen.
Ich gestehe, dass auch wir im Zentrum der Stadt ein in sich geschlossenes altes Viertel vergeblich suchten. Die älteren Häuser sind hier im Gegensatz zu Deutschland zum größten Teil überformt oder mit modernen Gebäuden umbaut. Über oder unmittelbar hinter einer Hausfassade aus dem 18. oder 19. Jahrhundert kann sich beispielsweise ein modernes Hochhaus auftürmen.
Die Straßenzüge sind eng bebaut, doch dominieren helle Farben. Kapstadt macht einen wohltuend sauberen, gepflegten Eindruck. Die Architektur spiegelt einen anderen Umgang mit Geschichte wider. Jetzt strebt alles zu Modernität und Aufbruch, wobei historische Details, sofern sie erhalten blieben, liebevoll hergerichtet bzw. integriert wurden. M2 und ich machen uns frisch und finden uns Punkt 19 Uhr in der Lobby ein, von wo es im großen Tross zum Restaurant geht. Susanne beschwert sich lautstark darüber, sich mit Ilona ein Zimmer teilen zu müssen, während Roswitha doch auch keinen Einzelzimmerzuschlag bezahlt habe und mit Ilona etwa gleichaltrig sei. „Wenn die auch noch schnarcht heute Nacht, flippe ich aus“, klagt sie ganz unbekümmert neben Ilona, die etwas hilflos neben ihr dreinblickt.
Die Gegend, die wir jetzt durchstreifen, ist sehr belebt und viele der älteren, heute gern als Restaurant oder Bar genutzten Häuser, kennzeichnet der sich mit Veranden und Säulen schmückende Kolonialstil. Aus den geöffneten Fenstern lärmt das Leben von Innen auf die Straße und vermischt sich dort mit den Geräuschen der Stadt.
Wir sind an der letzten Station dieses langen Tages angekommen, und das Schicksal hat mir einen Platz zwischen Susanne und M2 zugewiesen. M2 und ich bestellen eine Flasche guten Rotwein. Dazu probieren wir Krokodil – ein weißes Fleisch, Huhn nicht ganz unähnlich, außerdem einen tropischen Salat. Allmählich kommen wir mit den Mitreisenden ins Gespräch, etwa mit dem ungleichen Pärchen aus Köln, das erst vor zwei Monaten in Peru unterwegs war. Da können Susanne aus Bremen und der ihr gegenübersitzende Sven aus Kronberg mitreden. Auch sie waren bereits in den Anden. Ich erzähle von ursprünglichen diesbezüglichen Plänen, welche jedoch die dort drohende Höhenkrankheit durchkreuzt habe. Nächstes Thema sind die beruflichen Tätigkeiten und ich ernte ungläubige Blicke und Kommentare, wie ich mir diese Reise damit denn leisten könne. „Die bezahlt wohl Michael für Dich“, so Horsts Kommentar vom anderen Ende des Tisches.
Horst reist allein, wie einige hier in der Gruppe. Er scheint aufgeschlossen zu sein – verunsichert mich aber gerade. Ich bin schließlich stolz darauf, mir alles durch eigene Hände Arbeit sauer genug selbst zu verdienen. Das Beobachten und Abchecken, auch in finanzieller Hinsicht, scheint wohl in unserem Alter dazuzugehören. Ich kannte das bislang noch nicht und fühle mich an sich auch ganz frei davon. Mit M2 bin ich aber einer Meinung, dass ich in diesem Milieu fürs Erste genug von mir preisgegeben habe. Umgeben bin ich hier wohl vor allem von Leuten im gut bezahlten Angestelltenverhältnis bei Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern.
Wir genießen den Wein und das Essen, und während manche hinterher noch weiterziehen wollen, schließen sich M2 und ich einer Gruppe von ca. sechs Leuten an, die zum Hotel zurückkehrt. Unterwegs werden wir angebettelt. Die ältere Almuth holt das Portemonnaie heraus und gibt einem hinter uns her laufenden Jugendlichen eine Münze. Das spricht sich herum und die Schar der Bettler wird größer.
„Das nervt mich“, ruft Susanne wieder empört und beschleunigt ihren Schritt. Wir raten, auf die Älteren und Langsameren zu warten, schließlich ist eine Gruppe sicherer.
„Oh je“, klagt Susanne, „das kann ja heiter weiter werden, eine Reise mit einem Altenheim.“
Ein kühler Wind kommt auf.
Endlich haben wir das Hotel erreicht, wo eine SMS aus Eisenach auf uns wartet: „Alles Guuute, Ma und Pa!“ Erschöpft lassen wir uns in die Kissen sinken und schlafen sofort ein.
Spiel der Wellen und der Pinguine: Kap der Guten Hoffnung
Mittwoch, 08. Februar 06: Eine kurze warme Nacht liegt hinter uns – im vornehmen und bequemen Zimmer 102 des „Cape Diamond Hotels“. Ausgezeichnet haben wir in den guten Betten geschlafen.
Vor dem großen Eckfenster scheint schon wieder die südafrikanische Sonne. Wie die übrigen Fenster, ist es mit einem großen schweren Vorhang verdeckt, den ich gerade aufziehe. Etliche Schwarze Jugendliche tummeln sich wie am Abend noch immer auf der Straße unter uns. Worauf sie wohl warten oder was sie hier suchen?
Halb acht schlendern wir aus dem Hotel in die St. Georges Mall, die Fußgängerzone. Der Tafelberg liegt schwarz glänzend in der Sonne. Obgleich bislang so schönes Wetter ist, wird schon jetzt das „Tischtuch“ über die Tafel geschoben.
Rasch ist ein geeignetes Café gefunden, vor dem wir uns unter einem kleinen Bäumchen niederlassen. M2 bestellt ein Frühstück, bestehend aus Rührei, Croissant, Kaffee und Marmelade. Ich „ordere“ zwei Spiegeleier mit Bacon und Brotecken.
Nachdem ich endlich die Frage verstanden habe, ob ich „White Bread“ oder „Brown Bread“ haben wolle, wird ein etwas dunkleres, weiches Weißbrot serviert. Das Ganze kostet 14.90 R (rund 2 €) und ist damit rund 20 R günstiger als im Hotel. M2‘s Frühstück ist mit 9.90 R noch preiswerter. Im Vergleich zum Hotelfrühstück, das uns ebenfalls angeboten worden war, sparen wir umgerechnet 7-8 €.
Ach, es ist schön, in der lauen Morgenluft zu sitzen und die Ruhe zu genießen. Lange bleiben wir allerdings nicht allein. Ilona und der alleinstehende Typ, der gestern scherzhaft fragte, ob M2 mir die Reise bezahle, kommen um die Ecke und leisten uns am Nachbartisch Gesellschaft. „Guten Morgen, gut geschlafen, abends noch mal weg gewesen? Das Frühstück reicht?!“ Oh je, das kann anstrengend werden, wenn das nun jeden Tag so geht. Auf unsere Empfehlung hin, nehmen sie dasselbe wie wir. Und wir, mit frühstücken fertig, ziehen wieder unserer Wege und geben unseren Reisebegleitern damit die ungehemmte Möglichkeit, über uns ins Gespräch zu kommen.
Nach dem Frühstück schlucken wir unsere erste Lariam-Tablette zwecks Malariaprophylaxe, die an sich erst am Ende der Reise wichtig wird, und eilen schnell noch in einen um die Ecke liegenden Supermarkt. Um diese Zeit ist er noch beinahe menschenleer. Teilnahmslos ins Leere starrend, schiebt die Schwarze Kassiererin die Artikel über den Scanner. Genauso langsam und ohne hinzugucken versucht sie eine Plastiktüte zu öffnen. Dem Käufer vor uns dauert das zu lange und er reißt ihr die Tüte unwirsch aus der Hand. Die gemütliche Kassiererin bleibt davon völlig unbeeindruckt.
Mit ein paar Keksen und einem Kanister Wasser eilen wir schließlich zum Hotel zurück und sitzen Punkt neun Uhr mit den übrigen im Bus. Heute soll es ans „Kap der Guten Hoffnung“ gehen. Doch wer ist noch fünf Minuten nach neun Uhr nicht da? Ausgerechnet Uwe, unser Reiseleiter, der noch tags zuvor verkündet hat, jeder zu spät Kommende müsse eine Runde ausgeben. Nach allem, was Uwe uns über die Verbrechen in Kapstadt erzählt hat, müssen wir doch wohl nicht mit dem Schlimmsten rechnen!? Der Fahrer geht ins Hotel zurück und sieht nach dem Rechten. Nur fünf Minuten später eilt Uwe herbei: „Ich habe verschlafen!“
„Die Zeit wird aber hinten für uns drangehängt“, versucht die blonde, hoch aufgeschossene Heike, um die Mitte 40, zu spaßen. Manch anderer versucht sich ebenfalls mit einem Witz, doch so früh am Morgen will das noch nicht recht gelingen.
„Na ja, das akademische Viertel haben wir ja noch eingehalten“, gebe auch ich meinen Kommentar hinzu, dann schließen sich die Türen und unser erster Ausflug in Südafrika nimmt seinen Lauf.
Der Weg zum Kap führt an einer der wohl schönsten Küstenstraßen der Welt entlang. An einer ersten atemberaubend beeindruckenden Bucht legen wir einen Fotostopp ein. Susanne ist die erste, die aus dem Bus springt. Ilona klettert als letzte hinaus. „Ich hatte eine Hüftoperation“, entschuldigt sie sich. Wir sind in Camps Bay. Malerisch schmiegen sich die weißen Villen an die leuchtend grünen Hügel unterhalb hoher Berge, am Fuße das Meer. Trotz der schroffen Gegensätze ist die Landschaft lieblich. Zu diesem Eindruck trägt der türkisblaue Farbton des Wassers ebenso bei, wie die farbig schimmernden Berge, die weiße Wolken wie Watte umhüllen. Im Vordergrund dieses „Bildes“, wie aus einem Katalog, erhebt sich ein Bäumchen, das mit seinen roten Blüten unmissverständlich vom Sommer kündet. Die Luft ist lau, ein tiefer Frieden liegt über der Bucht.
Es geht weiter, die Straße bzw. der Küstenstreifen zwischen Bergen und Meer wird enger. Am Fuß der schroffen Berge liegen die schönsten Villen, und auch ein Township streifen wir. Extremer kann der Gegensatz nicht sein. Auf einer zum Teil ziemlich gefährlichen Privatstraße (Peak Drive), streckenweise in den Felsen hineingehauen, gelangen wir immer weiter gen Süden und schließlich durch ein Tor in den Nationalpark hinein. Hier, in dieser nahezu baumlosen Gegend, soll es weltweit die meisten verschiedenen Pflanzenarten auf engem Raum geben. Inzwischen hat sich der Himmel zugezogen, doch passt diese Stimmung wunderbar zu dem auch sogenannten „Kap der Stürme“, das 1488 Bartolomeu Diaz und 1497/99 Vasco da Gama umsegelt haben.
Vasco da Gama war es als ersten Europäer gelungen, Indien auf dem Seeweg ums Kap zu erreichen. Diaz kam hier mitsamt seiner Mannschaft im Sturm um – auf dem Rückweg von dem gerade an Portugal gefallenen Brasilien (1500). Kreuze an der Küste erinnern bis heute an die Schicksale. Interessant ist, dass phönizische Schiffe bereits in vorchristlicher Zeit das Kap umsegelten.
Auf dem Rückweg entdecken wir das ehemalige Lotsenhäuschen, in dem auf die Bedeutung des Kaps für die Messung des Klimawandels hingewiesen wird. Ein erst allmählich ins Bewusstsein rückendes Thema.
Was für eine Einsamkeit muss früher hier geherrscht haben! Wenngleich das Kap nicht der südlichste Punkt des afrikanischen Kontinents ist, ragen die Ufer doch besonders erhaben aus dem Meer. Wir sehen hier die unterschiedlichen Gesteinsschichten: Granit, Sandstein, Schiefer. Auf einem Holzweg gelangen wir in die malerische Bucht hinab, in der wir uns zum Picknick verabredet haben. Ein Pavian! Es ist der erste in freier Wildbahn lebende Affe, den ich zu Gesicht bekomme. Wie gelangweilt er trotz der vielen Fotografen im Gras sitzt und wie wenig er sich stören lässt! Unter lautem Geschrei der Touristen streckt er nun sogar fast teilnahmslos alle Viere von sich. Angeblich soll er jemandem die Tasche geklaut haben. Oder ist das nur ein Scherz? Es ist nicht leicht zu ergründen, was manche unserer Gruppe spaßig und was sie ernst meinen. Manch einer möchte wohl interessanter wirken als er ist, etwa der Kölner, ein Zyniker in meinem Alter, der mit seiner um etliche Jahre jüngeren Freundin mit uns reist. Diese übrigens vermisst tatsächlich ihre Tasche mit dem Proviant. Also ist es wahr! Gegenwehr, so wurden wir im Vorfeld gewarnt, kann trotz des possierlichen Aussehens der Paviane lebensgefährlich werden.
Eine weitere Überraschung erleben wir auf dem letzten Stück zum Strand des Kaps hinab. Plötzlich nämlich steht wieder der Urlauber aus dem Flugzeug vor uns, der meine Bemerkung über die 1. Klasse aufgegriffen hatte und den wir bereits in Kapstadt wiedergetroffen haben. „Na, Sie trifft man ja auch überall“, ruft er nun lachend, und wir kommen über unseren Südafrika-Trip ins Gespräch.
„Was, Ihre Reise kostet fast 3.000 €, da haben wir’s aber deutlich günstiger getroffen. Wir bezahlen nur 2.500 €“, freut sich der Mann.
„Aber Sie sehen bestimmt nicht den Kruger Park“, kontere ich.
„Doch“, triumphiert der Herr, „auch den sehen wir!“
„Oh, dann ist die Reise wirklich günstiger“, drehe ich mich nach M2 um und frage den Herrn nach der Reisegesellschaft. Die führt den schönen Namen „Berge & Meer“, wie sich der Mann freut. So ziehen wir unserer Wege. Schon bald kreuzen sie sich abermals.
„Zu schön hier“, ruft da der ältere Mann zu uns rüber, sich wohl noch immer über sein Reise-Schnäppchen freuend.
„Und Sie fahren auch nach Lesotho und Swasiland“, bohrt M2 nun nach.
„Nee, das ist ja in zwei Wochen nicht zu schaffen.“
„Zwei Wochen?“, schreien M2 und ich wie aus einem Munde, „wir sind ja drei Wochen unterwegs!“
Jetzt ist das Lachen auf unserer Seite. Der Mann ist verunsichert. „Na, dann ist Ihre Reise ja das Schnäppchen!“
„Ja, sieht so aus“, erwidere ich und lenke freundlicherweise ab: „Vielleicht sieht man sich ja noch mal, aller guten Dinge sind drei. Ach nee, das war ja nun schon das dritte Mal. Na dann also alles Gute!“
„Alles Gute und schönen Urlaub!“ Wir schütteln die Hände und gehen unserer Wege. Es war unsere letzte Begegnung.
Beim Picknick in einer angenehmen Sandbucht direkt am Kap komme ich ins Gespräch mit dem blonden Mittdreißiger, der auch heute wieder ganz in grün gekleidet ist und dank seiner grün-gelben Turnschuhe weithin leuchtet. In dieser Bucht unterhalten wir uns rege; es ist ein umgänglicher Typ – von Beruf Mediziner. Eigentlich cool: Eine Typ-Beraterin habe ihm einmal die Farbe Grün empfohlen, seither trage er sie konsequent. Längst hat er von mir inoffiziell den Namen „Laubfrosch“ erhalten.
Das Picknick mit traumhafter Kulisse war eine fabelhafte Idee. Beschwingt klettere ich sogar ein wenig in den Felsen herum. Auch der Weg zurück, oberhalb der Steilküste durch viel Grün hindurch, die perfekte Tarnung für unseren „Laubfrosch“, ist mehr als atemberaubend: die Meeresluft herrlich, die Stimmung ausgelassen.
Ilona fotografiert M2 und mich hinter dem Schild „Cape of Good Hope“, dann geht’s nochmals an einer Gruppe Paviane vorüber zurück zum Bus. Diesmal nehmen wir den Weg entlang der etwas wärmeren Küste des Indischen Ozeans, mit kurzem Stopp an einer Pinguin-Kolonie am Boulders Beach. Etwa eine halbe Stunde haben wir Zeit, diese nur auf der Südhalbkugel natürlich vorkommenden Brillenpinguine in ihrem schwarzen Frack zu beobachten (Abb. S. →). Das ältere Ehepaar Almuth und Rüdiger, das vor unseren Augen noch kein einziges Wort miteinander gewechselt hat, sich aber erstaunlich gut auch wortlos zu verstehen scheint, sitzt mit uns auf dem Fels und sieht dem interessanten, niedlichen Spiel der Pinguine aufmerksam zu.
Im Hotel angekommen, erfahren wir zu unserem Leidwesen, dass die gesamte Gruppe nochmals zusammen essen gehen möchte. Wie gern hätten wir den Abend einmal für uns gehabt, so ganz in Ruhe, zum Ausspannen, denn die Eindrücke sind schon jetzt enorm. Da wir aber ebenfalls im „Mama Africa“, einem hier bekannten Restaurant, speisen wollen, trifft sich das Ansinnen der anderen so etwa mit unseren Wünschen und wir erleben dort einen angenehmen Abend, wenngleich ich sehr müde bin. Obgleich wir etwa 30 € zahlen, dinieren wir nicht so gut wie am Abend zuvor. Vielleicht aber sind wir auch einfach nur zu ausgehungert nach den Erlebnissen des Tages? Sehr bekömmlich ist die Flasche Rotwein, ein „Cabernet Sauvignon“, der beste Wein der Karte für immerhin 90 R. Später sollten wir auf dieser Reise guten Wein auch etwa für die Hälfte bekommen. Ich bestelle heute Fisch „Catch of the day“ und M2 hat Springbock (medium) bestellt. Gut, dass wir uns jedes Essen „brüderlich“ teilen, denn mein Fisch ist von der Größe her weniger der Rede wert. Erheiternd ist die Unterhaltungsmusik der drei Schwarzen auf Xylophonen, wofür wir allerdings zehn Rand extra berappen müssen. Dazu kommen noch zehn Rand Trinkgeld, das in Südafrika Pflicht ist; mindestens zehn Prozent. So verbringen wir einen für hiesige Verhältnisse recht teuren Abend und verspüren keine Lust, mit den anderen noch einen Absacker trinken zu gehen.
Stress gibt es plötzlich, als zwei Drittel von uns bereits gegangen sind, jedoch die Rechnung noch nicht bezahlt ist. Zu unserem Erstaunen bringt der Zorn hierüber Heikes jüngeren Freund den Tränen nahe, dabei ließ sich nach langsamem Hin- und Herrechnen ein vermeintliches Defizit aufklären. „Ich glaube, hier ist manch einer noch ganz gewaltig überarbeitet“, raune ich M2 beim Gehen zu.
Mittlerweile stehen links und rechts neben der Tür zwei Schwarze Aufpasser. In Südafrika soll man, sofern nicht die richtige Garderobe angelegt ist, durchaus von einem Lokal ausgeschlossen werden können. Auf der Straße weht ein recht scharfes Lüftchen. Wir begegnen noch einmal unserem Reiseleiter, der erklärt, dass dieser allabendliche starke Wind mit der Vermischung der unterschiedlichen Lufttemperaturen von Land und Wasser zusammenhänge. Naja so ähnlich.
Es ist schon eine spannende, sehr reizvolle Gegend, dieser Küstenstreifen zwischen dem rund 1.000 Meter hohen Tafelberg und dem weiten Meer. Kapstadt ist nicht nur eine recht abgelegene Großstadt, sondern auch eine der schönsten Städte der Welt.
Ergreifende Weite, beklemmende Enge Vom Tafelberg nach Robben Island
Donnerstag, 09. Februar 06: Wir schlafen wieder nur kurz, doch in der warmen Sommerzeit macht das nichts. Das Erwachen in dem hellen, sauberen Zimmer ist angenehm. Kurz nach sieben Uhr besuchen wir unser „Stammlokal“, das wir tags zuvor ausfindig gemacht haben. Es bietet „Breakfast“ zwischen zehn und fünfzehn Rand an. Danach, kurz vor acht Uhr, wandern wir in Richtung Tafelberg, der heute, welch ein Glück, vollkommen frei von Wolken ist. Der Aufstieg bis zur Station der Kabelbahn (115 R pro Person) ist viel anstrengender als gedacht. In die Länge zieht sich vor allem das Stück Wald, in dem es wenige Wochen zuvor gebrannt hat. Dieser Brand ist eine der wenigen Meldungen gewesen, die zuletzt aus Südafrika nach Deutschland vorgedrungen sind. Ausgedehnte Brandspuren sind vor allem am benachbarten Löwenkopf sichtbar; dessen Vegetation ist fast vollkommen vernichtet. Bis an die schmucken, modernen Villen am Fuße des Berges reichte das Feuer heran.
Zunächst ist es die Villenarchitektur, die uns beeindruckt. Die schönsten und edelsten Häuser säumen die Straße, von der sie meist durch Mauern und sogar Stacheldraht- und Elektrozäunen abgetrennt sind. Nicht auf den ersten Blick sichtbar winden sich die Drähte durch blühendes Buschwerk. Hier sehen wir: Kapstadt ist in sozialer Hinsicht eine geteilte Stadt. Während wir in der Innenstadt kaum mehr einheimische Weiße zu Gesicht bekommen, scheinen sich diese hier an den Berghängen in ihren Villen zu verschanzen und in einem eigenen Netzwerk zu agieren. Es dürfte für die sog. Coloured und Schwarzen nach wie vor schwer sein, dort hineinzugelangen. Andererseits: Unser nur wenige Jahre alter Reiseführer schildert Kapstadts Innenstadt noch von Weißen dominiert, wir aber sahen bislang fast nur Schwarze. Wenn kein besseres Miteinander gelingt, werden dann langfristig die Weißen womöglich verdrängt werden?
Schweißgetränkt erreichen wir die Kabelbahn, und zu unserem Glück ist diese halb zehn Uhr noch fast menschenleer. Innerhalb einer viertel Stunde stehen wir in dem Kabinenlift, der sich auf der Fahrt nach oben einmal um die eigene Achse dreht. Almuth hatte am gestrigen Abend davon geschwärmt. Die Sicht während der knapp siebenminütigen Auffahrt ist gigantisch.
Oben angekommen, nehmen wir uns etwa 1½ Stunden Zeit für einen Spaziergang auf dem flachen Plateau, dessen kostbare vielfältige Vegetation in der schönsten Morgensonne liegt. Weit können wir schauen: nach Norden über bergiges Land, nach Osten über das Meer bis hin nach „Robben Island“ und nach Süden über das sich zu unseren Füßen ausbreitende Kapstadt. Die südlichste Stadt des afrikanischen Kontinents ist von oben ein unvergesslicher, beeindruckender Anblick. Noch vor 300 Jahren gab es auch hier wilde Tiere: Elefanten, Giraffen Leoparden. Seither hat sich die Küste deutlich verändert. Wie wir aus den Erläuterungen für eine neben uns stehende Reisegruppe erfahren, wurden weite Teile Kapstadts in jüngerer Zeit künstlich aufgeschüttet; die Uferzone somit erweitert.
Gegen 11 Uhr wandern wir in sengender Hitze von der Kabelbahnstation wieder in die Stadt hinab. Zum Mittagessen suchen wir das „Lavazza-Restaurant“ in der Fußgängerzone auf. Hier haben wir bereits am ersten Tag ganz gut gegessen. M2 nimmt einen Thunfisch-Salat, ich probiere Ostrich und finde während des Essens heraus, dass es sich dabei um Straußenfleisch handeln muss. Der Geschmack ist etwas herb und streng, etwa wie Wildschwein. Später sollte ich frischeren Ostrich genießen können, was doch neutraler mundet. Obgleich es also besseres Fleisch als dieses hier gibt, ist es bekömmlich, und wir entspannen uns unter dem Sonnenschirm mit Blick auf die geschäftigen Menschen. Ein Schwarzer Mann in bunten Gewändern, auf dem Kopf ein Tablett mit allerlei Klimbim balancierend, tanzt an unserem Restaurant auf und ab: mit ewig grinsendem Gesicht und fletschenden Zähnen, dabei merkwürdige Laute von sich gebend. Wir versuchen, nicht hinzuschauen, damit er uns nicht extra beehrt, so wie etwa zwei ältere weiße Damen am Nachbartisch, die ihm einige Münzen zuwerfen.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, da wir uns bereits halb drei an der „Waterfront“ einzufinden haben, um von dort nach „Robben Island“ hinüberzufahren. Das ist der Ort der Gefangenschaft Nelson Mandelas, den vor allem ich unbedingt sehen möchte. Zuvor haben wir einige Besorgungen im Supermarkt zu erledigen, in dem es jetzt lebhaft zugeht. Wir begegnen fast ausschließlich Schwarzen. M2 beobachtet, dass die mitgebrachten Taschen und Tüten der Einheimischen mit einem Klebestreifen verschlossen werden, möglicherweise, damit nichts illegal hineinwandert.
Wir decken uns mit Wasser und Bananen ein, die hier natürlicher gewachsen ausschauen und auch besser als zu Hause schmecken. Da wir sie nicht gewogen haben, holt ein Angestellter das für uns nach. Wie eine Schnecke so langsam watschelt er zur Waage. Die Schlange an einer der vielleicht zwanzig Kassen wird derweilen lang und länger. Alle aber warten geduldig, bis unsere Bananen in allergrößter Langsamkeit wieder auf das Band gelegt werden. Die Verkäuferin schiebt sie über den Scanner und guckt dabei ins Leere – genauso gelangweilt wie gestern. Wir schnappen die Früchte, eilen die Treppe hinauf und zu unserem nur etwa fünf Minuten von hier entfernten Hotel zurück. Jetzt bleibt noch etwa eine halbe Stunde für den Weg zum Hafen. Wo aber liegt genau die „Waterfront“? Wie am ersten Tag durchqueren wir die Stadt in südöstlicher Richtung, laufen aber zunächst konsequent die Adderley hinab, die in die Heerengracht mündet. Im vorigen Jahrhundert sollen in dieser belebten Gegend Eichenbäume einen Wasserlauf gesäumt haben. Nichts davon ist mehr zu sehen. Bei zwei Geschäftsleuten erkundige ich mich nach dem Weg, indem ich ihnen einen Plan vor die Nase halte. Diese mustern mich von oben bis unten und scheinen etwa eine Sekunde lang zu überlegen, ob sie mir Auskunft geben sollen. Einer von ihnen spricht sogar deutsch, und siehe da, wir sind auf dem richtigen Weg. Wie sich herausstellt, sind im Reiseführer die Straßenverhältnisse stark vereinfacht dargestellt. Eine ganze Zeit lang geht‘s nun auf langweiliger, ziemlich breiter Straße gen Hafen.
Die Gegend um den Hafen ist nun wieder interessant; anscheinend neu angelegt. Ein hübsches englisches Uhrtürmchen leuchtet rot vor der blauen Kulisse von Himmel und Wasser (Abb. S. → unten). Diese älteren Gebäude am Wasser sind frisch renoviert und die neuen Häuser fügen sich für meinen Geschmack recht gut in das Ensemble ein. Interessant ist die Halle, von der das Schiff nach „Robben Island“ ablegt. Im unteren Teil des weiten und hellen Gebäudes stimmen eine Reihe weißer Kommoden mit Glasdurchsicht auf den historischen Ort dort drüben auf der Insel ein. Hier, wie auch in den Schubkästen, lagern Gegenstände und Briefe aus dem Gefängnis von „Robben Island“. Hinweisschilder und Schautafeln an den Wänden erläutern die Geschichte der Insel, die bereits im 19. Jahrhundert als Gefängnis genutzt wurde. Die ersten Gefangenen sollen Schwarze Stammeshäuptlinge gewesen sein.