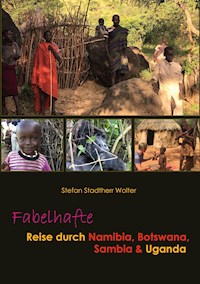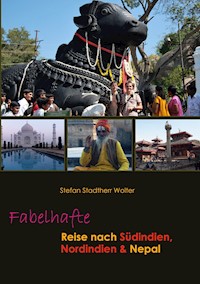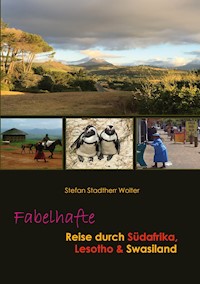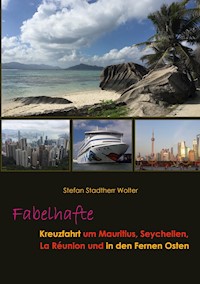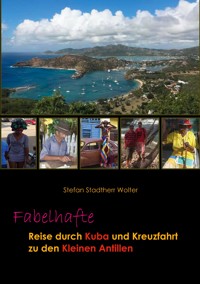
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fabelhafte Reisen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Sehnsuchtsort Karibik! Auf geht`s nach Kuba, in die Dominikanische Republik und zur Inselgruppe der Kleinen Antillen. Welch schaurig-schönes Flair, was für berührende Geschichten - umgeben von faszinierenden Unterwasserwelten und bizarren Korallenriffen! Wie fern und doch so nah sind uns die Geschicke der Menschen all dieser Inseln, die verschiedenen politischen Konstellationen und der melodienreiche, zu Herzen gehende Umgang mit dem Leben. 2006/07, noch regiert die Legende Fidel Castro, bereisen wir Kuba und sind berührt - vom kolonialen Erbe und von den überall präsenten Spuren der Revolution. 2015 steuert die AIDAdiva die "ABC-Inseln" (Aruba, Bonaire und Curaçao) sowie St. Vincent, Grenada, Barbados, Martinique, Dominica, Guadeloupe, Antigua und die Dominikanische Republik an. Das sind Eindrücke von atemberaubender Schönheit! Am Ende der Reise aber beunruhigt eine Beobachtung... Fabelhaft! Jedes Buch hilft Bäume pflanzen für das Weltklima!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinweis:
Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte Dritter wurden die Namen der mitreisenden Personen sowie deren Herkunftsorte geändert. Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Die Darstellungen erfolgen aus dem Blickwinkel des Autors. Trotz aller Sorgfalt kann keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen werden.
Um zu verdeutlichen, dass es sich bei „Schwarzen“ um ein ethnisches sowie politisches Konstrukt, zumeist mit dem Hintergrund von Rassismuserfahrungen, und nicht um eine biologisch klassifizierbare Gruppe handelt, wird in diesem Buch „Schwarz“ auch in adjektivischer Verwendung groß geschrieben.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Karibischer Sozialismus: Reise durch Kuba (2007)
Perlenkette im Atlantik: Schiffsreise von der Dominikanischen Republik zu den Kleinen Antillen (2015)
Es gibt keine Freude ohne gleichzeitiges Missfallen.
Kubanische Weisheit
Vorwort
Fabelhaft- dass es noch gibt, was selten geworden ist in Zeiten von Blogs und Social Media: Eine Reihe feiner Reiseberichte im klassischen Sinne, köstlich präsentiert. Auch ich bin up to date und bediene mich der Kanäle, die wunderbar im Hier und Jetzt verbinden. Doch abgesehen davon, dass vieles von dem noch gar nicht in der heutigen Form existierte, als ich mit Michael (M2) durch die Welt zu reisen begann, hatte ich immer das Ziel, unsere Reisen so tiefgründig wie möglich festzuhalten. Die angestrebte Tiefe gründet in drei Ebenen: das authentische Erleben, das Ausloten der historischen Hintergründe und die ungeschminkte Darstellung des Miteinanders der Reisenden. Das ist es wohl, was der Fabelhaft-Reihe ihren unverwechselbaren Charme verleiht. Und das hütet davor, nach einer Reise simpel alles zu verklären.
Saß man Anfang der 1990er Jahre noch geduldig in einer erzählenden „Bilder-Runde“ zusammen, so änderte sich das einerseits mit der Bilderflut der Digitalkameras, andererseits mit den immer günstiger werdenden Kurztripangeboten. Nicht nur immer mehr Bilder wurden produziert, es wurde auch immer häufiger gereist. Und als wir 2009 erstmals auf einer der AIDA‘s übers Meer schipperten, riet Kapitän Leitzsch bereits ganz unverblümt: „Verschonen Sie Ihre Angehörigen mit Ihren Bildern, die werden mit den eigenen schon nicht mehr fertig!“
Kreuzfahrten ermöglichen in höchster Komfortzone Stippvisiten in fernere Länder und Kulturen, mit denen viele Menschen ansonsten kaum in Berührung kämen. Die Rundum-Betreuung schenkt Geborgenheit; die weithin befriedigte Neugier stillt Sehnsüchte. Insofern kann eine Kreuzfahrt geradezu süchtig machen.
Auch auf den Kreuzfahrten vergaß ich nicht meinen Anspruch des reflektierten Reisens. Dennoch wird auch unser Reiseverhalten im zunehmenden Bewusstsein um den Klimawandel da und dort kritisch beäugt. Dem wollen und können wir uns nicht entziehen, auch im Wissen um die Komplexität des Geschehens: Viele Länder und letztlich die Menschen profitieren vom Tourismus bzw. sind gar auf ihn angewiesen! Wenigstens wollen wir an unserer Entdeckerfreude teilhaben lassen und zum Erkenntnisgewinn beitragen, in anspruchsvoller Unterhaltung.
Das mit dieser Buchreihe verknüpfte Buch-Baum-Projekt möge auch dem Umweltaspekt ein klein wenig Genüge tun.
Fabelhaft- dass mit dieser Reihe eine Möglichkeit gefunden ist, landschaftliche Schönheiten, kulturelle Vielfalt und geschichtliche Hintergründe einzufangen. Doch trotz sorgfältiger Nachbereitung des zeiteffizienten „Durchrauschens“ unterschiedlicher Lebenswelten bleibt eine Diskrepanz zwischen dem, was tatsächlich ist und war und wie es wahrgenommen und verstanden wurde. Ja, selbst Missverständnisse sind möglich und trotz intensiven Nachrecherchierens kann diese Buch-Reihe nicht den wissenschaftlichen Anspruch erheben, für den ich mich bei anderen Werken verbürge.
Wie waren wir gespannt auf den „Sozialismus unter Palmen“, für den die berühmten Revoluzzer Che Guevara und Fidel Castro mit Widerstandskämpfern und Sympathisanten mit der Beseitigung der Herrschaft des Diktators Fulgencio Batista (1901-1973) die Voraussetzungen schufen. Die Geschichte der Revolution begegnete uns auf Schritt und Tritt. Interessiert besahen wir uns die Propagandaplakate, oftmals farbenfreudiger gestaltet als ehemals in der DDR und in der Regel auf den kubanischen Sonderweg zugeschnitten (Abb. S. →). Die häufig authentische Spuren einbeziehende Erinnerungskultur ist berührend.
Unter der US-Regierung von Georg W. Bush kam es zu einer weiteren Verkrampfung des politischen Gegeneinanders. Die Geschichte des Fahnenhügels am Malecón, an den heute nicht mal leere Fahnenstangen noch erinnern, war ein eindrückliches Zeugnis dieser Zeit (Abb. S. →). Wir erlebten ein Land, das das koloniale Erbe nicht verleugnete, von der Substanz zehrte, aber auch Innovationen auf den Weg brachte. Das 1994 eingeführte doppelte Währungssystem wurde 2020 aufgehoben. Doch ist zu befürchten, dass Touristen noch immer eifrig „umworben“ werden.
Hinzu kamen im Jahr 2015 die vielfältigen Eindrücke auf den Kleinen Antillen. Hier faszinierte die je nach politischer Zugehörigkeit unterschiedliche Entwicklung der Inseln.
Bei allem Genuss des AIDA-Komforts und der landschaftlichen Schönheiten mit ihren liebenswürdigen Menschen drängt sich ebenso wie in Kuba die Frage auf, wie schuldig sich die europäisch geprägte Zivilisation einst in der Karibik machte – mit Vertreibung, Ausbeutung und Sklaverei.
Im Vordergrund steht hier der Reisegenuss, der jenen die Erinnerungen aufzufrischen mag, die ebenfalls auf diesen begehrten Routen unterwegs gewesen sind. Für künftige Reisende hält das Buch einen reichen Erfahrungsschatz und vielleicht sogar nützliche Tipps bereit – gemäß der karibischen Weisheit:
„Ein kluger Affe weiß, auf welchen Baum er klettern kann.“
Karibischer Sozialismus: Reise durch Kuba 28.12.06 bis 24.01 . 0 7
28. Dezember 2006: Minus zwei Grad und Dunkelheit können uns nichts anhaben, wir fliehen in den karibischen Sommer, wir fliegen nach Kuba! Gegen halb acht Uhr morgens geht’s zum Flughafen Frankfurt/Main. „Viel zu früh“, jammere ich schlaftrunken.
Bis zum Einchecken ist noch über eine Stunde Zeit und unser Gate D 24 im Terminal 2 mit Sicherheitsbändern weiträumig abgesperrt. Unheil verheißend dröhnt die Warnung vor einer „herrenlose Aktentasche“ durch die Lautsprecher. Doch nervös ist die Stimmung nicht. Der 11. September 2001 liegt weit genug zurück und inzwischen hat man hier Routine. Eine halbe Stunde später entpuppt sich die „herrenlose Aktentasche“ als „aktenlose Herrentasche“ – ohne Sprengstoff. Wir dürfen die Sicherheitskontrolle passieren. Die Pässe können wir noch stecken lassen, zunächst geht‘s „nur“ zum Umsteigen nach Paris – wo ich auch noch nicht gewesen bin.
Gegen 11 Uhr erheben wir uns in die Lüfte. Keks und Tee sorgen für Kurzweil. Zwar landen wir wie vorgesehen Punkt 12, dürfen aber diese kleine Maschine nicht verlassen. Was ist los? Ist man mit der Abfertigung eines anderen Flugzeugs nicht fertig geworden?! Zwanzig Minuten warten wir an Bord, doch es tut sich nichts. Mit dem Anschlussflug könnte es knapp werden – 12.45 Uhr soll nach Kuba eingecheckt werden. Die Stewards stolzieren durch die Reihen, besänftigen, geben Erläuterungen und Ratschläge. Dann endlich dürfen wir aussteigen. Den wahren Grund dieses Wartens erfahren wir nicht.
Unsere Sorge scheint berechtigt. Tatsächlich ist der Weg zum Gate A 39 länger als gedacht. Während wir endlich aus diesem Flugzeug befreit durch die verworrenen Gänge hasten, vertraue ich ganz auf M2‘s Instinkt und sauge den Flair des Flughafens und einen Hauch Paris in mich ein. Auf der Rolltreppe überholen wir einige parfümierte Damen, um rasch zur Sicherheitskontrolle zu gelangen. Die Beamten agieren an drei Tischen nebeneinander. Gelangweilt prüft eine Dicke den Inhalt meines durchleuchteten Koffers. Alles geht hier rasch und komplikationslos vor sich. Wir haben auch keine Zeit zu verlieren. Endlich: Gegen 13 Uhr besteigen wir einen riesigen Doppeldecker, unsere Boeing. Nie zuvor bin ich mit solch einem gigantischen „Gerät“ geflogen. Gegliedert in etwa fünf Einheiten mit „Teeküche“, reicht das Flugzeug über zwei Etagen. Das obere Stockwerk ist der 1. Klasse vorbehalten, vorn sitzt die Crew.
Ziemlich weit am vorderen Ende dieses Riesenvogels haben auch wir unsere Plätze eingenommen. Ich direkt am Fenster, M2 zu seinem Leidwesen neben einem unglaublich fettleibigen Mann, der zusätzlich einengt. Nur mit Mühe gelingt es diesem, den Gurt über seinem dicken Bauch zu schließen. Da sitzen wir nun alle drei, schweigend auf die Dinge wartend, die da kommen.
Doch sie kommen nicht. Eine halbe Stunde vergeht, nichts passiert. Nach einer Dreiviertelstunde scheint selbst das Personal unruhig zu werden. Manch einer schaut sich besorgt um, das Personal hat vielfache Fragen zu beantworten – in Französisch und Englisch, deshalb verstehen wir es kaum.
„Oh je, das geht ja gut los. Bestimmt ist das Flugzeug kaputt“, verunsichere ich M2. „Sorry“ rufe ich dem älteren Steward zu. „What’s happen?“ Alles, was ich verstehe, ist: “difficult problems”. Das ist nichts Neues. M2 ist blass.
Mit den Leuten vor und hinter uns versuche ich in Kontakt zu treten, aber ein Deutscher ist weit und breit nicht zu sehen. Wir fühlen uns gerade so ein bisschen ausgeliefert.
„Luggage“ macht da plötzlich ein Begriff die Runde. Irgendetwas soll mit der Gepäckbeförderung nicht stimmen, meint M2 herausgehört zu haben. „Ach, das sagen die nur so. Die Bordelektronik wird ausgefallen sein“, flüstere ich in Galgenhumor. Ohnehin ist uns ein wenig mulmig, so viele Stunden über den Atlantik zu fliegen. In die Gedanken versteift, dass wir in Kürze auch ableben könnten, sende ich noch ein paar SMS, unter anderem an Freund Gustav, der mit seiner Mutter in Frankreich einen Schneeurlaub verbringt. Er grüßt zurück aus 3.400 m Höhe. Der hat’s gut, der ist schon oben.
Es ist nun fast 15 Uhr und endlich geht es los. Beim Starten des Giganten werden wir gehörig in den Sitz gedrückt, dürfen uns aber bald entspannen. Ruhig gleiten wir in den Lüften dahin, der Sonne und der Wärme entgegen. Zwischen 17 und 18 Uhr gibt’s endlich auch das erste ersehnte Essen: Hühnerklein mit Kartoffelbrei und Zucchinigemüse, außerdem Hähnchenstreifen mit Kartoffeln, grünen Bohnen und Salat. Dazu werden zwei Brötchen, Käse, Butter, eine kleines Fläschchen Wein aus Südfrankreich und ein nettes Fläschchen Rumlikör gereicht. Mit dem stoßen wir an: „Auf die Reise!“ – „Auf die Reise!“
Ein Hauch von Wärme und Freude durchströmt uns, während es unter uns immer kälter wird. Gegen 20 Uhr MEZ glaube ich Grönland zu erkennen. Wir fliegen über tief verschneite Berge, alles scheint dort unten friedlich. Eine Lichterkette grenzt ans dunkle Meer: Wie werden die Menschen dort leben? Sicherlich haben sie gut eingeheizt und bereiten nun das Abendessen vor. Plötzlich stelle ich mir eine gemütliche Holzhütte mit dem Flair einer finnischen Sauna vor. Darauf hätte ich jetzt Lust! Für die Vorstellung von karibischer Sonne und Abenteuer pur bin ich nämlich gerade zu müde. Kein Wunder, es ist inzwischen auch schon 21 Uhr MEZ und wir sind satt wie gefütterte Säuglinge. Da kann man auch schon schlafen. Doch ausgerechnet jetzt geraten wir in ein Unwetter. Es rumpelt und rattert, wir sinken ab und steigen auf. Hhmmm, der klammernde Griff an die Sitzlehne wird fester. Erst zwanzig Minuten später wird’s wieder ruhig – endlich Gelegenheit, ein bisschen zu dösen.
Irgendwann meldet sich der Durst, doch es gibt nichts zu trinken. Endlich traue ich mich, anderen es nachzumachen und mich der Getränkeflaschen, die in der Minibar herumstehen, selbst zu bedienen. Wie ein Steward hantiere ich nun dort herum und komme mit einigen der Umstehenden ins Gespräch. Ein blonder Holländer neben mir bestätigt den schlechten Service von „Air France“. Die „Martin-Air“ sei viel besser. Der nette Typ hat eine Autotour durch Kuba geplant, zusammen mit Freunden. Sicherlich auch schön! Auf der anderen Seite von mir amüsiert sich ein Grüppchen Schwarzer Kubanerinnen und Kubaner in lockerem Gespräch.
Gegen 24 Uhr MEZ werden wir wieder an unseren Plätzen bedient, mit einem einfachen Abendessen. Danach stelle ich meine Uhr sechs Stunden zurück.
Gut eine Stunde nach dem Abendessen setzen wir zur Landung an: Es ist 19 Uhr Ortszeit und auch hier schon dunkel. Da und dort blinkt ein Licht auf. „Das ist Kuba!“
Auch M2 ist neugierig geworden. Rasch rücken die vereinzelten Lampen und Häuser näher. Schemenhaft sind ganze Ortschaften zu erkennen, doch zusammenhängende Lichterketten fehlen.
„Das ist schon Havanna!“ jauchzt M2. Tatsächlich: Jetzt erkenne auch ich lange Straßenzüge in spärlicher Beleuchtung – nur an den Ecken brennt eine Laterne. Unter uns liegt eine Großstadt, allerdings in Finsternis getaucht. Und das gruselt mich jetzt ein bisschen. Neulich erst hatte ich einen Fernsehbericht über einen weiteren sozialistischen Staat mit Energieproblemen gesehen: Nordkorea.
Die beängstigende und bedrückende Tristesse und Dunkelheit dort hatten mich negativ berührt. Und jetzt kommen Zweifel auf. Wie werden wir dieses Land hier erleben oder überleben? Immerhin wollen wir zehn Tage zu zweit die Gegend in und um Havanna erkunden, ehe wir uns einer Reisegruppe anschließen, mit der wir dann etwas sicherer durchs Land reisen werden – zunächst ins Valle de Viñales, dann nach Cienfuegos, Camagüey, Trinidad, in die Sierra Maestra, nach Santiago de Cuba, Santa Clara und abschließend nach Varadero.
Die schwindende Vorfreude beim Anblick Kubas von oben weicht zum Glück der Neugier. Wir entsteigen dem Riesenvogel und gelangen durch einen längeren Gang in eine rotbraun-beige Halle. Diese ist trotz einiger bunter Werbeplakate für Kuba mit der Aufschrift „Cuba Si“ trist und muffig.
Unser Weg endet vor einer Reihe von etwa 22 Schaltern, von denen wir uns an Schalter 17 anstellen. „Schalter“ ist ein verharmlosender Begriff für die Schranke zwischen Ankunftshalle und Zutritt zum Land. Näher dran, werfen wir einen genaueren Blick in die Kabinen aus billigem Sperrholz, in die man nur einzeln eintreten darf. Ein Spiegel links über dem Kopf offenbart dem Beamten den gesamten Körper des Einreisenden. Lange muss der Ankömmling dort stehen, während der Beamte hinter dem Fensterchen etwas zu prüfen scheint. Dann öffnet sich die Tür mit einem lauten Surren und entlässt den Inspizierten. Erst nachdem die Tür wieder ins Schloss gefallen ist, wird der nächste herangewinkt. So werden etwa zehn Personen abgefertigt, ehe wir an der Reihe sind. Ein Glück, dass wir im Flugzeug ziemlich weit vorn saßen, denn längst nicht alle dieser Abfertigungskabinen sind geöffnet und die Warteschlangen werden lang und länger. An den Füßen schnüffeln Hunde. Was sie wohl suchen? Gegen den modrigen Schimmelpilzgestank, der durch die Halle wabert, scheinen sie immun zu sein.
Endlich bin ich an der Reihe. Ich stelle mich vor dem Fensterchen in Kabine 17 auf, die mich plötzlich an die Ausreise nach Westberlin im November 1989 erinnert. Lange guckt mir der junge Beamte intensiv in die Augen, dann wieder in den Pass, dann wieder in die Augen. Ich kann dem Blick dieser schönen himmelblauen Augen kaum standhalten, bloß nicht lachen. Endlich erhalte ich meinen Ausweis zurück, und das Surren der Tür entlässt mich.
Ich bin enttäuscht. Nach dieser Prozession habe ich nun wenigstens mit einem großen Stempel im Ausweis gerechnet. Nichts dergleichen. Doch wie wir noch erfahren werden, würde dieser eine möglicherweise später einmal geplante Einreise in die USA erschweren. Die beiden Länder sind bekanntlich Erzfeinde.
Im feuchten Schimmelpilzgestank warten wir nun auf unsere Koffer und M2 tauscht bereits ein wenig Geld: 1 Euro entsprechen etwa 0,80 Peso convertible (CUC). Endlich können wir den Bau hinter uns lassen und treten in die warme, wispernde Luft der Karibik hinaus. Es sind noch immer 25 Grad Celsius. Winter und Strapazen sind verflogen, der Sommer duftet nach Palmen und Gras.
Mit einem Taxi sausen wir die nahezu autofreie, von Fahnen in den Nationalfarben geschmückte Straße hinab nach Vedado, dem modernen, einst sogar mondänen Stadtbezirk Havannas. Eine kleine Uhr zeigt 19.59 Uhr. Passt ja, denke ich: Mit dem Jahr 1959 siegte die Revolution.
Allerdings sind wir durch die Startschwierigkeiten des Flugzeugs nun zwei Stunden zu spät dran – und es ist dunkel.
Der Taxifahrer beherrscht ein wenig Deutsch. Er erzählt, dass er ein paar Monate in der DDR gearbeitet habe, in Merseburg. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es ihm dort gefallen haben könnte, in einer der umweltbelastetsten Gegenden der DDR. Doch er gerät beinahe ins Schwärmen. Sicherlich war es ein großes Abenteuer, und außerdem: Damals war er noch jung und voller Illusionen.
Dass auch unsere Zeit der Vorfreude und Illusion gleich schlagartig vorbei sein wird, ahnen wir noch nicht. Immerhin haben wir jetzt unsere vermeintliche Unterkunft erreicht. M2 hat erstmals übers Internet gebucht – für eine knappe Woche. Eine wunderschöne Wohnung soll es sein, im Herzen des pulsierenden, von prächtigen Villen aus dem frühen 20. Jahrhundert geprägten Stadtteils Vedado.
Obgleich es stockfinster ist, imponiert die alte weiße Stadtvilla mit ihren vorgesetzten Säulen. Spärliches Licht fällt aus dem oberen Stockwerk auf die blühenden Büsche und grünenden Palmen im Garten. Da stehen wir nun inmitten des zirpenden Grüns unter Kubas Sternen und klingeln bei der Person, die M2 übers Internet als Ansprechpartnerin genannt worden war. Doch – es meldet sich niemand. Das bühnenreife Theaterstück nimmt seinen Lauf.
Wir klingeln noch einmal, diesmal länger. Wieder nichts! Oh je, wir sind ja auch zwei Stunden zu spät dran. Wir klingeln abermals und mustern die gepflasterte Terrasse. Es ist ein einstiges herrschaftliches Anwesen. Da geht endlich eine riesige alte Laterne zwischen den neoklassizistischen Säulen an, wirft jedoch nur ein spärliches Licht. Gleichzeitig rumpelt es im Haus. Ein Fenster öffnet sich und eine Frau guckt heraus, sich einen Bademantel überstreifend. Welch ein Glück! Erwartungsvoll schauen wir nach oben. „Hallo, we are Mr. Stadtherr and Wolter, we booked a flat.”
“Oh no!” Das Fenster fliegt zu.
„Was ist das denn?“, rufe ich entsetzt, „ich denke hier haben wir gebucht?“
M2 wird ebenfalls unruhig: „Die Frau hier soll nur den Schlüssel zur Wohnung haben, weil unser Vermieter heute Abend nicht da ist. Es kann auch sein, dass wir woanders schlafen.“
„Na, das ist ja eine schöne Bescherung“, ärgere ich mich vor allem darüber, dass ich mich im Vorfeld der Reise um nichts gekümmert habe. Bis zuletzt beschäftigte mich mein Buch über das Klinikum Quedlinburg. Was soll nun aus uns werden, mehr als 10.000 Kilometer von zu Hause entfernt, mitten in der Nacht? Wir klingeln abermals. Da geht das Licht im Treppenhaus an, die Frau klappert nach unten. Sie öffnet die Tür und krümmt sich am Türrahmen, lachend oder weinend? Unaufhörlich plappert sie: „Oh no!“
„Sie ist betrunken“, flüstere ich.
„Sag doch mal was auf Englisch“, raunt M2 fassungslos. Ich wiederhole unseren Vers. Doch sie versteht nicht oder will nicht verstehen, dann aber deutet sie an, dass wir gemeinsam telefonieren wollen, oben in ihrer Wohnung.
„Bleibe hier bei dem Gepäck, ich gehe mit“, rufe ich M2 zu.
Eine schmale Treppe mit vielen Stufen führt in eine mit Stuck und altem Bleikristallleuchter prachtvoll ausgestaltete, jedoch nur spärlich eingerichtete Wohnung. Verstörend diese offensichtliche Armut inmitten der prächtigen Hülle aus besseren Zeiten.
Am Tisch vor einer geöffneten Balkontür sitzt ein halbnackter üppiger Mann in den Fünfzigern, nagend an einem Fleischstück. Die Frau deutet mir an, mich zu setzen und wählt eine Nummer. Dann schwatzt sie und lacht, schwatzt und schwatzt, und dann darf ich wieder nach unten gehen. Den Hörer habe ich also gar nicht in die Hand bekommen und der Mann hinter mir hat sich auch nicht im Geringsten stören lassen bei seinem Hühnerfraß.
„Alles sehr komisch. Hier stimmt was nicht“, berichte ich M2 aufgeregt, zurück unten im Garten.
„Come please!“, sagt da die Frau und führt uns nun die stockdunkle Straße hinab bis an eine Ecke, an der wir, umgeben von Schmutz, leeren Büchsen und Flaschen, zu warten haben. Es raschelt und nervös schaue ich mich um. Unter den im fahlen Licht einer einzigen Straßenlampe gerade noch schemenhaft erkennbaren Bäumen huschen kleine Pelztiere umher. „Raton“ erklärt diese Frau auf unseren angestrengt starrenden Blick hin. Das Wort kenne ich noch aus Argentinien (1994). „Es sind Ratten“, übersetze ich M2.
Die Dame scheint es nicht eilig zu haben. Nach einer halben bis dreiviertel Stunde etwa kommt ein Jugendlicher um die 26 des Weges geschlendert und gibt uns lasch die Hand. Die Dame verabschiedet sich und wir sind mit diesem wildfremden Jungen allein. Er deutet an, ihm zu folgen. Nun geht’s die dunkle Straße hinab, während es von den Balkonen links und rechts lärmt. Hier wird gesungen und getanzt, dort geschrieen. „Sie sind alle betrunken“, flüstere ich wieder.
Der wildfremde Junge versteht kaum Englisch, noch weniger Deutsch. Drei Straßen weiter scheinen wir am Ziel zu sein. Der junge Mann klingelt. Hinter der Tür poltert es, dann öffnet eine dicke ältere Frau die Tür und wir stehen in einem großen Wohnflur mit einem Schaukelstuhl vor dem viel zu lauten Fernseher. Es stinkt nach Propangas. Ohne große Worte führt uns die Frau in einen Raum links neben der Küche. Vor einem vergitterten Fenster steht eine Doppelliege. „You can stay here or there“, sagt der Junge und zeigt uns einen weiteren, aber fensterlosen Raum zwischen Flur und Klo.
„Was wird das denn?“, raune ich M2 gereizt zu, „ich denke wir haben eine eigene Wohnung gebucht?“. Auch M2 versteht die Welt nicht mehr.
„Ich bleibe hier nicht“, sage ich bestimmt, während uns der Junge erwartungsvoll anguckt.
„Wo willst Du denn jetzt hin“, gibt M2 nicht weniger entnervt zurück. Wir sind in Kuba, ohne staatliche Genehmigung werden wir kein privates Ausweichquartier finden!
Oh nein, mir wird schummrig! Wie konnte ich freiwillig in den „Kommunismus“ zurückkehren?
Was soll‘s. Ich schicke mich ins Schicksal und stelle mich auf eine Nacht „Zwangsaufenthalt“ ein. Doch stimme ich für das größere Zimmer mit vergittertem Fenster. Wir stellen dort unser Gepäck hinein und der Junge wirkt zufrieden. Auch die Alte ist zufrieden. Was sie sich verspricht, weiß ich nicht. Jetzt jedenfalls gibt sie uns zu verstehen, dass uns der Junge ein Restaurant zeigen wird.
„Nein, so schnell bin ich nicht ruhigzustellen“, ärgere ich mich noch immer. Ist es nicht möglich, mit dem Vermieter unserer nicht zugänglichen Ferienwohnung zu telefonieren? Die Alte drückt mir den Hörer in die Hand und guckt erwartungsvoll. Doch der vermeintliche „Vermieter“ lebt gar nicht auf Kuba, wie sich herausstellt, sondern in Deutschland. Die auf Kuba vermittelnde Dame am anderen Ende der Leitung verspricht, am nächsten Tag eine Ferienwohnung zu besorgen. Unsere gebuchte Wohnung sei besetzt. „So much tourists“, stöhnt sie.
„Okay, also wir bleiben“, gebe ich klein bei. Und während ich die linke Seite des Ehebettes in Beschlag nehme, ärgere ich mich über M2, der das alles scheinbar gelassen nimmt. „Mehr als eine Nacht bleibe ich nicht“, versuche ich ihn aus der Reserve zu locken und erbitte uns von der Frau den Schlüssel von diesem Zimmer.
„Wir müssen verrückt sein. Gehen in einem fremden Land zu wildfremden Leuten, geben dort sämtliche Sachen ab und gehen dann essen“, jammere ich, die Wertsachen in unseren kleinen Rucksack stopfend. Zehn Minuten später sitzen wir in der nahe gelegenen Bar unter Neonlicht. Immerhin gibt‘s hier netterweise einen Goldfischteich mit ein paar üppig grünen Gewächsen drum herum. Das vermittelt ein bisschen das erwartete Karibik-Flair. Hier machen wir nun auch die erste Bekanntschaft mit einer kubanischen Mahlzeit: Schweinefleisch und Hähnchenschenkel, dazu Pommes und Reis mit roten Bohnen.
Gegen 23 Uhr, in Deutschland ist es jetzt 5 Uhr morgens, betreten wir wieder die Wohnung. Wenigstens ist zumindest in Deutschland die Nacht schon herum. Mutter und Sohn sitzen noch immer vor dem lauten Fernseher. Wieder steigt der penetrante Geruch nach Gas – oder ist es Abwasser? – in die Nase. Der Sohn zeigt sich geschäftstüchtig. Für umgerechnet 6 € pro Person dürfen wir morgen hier frühstücken.
„It’s too much“, schreie ich wieder unfreundlich. In der Tat ist das zu viel für diese Verhältnisse hier. Und außerdem würde ich in dieser Bude nur ungern etwas zu mir nehmen.
„Oh, it‘s with eggs and salad“, versucht er uns umzustimmen. Wir lehnen dankend ab.
Die Frau erklärt uns nun, dass es in der Wohnung zwar zwei Badezimmer gibt, wir aber nur das kleine hinter einem fensterlosen Schlafzimmer benutzen dürfen. Das andere sei für eine Studentin aus Deutschland reserviert, die ein Sprachstudium in Havanna absolviere. Unser Zimmer finden wir noch immer abgeschlossen vor, doch seltsamerweise stehen unsere Rucksäcke nicht mehr auf dem Bett, sondern auf dem Boden. Es ist ja klar, dass die Familie einen Zweitschlüssel besitzt. Unter dem spärlichen Wasserstrahl der in die Jahre gekommenen Dusche versuche ich mich zu waschen; M2 ist das nichts. Auch Waschbecken und Wasserklosett geben kaum Wasser her. Und anstelle des Spülknopfes prangt da ein von Schmutz beflecktes rotes Stoffröschen, das es nach oben zu ziehen gilt.
„Komisch und schrecklich“, stöhne ich, während ich mich ins Bett lege. So hatte ich mir die erste Nacht in Havanna nicht vorgestellt. M2, der wenigstens auch alles nur eklig findet, aber total erschöpft ist, schläft sofort ein. Meine Augen wandern durch diesen schlichten Raum – vom Propeller über uns, hin zu den kleinen, zum Teil mit Fensterläden und Gittern ausgestatteten Fenstern, dann zu einer Tür zum benachbarten Badezimmer, das wir nicht benutzen dürfen.
„Mist, jetzt muss ich vor Aufregung schon aufs Klo“, murmele ich eine Stunde später und schleiche mich aus dem Zimmer. Im Wohnflur brennt noch Licht, doch zu sehen ist niemand. Auch nicht im fensterlosen Schlafzimmer vor dem Klo. Ich ziehe wieder an der kleinen roten Stoffblume und schleiche voll Ekel zu meinem Bett zurück. Einschlafen kann ich noch immer nicht. Plötzlich schrecke ich auf. Ein nicht enden wollender Hustenanfall aus dem verbotenen Badezimmer nebenan reißt auch M2 aus dem Schlaf.
„Solch einen Husten habe ich noch nie gehört“, flüsterte ich besorgt, während der Anfall in einen brechartigen Auswurf mündet, danach ist es totenstill.
„Es ist grauenhaft“, jammere ich vor mich hin, während M2 und ich mit klopfendem Herzen im Bett liegen. Da beginnt der Anfall von neuem. Ein Mann stöhnt, ringt nach Luft, speit und hustet.
„Du Micha?“
„Ja?“
„Wahrscheinlich hat er Tuberkulose, daher dürfen wir nicht ins Badezimmer.“
Jetzt steigert sich auch M2‘s Furcht. Tbc! Wir müssen verrückt sein, was wollen wir nur hier? Ich starre wieder an die Decke, wünsche mich zurück nach Deutschland und zähle die Tage. Doch es sind und bleiben knapp vier Wochen Kuba. Weniger werden es nicht.
Nach etwa zwei Stunden drückt schon wieder die Blase. Jetzt ist es im Wohnzimmer dunkel und ich leuchte mit der Taschenlampe den Weg. Da schrecke ich zusammen! Die Alte hat sich ein Lager auf dem Boden gebaut – direkt vor der Haustür. Na klar, wir liegen ja in ihrem Bett! Hier kommt so einfach keiner mehr raus.
Ich wandere mit der Taschenlampe weiter – durch das fensterlose Schlafzimmer zum Klo. Das erschreckt den Sohn des Hauses, der nun auf dem Bett vor der Klotür liegt. Der Blasendruck ist schlagartig weg. Schließlich aber überwinde ich mich doch, neben dem Jungen zu pieseln und ziehe anschließend wieder an diesem roten Röschen. Die Hand voller Abscheu von mir gestreckt, schlafe ich nun endlich ein und sogar bis gegen 5 Uhr durch. Dann drückt abermals die Blase – das gibt es doch nicht! Die pure Aufregung! Inzwischen habe ich darin nun Routine und M2 folgt mir nach. Die Alte vor der Tür schnarcht laut, der Junge schläft tief und fest und das Husten des Unbekannten ist verstummt. Wir ziehen am roten Röschen und legen uns wieder schlafen. Cuba, Si!?
“ Hotel Deauville – Blick über Havanna und das atlantische Meer“ Havanna
29. Dezember 2006: Endlich schimmert die Sonne durch den halbgeschlossenen Fensterladen. Auf dem Balkon hinter der Küche scheppert es. Das klingt, als würde mit einer Pumpe Wasser in Gefäße gefüllt. Wegen des Wassermangels tragen manche Häuser einen Tank zum Auffangen von Regenwasser auf dem Dach. Das wird‘s sein, versuche ich diese Geräusche einzuordnen.
So zögerlich ich mich schlafen gelegt habe, so wild springe ich nun aus dem Bett. Wortlos gehe ich ins Klo, um mich zu erfrischen. Der Junge ist aufgestanden und auch die Alte ist schon beschäftigt. In der Küche bereitet sie das Frühstück vor, verteilt Tomatenschnipsel und Käse auf mehrere Scheiben Brot.
„Haben wir der deutlich zu verstehen gegeben, dass wir hier nicht frühstücken?“, sorge ich mich gegenüber M2. Auch er ist hellwach und sich sicher, hier nichts anrühren zu wollen.
„Ich habe überhaupt keine Lust mehr auf das hier“, stöhne ich. „Los, lass uns abhauen und eine andere Bleibe suchen. Wer weiß, ob die Frau, mit der ich gestern telefonierte, jemals kommt und wo sie uns dann hinführt!“
M2, der besser geschlafen hat, erkennt die Not am Mann und hat eine glänzende Idee: Hotel Deauville am Malecón. Das ist die wohl berühmteste Straße von Havanna und eine beliebte Flaniermeile. In gut einer Woche werden wir dort ja sowieso unterkommen – mit unserer Reisegruppe, mit der wir dann das gesamte Land durchstreifen wollen. So könnten wir das Hotel quasi vortesten. Und in ein paar Tagen fahren wir sowieso weiter ans Meer. Dass das die nächste Pleite wird, ahnen wir jetzt noch nicht. Zum Glück! Wir packen unsere Sachen zusammen, von denen wir lediglich die Wertsachen auf die Zimmersuche mitnehmen. Wir schließen ab und laufen im strammen Schritt beinahe panisch vorwärts Richtung Atlantik – weg von diesem Loch, der Zukunft entgegen. Das Hotel soll unserem Stadtplan zufolge irgendwo dort liegen, wo die Sonne jetzt steht. Romantisch! Doch das uns umgebende Grün und die Wärme nehmen wir gerade kaum wahr. Dass diese Gegend hier mit einem Park glänzt und tatsächlich noch heute besser situiert zu sein scheint, ist aber nicht zu übersehen.
Bei einigen Arbeitern am Straßenrand erkundigen wir uns nach dem Hotel unserer Hoffnung, dem „Deauville“. Bis dorthin sollen es rund drei Kilometer sein. Wir laufen und laufen, die Luft ist frisch und salzig, und die Sonne steigt erstaunlich schnell am Horizont empor. Jetzt brennt die Kehle und drückt der Hunger. Wie von Sinnen hasten wir vorwärts. „Sind wir noch normal“, frage ich mich lautstark: „Wir rennen hier durch Havanna, haben das Gepäck bei dieser wildfremden Familie gelassen und wissen nicht wohin!“
Da erreichen wir das mondäne Nationalhotel, das uns zu teuer ist. Kurz darauf haben wir die Uferpromenade, den Malecón, erreicht. Nach etwa 200 Metern erblicken wir endlich ein Hochhaus an der Straße, in dem M2 glaubt, das „Deauville“ zu erblicken (Abb. S. → oben links). Knapp einen Kilometer noch am Meer entlang, dann ist das Hotel mit vorletzter Kraft erreicht. Gott sei Dank ist ein Zimmer frei, sogar im neunten Stock, also fast ganz oben, mit einem fabelhaften Blick auf Havanna und das Atlantische Meer (Abb. S. → unten). Zwar riecht es bestialisch muffig und wir können nicht klären, ob es nach Rattengift oder irgendeinem Putzmittel stinkt – und ob die Quelle dieses Gestanks das fensterlose Vorzimmer oder aber das Badezimmer ist. Doch in diesem Moment ist es für uns die Rettung. Den Fahrstuhl wollen wir wegen der berüchtigten Stromausfälle nicht nutzen und mühen uns mit dem Treppenhaus ab. 9 Stockwerke!
Mit dem Taxi fahren wir zurück zu unserem nächtlichen Domizil, packen die Sachen ins Auto, bezahlen 30 € für die Nacht – wenn das mal kein Geschäft für die beiden war – und brausen unter den verständnislosen Blicken der Vermieter davon.
Geschafft! Früher hätte ich mir Gedanken darüber gemacht, wie die „armen“ Leute unseren Abgang verkraften würden. Gerade ist mir das aber ganz egal. Immerhin haben wir diese Nacht, die wir eigentlich in einer gebuchten Wohnung verbringen wollten, gut bezahlt – und ich habe kaum ein Auge zugemacht.
So also wird nun das Hotel Devauille am Malecón unser Domizil für die kommenden vier Nächte. Ein „heißer“ geschichtlicher Ort, der nach seiner Erbauung 1957/58 eine kurze Phase als Casinohotel erlebt hat. Unsere Geister kehren zurück. Am frühen Nachmittag studieren wir das Leben in der Avenida de Italia (Galiano), die sich recht lang von der Uferpromenade, dem Malecón, in Richtung Altstadt-Zentrum erstreckt.
In der Straße herrscht ein wildes, fast hektisches Treiben. Menschen eilen hin und her, meist einfach bekleidet, mit zumeist sehr ansehnlicher Figur. Alte Straßenkreuzer, mitunter mächtige Schiffe, schieben sich um die Ecke – über und über voll mit Menschen. Von den Balkonen lärmt Musik herab. Die Häuser sind heruntergekommen, doch an bröckelnden Putz und herabhängende Leitungen scheinen die Einheimischen ebenso gewöhnt zu sein, wie an die klaffenden Löcher auf dem Gehweg. Mal mangelt es nur an einigen Pflasterplatten, mal aber fehlt sogar ein Gullydeckel. Mich wundert, dass nicht schon ein paar Touristen im Kanal verschwunden sind.
Unter den etlichen ärmlich anzusehenden Läden befinden sich offensichtlich auch Geschäfte für ausschließlich Peso convertible (CUC). Vor einem solch besser ausschauenden und gut bestückten Laden müssen die Taschen abgegeben werden. Gleich daneben bietet ein Pizza-Verkäufer seine ganz einfachen, dünn mit Käse und Ketchup bestrichenen Teilchen aus einem kleinen Fensterchen an. Gegenüber stehen die Kubanerinnen vor einem feinen Schuhladen Schlange. Die Schuhe gibt es offensichtlich ebenfalls nicht für den einfachen Peso, weshalb die Kunden, die sicherlich oft auch nur schauen und träumen, nur nach und nach hineingelassen werden.
Schuhe scheinen so rar wie begehrt zu sein: Ein Schuster nebenan beschäftigt etwa sechs bis sieben Angestellte, die hinter ihren schmutzigen Tischchen nähen, flicken und kleben. Solche Schuster kenne ich noch gut aus meiner Kindheit -– wie liebte ich den Geruch nach Leder und Kleber!
Neben dem Schusterladen stehen da, wo nur noch spärliche Reste von einem Haus übrig sind, verschiedene Stände für Gemüse und Fleisch. An letzterem werden aus großen Schweinestücken Fleischlappen geschnitten, die in Brötchen geklemmt mit Gewürz bestreut oder mit einem geschnetzelten Salat angeboten werden. Das sieht nicht wirklich appetitlich aus. Scheint aber ziemlich echt kubanisch zu sein, wie wir noch erleben werden. Außerdem gibt‘s jede Menge Schweinefüße. Sie „schmoren“ in der Nachmittagssonne auf einem riesigen Berg, von potentiellen Kunden eifrig begutachtet und sogar betastet. Schweinefleisch hatte ich eher nicht mit der Karibik assoziiert. Aber dazu ist das Reisen ja da – Realität erleben und den Horizont erweitern.
Nach einem kurzen Blick des Staunens ziehen wir weiter, an vielen leeren Läden vorüber, in denen außer Vitrinen kaum etwas zu finden ist. So blicken wir in ein ehemaliges Kasino aus Kolonialzeiten mit einer unter der Decke um den Raum führenden Galerie hinein. Das Haus in seiner verblichenen Pracht dient heute als Kaufhaus. Wenigstens zum Ausruhen eignet sich dieser Laden, ausgestattet mit einer großen Sitzecke mit Grünpflanzen drum herum. In diesem Geschäft wird unsystematisch angeboten, was gerade vorhanden ist: Kleidung, Kochtöpfe, Kämme und andere Waren des täglichen Bedarfs; auch Lebensmittel. Alles ist übersichtlich geordnet. Kein Kunststück bei dem Wenigen, was vorhanden ist. In einer Vitrine vor uns liegen neben einem Kamm drei Rasierer aufgereiht. Jeder Kauf wird an der Kasse schräg rüber auf einem Quittungsblock notiert.
Gleich mehrere solcher Läden mit „umfassenden Angeboten“ gibt es zu bestaunen. Eines dieser Kaufhäuser bietet in einer Vitrine Unisexgel an, was immer das sein mag. Gleich daneben gibt’s frittierte Hühnchen und Hamburger und noch eine Theke weiter Eis oder Kuchen. Spezialgeschäfte scheinen sich nicht anzubieten, zu gering ist die Auswahl und zu rar das Angebot.
Wir biegen nach links in die Straße „Barcelona“ ein. Die führt direkt auf die Straße „Industria“, deren Name vielleicht auf die weltberühmte Zigarrenfabrik „Partagas“ hindeuten mag, einer Fabrik im Stil der Gründerzeit, aus der es klopft, trampelt und singt. Was geht dort drinnen vor sich? Es scheint tatsächlich so, dass die Frauen beim Zigarrendrehen, ausgeführt in Handarbeit, inbrünstig singen. Bekannt wurde die Fabrik nicht nur durch ihre Markenzigarren, sondern auch durch die Vorleser, die hier früher den Frauen während der Arbeit Kurzweil boten. Den Besuch wollen wir uns für einen anderen Tag aufheben, so viele haben wir ja noch vor uns! (Abb. S. →)
Auch das schräg gegenüberliegende imposante Capitolio betrachten wir nur von außen. Das Gebäude mit der Kuppel, das dem amerikanischen Capitol ähnlich sieht (Abb. S. → oben rechts), ist eines der imposantesten Gebäude von La Habana. Nicht weniger als 2.000 Arbeiter mühten sich 1929 um die Fertigstellung. Gestaltet wurde es im Stil der damaligen Zeit und sollte ursprünglich in einer weiten Parkanlage stehen. Eine Kostenexplosion hatte den Weiterbau vorübergehend gestoppt. Insgesamt benötigte man daher 17 Jahre für diesen Bau und angeblich kursierten 5.000 Architekturzeichnungen, durch die spätere Architekten hindurchfinden mussten. Prächtig wurde es: Der Zentralbau, dem Pariser Pantheon nachempfunden, wird von einer Kuppel in Stahlskelettbauweise gekrönt.
Vor der Revolution beherbergte das Gebäude den Sitz des Senats und des Repräsentantenhauses. Heute ist hier die 1860 gegründete Akademie der Wissenschaften untergebracht. Der linke Gebäudeteil beherbergt das Museo Nacional de Historia Natural.
Wir spazieren noch ein kleines Stück weiter in Richtung altes Stadtzentrum. Verfallene Straßenzüge wechseln mit jenen ab, in die seit der Erklärung Havannas zum Weltkulturerbe 1982 UNESCO-Gelder geflossen sind. Um weitere Häuser vor dem Verfall zu schützen, hat die Stadtverwaltung außerdem ein Projekt initiiert, das den Bewohnern ermöglicht, ihren Stadtteil selbst zu sanieren. Ein solches Projekt muss auch am Malecón gestartet worden sein, denn viele Häuser werden hier anscheinend in Eigeninitiative Stück für Stück wiederhergestellt. Doch gleich hinter dem Hotel, wohin wir einen kleinen Abendspaziergang unternehmen, empfängt uns noch immer der kubatypische morbide Charme, umdröhnt von musischen Klängen aus den Eingängen hier und da.
Verfall und Verführung: Überall stehen oder sitzen Frauen in den Hauseingängen, die uns eine Kusshand zuwerfen oder uns zuwinken. Ein Tourist wird von einem Schwarzen Jugendlichen in eines der Häuser geführt. Ob ihm ein schönes Angebot unterbreitet wurde? Die Prostitution, in den 1990er Jahren während der schlimmsten ökonomischen Krise seit der Revolution aufgeblüht, ist in jüngerer Zeit zwar verboten worden. Trotz drohender drastischer Strafen, wie etwa Umerziehungslager, liegen die Jineteras (Reiterinnen) aber dennoch auf der Lauer. Allerdings sollen auch Touristen, die in Begleitung mit einer kubanischen Frau in Hotels erscheinen, Ärger bekommen. Dem widerspricht, dass uns im Hotel des Badeortes Santa Maria del Mar Frauen regelrecht angeboten werden. Dazu später. Noch einmal saugen wir die frische Luft des Atlantiks ein und begeben uns froh, ein neues Zuhause gefunden zu haben, in unser gleichwohl muffig stinkendes Zimmer, um bei offener Balkontür im dröhnenden Rauschen des Meeres in den Schlaf zu sinken.
„Es warten die Menschen in Engelsgeduld“ Havanna
30. Dezember 2006: Acht Uhr. Ich habe schlecht geschlafen. Zu laut waren der Verkehr und das vom Malecón zu uns heraufschallende Gelächter. Jetzt strahlt die Sonne über Havanna und wir springen die mehr als 200 Stufen in die Eingangshalle hinab, um dort unser Frühstück zu genießen. Zu M2‘s Freude gibt es Eierkuchen! Außerdem Spiegelei, verschiedene Salate, wie Nudelsalat mit Mayonnaise, sowie Rührei, zwei Sorten Aufschnitt und dazu Brötchen und Weißbrot. Das Brot wird in einer kleinen Maschine, ähnlich einem Grill, geröstet und fällt anschließend in einen dreckigen Behälter. M2 kennt solch ein Ding aus früheren Urlauben. Ich war in Hotels bislang selten unterwegs und staune.
Nach dem Frühstück spazieren wir abermals die Avenida de Italia hinauf, biegen in die Zanja und dann in die Dragones ein und gelangen wieder in die Gegend der Zigarrenfabrik Partagas und des Capitolio, um von dort die Calle Brasil (Teniente Rey) hinabzuschlendern. Diese belebte Straße spazieren wir bis zum Plaza de San Francisco hinab. 1628 wurde er angelegt und ist damit einer der ältesten Plätze Havannas. Der schmucke Plaza liegt direkt an der Hafeneinfahrt. Hier, am imponierenden Terminal Sierra Maestra, einem großen alten Speicher, beginnen wir mit unserem Sightseeing – und zwar mit der griechisch-orthodoxen Basilika San Franciscus von Assisi schräg gegenüber, die wir wegen der 2 CUC Eintritt nur von außen besichtigen.
Die bereits aus dem 16. Jahrhundert stammende Klosterkirche dient inzwischen als Konzertsaal und verfügt über zwei große schöne Klosterhöfe. Im Garten beeindruckt eine kleine, aber lebensgroße Statue von Mutter Theresa. 2001 nutzte der damalige deutsche Botschafter die Räume der Basilika für den Botschaftsempfang zum Tag der Deutschen Einheit.
Auffällig ist natürlich der davor stehende Brunnen von 1836 mit den vier wasserspeienden Löwen. Bemerkenswert ist schließlich noch die vom Künstler Horacio de Eguia (1914-1991) geschaffene, auf einem Sockel vor der Basilika stehende Statue, deren Original in Mallorca zu finden ist: Ein Mönch hält ein Kind an seiner Hand. In der Seitenstraße, nicht weit vom Haupteingang entfernt, kann man sein Glück versuchen. Es soll jenem hold sein, der hinter der dortigen kupfernen Mannesstatue stehend die Bartspitze mit der einen und den abgespreizten Zeigefinger des Mannes mit der anderen Hand gleichzeitig zu berühren in der Lage ist. Natürlich glänzen diese Teile wie poliert. In der Nähe steht die neue orthodoxe Sankt-Nikolaus-Kathedrale, die im Januar 2004 eingeweiht wurde; im kommunistischen Kuba eine Sensation. Erwähnenswert sind noch die kleinen Gärten, angelegt zu Ehren von Lady Di und Mutter Theresa, und natürlich die prächtigen Fassaden der mehrstöckigen Stadthäuser.
Das gesamte, mit ausländischen Geldern sanierte Viertel wirkt fast künstlich. Eine Straßenecke weiter erblicken wir rechterhand ein Stück einer uralten maroden Wasserleitung, die kürzlich bei Restaurierungsarbeiten freigelegt wurde. Eine Reiseleiterin erklärt dort einer Gruppe, dass die elf Kilometer lange Leitung an anderer Stelle sogar noch in Betrieb ist.
Ein kleines Stück weiter, in einer Seitenstraße, ist ein alter Eisenbahnzug mit verschiedenen Abteilen aufgestellt (Abb. S. → Mitte). Wie gelangte dieser wohl hierher? Eine Dame in hellblauer Uniform lockt uns hinein und erläutert, dass es sich hierbei um das Transportmittel früherer kubanischer Präsidenten handelt. Stolz demonstriert sie den Luxus vergangener Tage. Zunächst betrachten wir das mit Mahagoniholz und zwei einfachen grünen Sitzen ausgestattete Coupé. Daneben befindet sich die Präsidentensuite mit Bett, Toilette und Dusche mit einem kleinen Extra-Gang ins Zimmer der Lady, das ganz in Rosa gehalten ist. Daran schließt sich der Speiseraum mit langem Tisch, Stühlen und Vitrine mit Silberbestecken an. Danach folgen die Personalräume und die Küche, in der ein alter Feuerlöscher und die Edelstahlschränke für Bewunderung sorgen. Dank des sehr langsamen Spanisch der Dame verstehe ich sogar ein paar Brocken, und M2 gibt 2 CUC Trinkgeld, ehe wir die Wagen wieder verlassen.
Unser Weg führt uns nun von der mit Fördergeldern restaurierten Altstadt in jenen Teil, der offensichtlich dem Verfall preisgegeben wurde. Da geht’s sogleich an einem einsturzgefährdeten Haus vorbei, das in einigen Zimmern sogar noch bewohnt ist.
Gegenüber schauen wir in einen kleinen dunklen Laden hinein, in dem einzig und allein Kartoffeln verkauft werden. Im Lebensmittelgeschäft gleich daneben stehen nur etwa zwanzig Produkte aufgereiht in einem ansonsten leeren Regal. Vor der Theke warten zahlreiche Menschen in Engelsgeduld. Auch die benachbarte Bar wirkt trotz Besuchern gähnend leer. Flaschen suchen wir im Regal vergeblich, während nur um die Ecke herum, nicht weit von diesen Löchern entfernt, das Leben in einer musikbeschallten „CUC-Bar“ tobt – für Touristen versteht sich. Davor steht ein Geldtransporter.
Wir befinden uns nun wieder am Wasser. Eine Fähre, besser gesagt eine rostige hellblaue „Laube“, über und über voll mit Menschen, ist unterwegs hinüber zum Kastell. Diese Tour wirkt wenig einladend und obendrein gefährlich, obgleich wir ja gern dieses Kastell besuchen würden. Jeder Passagier muss sich einer Taschenkontrolle unterziehen, und darauf haben wir nun aber wirklich keine Lust. Interessant ist hier die Erinnerung an die Granma – die Yacht, mit der Fidel, Che Guevara und rund achtzig weitere Revolutionäre im November 1956 von Mexiko nach Kuba aufgebrochen sind, um nach dem ersten Revolutionsversuch (1953) nochmals in Santiago de Cuba ihr Glück zu wagen. Aufgrund von Stürmen kam das völlig überlastete Schiff mit der seekranken Mannschaft zwei Tage später als geplant an und wurde von Batistas Truppen bereits erwartet und heftig angegriffen. Bis zur Revolution, die in den Sierra Maestra von den wenigen Überlebenden um Fidel Castro vorbereitet wurde, dauerte es bekanntlich nochmals drei Jahre.
Wieder streunt einer dieser kleinen verhungerten Hunde an uns vorüber. Zahlreich streifen diese armen Tiere durch die Straßen.
Wir schlendern allmählich zurück, die Verkaufsstraße Obrapia hinauf, deren unterer Teil sehr schön renoviert ist, der obere Teil Richtung Kapitol aber ebenfalls dem Verfall preisgegeben zu sein scheint. In unmittelbarer Nähe zu den feinen Devisenläden finden wir auch hier die armen einheimischen dunklen Löcher vor, wie wir sie verschiedentlich bereits in Augenschein nahmen. In einem von diesen wird gerade Schweinefleisch gehackt und Menschen stehen auch hier in Schlange an, um den Silvesterbraten zu erstehen. Sie haben allesamt kein Problem damit, die großen, fast dreckigen Fleischklumpen auf der Theke einzeln anzugrapschen und zu befühlen (Abb. S. → Mitte). Von Gammelfleisch, wie in Deutschland, spricht hier niemand, und angesichts dieses Erlebnisses relativieren sich die deutschen Probleme einmal mehr.
Neben dem Metzger ist wieder ein Schuster zu sehen, in dem drei Damen auf ihre Schuhe warten, die im Moment an einer Theke zurechtgezimmert werden. In einem Eckladen sind eindrucksvolle Sahne-Torten in grellen Farben drapiert, wie sie hier häufiger zu sehen sind; sie werden wohl auf Bestellung hergestellt. Das macht Appetit auf zwei Blätterteigteilchen, die wir uns für insgesamt 60 Centavos gönnen.
Zum Essen finden wir kaum Ruhe. Stehen wir auch nur eine Sekunde irgendwo herum, wird uns sofort Hilfe angeboten. Natürlich erwarten die Leute Geld dafür. An jeder Ecke scheint jemand auf Touristen zu warten. Und schon kommt ein schlanker Schwarzer Jugendlicher auf uns zu, der uns die Hemingway-Bar zeigen will. Doch wir wollen uns nicht führen lassen. Da macht uns ein anderer, schäbig aussehender Mann, dem wir ebenfalls aus dem Weg gehen, mit den Worten an: „Sie wohl nicht mit Einheimischen sprechen?“
Ein junger Mann versucht uns daraufhin zum Buena Vista Social Club zu führen. Warum wir ihm denn nicht folgen wollen, es gäbe keine Gewalt in Kuba. Hhmm, wie ist diese schlüpfrige Aussage zu bewerten? Der Jugendliche weicht eine Zeit lang nicht von unserer Seite, dann weist er uns den Weg in eine der sehr verfallenen Passagen.
Dieses Treiben auf Kubas Straßen erinnert mich ein bisschen an Kairo. Doch insgesamt wirken die Menschen hier weniger finster. Die Kinder spielen Baseball und im Gegensatz zu den überall umherstreunenden Hunden sehen die Menschen auch nicht schlecht genährt aus. Auffällig „unauffällig“ sind überall Kontrollposten positioniert, sowohl in Uniformen als auch in zivil. Wie lange wird es hier so friedlich bleiben? An einem Garagentor steht geschrieben: „Viva Fidel“. Wie lange noch? Die durch den Peso convertible entstandene Zweiklassen-Gesellschaft wird sich auf Dauer nicht fortsetzen lassen. Zumindest Havanna hat der CUC fest im Griff.
Wir haben inzwischen wieder den uns vertrauten Platz mit dem Kapitol erreicht, wo wir es uns auf den Stufen bequem machen. Ein Mann bietet ein Foto von uns mit seiner alten Kamera, einer Leica, an. 1 CUC soll solch ein Bild kosten. Das ist ein weiterer Touristennepp: Aufgenommen werden nur die auf den Stufen sitzenden Touristen; der obere Teil des Kapitols wird durch eine Fotomontage drangesetzt.
Von den Treppen aus genießen wir den herrlichen Blick auf den zu Füßen liegenden Platz. Interessant sind da die Oldtimer und ein jetzt gerade haltendes „Kamel“– ein zum Bus umgebauter LKW (Abb. S. → unten). Ursprüngliche Pläne sahen für den Platz um das Gebäude herum einen blühenden Garten vor, doch nun gibt es nur links und rechts von uns einige Grünanlagen. Als M2 auf eine Brüstung steigt, um diese zu fotografieren, wird laut hinter ihm gezischelt. Ebenso zischelt ein Kontrollposten, als ich einen Blick auf die überlebensgroße Statue im Inneren des Kapitols zu erhaschen suche. Interessant wäre sicher auch der große goldgefasste 24-karätige Diamant aus Südafrika, der in der Mitte der Eingangshalle im Mosaikboden eingelassen ist und den Kilometer Null der Landesautobahn nach Santiago markiert. Der Eintritt ins Kapitol kostet 4 CUC und Fotoerlaubnis extra. Uns ist das ist zu teuer.
Der Rückweg führt durch eine schmutzige Straße in unsere bekannte Ave. Italia. Es ist 14 Uhr. Bis 16 Uhr ruhen wir im muffigen Zimmer aus und genießen dann eine Papaya, die ich für 1 CUC viel zu teuer am Gemüsestand auf der Straße erworben habe. Doch jetzt sitzen wir mit dieser Vitamin-C-Bombe ganz zufrieden auf dem Balkon, das sonnenbeschienene Havanna zu unseren Füßen (Abb. S. → unten). M2, der einen Rumcocktail mixt und eben noch über die dreckigen Handtücher im Bad geschimpft hat, schwärmt jetzt, es sei doch „herrlich, hier zu sein“. Das findet auch unser älterer Zimmernachbar, der aus Holland kommt, wie er uns im Gespräch von Balkon zu Balkon erzählt, dabei immerfort die Oberlippe zurückschiebend. Seltsam.
„Kleine Meise“, tuschelt M2, die Balkontür schließend.
„Nein, Hase“, lache ich.
17 Uhr liegt der Malecón in der schönsten Nachmittagssonne. Diese Straße zu unseren Füßen, am frühen Nachmittag so belebt, scheint in den Schlaf versunken. Auf einem kleinen Markt, ein Stück die Promenade am Meer hinab, gibt es Tomaten und irgendwelche grüne Früchte für einen Peso moneda nacional das Stück. Ich nehme davon gleich drei und da wir nur noch convertible Währung haben, geben wir dreißig convertible Centavos, die reichen aus. Es wird allmählich dunkler; die Sonne sinkt schnell.
Zurück nehmen wir einen kleinen Umweg und gelangen an einer katholischen Kirche vorüber zu einem mächtigen Hochhaus mit breiter Auffahrt. Wegen der kubanischen Flagge davor halten wir es zunächst für ein Ministerium. Auf dem Dach des vorgezogenen Unterbaus, der in großen Teilen leer zu stehen scheint und einen verwahrlosten Eindruck macht, parken inmitten gemauerter, kaum bepflanzter Rabatten wenige Autos. Einen Kontrast dazu bildet die überraschend gepflegte Eingangshalle im Stockwerk darüber: riesengroß und sauber. Mit den bunten Fensterchen wirkt sie wie eine Kathedrale. Umgeben von Sitzgelegenheiten inmitten grüner Pflanzen steht die Empfangstheke. Ein rotes Leuchtband darüber macht unmissverständlich deutlich, dass wir kein Ministerium, sondern das Hospital aufgesucht haben. Das Gesundheitswesen auf Kuba gehört zu den Prestigeobjekten des Staates. Trotz aller Mängel unterscheidet sich Kuba doch vor allem darin positiv von den lateinamerikanischen Staaten drum herum. Es ist dunkel geworden. Rasch gehen wir die lärmende Straße „San Lazaro“ zu unserem Hotel zurück und können zu unserem Bedauern nun keine Securitade mehr erkennen. Wie paradox eigentlich, dass man sich nach diesen flächendeckend eingesetzten Spitzeln sehnen kann. Doch man bedenke, dass wir mangels eines Safes unser gesamtes Reisegeld durch diese Finsternis spazierentragen.
In einer Backstube, in der ausschließlich diese weichen Brötchen gebacken werden, wie wir sie vom Frühstücksbüfett her kennen, tanzt der Bäcker zu dröhnenden Klängen. Er bittet uns in seinen Laden hinein, aus dem uns eine junge Frau einen Kussmund zuwirft. Wie haben wir das zu interpretieren? Wir hasten weiter und kommen an kleinen Wohnungen vorüber, in denen hier und da eine Dame im Sessel sitzt oder in einem Schaukelstuhl wippt. Wartet sie auf einen Freier oder ist das ganz einfach ihr Wohnzimmer – oder trifft beides die Situation?
Es wird immer finsterer und wir müssen noch an sich prügelnden Kindern und einem Berg Abfall vorbei. Obgleich wir nicht direkt belästigt werden, fühlen wir uns doch ständig beobachtet. Eine knisternde Spannung liegt fühlbar in der Luft. Ohne den gewaltigen Schutzapparat könnte es zu grollen beginnen. Wie man doch Menschen unter Kontrolle halten und erziehen kann!
Wir haben heute genug gesehen und keine Lust mehr, in der Dunkelheit noch einmal das Hotel zu verlassen. Zu gruselig war die erlebte Atmosphäre. Und zu traumatisch war etwa auch ein abendliches Erlebnis in Kapstadt ein Jahr zuvor (Bd. 1).
19 Uhr suchen wir uns zwei Plätzchen in der Lobby, um zu speisen. Aber auch das ist keine gute Idee: Die bestellte Chicken-Suppe (ohne Hühnchen!) kostet 2 CUC, ein winziger Salat mit Weißkraut und abgezählten Gurken- und Tomatenscheiben 2.50 CUC. Einen kleinen Fisch gibt es für 7.20 CUC und ein plattgeklopftes Hühnchen für 5.70 CUC. Auch die Cocktails für 2-3 CUC sind nicht empfehlenswert. Ein Abendessen im „Hotel Deauville“ lohnt sich also ebenso wenig wie das Frühstück. Ein Drittel mehr und wir hätten bereits europäische Preise, ohne dass die Qualität erreicht wäre. Für viele Kubaner dürfte das hier jedoch absoluter Luxus sein. Man bedenke den Monatslohn von umgerechnet rund 12 CUC. Während wir im Essen pickend am Fenster dieses einstigen Spielcasinos sitzen, den Blick auf den umspülten Malecón gerichtet, drückt sich an der Scheibe ein Kind die Nase platt.
„ins 49. Jahr der Revolution“ Havanna
31.12.06: Nachts wache ich nur zweimal auf – halb 2 und halb 6. Zunächst entscheide ich mich für Ohropax, dann fürs Meeresrauschen. Heute werden wir mal nicht vom Verkehr geweckt, es ist Sonntag. Halb acht sitzen wir im Frühstückslokal. Am Nachbartisch frühstückt der Herr aus dem Nachbarzimmer, schiebt jedoch gerade den Teller mit Weißkraut, Bohnen und Möhren mürrisch beiseite.
Es gibt vor allem Salate, von denen der Nudelsalat am ekeligsten aussieht und der Weißkrautsalat, in Öl getränkte Streifen, besonders merkwürdig schmeckt. Kuchen gibt es heute nicht, auch keine Plätzchen, keine Croissants und, was vor allem schade ist, keinen Käse. Dafür ähnliche Früchte wie gestern, allerdings ohne Bananen. Da bleibt für mich vor allem das Weißbrot, was in dieser sonderbaren Maschine getoastet wird. Darauf Butter und ein paar Obstscheiben dazu. M2, der meint, dieser Apparat habe wohl schon 100.000 Scheiben getoastet, schwärmt wieder für die Eierkuchen.
Nach dem Frühstück trauen wir uns sogar, den Fahrstuhl hinauf zu benutzen. Doch abwärts nehmen wir besser wieder die Treppen. Auf der Galerie der Lobby dieses einstigen Gangsterhotels müssen wir Geld tauschen. Die Schwarze Dame im Glaskasten telefoniert rege und kann sich vor Lachen kaum halten. Mit ihrer Fröhlichkeit steckt sie uns an, doch fänden wir es auch ganz nett, wenn sie es mal schaffen würde, die bereits in die Hand genommene Kreditkarte durch den Apparat zu ziehen. Mehrmals ist sie kurz davor, dann schnattert sie aber doch lieber wieder in den Hörer hinein, wendet sich ab und biegt sich abermals vor Lachen. Nun hat sie endlich aufgelegt und schiebt die Kreditkarte in den Apparat hinein. Doch irgendetwas funktioniert nicht. Jetzt wird sie ernst, was nichts anderes heißt als: Konto nicht gedeckt. Per Augensignal verständigt sie sich mit einem in der Nähe stehenden Sicherheitsbeamten, und der klärt auf. Das Geld darauf reicht nicht! Wie das? M2 ist blass: Wir wollten 400 CUC abheben! Wir verständigen uns auf die Hälfte, denn das Konto muss gedeckt bleiben. Es klappt. Allerdings haben wir nun noch eine neue „Baustelle“, die nur mit Hilfe der heimischen Bank beseitigt werden kann.
Nach dem Zahlen der üblichen ca. zehn Prozent Gebühren (23 Pesos) geht’s weiter. Wir haben Glück: In der Nähe des Hotels finden wir sofort ein Ladataxi, das uns für 1,45 CUC durch die 22 Meter tiefe Untertunnelung der Hafeneinfahrt nach drüben zur Festung auf dem Felsen „El Morro“ bringt (Abb. S. → Mitte links). Die Festung dominiert den Hafen und ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Von hier hinüber zum stadtseitig gelegenen „Castillo San Salvador de la Punta“ wurde früher eine dicke Eisenkette gezogen, um den Hafen gegen Eindringlinge zu schützen. Als 1582 der spanische König Philipp II. diese Festung mit ihren zweieinhalb Meter dicken Mauern erbauen ließ, war es noch nicht einmal 100 Jahre her, seitdem Kuba von Kolumbus entdeckt worden war. Schon bald galt der Hafen als einer der sichersten der Karibik. Einstmals gab es acht Festungsanlagen, die ihn vor Seeräubern schützte. Spanische Konquistadoren brachen von hier aus zu ihren Eroberungszügen nach Südamerika auf und brachten im Gegenzug ihre Beute für Europa hierher. Diese lockte zwar französische und englische Piraten an, doch die Enge der Hafeneinfahrt machte es den räuberischen Schiffen schwer. Allzu leicht konnten sie unter Beschuss geraten.
Die Festung ist bis 10 Uhr geschlossen. Wir schlendern daher die Anhöhe in entgegengesetzter Richtung hinauf – auf einer breiten, von Palmen gesäumten Straße. In den Vorgärten der kleinen Häuschen blühen die Weihnachtssterne (Poinsettien) in üppigen Büschen, Ruhe und Pracht ausstrahlend an diesem heiteren Dezembermorgen – am letzten Tag des Jahres 2006, das mir so relativ großen Erfolg beschert hat mit meinem NVA-Bausoldatenbuch. Und schon gelangen wir an einem Armeeobjekt vorüber. Häuser, wie kleine Schlösschen, erheben sich aus einem weitläufigen parkähnlichen Gelände. Es ist eine Kaserne, in der unter Musikbeschallung, von Ferne zu uns herüberklingend, Rekruten ihre Morgenübungen absolvieren. Etwas weiter oben kommen wir an einem weiteren Armeecamp vorüber, in dem sich die Soldaten sonnen oder ihren Körper am Reck stählen.
M2 rastet auf einer verwahrlosten Tribüne vor der zauberhaften Kulisse Havannas. Das Kapitol nimmt sich von hier aus wie der Petersdom von Rom. Ein friedlicher Ausblick, trotz der nach Westen gerichteten alten Panzer und Fluggeräte.
Wir suchen den Weg zur überlebensgroßen Statue San Cristobál (Abb. S. 57 oben links), dem Schutzheiligen Havannas, die auf einem kleinen Platz steht. Zutritt gibt es nur mit einem Eintrittsgeld von 1 CUC. Ein an der Statue herumlungernder Führer möchte mir den Text am etwa drei Meter hohen Sockel übersetzen. Ich finde das nett. „Denk dran, dass wir kein Kleingeld mehr haben“, warnt M2, weshalb ich dankend ablehne. Still sitzen wir in der Sonne, da kommt jener Kubaner wieder an. „Woher seid ihr?“
„Alemania, Deutschland!“, geben wir uns wortkarg.
„Oh, Michael Ballack!“
“Ja”, lachen wir im Wind, und der weht den Deckel unserer Sonnencreme ins Gebüsch unterhalb der Mauer. Das ist nun die Gelegenheit für den „Denkmalwächter“. Jetzt glaubt er, einen bezahlten Dienst an uns verrichten zu können: Während ich rätsele, wie ich am besten durch den Schmutz wate, springt dieser leichtfüßig ins Gebüsch und fördert den Deckel zutage. Mangels Kleingeld danken wir verlegen lächelnd und sitzen eine weitere Weile still auf dem Mäuerchen. Der Kubaner verharrt etwa zwei Meter vor uns am Fuß dieser Statue und schaut uns erwartungsvoll an. Ich finde diese Situation komisch und nehme erneut das Gespräch auf. Ob er die Geschichte des Häuschens hinter uns kennt? Am Giebel dieses exponierten Gebäudes ist der Schriftzug „Che“ angebracht.
Che, so erfahren wir, habe hier von 1959-1965 als Finanzminister gelebt und gewirkt. Der Kubaner hält mir ein 3 Peso-Stück national unter die Augen: Che ist darauf abgebildet. „Wie schön, bien!“
Dummerweise nur zieht der junge Mann die Hand nicht wieder zurück. „Er will es mir andrehen“, rufe ich M2 verunsichert zu, der sich erst gar nicht auf ein Gespräch eingelassen hätte und nun erneut daran erinnert, dass wir kein kleineres Geld haben als convertible Pesostücke.
‚Oh je, aber ich müsste ich ihm doch jetzt endlich etwas geben, hier bekommt man schließlich nichts geschenkt!‘, geht es mir durch den Kopf, da hören wir auch schon: „One Peso per Person, please!“
M2 kramt die Pesostücke widerwillig hervor, dann machen wir uns auf – zur Besichtigung von Che Guevaras Wohnhaus (Abb. S. 57 oben rechts). Von dem Häuschen, an dem wir den Eintritt für die Statue bezahlt haben, laufen nun drei Mann hinter uns her, von denen einer einen Holzkasten, die Kasse, schleppt.
Eine Eintrittskarte kostet 3 CUC pro Person, doch der Besuch dieses Hauses ist wenig empfehlenswert. Bis auf das Büro mit Schreibtisch, Bett und einigen Konferenzzimmermöbeln sind kaum Originalia zu besichtigen. Am eindrücklichsten ist wohl das Bett, in dem Che einige Asthmaanfälle aushalten musste. Ein paar Bilder künden von diesen Qualen, die ihn auch in diesem Haus nicht verschonten.
Wie wir uns hätten denken müssen, ist das Haus eher ein Ort der Propaganda. M2 stört sich vor allem an dem enorm vielen Personal. Mindestens zehn Leute wuseln nichtstuend durch die Räume und beobachten uns auf Schritt und Tritt. Lange bleiben wir nicht in diesem Domizil mit dem ungepflegten und wenig blühenden Garten drum herum, denn inzwischen hat auch das Castillo geöffnet, zu dem wir nun endlich hinüberwandern wollen. Da aber die Festung vier CUC Eintritt kostet, verspüren wir interessanterweise doch eher Hunger als Lust auf größere Besichtigungen.
Zunächst schleichen wir an einem Touristenmarkt vorüber zum Museumsshop, in dem wir fünf Ansichtskarten für je einen CUC erwerben, was auch nicht eben billig ist. Ich verlange zudem Briefmarken fürs Ausland und erhalte von der freundlich lächelnden Dame fünf 85-Centavos-Briefmarken. Wie wir später herausfinden sollten ist das der reinste Betrug. Denn was wir da bekommen, sind Marken der nationalen Währung, für die uns die Verkäuferin jedoch konvertibles Geld abknöpft. Wir zahlen also umgerechnet mehr als 4 € und erhalten einen Wert von vielleicht zwanzig Cent; obendrein werden diese Briefmarken niemals ihr Ziel erreichen. Das ahnen wir nicht, als wir uns gegenüber der Burg ein Restaurant zum Mittagessen suchen.
Unter viel zu lauter Musikbeschallung und kaum vorhandenem Sonnenschutz nehmen wir auf dem gerade angelegten, mit kleinen Palmen frisch bepflanzten Gelände Platz. Den Tisch ziert ein Stoffröschen, wie ich es am Klo unserer ersten Übernachtung fürchten gelernt habe. Wenigstens ist dieses hier nicht rot, sondern gelb.
Der junge Kellner freut sich, die ersten Gäste des Tages begrüßen zu können und schlägt Chicken mit Kartoffeln für 6 CUC vor. Der Cocktail kostet 3,50 CUC, mein Bier etwas über 1 CUC. Die Teller sind bemerkenswert alt und stammen aus England, um 1930. Das Besteck trägt die Aufschrift Monsigneur. „Die tragen hier alles zusammen, was sie finden können“, ist sich M2 sicher.
Die Mahlzeit ist nett angerichtet, mit Früchten, viel Reis und salzigen gebackenen Bananenschnipseln. Doch während wir da sitzen, die Stadt Havanna zu unseren Füßen, pufft es mehrmals laut in einer Fabrik der Stadt, und der Gestank zieht zu unserem Hügel hinauf. Wer weiß was das ist! Sowieso können wir hier in der Sonne nicht lange verweilen.
Auf dem Weg zu den Taxiständen spürt M2 sogleich den durchschlagenden Erfolg unserer Mahlzeit. Hinter der Tribüne, zwischen den Panzern, findet er ein stilles Örtchen. Dreimal muss er noch ins Gebüsch springen, ehe wir ein Taxi finden, das uns bereitwillig einsteigen lässt. Die Fahrt zurück soll 6 CUC kosten. Ich bin entrüstet. „Ok“, sagt der Fahrer: „5“. Ich korrigiere „2“. Daraufhin öffnet er die Tür und wir sitzen wieder am Straßenrand, im schönsten kubanischen Sonnenschein. Ein anderes Taxi bringt uns schließlich für 3 CUC zurück in die Stadt. Immerhin ist das auch doppelt so teuer wie die Hinfahrt.
Wieder im Hotel angekommen ist es früher Nachmittag, und nun bin ich es, der Bauchkrämpfe bekommt. Obgleich ich mich dadurch sehr geschwächt fühle, unternehmen wir zum späten Nachmittag hin einen weiteren kleinen Spaziergang durch die Stadt. Diesmal in die Gegend des „Hotels Nacional“, das ebenso wie die Altstadt Havannas seit 1982 zum Weltkulturerbe gehört (Abb. S. → oben links)