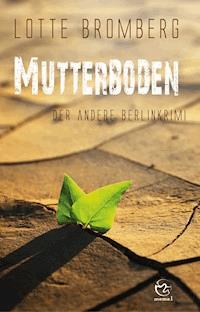4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Memel Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Kann man sich am Schicksal rächen? Und wohin stürzt ein Gehirn? Jakob Hagedorn, Berliner Hauptkommissar und verhasster Paradiesvogel im Revier, wird auf einen blutigen Mordfall angesetzt. Jemand hat die Frau eines Physikprofessors erstochen. Gemeinsam mit der Privatdetektivin Dao, der kiffenden alten Lehrerin Grete und der zornigen Ärztin Hanna entdeckt Jakob eine Mordserie. Als Penta, geheimnisvolle Bootsrestauratorin und alte Freundin Hannas, unter Verdacht gerät, stellen sich auch die Freunde gegen Jakob. Allein mit einem Gehirn auf Abwegen, angetrieben von den Geistern der Opfer, riskiert er alles, stößt auf ein tief vergrabenes Verbrechen und sieben zerstörte Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Lotte Bromberg
F a l l s u c h t
Der andere Berlinkrimi
Memel Verlag
Dies ist ein Roman. Jegliche Übereinstimmung oder auch nur Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen oder Begebenheiten ist zufällig und in keiner Weise beabsichtigt.
Deutsche Erstausgabe
©Memel Verlag Berlin 2014
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagphoto ©cw-design/photocase.de
Umschlaggestaltung anettemartin.de
E-Book-Erstellung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
ISBN 978-3-945611-00-5
ISBN 978-3-945611-01-2 (E-Book)
Für Dichwen sonst
I
Es gibt nicht viele Einsatzorte, die Berliner Kripobeamte überraschen können. Die meisten Menschen halten ihren Ausraster für einzigartig, dabei ist es immer die gleiche Leier. So oder so alles schon mal dagewesen. Ein Krankenhaus allerdings, das morgens um sieben im klirrend kalten Februar wegen einer amoklaufenden Ärztin die Kripo ruft, Verdacht auf Mordversuch, das ist mal etwas Neues. Arbeitstage können schlechter beginnen als mit einer Göttin in Weiß auf Schußfahrt.
Für die Hauptkommissare Jakob Hagedorn und Oskar Blum war das ohnehin ein guter Morgen, die Februarsonne steckte vorsichtig ihre Nasenspitze in den eisigen Tag, als sie auf die Straße traten. Endlich mal wieder eine gemeinsame Schicht, wie in alten Zeiten.
Als Jakob damals angefangen hatte bei der Kripo, war Oskar sein erster zugeteilter Partner gewesen. In der zweiten Nachtschicht hatten sie wegen der Anzeige einer am Schlaf gehinderten Nachbarin vor einer Wohnung gestanden, um dem Verdacht auf häusliche Gewalt nachzugehen. Nach zweimaligem erfolglosem Klingeln hatte Jakob den Wohnungsinhaber zu überreden versucht, die Tür zu öffnen, Oskar einen Lachkrampf bekommen und ihm so seine Pranke auf die Schulter gedeppert, daß der fast in die Knie gegangen war.
Noch Tränen in den Augen und nach Luft schnappend hatte Oskar Blum die Tür eingetreten, war zielstrebig an den Müllbergen im Flur vorbeigestiegen, hatte den lärmenden Fernseher abgeschaltet und ergebnislos versucht, den geübt volltrunkenen Bewohner der charmanten Bleibe auch nur zum Öffnen der Augen zu bewegen. Er hatte den Notarzt gerufen, der Zentrale gemeldet, daß sich die befürchtete Gewalt auf das Fernsehprogramm beschränkte, das Fenster geöffnet und zu Jakob gesagt, daß seine Sätze eindeutig kürzer werden müßten.
Sie waren gleich alt, aber Oskar wollte nie etwas anderes als Kriminaler werden. Nach Abitur und Ausbildung war er in Grün auf der Straße gelandet, mit fünfundzwanzig bei der Kripo und als sie sich kennenlernten, war er so erfahren gewesen, daß Jakob sich vorgekommen war wie ein Waschlappen, wenn auch ein studierter.
Schon immer liebte Jakob Bücher und Geschichten, hatte sich in Universitätsbibliotheken eingebuddelt und erst nach dem in einem Innenhof der Rostlaube abgepflückten Magister gefragt, was jetzt. Sein Professor wollte ihn für eine Promotion zu gewinnen, er hatte Doktorandencolloquien besucht und war Gesprächen über die immanente dialektische Struktur des Spätwerks französischer Autoren gefolgt.
Eines Morgens war er erwacht, seine Mutter hatte ihn großäugig und hohlwangig von der Fensterbank angelächelt, war hinter der aufgehenden Sonne verschwunden und er hatte gewußt, er würde sich um die Geschichten der Toten kümmern müssen. Das war so sicher gewesen wie das strapazierte Amen in der Kirche.
Magister Jakob Hagedorn bewarb sich bei der Kripo. Verblüffenderweise war man dort entzückt über seine akademische Vorbildung und bildete ihn bereitwillig im Berliner Straßenkampf aus.
Den Rest machte Oskar. Er hatte Wort gehalten und Jakobs Sätze verschlankt, indem er ihn sofort unterbrach, wenn es kompliziert wurde oder zu lange dauerte. Ausreden lassen hatte er ihn erstmals, als ein Rechtsanwalt nach zu viel genossener Sonne auf dem äußersten Rand der Dachpappe eines Siebzigerjahrebaus am Kudamm seinen Kompagnon im Arm hielt und ihn den Gesetzen der Schwerkraft überantworten wollte. Das war das erste Ding für Jakobs Birne gewesen, wie Oskar sagte. Akademiker eben. Wobei für Oskar Blum alle Akademiker waren, die einen Umweg machten zwischen dem Anfang und dem Ende eines Satzes.
Der Rechtsanwalt hatte nach einer Stunde gepflegten Textaustausches die Finger vom Kompagnon genommen, ohne ihn ins Erdgeschoß schweben zu lassen. Gut, danach war er selbst gesprungen. Man kann nicht alles haben. Aber halbe-halbe ist gut für den Anfang.
Ihre Arbeitsteilung war fortan geregelt, an den Feinheiten mußte Jakob noch arbeiten. Oskar war, wie er war, keine Verhandlungsmasse. Entweder man mochte ihn oder nicht. Ohnehin mochten ihn die meisten. Jakob dagegen mußte sich alles erarbeiten. Er war großgewachsener Akademiker, Brillenträger, Freund gepflegt lässiger Leinenhemden, kurzer Mäntel und ein zurückhaltender Mensch. Seine Finger waren zu lang, seine Hände zu schön, seine Augen zu dunkel, sein Blick zu tief.
Und er träumte.
Stieg durch die Stadt, erkannte Leute nicht, vergaß zu grüßen.
Und er las Bücher.
Oskar hatte viel zu tun, hinter ihm aufzuräumen. Aber nach einem Jahr war klar gewesen, daß Jakob Hagedorn schlicht ein guter Kripomann war. Er löste die Fälle ohne hinzusehen. Setzte sich zum Verhör, sah die Täter an und sie begannen zu plappern, als hätten sie nur darauf gewartet, in seine ruhende Visage hinein ihr Leben zu versenken. Er erkannte Verbindungen, an die niemand dachte, sah Details, die es gar nicht geben konnte, stellte Fragen, auf die niemand eine Antwort wußte, und er sah Geister.
Das war sein Durchbruch.
Er fand ein Mordopfer, das niemand vermißte. Und den Mörder dazu. Sie saßen mit einem unrasierten, fünfzigjährigen Vierschröter im Verhör, der seine Nachbarin erwürgt hatte, was unstrittig war, trotzdem schwieg der Mann wie zugeklebt. Sie hatten es von allen Seiten versucht, aber seine Deckung war so geschlossen wie die Beweislage dürftig. Da war Oskar Kaffee holen gegangen.
Als er zurückkam, hockte der Mann zusammengekauert mit aufgerissenen Augen in der Ecke, gestand alles und wollte raus, weg, so schnell wie möglich. Jakob Hagedorn hatte auf dem Stuhl neben ihm ein kleines Mädchen gesehen, fünf, sechs Jahre alt. In einem vorgestrigen Blümchenkleid saß sie, einen Zopf im Mund, auf ihren Händen, baumelte mit den in Strümpfen und Lackschuhen steckenden Beinen und sah abwechselnd Jakob und den Nachbarinnenwürger an.
Da hatte der Kommissar den Mann gefragt, ob er das Mädchen kennt, schließlich will man wissen, mit wem man es zu tun hat. Hatte ihr Kleid beschrieben und die dünnen braunen Zöpfe. Sie war die Schwester des Vierschröters, tragisch ertrunken mit fünf Jahren in einem Teich. Tatsächlich hatte ihr einziger Bruder sie ertränkt. Elf war er und wollte alle elterliche Liebe, nicht die kleinere Hälfte. Gestand das alles, nachdem er aufgesprungen war, bloß weg von dem Stuhl, der für ihn leer blieb, bloß weg von Jakob, dem Geisterseher. Gestand das Ende der Nachbarin gleich mit, das Maul hatte sie endlich halten sollen, die Giftnatter.
Danach schwiegen alle.
Oskar Blum war stolz auf seinen Freund. Der galt fortan als irre und ein bißchen gefährlich. Gut so, fand Oskar, nichts mehr aufzuräumen. Alle machten eine Gasse für ihren Paradiesvogel. Und auf einmal hatte er gegrüßt, der lange Dunkle, die Kollegen angesehen wie vorher nur seine Verdächtigen. Fragte nach Kindern, neuen Autos, Gesundheit und Urlaubsreisen. Vergaß nie ein Fitzelchen, keinen Geburtstag, Ehrentage überhaupt. Er legte über die Flure der Keithstraße ein freundliches Zwitschern der Anerkennung für jeden gottverdammten Blumenpott. Alle waren wie auf Droge. Na ja, fast alle.
Oskar wurde immer stolzer. Sein wunderbarer Geisterfreund brachte die Luft zum Brummen. Er las immer noch Bücher, seine Finger waren immer noch zu lang, seine Hände zu schön, sein Blick dunkel und unverschämt tief.
So war es bis vor drei Jahren gegangen, als Jakob den Mord an einer jungen Frau ausgegraben hatte. Längst abgeschlossen, der Täter saß vergittert, alles in trockenen Tüchern. Aber dann hatte sich die Pflaume umgebracht, ihr feiner Lebensgefährte, indem er sich in der Zelle eine Gabel in den Hals stach. Muß man sich mal vorstellen. Kann man so jemandem glauben, was er sagt?
Jakob konnte.
Drei Tage später hatte ein Kurier einen geschmuggelten Abschiedsbrief an Kommissar Hagedorn von dem Gabelhals gebracht – auf die eigene Geisterzukunft zu vertrauen schien ihm wohl zu riskant.
Er hätte seine vollbusige Susi nicht getötet, schrieb er, ein Kriminaler sei’s gewesen. Na klar, wenn’s sonst nichts ist, dachte Oskar. Es lebe die Verschwörung.
Aber das Briefchen ging ja an Jakob.
Also den Blick nach innen, alte Akten lesen, stundenlanges Rumgestapfe durch die Stadt, und dann stand er eines Mitternachts vor Oskars tiefschlafender Wohnungstür, patschmadennaß in einem Mäntelchen, hängte seine Augen in Oskars Seele und sagte, er hat recht. Punkt. Und so war’s. Hatte ihn ein Jahr gekostet, das auch zu beweisen. Oskar hatte ihn gewarnt mit aller Glöckchenkraft seiner Neuköllnischen Engelszungen, aber Jakob wollte nicht hören. Wen wundert’s.
Die Geisterlatte wies also seinem verdienten Kollegen Pommerenke nach, ehrenamtlicher Trainer der Fußballzwerge des Polizeisportvereins, Gewerkschaftsmitglied, Posaunenbläser, Trauzeuge, Patenonkel, glücklich verheiratet seit neunzehn Jahren mit einer Kollegin vom Nachbarrevier, daß er Susi erschossen hatte.
Seine Geliebte war sie gewesen, hatte mehr gewollt, zu viel von grenzgängerisch legalen in Hormonseligkeit erzählten Gesetzeshütergeschichten gewußt, Zeit, Ehe und teurere Geschenke gefordert, der Klassiker. Also hatte er sie aus dem Weg geschafft, ihren Gefährten hingehängt, relativ schockgefrostet geplant das Ganze und gut ausgeführt.
Nicht gut genug für Jakob Hagedorn. So tief kann keiner graben.
Jakob wollte ein Geständnis, vorbeugend gegen die Legendenbildung, hatte ihn eingelullt, die kurzen Sätze konnte er inzwischen, und dann war er mit der Geisternummer gekommen. Hatte behauptet, die erschossene Vollbusige und ihr gegabelter Lebensgefährte wären mit im Raum. Also hieß es Eins zu Drei. Klar, wer da verlor. Gut fand das allerdings nur Oskar.
Die Keithstraße drehte sich wieder. Um einen aus ihrer Mitte zu klauben, war der fremde Geisterseher mit den vielen Büchern dann doch zu wenig geerdet. Sie stießen ihn ab. Jetzt wurde er nicht mehr gegrüßt, sondern übersehen. Aber niemand träumte, alle waren hellwach. Schwiegen in sein Gesicht, ballten die Faust in seinem Rücken.
Oskar hätte gern aufgeräumt, die Fäuste und alles andere hinter ihm. Er erklärte, stellte richtig, stoppte Nachrede, die üble wie die geschwätzige. Aber es nützte nichts, es wuchs immer wieder nach. Unkraut eben.
Irgendwann sagte Jakob, laß gut sein Oskar, das kostet zu viel Kraft. Seitdem standen sie nebeneinander, kümmerten sich gemeinsam um den Rücken und waren der Kiesel in der Brandung. Sie machten ihre Arbeit, meistens gut, aber man lauerte. Es ließ sich trotzdem damit leben. Vielleicht wuchs irgendwann Gras über den Fall des Ehrentrainers der Fußballzwerge. Wahrscheinlich war es nicht.
Seit damals hatten gleichgültige Dienstpläne oder mißgünstige Vorgesetzte sie nur noch selten zusammen losgeschickt. An diesem Februarmorgen pflegte jedoch ein dauerversehrter Kollege seinen xten Bandscheibenvorfall, zwei Kolleginnen waren im Schwangerschaftsurlaub und der harte Winter hatte eine kräftige Grippewelle über den verbliebenen Ordnungshütern Berlins abgeladen.
So sprangen die zwei letzten Mohikaner endlich mal wieder gemeinsam in Oskars Citroën und bretterten durch die winterstarre Stadt zum Arbeitsort der ausfälligen Halbgöttin. Oskar war der sonderbarste Autofahrer, den Jakob kannte. Er konnte sich nicht einigen, ob er nun schnell und schnittig oder gemütlich fahren wollte. Das Ergebnis war eine Mischung aus impulsiven Überholmanövern und schaukelnder Kutschenfahrt. Vor der Klinik ließ er den Wagen ausrollen und latschte zum Abschluß so heftig auf die Bremse, daß Jakob sich mühsam im Sitz hielt, als sie erst jenseits der Eisplatte, die eine nicht abreißende Kette von Notarztwagen vor dem Portal verdichtet hatte, ruckartig zum Stehen kamen.
Am Krankenhauseingang stand ein grünlich dreinblickender Pfleger mit Piercing in der Wange und wartete rauchend. Als sie ausstiegen, schnipste er die Selbstgedrehte in einen von Frost und Splitt der vergangenen zwei Monate lädierten Grünstreifen, zog die Tür auf und ging voraus. Sie liefen über endlose menschenleere Flure und stiegen verwirrende Treppen auf und ab. Jakob schwindelte.
»Wo geht es überhaupt hin? Ich meine, nicht, daß wir völlig entkräftet der Furie gegenübertreten«, fragte Oskar.
Der Pfleger blieb, begleitet von einem grellen Quietschen seiner Gummisohlen auf dem Linoleum, abrupt stehen und starrte ihn an. »Wer sagt das?«
»Wer sagt was?«, fragte Oskar wachsam.
»Sie ist keine Furie, wer sagt solchen Scheiß?« Der Pfleger machte einen Schritt auf Oskar zu.
»Mit der Affektkontrolle habt ihr es anscheinend hier alle nicht so? Der Schichtdienst, die Verantwortung und so weiter, nehme ich an. Trotzdem wüßte ich gern, wo es hingeht.«
Der Pfleger starrte ihn weiter an. Vielleicht auch etwas zu wenig Schlaf und ein klein wenig zu viel Gras.
»Er meint die Station, auf welcher Station es passiert ist«, sagte Jakob so sanft wie möglich.
Der Pfleger löste seinen Blick langsam von Oskar. »Die Innere, so was passiert nur auf der Inneren II«, antwortete er und setzte sich wieder in Bewegung.
Oskar sah zu Jakob, der zuckte die Achseln. Sie folgten dem Pfleger. Es war eindeutig, wann sie am Ziel waren. Die letzte Glastür war von der Rückseite mit irgendwelchen Flüssigkeiten beschmiert, über deren Herkunft Jakob lieber nicht genau nachdenken mochte. Der Pfleger zog die Tür auf, winkte sie durch und verschwand.
Vor ihnen tat sich ein verwüsteter Krankenhausflur auf. Den leuchtendblauen PVC-Boden bedecktenzerschlagene Urinale, Glasscherben, Infusionsschläuche und -flaschen. Stühle lagen auf dem Boden, einem fehlte ein Bein. Den Durchgang versperrte ein querstehendes Krankenhausbett, dessen Galgen sich verbogen in den Raum krümmte, als hätte ihm jemand gerade einen grandiosen Witz erzählt. Es war vollkommen still.
»Wow«, sagte Oskar leise, »eine Furie, sag’ ich doch.« Er zog seine Waffe aus dem Halfter und entsicherte sie.
»Spinnst Du jetzt? Das ist ein Krankenhaus.« Jakob schob Oskar zur Seite, der widerwillig seine Waffe sicherte, und ging vorsichtig den Gang hinunter.
Es roch nach Staub der Siebziger, scharfen Desinfektionsmitteln und süßlich nach alten Menschen. Jakob sah auf geschlossene Türen. Der Flur war eine Schleuse ohne Ausgang. Er atmete flach. Nachdem er etliche Hindernisse vorsichtig umstiegen und Lachen von Zerstörung ausgewichen war, erschien ein Weißkittel hinter einer handbreit geöffneten Tür linkerhand. Auch er sah grünlich aus.
»Sie ist da drin.« Der Kittel deutete auf eine geschlossene Tür rechts weiter hinten, über der eine Leiste mit farbigen Signalen hektisch blinkte. Jakob kramte in seiner Krankenhauserinnerung. »Das Schwesternzimmer?«
»Der Aufenthaltsraum für das Pflegepersonal.«
Fatzke, dachte Jakob und las auf dem an der Brusttasche zitternden Schildchen »Dr. P. Pansel«. Jakob deutete in das Zimmer hinter ihm und der Kittel zog sich unwillig einen Schritt zurück. »Aber seien Sie vorsichtig«, sagte er, »die ist gemeingefährlich.«
Bei Risiken für Leib und Leben fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, dachte Jakob.
»War sie das schon immer?«, fragte Oskar.
»Ich bin sonst auf der Gynäkologie. Personalmangel.«
»Also kennen Sie die Frau gar nicht?«, fragte Jakob.
»Aus der Kantine. Sieht unverschämt gut aus, müssen Sie wissen.«
»Aber gemeingefährlich«, sagte Oskar.
»Man steckt nicht drin in den Leuten. Ist eben ein knallharter Job.« Der Gynäkologe drückte das Kreuz durch.
»Knüppelhart«, sagte Oskar, schob den Doktor zurück in das Zimmer und schloß die Tür vor seiner Nase.
»Beinhart«, sagte Jakob.
»Besonders auf der Gynäkologie«, sagte Oskar.
Sie nickten sich zu und näherten sich der Tür, über der die Lichter Alarm schlugen. Nichts war zu hören. Jakob klopfte, öffnete die Tür und verschwand in dem Zimmer. Oskar steckte seine Waffe zurück ins Halfter, griff sich einen der herumliegenden Stühle, testete ihn auf Standfestigkeit und setzte sich neben der Tür an die Wand. Frauen waren eindeutig Jakobs Revier. Geister und Frauen, was vermutlich irgendwie zusammenhing. Zeit für eine kleine Dösepause. Er verschränkte die Arme vor der Brust, lehnte den Kopf an die Wand und schloß die Augen.
Jakob sah auf den Rücken einer großen, schmalen Frau, die am offenen Fenster stand, in den eisigen Berliner Morgen hinaussah und eine Zigarette rauchte. Wenn sie den Arm hob, um einen Zug zu nehmen, spannte sich der weiße Kittel in ihrem Rücken.
Das Zimmer war klein, aber gemütlich. Eine Gegenwelt zu der technischen Kälte hinter der Tür. Ganz zu schweigen von dem Chaos. Auf einem Tischchen nah am Fenster verteidigte ein Christstern aus dem letzten Jahr tapfer seine Stellung. Galt sicher als unhygienisch.
Jakob erinnerte sich, daß er als Knirps seiner Mutter bei ihrem Generalprobenausflug in die Hölle nur noch Schokolade mitgebracht hatte, weil er die Blümchen immer wieder mitnehmen mußte. Rechts den Gang hin mit der Faust um die armen kleinen Stengel, links den Gang zurück. Wenn er sie zuhause losließ und sein Vater eine Vase suchte für die Weitgereisten, waren sie längst in Sorge und Liebe erstickt. Weinte er dann, schloß der große, starke Vater seine rauhen, warmen Hände um Jakobs weichen Kinderkopf und der verkroch sich in ihrer Höhle, wo kein Platz war für sterbende Mütter. Später hatten auch die Tafeln beim nächsten Besuch unberührt auf dem Nachtisch gelegen, umkreist von Schalen und Dosen mit Tabletten.
Also hatte er Bilder von ihrem Cello mitgebracht, oder zumindest dem, was ein siebenjähriger Wurm so malen kann. Es mußte ähnlich gewesen sein, zumindest war sie in Tränen ausgebrochen und hatte ihn an sich gedrückt, wobei er die Luft anhielt aus Sorge, ein tiefer Atemzug könnte ihren Brustkorb zerbrechen und sie würde nie wieder für ihn spielen.
Jakob ging auf den Tisch mit dem Christstern zu, zog sich einen Stuhl vor und setzte sich. Die Frau zeigte keine Regung. Draußen lärmten die Spatzen der aufgehenden Tiefkühlsonne entgegen als würde Hertha gegen Bayern antreten.
»Überall zwitschern die Vögel erst im Frühling, nur in Berlin quatschen sie schon bei Eis und Schnee«, sagte Jakob.
»Wir reden doch auch immerzu, egal ob wir was zu sagen haben«, sagte die Frau. »Hauptsache, es ist nicht still.«
»Aber was die Vögel erzählen, ist schöner.«
»Das hängt damit zusammen, daß sie singen.«
»Sollten wir vielleicht auch. Aber ich glaube, ich werde lieber von Spatzen auf meiner Fensterbank geweckt als vom Duschgesang meines Nachbarn.«
Die Frau drehte sich um und sah ihn an.
Mein Gott, war sie müde. Jakob zog einen zweiten Stuhl vor und klopfte auf die Sitzfläche. Die Frau drückte die Zigarette in einem mit Sand gefüllten Eimerchen aus, stieß sich von der Fensterbank ab und setzte sich Jakob gegenüber. Sie sah ihm in die Augen. Jakob sah zurück, ruhig und geduldig. Ihr Lidschlag war so langsam, daß er Sorge hatte, sie würde einschlafen. Aber jedes Mal, wenn die Augen sich wieder öffneten, sank er tiefer hinab.
»Ich bin Hanna und wer bist Du?«, fragte die Frau.
Jakob versuchte, die Wasseroberfläche zu erreichen. Als er sich aus ihren Augen gelöst hatte, tanzten Funken um ihre Haare. Eine Perle kullerte den langen Hals hinab, zögerte unentschlossen am Schlüsselbein, sprang dann ab und landete hüpfend auf dem Linoleumboden.
»Ich bin der Märchenprinz«, hörte Jakob sich sagen.
»Du hast mich lange warten lassen, Prinz. Meine Mutter hat mir erzählt, Du kommst auf einem Klepper, wo ist er?«
»Wartet draußen, er wollte nicht mit ins Krankenhaus.«
»Kluger Gaul, auf den solltest Du hören, wenn es mal Diskussionen wegen der eingeschlagenen Richtung gibt.« Sie stand auf, strich sich über den von Spuren ihrer Schlacht übersäten Kittel, entfernte das Namensschild vom Revers und steckte es in ihre Hosentasche. Sie zog den Kittel aus und legte ihn über den Stuhlrücken. »Laß uns gehen, da draußen gibt es im Februar nicht genug Gras für Prinzenpferde«
Jakob hätte ihren Fingern eine Zigarette gewünscht, verloren taumelten sie durch den Raum. Er sah, wie sie zu einem Schrank ging, einen Mantel vom Bügel streifte, sah ihre Finger Knöpfe öffnen und schließen und wollte nie wieder etwas anderes sehen. Sternschnuppen trudelten aus ihrem Haar, verteilten sich gleichmäßig auf den Schultern. Er versuchte sich an das Ende von Sterntaler zu erinnern, aber es fiel ihm nicht ein. Hanna sah sich langsam im Raum um, als wollte sie alles in ihre Erinnerung einbrennen, nahm den Christstern vom Tisch und sah aus dem geöffneten Fenster. »Ob es trocken bleibt?«
»Es riecht nach Schnee«, sagte Jakob.
Sie schloß mit einer Hand das Fenster, drehte sich zu Jakob um und nickte. Er stand auf und ging voran. Oskar war auf seinem Stuhl eingenickt. Er schreckte hoch, als die beiden durch die Tür kamen. Jakob schüttelte den Kopf und verließ langsam durch die Hindernisse steigend mit Hanna die Station, das Krankenhaus und das Gelände.
Für Oskar blieb der Rest. Er seufzte, rief Dr. P. Fatzke herbei, verkündete das Ende der direkten Lebensbedrohung, forderte ihn auf, für ein Protokoll auf dem Abschnitt zu erscheinen, fragte, ob er Anzeige erstatten wolle, was der Doktor entsetzt verneinte, schloß nach zwei Stunden gähnend seinen Wagen auf und fuhr zurück zum Abschnitt.
Anzeige erstattete schließlich der Verwaltungschef der Klinik, wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und versuchten Mordes. Da er schon mal dabei war, schloß er eine fristlose Kündigung an, alarmierte die Ärztekammer und forderte den Approbationsentzug.
Gegen Mittag kam ein übermüdeter Trupp Kriminalbeamter, ließ sich die Ortschaften zeigen, nahm Hannas Opfer in Augenschein, machte Photos, vermaß und tütete Proben ein. Nach einer Stunde zogen sie wieder los und antworteten auf die Fragen des erregten Verwaltungschefs, wann die Täterin mit Konsequenzen zu rechnen hätte, mit einem routinierten Achselzucken.
Als der Verwaltungschef die Station verließ, begegnete er einem Boten, der eine Krankschreibung der Furie vorbeibrachte, was ihn so wütend machte, daß er das Schreiben in kleine Schnipsel zerriß und sie auf das leuchtend blau unterlegte Chaos niedersinken ließ. Der Bote bestand kaugummikauend auf einer Unterschrift, die den Erhalt des Schreibens bestätigte, der Klinikchef gab sie ihm fluchend.
Oskar erfuhr von all dem nichts. Bei seiner Rückkehr zum Abschnitt wurde er zum nächsten Einsatz geschickt. Ein Mann drohte mit einer Handgranate bewaffnet abwechselnd sich und die Schaulustigen in die Luft zu sprengen. Das war nun wieder Oskars Kaliber. Jakob, den er verständigt und auf halber Strecke aufgelesen hatte, blieb im Wagen, wirkte allerdings auch etwas derangiert.
Als sieben Stunden später ihre Schicht endete, waren sie zu müde, um über die schöne Furie zu sprechen. Oskar schrieb das Protokoll über den Handgranatenirren – sie hatte sich als Attrappe entpuppt, als sich der Mann eine Zigarette damit anzündete. Sein anschließendes verspanntes Gelächter hatte von den Kollegen einen ganzen Blumenkübel voll Affektkontrolle gefordert –, setzte Jakob an der U-Bahn ab und kutschte ohne Umwege in sein Bett.
Jakob kehrte zurück, von wo er sieben Stunden zuvor aufgebrochen war. Wehrlos hatte Hanna sich in ihre Wohnung bringen und Tee einflößen lassen. Jakob hatte versprochen, nach Dienstende zurückzukommen. Als er die letzte Treppe nahm, kauerte sie in der Wohnungstür, als hätte sie auf ihn gewartet.
II
An manchen Tagen hätte man einfach liegenbleiben sollen. Im Nachhinein. Wäre Jakob an diesem Tag nicht aufgestanden, wäre er nicht gefallen. Aber selbst wenn, was hätte es genützt, das Schicksal läßt sich nicht austricksen, es kann warten, Zeit ist nicht sein Problem.
Aufstehen konnte Jakob schon immer gut. Außer im August vielleicht, wenn die Hitze jeden Knochen zu Brei kocht und niemand morgens noch die Kraft findet, der vor Tatendrang sprühenden Sonne bei ihrer Jagd nach neuen Rekorden hinterherzuschlurfen. An diesem knirschenden Februarmorgen jedoch stand der Fixstern selbst spät auf und blinzelte ihn sanftmütig wach. Auf dem Balkongeländer erschien Frieda, seine Spatzengesellschaft und quasselte ihm das Ohr fusselig. Jakob streckte sich, steckte noch einmal die Nase in die nachtwarme Bettwäsche, versuchte sich erfolglos einzubilden, er röche Hanna.
Seine Füße erkannten auf dem Weg zum Bad die Dielen wieder, wie jeden Morgen. Nun wohnte er schon so viele Jahre in dieser Wohnung, ohne sie satt zu haben. Er war gerade zwanzig geworden und im dritten Semester an der FU, als ihm eines Abends dämmerte, daß sein Vater nie in die Wohnung zurückkehren würde, in der seine Mutter acht Jahre zuvor gestorben war. Bei der nächsten Berliner Stippvisite zwischen irgendwelchen Bildhauerprojekten in Norwegen und Schafsfarmen in Irland sprach er ihn darauf an. Ich brauche kein Zuhause, antwortete sein Vater, Deine Mutter ist tot.
Vier Wochen später war Jakob in diesen ehemals schönen Altbau der Jahrhundertwende eingezogen, plattgebombt und wieder hochgefummelt in kargen Nachkriegsjahren, nachlässig verputzt Anfang der Achtziger, im mittelschönen Schöneberg, ohne Park, ohne Schnick, aber sein erstes eigenes Zuhause. Nicht in seiner jetzigen Wohnung hatte er angefangen, sondern im Parterre. Mittendrin, alles auf einer Ebene. Ein Zimmer, Küche, Innenklo, mit Bürgersteiganschluß, sehr gesellig. Alle klopften bei ihm ans Fenster, wenn sie den Hausschlüssel vergessen hatten. Postboten gaben Pakete ab, Eltern ihre Kinder, Alte ihre Hunde. Lüftete er, nahm man das als Aufforderung, die neuesten BZ-Katastrophen auszutauschen, kommentierte Jakobs Frauenbesuche und seine Einrichtung, riet zu mehr frischer Luft und weniger Büchern, brachte Kuchen vorbei und gebratene Rippchen.
Nach zwei Jahren griff Jakob aus Sorge um den Fortgang seines Studiums zu, als im dritten Stock eine Zwei-Zimmer-Wohnung frei wurde. Sein Blick ging fortan nicht mehr auf den Bürgersteig und die von Rüden als Kiosk mißbrauchten Baumscheiben vor dem Haus, sondern auf weit ausladende Baumkronen der Linden zur Straße und einer Kastanie zum Hof. Und da saß er nun, zwanzig Jahre später, und seine Zehen kannten jedes Astloch zwischen dem Bett und dem Bad. Durch die Baulücke gegenüber, seit fünf Jahren bodennah belegt von einem Gebrauchtwagenhändler, sah er die Sonne sieben Monate im Jahr untergehen, über dem Hof schien sie nach Ersteigung des Nachbarhauses morgens auf sein Bett.
Kann wohnen schöner sein?
Oskar war in den rund fünfzehn Jahren, die sie sich inzwischen kannten, sechs oder sieben Mal umgezogen. Jakob hatte immer mit angefaßt und sich gefragt, was ihn trieb. Vielleicht war Jakob als Kind einfach zu viel herumgekommen. Wenn sein Vater zum Aufbruch blies, hatten sie meist nur wenige Tage, bis es losging in irgendwelche Länder, zu irgendwelchen noch nie dagewesenen Vorhaben. Jakob war in seine Bücher getaucht, hatte sich einen Schlafplatz zuweisen lassen, erkundet, in welcher Himmelsrichtung seine Heimatstadt lag, sein Bett dorthin ausgerichtet und gewartet, bis es wieder zurückging. In eine neue Wohnung, einen anderen Kiez, aber heim nach Berlin.
Oskar hatte ihn oft gefragt, warum er nicht wegzöge. Der Umgebung seiner Wohnung waren die zwanzig Jahre mehr auf dem Buckel nicht gut bekommen. Aufgerauht und durchgegraut. Die Menschen sahen immer weniger zueinander und immer mehr auf ihre Displays. Die Straßenraubfrequenz nahm zu, im Parterre ließ niemand mehr seine Fenster offen, die Haustür hatte eine dauerhaft defekte Gegensprechanlage zur Verstärkung bekommen, die Eckkneipe war einer Daddelhölle gewichen, der kiezige Kramladen einer Billigdrogerie, der Schreibwarenladen rechts neben seiner alten Wohnung, vor dem sich zu Schulbeginn vor zehn Jahren noch die Kinder zappelnd anstellten, beherbergte jetzt eine Karaokebar.
Andererseits war es unter anderem diese Karaokebar, die ihn bleiben ließ. Eine Nachbarin hatte aus ihrem Schlafzimmer versucht, die vor die Bar tretenden Sänger an einem Sonntagmorgen um kurz nach vier mit dem Inhalt einer Wasserpistole auf ihre vom Alkohol vernebelten Hirne zum Schweigen zu bringen.
Da das aus dem vierten Stock wenig Erfolg hatte, bat sie den Kommissar um polizeiliche Mithilfe. Jakob traf mit dem schweigsamen Mieter aus dem ersten OG eine konspirative Vereinbarung. Der übernahm die Wasserpistole zu treuen Händen und die um ihren Schlaf gebrachte Nachbarin aus dem vierten dafür seinen Treppenwischdienst. Das war Nachbarschaft wie in alten Zeiten. Erst recht, als die Karaokebar an ihre Kundschaft Regenschirme ausgab und schließlich eine beschichtete Markise installierte. Sie nahmen es sportlich und brüteten über einer kreativen Antwort.
Nein, Jakob wußte nicht, warum er hätte umziehen sollen. Ringsum veränderte sich die Stadt, als hätte sie einen überdimensionierten Düsenantrieb unterm Hintern, seine Wohnung aber wurde immer gemütlicher. Bücher krabbelten die drei Meter vierzig hohen Altbauwände hoch, jedes Jahr baute er Regalbretter an. Seine Pflanzen wuchsen und rankten, als gälte es, ein vegetabiles Methusalemprojekt zu verwirklichen. Er hatte seinen Lesesessel mit dem Hocker aus Marokko davor, in den seine Fersen zwei Kuhlen gegraben hatten. Sein wohlig quietschendes Bett an der Wand, umbaut von Bücherregalen mit dem Ausblick auf den schönsten Balkon der Welt, auf dem die netteste Spatzendame von ganz Schöneberg ihr Zuhause hatte.
Jakob genoß das. Eine Wohnung, in die sein langer Körper wie in eine abgeliebte Wolldecke einwuchs, umgeben von Dingen, die ihm etwas bedeuteten, eingerahmt von Nachbarn. Ihre Geschichten, Streitereien, ihre Erfolge und Krankheiten. Frisch verliebtes Gelächter über den Balkon rangeweht. Zorn und endlose Gespräche die ganze Nacht, an- und abschwellend, um zu retten, was längst untergegangen ist.
Eine Frau, die zum Hof jeden Morgen ihr Schlafzimmmerfenster aufriss, der berufsmotivierten Trainerin von einer CD folgte, indem sie die Arme hob und senkte, in die Hände klatschte, den Morgen mit weit aufgerissenen Augen begrüßte und sich immer wieder einhämmern ließ, dies sei ein guter Tag. Und die eines Abends, als Jakob heimkam, auf der Treppe saß, um sich versammelt vier volle Einkaufstüten wie eine Schar müder Kinder, und heulte wie eine Fünfjährige, daß Rotz aus allen Öffnungen lief. Jakob setzte sich dazu, sah nach, was sie eingekauft hatte und bot ihr eine Banane an. Sie lachte, zog den Rotz hoch, sie teilten sich die Banane, sie ging hoch in ihre Wohnung und am nächsten Morgen riss sie wieder die Augen auf, klatschte in die Hände, als sei nichts geschehen.
Es war ja auch nichts geschehen. Außer, daß sie Jakob jetzt ansah, wenn sie sich begegneten, die Tür aufhielt, wenn er angeschlendert kam mit seinen langen Beinen und offenen Mänteln. Mehr nicht. Weniger nicht. Zieht man da aus, nur weil die Welt sich ändert? Man schleppt Bücher drei Treppen hoch und hofft, daß kein Erdbeben oder eine Fliegerbombe diese Höhle zum Einsturz bringt.
Zwei Stunden, nachdem Kommissar Jakob Hagedorn seine großen Füße auf den Dielenboden seiner Höhle gesetzt hatte, steckte er mit beiden Armen tief im Dienst, Frieda war weit weg bei ihrem winterlichen Tagwerk, sein Bett so kalt wie die Straßen der Stadt. Um zehn Uhr dreizehn lief ein Notruf ein, bewaffnete Geiselnahme in einer Weddinger Oberschule. Das zuständige Kommissariat war von Krankenstand und Sparmaßnahmen leergefegt und so half die Mordkommission aus. Um elf Uhr siebenundzwanzig waren die Schüler evakuiert, das Gelände gesichert, der Geiselnehmer saß im Lehrerzimmer mit einer unbekannten Zahl Geiseln. Jakob betrat das Gebäude, schickte die versammelten Einsatzkräfte nach draußen und klopfte.
»Weg von der Tür, Ihr Scheißer, oder ich murkse sie alle ab.«
»Ich bin Jakob Hagedorn, Hauptkommissar, außer mir ist hier niemand. Die anderen warten draußen und fragen sich, was sie für Dich tun können.« Jakob horchte. Leises Wimmern drang aus dem Lehrerzimmer. »Also ich fände Kaffee eine gute Idee.«
Stille.
»Nur müßten die draußen wissen, ob mit Milch und Zucker. Milch würde ich nicht hinterkriegen, dieses cremige Zeug, aber das ist natürlich Gechmacksache. Was hältst Du davon, wenn sie Dir gleich eine Kanne reinschicken, Beilagen extra, und ein paar Becher dazu?«
Stille.
»Nicht, daß ich was gegen Selbstgespräche habe, aber könntest Du vielleicht mal antworten? Oder noch besser, Du läßt die Frau raus, die da so wimmert, man kann sich ja kaum unterhalten. Und für Dich ist es sicher egal, ob nun einer mehr oder weniger. Also, ich bestelle mal eben den Kaffee und dann komme ich zurück.«
Jakob verließ den Vorraum, ging durch das Portal und schickte einen beispringenden Kollegen Kaffee und Brötchen holen.
»So, bin wieder da, kommt alles. Hier um die Ecke gibt es einen Kiosk, der hämmert Euch was zusammen. Ist ein freundlicher Kiez, wußte ich gar nicht. Die Panke plätschert vorbei, paar schöne Bäume auf dem Hof, was will man mehr, um ins Leben zu starten.«
Die Tür öffnete sich einen Spalt und ein verquollener Mann um die Vierzig taumelte heraus. »Das ist die Heulsuse«, donnerte es aus dem Hintergrund. »Der ist nicht mal ’nen Pott Kaffee wert.«
Jakob zog den Mann aus dem Vorraum, winkte den Kollegen am Portal und übergab ihnen den Schluchzenden. Er ließ sich das Tablett mit dem Kaffee und eine große Tüte belegter Brötchen geben, stellte beides auf den grauen Linoleumboden vor die Tür des Lehrerzimmers, nahm sich ein Brötchen und setzte sich neben die Tür. »Zimmerservice«, rief er. Die Tür öffnete sich einen Spalt.
»Woher weeß ick, daß da nüscht zum Schlafenlegen drin ist?«
»Laß Deine Gäste essen und trinken. Wenn sie nach einer Stunde noch wach sind, ist der Rest für Dich. Aber dann ist der Kaffee kalt.«
»Leck’ mich.«
»Du kannst uns natürlich auch einfach vertrauen«, sagte Jakob und biß von dem Brötchen ab. »Der Käse schmeckt nach Aldi.«
Eine behaarte Hand, geschmückt mit einer beachtlichen Goldkette, zog an dem Tablett, krachend schloß sich die Tür. Jakob wartete schweigend und kauend. Gummi, dachte er. Eine Schrippe war das zuletzt im Mittelalter.
»Großmaul«, hallte es eine Viertelstunde später aus dem Lehrerzimmer, »bist Du noch da?«
»Wie könnte ich weggehen, ohne mich von Dir zu verabschieden.«
»Sag denen, ich will Kaviar. Und Lachs. Schampus. Persecco.«
»Wir sind hier im Wedding, wo sollen die das denn herholen?«
»Ist mir doch egal, KadeWe oder so. Genau, ich will einen richtig fetten Freßkorb. Von ganz oben, wo die Geschniegelten immer sitzen und uns angucken, als müßten wir ihnen die Schuhe putzen.«
»Weißt Du, wie lange das dauert? Da müssen wir erst den Chef vom KadeWe überzeugen, daß er Dir kostenlos einen zusammenstellt, weil, auf Staatskosten geht das gar nicht, Du kennst ja unseren Finanzsenator, spart an allen Enden. Und außerdem jagst Du dann die nette kleine Kollegin hin, die vor der Tür wartet und die bekommt den ganzen Zoff ab, dabei kann sie gar nichts dafür. Nee, das gefällt mir nicht, das lassen wir.«
»Und wenn ich meinen Geiseln was antue?«
»Sitzt Du in der Scheiße. Und Kaviar kriegst Du trotzdem nicht. Schmeckt übrigens sowieso nicht. Stell Dir vor, Du langst in ein Salzfaß, in dem etwas Glibberiges schwimmt, das nach nix schmeckt.«
»Und warum essen die das dann alle?«
»Damit Leute wie Du denken, daß sie die sind, denen die Schuhe gehören und nicht die, die sie putzen.«
»Ich hab’ aber Hunger.«
»Das waren zehn Schrippen, haben Deine Geiseln Dir nichts übriggelassen?«
»Ich bin eben gut erzogen.«
Jakob lachte.
»Hör’ auf zu lachen, Du Arsch.«
»Sei nicht so empfindlich. Was hältst Du von Pizza?«
»Gibt der Polizeipräsident Dir das wieder?«
»Der mag keine Pizza.«
Man einigte sich auf eine Einladung aus Anlaß der neuen Bekanntschaft. Jakob kehrte mit einem Stapel Pizzakartons auf dem Arm zurück in den Vorraum. »So langsam wird mir das aber zu blöd, mit Dir immer durch die Tür zu reden. Ich lasse meine Knarre hier draußen, wenn Du willst, kannst Du mir ja dabei zusehen, und dann kommen die Pizza und ich rein.«
Stille.
Jakob legte seine Waffe auf die Fensterbank und öffnete langsam die Tür. Die Mitte des Lehrerzimmers war gefüllt mit zusammengeschobenen Tischen. Darum gut dreißig Stühle, darauf jede Menge Schulhefte, Bücher, Stiftmappen. Lehrers Arbeitsplatz, nicht mal ein eigener Schreibtisch für jeden. Am gegenüberliegenden Ende des Raumes verschanzte der Geiselnehmer sich hinter einem Regal, in seinem Arm eine Geisel, an deren Hals er theatralisch ein großes, böse blinkendes Messer drapiert hatte. Die Frau war langstrippig blond, in Lehreruniform. Jeans, T-Shirt, Pullover drüber, Nickelbrille. Sie sah aus, als bräche ihr demnächst das Genick von allein.
Links vom Geiselnehmer unter dem Fenster saß die Reihe der übrigen Geiseln, acht müde, schweißnaß gerötete Lehrergesichter, die sich in ihr schon lange so ähnlich erwartetes Schicksal fügten. Sie waren aneinander und an die jetzt im Februar unangenehm heißen Heizungsrohre mit Seilen gefesselt. Jakob ging zielstrebig auf die raumgreifende Tischplatte zu und verteilte seine Pizza. »Leider wußte ich nicht, was Deinen Geschmack trifft, deshalb habe ich die Speisekarte rauf und runter mitgebracht. Salat ist nicht dabei, ich dachte mir, Du bist sicher kein Grünzeugesser.«
»Woher willst Du das wissen?«, fragte der Geiselnehmer, ohne das Messer vom Hals der Lehrerin zu lösen.
»Soll ich noch mal losgehen und welchen holen?«
»Quatsch, stell’ Dich da hinten an die Wand zu den anderen und binde Dich fest.«
Jakob öffnete seelenruhig den ersten Pizzakarton und wedelte sich den Duft zu. »Das mache ich sicher nicht. Hast Du schon mal von einer Einladung zum Essen gehört, wo nur einer essen darf? Also, laß die Frau los, komm’ her und such Dir eine aus.«
Der Mann führte die Frau zu den anderen Geiseln und versuchte sie zugleich anzubinden und Jakob nicht aus den Augen zu lassen.
»Deine Pizza wird kalt, Mann. Glaubst Du, ich zahle so viel Geld für kaltes Gummi? Die Brötchen waren schon schlimm genug. Also, laß die Frau gehen und komm endlich her.«
Der Mann legte den Kopf schief und sah ihn an. Die Schulglocke läutete das Ende der sechsten Stunde ein.
»Siehst Du, jetzt hat sie Schulschluß. Was sollen denn ihre Leute zuhause denken, wenn sie nicht kommt.«
Der Mann ließ die Lehrerin los. Entgeistert sah sie zwischen ihm und dem Messer hin und her. »Worauf wartest Du, Alte, verschwinde, bevor ich es mir anders überlege.« Er wedelte mit der Hand, als sei sie eine lästige Fliege. Die Frau sah zu Jakob, der zur Tür deutete und sich ein erstes Stück Pizza nahm. Hastig stolperte die Frau los, riss die Tür auf und verschwand. Jakob sah zur weit geöffneten Tür und fragend zu dem Geiselnehmer. Der hob sein Messer, schüttelte den Kopf und ging selbst zur Tür. Sah vorsichtig um die Ecke und verschwand im Vorraum. Jakob kaute weiter. Als der Mann zurückkehrte, hatte er Jakobs Waffe in der Hand. Jakob kaute nicht mehr.
»Ist die geladen?«, fragte der Geiselnehmer und ließ sie am ausgestreckten Zeigefinger baumeln.
»Das solltest Du nicht ausprobieren. Wenn die draußen einen Schuß hören, wird gestürmt und das überlebst Du nicht. Nimm lieber etwas Pizza. Hier, mit schön viel Salami.« Jakob schoß die Schachtel quer über den Tisch in Richtung des Geiselnehmers. Die Pappe kam an einer wildledernen Stiftmappe ins Straucheln, stieß gegen einen krummen Heftstapel, der sich zögernd entschloß, vom Tisch zu stürzen. Der Geiselnehmer öffnete ungerührt den Karton, riß ein Stück Pizza ab, faltete es zusammen und schob es sich in den Mund. Mit fettigen Fingern griff er wieder nach der Waffe, dieses Mal schon deutlich routinierter. »Der bei mir um die Ecke ist besser.«
Jakob zog die Schultern hoch. »Die Schrippen waren schlimmer.«
»Kaviar muß ich trotzdem mal kosten.«
»Wenn wir alle heil draußen sind, lade ich Dich ins KadeWe ein."
»So siehst Du aus.« Der Geiselnehmer lachte. »Ich und ein Kripomann, noch dazu einer vom Mord.«
»Woher weißt Du das, sollte ich Dich kennen?« Jakob nahm sich eine Papierserviette vom Stapel der übrigen Pizzakartons, wischte sich sorgsam die fettigen Finger ab und sah den Geiselnehmer an.
»Du bist eine Legende, Mann. Ein Bulle, der ’nen Kollegen in den Knast bringt, weil der seine Mausi umgenietet hat, obwohl der Fall längst zu war und so ’ne arme Sau schon stellvertretend einsaß. Den, der so was fertig bringt, wollte ich schon immer mal treffen, habe mich bloß gefragt, ob ich dafür einen abmurksen muß.« Er griff sich ein weiteres Stück Salamipizza, klappte es zusammen und schob es quer in den Mund. Seine Kiefermuskeln waren Hochleistungseinsatz gewöhnt, Jakob dachte an eine Schlange, die eine Maus hinunterwürgt. »Wie man sieht, geht es auch anders«, sagte er schmatzend, »freut mich, Dich kennenzulernen, Hagedorn.«
Jakob griff den Stapel Pizzakartons und deutete fragend zur angebundenen Lehrerschar. Der Geiselnehmer nickte. Jakob brachte die Pizza zu den Lehrern, öffnete zwei Kartons und bat sie, mit der jeweils freien Hand zuzugreifen. »Es tröstet mich, daß wir uns nicht kennen. Ich vergesse kein Gesicht, mit dem ich es mal zu tun hatte.«
»Sag mal, stimmt das, daß Du die Leichen siehst, so als Geister und so? Hat mir ein Kumpel erzäht, der saß mit einem Mörder von Dir in einer Zelle.«
»Hier im Raum sind keine und das sollte auch so bleiben, wenn Du mich fragst.«
Der Geiselnehmer starrte ihn an und rülpste. »Hängt ganz davon ab, ob ich kriege, was ich will.«
»Und das wäre?«
Der Geiselnehmer nahm sich Jakobs Waffe, spielte damit und zielte auf die Orgelpfeifen an der Heizung, die nach Luft schnappten. »Gerechtigkeit für meinen Bruder.«
Jakob ging zu den Geiseln, nahm die offenen Pizzakartons weg und schob sich so in die Schussbahn. »Wer ist denn Dein Bruder? Wart Ihr schon so weit, das zu klären?«
»Alexander, so heißt er«, sagte eine Frau mit geschlechtslosem Bürstenhaarschnitt leise. »Wir mußten ihn von der Schule verweisen.«
Der Geiselnehmer kam auf die Frau zu und schwenkte die Waffe vor ihrem Gesicht. »Gar nix mußtet ihr. Ein super Schüler ist er, immer gute Noten hat er nach Hause gebracht.«
Jakob sah die Frau an.
»Er ist einfach nicht mehr erschienen.« Sie zog die Schultern hoch. »Was sollten wir denn machen?«
»Vielleicht mal seinen großen Bruder fragen, Ihr Penner? Ich hätte das schon geklärt. Stattdessen kündigt Ihr ihm, so ein Scheiß.«
Jakob drehte sich zu ihm um. »Wie heißt Du, großer Bruder?«
»Wladimir, verflucht noch mal. Und ich bin ein guter Bruder.«
»Deshalb bist Du jetzt hier.«
»Genau, Alter, man hilft seinem Bruder.«
Jakob drehte sich zurück zu den Lehrern. »Also, wie war das mit Alexander?«
Die Frau mit der Bürste antwortete, nachdem sie jeden ihrer Kollegen angesehen hatte. »Alex war mein Schüler, in Mathe, Physik und Chemie. Er war zuletzt in der 10a und ein guter Schüler, Sie haben recht. Manchmal dachte ich, er ist so etwas wie mein verlängerter Arm in der Klasse, verantwortungsbewußt, sehr aufmerksam bei Ungerechtigkeiten, ruhig und besonnen.« Wladimir grunzte zufrieden, setzte sich auf den Lehrertisch und legte Waffe, Messer und Handy neben sich. »Vor gut vier Monaten wurde er dann achtzehn. Das ist alt für einen Schüler der zehnten Klasse, vielleicht hat ihm das etwas ausgemacht, ich weiß es nicht, zumindest hatte er sich in den Wochen vor seinem Geburtstag verändert. Verunsichert wirkte er, angeschlagen. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen, aber er wollte nicht.«
»Sind Sie seine Klassenlehrerin?«, fragte Jakob.
»Nein, das ist Lars Thom«, sie deutete auf einen jungen, durchtrainierten Kollegen, der sich an den Heizkörper klammerte. »Es schien mir nur, Alexander und ich hätten einen Draht zueinander, deshalb habe ich es versucht.« Sie rieb sich mit der freien Hand das Handgelenk der anderen. Das Seil schnitt ihr ins Fleisch. »Gut eine Woche nach meinem Gesprächsangebot war er verschwunden, um seinen Geburtstag herum. Normalerweise nehmen wir in solchen Fällen Kontakt auf zu den Eltern, aber Alex war achtzehn, das heißt, er kann tun und lassen, was er will.«
»Scheiße, Mann, Ihr müßt Euch doch trotzdem kümmern«, sagte Wladimir.
»Wenn Sie mich ausreden ließen, wüßten Sie, daß wir das getan haben.«
Wladimir hob begütigend die Arme, Waffe, Messer und Handy in Griffweite.
»Erzählen Sie weiter«, sagte Jakob und behielt ihn im Blick.
Die Frau räusperte sich. »Das Sekretariat war erst nach vier Wochen bereit, den obligatorischen Brief zu schicken. Androhung des Schulverweises wegen der angesammelten unentschuldigten Fehlstunden im üblichen Amtsdeutsch. Mir war das zu wenig, deshalb bin ich zu Herrn Thom gegangen und habe mit ihm geredet.«
Alle sahen zu dem jungen Lehrer, der sich dichter an die Heizung drückte.
»Er sah keinen Handlungsbedarf?«, half Jakob nach.
»Schlimmer. Das geht uns nichts an, hat er gesagt, Alex ist volljährig.« Die Frau sah den Kollegen strafend an. »Also habe ich dem Jungen selbst geschrieben. Versucht, Hilfe anzubieten, ohne daß ich wußte, worum es ging.«
»Er hat nicht reagiert?«
»Leider. Da ich stur bin, habe ich ihn in seiner Wohnung aufgesucht. Sturm geklingelt, angerufen. Bin immer wiedergekommen.«
»Aber er wollte sich nicht erretten lassen?«
»Offensichtlich nicht. Man muß wohl irgendwann akzeptieren, wenn die angebotene Hilfe ausgeschlagen wird.«
Wladimir griff sich das Messer, stand auf und ging auf die Frau zu, zerschnitt das Seil um ihr Handgelenk und warf die Stücken auf den Fußboden. Als er im Rücken Jakobs Bewegung bemerkte, drehte er sich um und griff zu der Waffe auf dem Tisch. »Denk’ nicht mal dran, Alter«, sagte er und setzte sich wieder.
Jakob war müde. Die letzte Nacht hatte ihn mehr erschüttert als ihm lieb war. Wenn er sich bewegte, roch er immer noch Hannas Haut. Sein Kopf funktionierte nicht richtig. Als sei etwas verrutscht. Die Stimmen schienen durch den Raum zu wandern, er hörte es klopfen, wahrscheinlich die Heizkörper. »Bleibt die Frage, was vorgefallen ist«, sagte er. »Alexander war ein guter Schüler, integriert in die Klassengemeinschaft,« er sah die Lehrerin an, »ein Vorbild sogar.« Sie nickte heftig. »Was ist an einem achtzehnten Geburtstag so dramatisch, daß es einen aus der Bahn wirft? Die Freiheit, die Verantwortung, für sich selbst auf eine neue Weise einstehen zu müssen, überfordern manchen, aber doch nicht Alexander?«
Jakob sah fragend die Heizung entlang. Der Klassenlehrer Thom sah auf den Boden, sein Ohrring blinkte in der Sonne wie eine Kaskade von Sternen. Jakob blinzelte, aber die Sterne breiteten sich im Raum aus und tanzten in den durch das Fensterlicht angeleuchteten Staubbahnen, als wollten sie eine neue Milchstraße bauen, mitten im Lehrerzimmer einer Weddinger Oberschule.
Wenn das Liebe ist, dann verschiebe das bitte auf später.
»Sex«, zischte es von links. Ein zu früh gealterter Lehrer mit einem Gesicht wie ein aufgegebener Bergwerksschacht reckte das Kinn. Jakob dachte an die fließende Bewegung von Hannas Hüften. »Meinen Sie etwa, er war bis zu seiner Volljährigkeit Jungfrau?«, fragte er.
»Fragen Sie doch ihn«, rief der Lehrer. Mit ausgestrecktem Zeigefinger deutete er auf den Kollegen Thom, dessen Kopf mit dem Ohrring um die Wette leuchtete.
Bin ich jetzt auch noch begriffsstutzig? Der sieht nach fünfzehn Stunden Muckibude die Woche aus und nicht nach Sex.
»Unterrichten Sie Sport?«, fragte Jakob. Der Lehrer hob vorsichtig den Kopf, Jakob staunte über seine verschiedenfarbigen Augen.
»Leistungssport«, zischte es aus dem Stollen, »besonders die Disziplinen auf dem Jungenklo.«
Jakob starrte den Klassenlehrer an. Jetzt waren an beiden Ohren Ringe, auch in der Nase und der rechten Augenbraue. Sie schossen Blitze ab, wie eine zerstörte Hochspannungsleitung. Es knisterte und zischte.
»Unser Sportlehrer ist eine Schwuchtel, so sieht es aus«, donnerte der Stollen. »Und bei Alexander konnte er sich nicht beherrschen. Ich habe sie selbst gehört, auf dem Klo, nach Schulschluß, an seinem achtzehnten Geburtstag. An Alexanders Stelle wäre ich auch nicht wiedergekommen, so wie das klang. Wäre das Gebäude nicht aus der Gründerzeit, die Wände wären eingestürzt.«
Der Geiselnehmer sprang auf, schoß auf den Stollen zu und brachte ihn mit der Faust zum Einsturz. Als er sicher war, daß das eine Maul gestopft war, drehte er sich um und fixierte Lars Thom. Die anderen Lehrer drückten sich weg, der Bürstenhaarschnitt – Mathe, Physik, Chemie – warf sich mit fesselfreien ausgebreiteten Armen vor den Sportlehrer. Jakob sprang auf, sah den Geiselnehmer auf sich zustürzen, umgeben von Brillanten, die funkelten wie ein Sternenregen. Wladimir nahm das Gesicht des Sportlehrers an, die Augen wechselten die Farbe in rasender Folge. Sein Mund öffnete sich und es fielen lauter Sternschnuppen heraus. Die Milchstraße war längst voll. »Wir lieben uns«, war das Letzte, was er hörte. Hanna, dachte er, ich falle.
III
Das Tal war überschaubar wie eine Puppenstube, eingerahmt von jetzt im späten Mai kraftstrotzenden Buchen. Eine Sandpiste stieß in das Rund, endete auf dem breitgefahrenen Vorplatz eines klapprigen Schuppens. Ein paar vergessene Apfel- und Zwetschgenbäume krümmten sich auf dem sanften Hang den Schuppen entlang.
Oberhalb der verschlafenen Szene saß eine kleine, schlanke Frau von Mitte dreißig am Waldrand und sah nachdenklich auf den Schuppen hinab. Ihre Beine steckten in bleichen Jeans, die Füße in ausgetretenen Wanderstiefeln. Sie trug einen viel zu großen grauen Pullover mit aufgekrempelten Ärmeln, darüber einen breiten speckigen Ledergürtel voller Schlaufen und Taschen mit Werkzeug. Sie hatte die Beine aufgestellt und ihre Arme auf den Knien abgelegt. Sie bewegte sich nicht, schwer hingen die von Schwielen bedeckten Hände, in der Rechten hielt sie ein Messer. Der Wind fuhr ihr durchs Haar, sie ließ es mit ihm spielen, ohne darauf zu achten. An ihrer Seite sicherte eine große graue Hündin mit aufmerksamen Ohren die Einöde nach allen Richtungen.
Wäre die Frau ein Vogel gewesen, sie hätte im Flug einen neugierigen kleinen Schlenker gemacht, um in dieses Tal zu blicken, wäre getrudelt von Hang zu Hang. Sie hätte innegehalten über dem Schuppen, der ausgedünnten Obstwiese, rüttelnd den in den Büschen knispernden Mäusen bei ihrem Tagwerk zugesehen, einen übermütigen Pfiff losgeschickt, der den Frühling preist, und wäre weitergeflogen. Aber sie war kein Vogel. Sie hatte einen Auftrag in dem kleinen Tal, im Innern seines Schuppens. Seit zwei Wochen wartete sie nun, sah den Buchen zu, wie sie das Dach des Waldes mit ihrem Grün zu schließen versuchten, und wägte ab. Ließ das Tal auf sich wirken, ihre Entscheidung reifen. Es gab keinen Grund mehr zu warten. Keinen vernünftigen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!