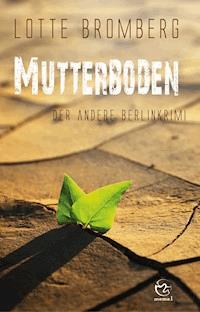
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Memel Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane mit Jakob Hagedorn
- Sprache: Deutsch
Kurz nach Mauerfall verschwand eine Biologieprofessorin spurlos. Was geschah mit Tilla von Bredow? Jakob Hagedorn, Hauptkommissar mit gründelndem Wesen und unordentlichem Hirn, ist nach seiner Rehabilitierung kaltgestellt. Er nutzt die Zeit und sucht die Mutter seiner geliebten Hanna. Als die exotische Schönheit Alika jedoch ihren Vater, einen georgischen Volkshelden, vermißt meldet, darf Jakob auf die Straßen der Stadt zurückkehren. Zerrissen zwischen zwei starken Frauen, in die Knie gezwungen von ostpreußischen Wintern, erschlagen von der Macht des Kaukasus, entdeckt er eine Tragödie und ein Mörder findet ihn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Lotte Bromberg
Mutterboden
Der andere Berlinkrimi
Memel Verlag
Mutterboden
Tilla von Bredow, Biologieprofessorin und überzeugte Alleinerziehende von sechs Töchtern, verschwand kurz nach Mauerfall spurlos. Jakob Hagedorn, Hauptkommissar mit gründelndem Wesen und unordentlichem Hirn, ist nach seiner Rehabilitierung im Archiv kaltgestellt. Er nutzt die freie Zeit und sucht die Mutter seiner Geliebten Hanna.
Als jedoch die exotische Schönheit Alika, bildende Künstlerin und Betreiberin eines stadtbekannten Restaurants, ihren Vater, einen georgischen Volkshelden, vermißt meldet, darf Jakob als Kriminaler auf die Straßen der Stadt zurückkehren und vernachlässigt die Suche nach Tilla.
Zerrissen zwischen zwei starken Frauen, gefangengehalten in einer Gruft, in die Knie gezwungen von ostpreußischen Wintern und erschlagen von der Macht des Kaukasus, entdeckt er eine Tragödie und ein Mörder findet ihn.
Jakobs dritter Fall: kraftstrotzende Figuren, wuchtige Geschichten, melancholische Komik und jede Menge Spannung.
Der andere Berlinkrimi - prall, schräg, abgründig, poetisch.
Lotte Bromberg
wurde 1968 geboren. Sie wacht, schläft, arbeitet und schreibt in Berlin. Mutterboden ist nach Fallsucht und Auslaufgebiet ihr dritter Kriminalroman mit den Berliner Ermittlern Jakob Hagedorn und Oskar Blum. Weitere folgen. Leseproben und mehr:www.memelverlag.de
Dies ist ein Roman. Jegliche Übereinstimmung oder auch nur Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen oder Begebenheiten ist zufällig und in keiner Weise beabsichtigt.
Erstausgabe
© Memel Verlag Berlin 2016
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagphoto © fotolia.com/viktor
E-Book Herstellung: Zeilenwert GmbH 2016
ISBN 978-3-945611-08-1
www.memelverlag.de
Ungewiß, wann die Dämmerung beginnt, öffne ich alle Türen.
Emily Dickinson
Inhalt
Cover
Titel
Das Buch/die Autorin
Impressum
Zitat
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
Danke
I
Alika hatte eine Heimat für den Kaukasus gesucht und eine Apotheke gefunden.
Sie war sechzehn gewesen, als ihr Vater Guram seine Familie aus Georgien rettete. Er führte sie nach Berlin und kehrte selbst zurück nach Tiflis, um an allen erdenklichen Fronten für seine Heimat zu kämpfen.
Vom ersten Tag an hob das Heimweh in Alika tiefe Gräben aus. Sie machte Abitur und studierte auf Anweisung der Mutter Betriebswirtschaft. Aber die Winde des Kaukasus zerrten immer stärker an ihr. Und als die Mutter mit einem neuen Mann nach Israel weiterzog, ließ Alika die Wirtschaft fahren und folgte den Einflüsterungen des Windes.
Sie kaufte von ihrem restlichen Geld Pinsel, Farbe und Leinwand und malte wie eine Besessene die verlorene Heimat. Bewarb sich erfolgreich um einen Studienplatz an der UdK und bezog die bezahlbare Abstellkammer einer schmuddeligen Moabiter WG, regelmäßig von den Mitbewohnern eingeladen, mit ihnen ihre Betten zu teilen.
Denn Alika war eine exotische Schönheit in einer an fremdartigen Physiognomien überreichen Stadt. Über ihrer gebogenen Nase teilte eine Kindheitsnarbe Stirn und Gesicht in zwei ungleiche Hälften. Ihre tiefschwarzen Augen gruben sich in das Gegenüber. Alika trat den Menschen zu nah, strahlte eine atemberaubende Intimität aus, mit ihrem wilden schwarzen Haar, ihrem ausgreifenden Schritt, ihren von Ölfarben bunten Fingern. Obwohl klein an Körpergröße, war Alika eine unübersehbare Frau, zu deren glühendem Wesen sich jeder stellte – in Bewunderung oder Ablehnung, in Begehren oder Haß.
Wer es wagte, sich ihrem Blick zu öffnen, aus Abenteuerlust oder Naivität, traf auf erschlagende Hitze und eine unendliche Zahl geschundener Vorfahren. Niemand hielt dem stand.
Alika hatte mit ihrer georgischen Heimat auch den Resonanzboden für ihr ausuferndes Temperament, den Raum für ihre Bilder und Lieder, den Ort für ihr Wesen verloren. Sie war so gesellig wie einsam.
Aber sie war jung und lernte die Sprache Berlins. Die andere Art der Begegnung und Zurückweisung, die anderen Gerüche, Stimmen, Lieder, Farben, die fremden Speisen, den anderen Geschmack. Alika lernte, ihr Lachen zu zügeln, die sie anspringende Trauer zu verbergen, nicht zu berühren, nicht zu singen, niemals zu tanzen. Sie lernte, unter ihren Berliner Nachbarn zu sein, aber alles Wesentliche zurückzuhalten. Zugleich behütete sie das Verborgene, nährte und pflegte es. Bat es um Geduld. Und sie malte, um von ihm in ihren Bildern zu erzählen.
Mit dem erfolgreichen Abschluß des Studiums verlor sie das Atelier an der Universität. Die Abstellkammer war so klein, daß sie im Stehen kaum die Arme ausstrecken konnte. Und so suchte sie ein Berliner Zuhause für sich und ihren auf Leinwand ausgelagerten georgischen Mutterboden.
Sie beäugte die Rückseite von Mitte, stöberte in Moabiter Kellern, stromerte durch Bucher Lagerhallen und durch Britzer Schrebergärten. Nirgendwo war Raum für ihr Feuer, für die im Schwarzen Meer versinkende Sonne.
Dann lud ein Bekannter vom Savignyplatz sie ein. Sie trank zu viel Wein, lauschte zu lange traurigen Liedern und bestieg die falsche S-Bahn. Fand sich um vier in der Früh am Stuttgarter Platz wieder und sah die Tür.
Vor einer Pension rauchten Prostituierte mit vor Kälte blauen Fingern. Ein krummer Mann beschimpfte seine obstkistenbeladene Sackkarre. Orangen kullerten in den Rinnstein. Ein Porsche bog um die Ecke, in einer Kneipe jaulten Männer mit Howard Carpendale von Liebe und Abschied. Eine Frau goß ihre Balkonblumen, schräg über ihr hing der riesengroße Vollmond.
Und dann war da die Tür.
Sie war einmal prachtvoll gewesen, Pforte für ein mächtiges Haus. Hundert Jahre später jedoch blieb sie für seine im Abseits lebenden Bewohner nur noch ein uneingelöstes Versprechen, vom vollen Mond in fahles Licht getaucht. Zwei Atlasbrüder trugen auf ihr die Last der Welt, eine sterbenskranke Nixe bildete den Türknauf aus Messing, golden leuchtend von so vielen Händen seit so vielen Jahren. Ranken aus großblättrigen Blumen rahmten das vergitterte Glas in ihrer Mitte. Über ihr dämmerte der verrußte Schriftzug »Apotheke«, im trüben Fenster daneben hing schief ein Maklerschild.
Alika hatte ihren Ort gefunden.
Ein ehemaliger Seemann hatte dort dreißig Jahre Schrauben und Nägel, Ösen und Muttern, Unterlegscheiben und Scharniere verkauft. Hatte Schuhe besohlt, Schlüssel geschliffen und Schilder geprägt. Als man ihn tot inmitten seiner Schrauben fand, sang Freddy Quinn in Endlosschleife »La Paloma«.
Es gab die alte Apothekeneinrichtung noch, der Seemann hatte sie genutzt. Jede Lade, jede Nische war gefüllt mit Kram aus längst vergangenen Zeiten. Alika räumte Platz frei für ihre Staffelei und hängte ein Schild in das Fenster: Alles mögliche zu verschenken.
Sie feierte eine rauschende Einweihungsparty mit ihren Künstlerfreunden. In der kleinen Küche kochte sie georgische Spezialitäten. Die ersten Nachbarn kamen. Zogen Schrauben und Nägel aus Schubladen und Kistchen, linsten nach der Narbe auf Alikas gespaltener Stirn und schnupperten an ihrem fremden Essen. Alika ließ sie kosten.
Ihre Apotheke war von Anfang an ein offener Ort. Wollte sie malen, hängte sie ein Schild in das Fenster: Bin im Kaukasus. Niemand störte sie dann. Aber öffnete sie die Tür und die Gerüche ihrer Heimat wehten auf die Straße, blieb sie nicht lange allein. Als erstes kamen die Huren, dann die Ladenbesitzer von nebenan, die Nachbarn aus dem Haus. Alle bewunderten ihre Bilder, niemand kaufte sie. Aber alle wollten essen, und Alika war eine gute georgische Gastgeberin, sie fütterte sie mit den Genüssen ihrer Heimat.
Dann kam ein Mann von der Gasag, um ihr das Gas abzudrehen, das sie seit Monaten nicht hatte bezahlen können. Sie bettelte, weinte und sie bekochte ihn. Er rieb sich den wohlig gefüllten Bauch und schlug ihr vor, ein Restaurant zu eröffnen. In ihrem Essen stecke Gas für einen ganzen Winter.
Und Alika sah sich um. Sah in dem Apothekentresen eine Bar, darüber einen Zapfhahn. Sah in den Regalen Weinflaschen stehen, hörte Gäste lachen, sah zusammengeschobene Tische, ihre Bilder an der Wand, hörte georgische Musik.
Sie sammelte Stühle aus abgelebten Wohnungen, baute Tische aus Zimmertüren, Bänke aus Bauholz, schweißte Lampen und Kerzenständer aus Wasserrohren und schließlich ihr neues Schild. Zwei Monate später eröffnete »Alikas Apotheke«.
Schnell wuchs das Lokal. Immer tiefer fraßen sich ihre Gasträume in das Haus hinter der Apotheke mit der verwunschenen Tür. Alika eroberte den Hof, begrünte ihn mit exotischen Pflanzen ihrer Heimat, sprang in das Hinterhaus, belegte dort das Parterre mit ihren Gästen und stieg über den zweiten Hof in das Gartenhaus. Stellte Köche und Kellner, Spüler und Putzfrauen ein. Verhandelte mit dem Gesundheitsamt, besorgte Papiere und Genehmigungen, bekochte Aufseher vom Gewerbeamt und hatte immer mehr Gäste.
Als erstes kamen die Kaukasier. Abchasen, Armenier und Aserbaidschaner, Tschetschenen, Inguschen, Mescheten und Osseten, Georgier und Russen. Es wurde gefeiert und gelacht, geschlemmt, gesoffen, gesungen und geweint, gestritten und sich versöhnt.
Manchmal war Alika jedoch froh über die ungewöhnliche Aufteilung der Räume. Wenn es zwischen den einzelnen Gruppen rumpelte, trennte sie sie mit harter Hand. Sie wies sie in verschiedene Räume und ließ sie sich trotzdem bei ihr zuhause fühlen. Niemand wollte dieses Stück Heimat in der Fremde missen, alle gehorchten ihrer georgischen Herdmutter.
Dazu gesellten sich Besucher vom Stuttgarter Platz. Altlinke Oberstudienräte bestellten grünen Tee. Bärtige Nachwuchsväter nahmen an Alikas georgischen Fleischtrögen Auszeit vom veganen Alltag. Charlottenburger Hinterhofganoven pumpten sich am Tresen auf, bis zum ersten kaukasisch ausgetragenen Streit unter Männern.
Bald sprach sich das ungewöhnliche Restaurant am Stuttgarter Platz in der Stadt herum. Es wurde schick, in der Apotheke bekannt zu sein. Schlagersternchen machten Selfies mit Alika, Prominenzfriseure legten gefönte Hundchen auf Tische und fütterten sie mit Lammfleisch. Es kamen die Rechtsanwälte mit ihren Cabrios, ein Staatsanwalt aus dem Kiez, schließlich die Richter und zuletzt die Polizei. Jeder aß von Alikas Tellerchen und ihr aus der Hand.
Sie bezahlte ihre Gasrechnungen pünktlich, lernte, über Schutzgeldbeträge zu verhandeln, wies Russen und Kaukasier in ihre jeweiligen Schranken und spielte sie gegeneinander aus. Malte nur noch an freien Tagen und wurde immer besser. Plötzlich verkauften sich die Bilder der schönen Apothekerin.
Inzwischen war Alika eine gestandene Wirtin, hatte den Kaukasus nach Berlin geholt, lebte mit allen Sinnen in ihm, und ihre Gäste liebten sie dafür, daß sie sie daran teilhaben ließ.
Der Frühling war überraschend mit einem fremden südlichen Wind in die Stadt eingezogen. Viel zu früh, aber zu schön, um vorsichtig zu sein. Alikas Apotheke wurde zu einem nervösen Bienenstock.
Kaukasische Mafiosi gingen zwischen Vorspeise und Hauptgang ihren Geschäften nach, lauter als sonst, wilder als sonst. Tscherkessen zeigten Verkaufsphotos von siebzehnjährigen Dorfschönheiten. Alte Männer schwärmten von vergangenen Bärenjagden und im Traum gewonnenen Kriegen. Eine Gruppe junger Aserbaidschaner hatte Tische zusammengestellt, breitete Landkarten für eine Bergtour aus und markierte die einzelnen Etappen mit Weingläsern. Ein vorbeitorkelnder Russe stieß an die Tischplatte, Wein schwappte auf den Kleinen Kaukasus. Ein Aserbaidschaner sprang auf, die Männer maßen sich mit Blicken, der Russe murmelte eine abfällige Entschuldigung.
Die Gefahr, daß verschiedene Volksgruppen aneinandergerieten, war groß an so einem flirrenden Frühlingstag. Und ausgerechnet heute feierte Kriminalrat Fockemeyer, Chef aller Mordermittler der Stadt, korrupter Strippenzieher und unverwüstlich intrigantes Stehaufmännchen aus alten Westberliner Zeiten, in Alikas Apotheke seinen Geburtstag. Mit der halben Strippenzieherprominenz der Stadt.
»Aber Herr Kriminalrat, ein Glas von unserem guten georgischen Wein vertragen Sie noch. Sie sind doch ein vitaler junger Mann«, sagte Alika und schenkte nach.
Fockemeyer zog lachend seine sehr junge armenische Flamme an sich. »Ich will gar nicht mehr jung sein. Hatte nix zu sagen und eifrig das Auge auf den Pfad der Tugend gerichtet.«
»Wann soll denn das gewesen sein?«, fragte Rudi Laritzke, ein mit allen Berliner Wassern gewaschener Baulöwe, der seit zehn Jahren sein Geld mit Nichtstun auf dem Schönefelder Flughafenneubau verdiente.
»Da kanntest Du mich noch nicht.«
»Das glaube ich, alter Ganove.«
»Vorsicht, was Du sagst«, Fockemeyer wedelte mit dem Zeigefinger, »ich bin die Polizei.«
»Willst Du uns alle auf der Flucht erschießen?«
Die Geburtstagsgesellschaft lachte dröhnend.
Zwei Tische weiter schimpfte ein Gast auf Russisch mit dem Kellner. Der Bienenstock summte.
»Frag unsere schöne Alika«, Focke legte vertraulich seine Hand auf ihren Arm, »was für eine fürsorgliche Seele der tugendhafte Fockemeyer ist. Wenn es ein ernstes Problem in der Apotheke gibt, ist der Kriminalrat sofort zur Stelle.«
»Darf ich nachher darauf zurückkommen?«, fragte Alika und sah zu dem mit dem Russen verhandelnden Kellner.
»Du hast doch nichts ausgefressen?« Fockemeyer grinste Alika an. »Etwa einen Zechpreller erschlagen? Und jetzt soll der Onkel von der Keithstraße die Leiche entsorgen?« Die armenische Flamme lachte quietschend und hielt ihre weichen Finger vor den Mund.
Der russische Gast fuhr mit der Faust auf die Tischplatte, Gläser klirrten, der Kellner sah zu seiner Chefin.
Alika zog ihren Arm unter Fockemeyers Hand hervor. »Mein Vater wird vermißt, und Ihre Kollegen nehmen das nicht so ernst, wie es ist. Sein Leben ist bedroht, Sie müssen ihn bald finden. Aber jetzt wird erst einmal gefeiert.« Sie winkte einer Kellnerin. »Die Runde geht aufʼs Haus.«
»Die schöne Alika«, sagte der Russe. Seine goldene Armbanduhr leuchtete. Er hatte Verstärkung mitgebracht, ihm gegenüber saßen zwei weitere Männer, stiernackig und rotgesichtig. Alika hatte alle drei noch nie gesehen.
»Gibt es Schwierigkeiten?«, fragte sie.
»Der will uns keinen Wodka mehr geben.« Der Russe deutete auf Igor.
Alika sah auf die zahlreichen Wodkaflaschen im Spirituosenregal und nickte Igor zu.
»Schmeckt Euch mein Essen denn?«, fragte sie und stellte sich zwischen den Tisch und Fockemeyers Geburtstagstafel.
»Teuer ist es«, sagte der Russe.
»Ihr seid zum ersten Mal hier und meine Gäste.«
Igor, Alikas Chefkoch, brachte eine neue Flasche Wodka und schenkte dem Russen ein. Aus der Küche kamen die fünf kasachischen Spüler und reihten sich hinter dem Tresen auf, die muskulösen Arme vor der breiten Brust verschränkt.
»Ich nehme an, Jurij Iwanow hat Euch geschickt«, sagte Alika und beugte sich vor zu dem Russen. »Sagt ihm, daß mein Angebot nur für Euren ersten Besuch gilt.« Sie schoß ihn mit ihrem schwarzen Blick ab.
»Um Alika würde ich mich auch gerne mal kümmern«, sagte Rudi Laritzke mit gierigem Blick auf ihre Rückfront.
»Übernimm Dich nicht«, sagte Fockemeyer. »Und ich krieg noch Geld wegen der Baugenehmigung für Dein Hochhaus.«
Die armenische Flamme kreischte. »Sie bauen Hochhäuser?«
»Am Ernst-Reuter-Platz, meine Süße, bis zum Himmel.« Er beugte sich über den Tisch. »Kann ich Dir gern mal zeigen.«
Fockemeyer schlug ihm auf die Finger. »Ohne mich krepiert das Ding im zweiten Stock.«
»Hab gehört, Ihr macht Solarfassaden«, sagte Boltz-Kercher, in Spanien gestählter Hoch- und Tiefbauer mit dichtmaschigem Schmieröl-Netzwerk in der Politik.
»Man will ja was für die Umwelt tun«, sagte Rudi.
»Und was machen die Fördergelder?«
»Sprudeln.« Rudi sah ihn an. »Brauchst Du auch welche?«
»Kannst Du Solar empfehlen?«
Rudi winkte ab. »Hohe Kosten, geringer Ertrag. Es sei denn, Du willst der Zielgruppe den Bauch pinseln. Bei ʼner Neubausiedlung hab ich das mal gemacht. Öko, junge Familien. Rechnet sich aber nicht. Veganer Babybrei ist teuer. Locker sitzt das Geld erst, wenn der Sargdeckel in Sicht ist.«
»Was siehst Du mich an?«, fragte Focke. »Ich bin frisch und knackig.«
»Deine Kleine guck ich an, Du eitler Sack.«
»Und wo willst Du hin mit dem Solar?«, fragte Focke.
»Brandenburg«, sagte Boltz-Kercher.
»Echt? Die Sandpiste?«
»Hab da zwei Seen billig gekriegt.«
»Wieder die Sozialisten geschmiert, gibʼs ruhig zu.«
»Aber nie.« Boltz-Kercher hob drei Finger zum Schwur.
»Was kosten die Landeier von der Linken jetzt? Sag schon.«
»Vorwärts Genossen«, sagte Rudi und rülpste. Er sollte auf Bier umsteigen. Den Magen schmieren.
»Betriebsgeheimnis«, sagte Boltz-Kercher. »Die billigen Zeiten sind vorbei.«
»Und was machst Du am See?«, fragte Focke. »Luxushotel?«
»Bootshäuser. Vierhundert Stück.«
»Du lieber Himmel.«
»Kauf ich für ʼn Appel und ʼn Ei in Holland, die Dinger. Null Isolierung, fast keine Vorschriften. Und verscherbele sie als individuelle Ferienhäuser.«
»Bootshäuser, tzzzz«, sagte Rudi und rieb sich den Bauch.
»Sind eigentlich ja bloß Bretterbuden mit Frischwasservorbeifluß. Aber Ihr glaubt nicht, was die Neuberliner dafür bezahlen. Hab eine Werbekampagne gestartet. War richtig teuer, aber genial. Freiheit, Frieden, Glückskekse. So ein Yogading. Märkische Einöde als meditative Erfüllung. Kopfstand auf dem eigenen Bootssteg.«
Focke lachte. »Die sind sooo blöd.«
»Haben meistens nicht mal ein Boot. Und anfangs dachte ich, die Buden müßten alle unterschiedlich aussehen.«
»Müssen sie nicht?«
»Aber nein, im Gegenteil. In Terrorzeiten wollen die Leute Sicherheit und sich verstecken.«
»In Brandenburg. Im Bootshaus.« Focke schüttelte den Kopf.
»Wenn ein Moslem mit der Machete kommt, soll er verwirrt vor lauter geklonten Bretterbuden stehen. Verringert die Wahrscheinlichkeit, inʼs Paradies gesäbelt zu werden.«
»Und wenn er doch kommt, springst Du einfach inʼs Wasser.« Focke lachte. »Offener Fluchtweg.«
Der Russe nahm sein Glas und kippte den Wodka in den Rachen. Hustete und spuckte aus. »Was ist das?«, schrie er.
»Spülwasser«, sagte Igor, Alikas Chefkoch, ruhig. »Gut genug für russische Schmarotzer.«
Der Russe sprang auf, sein Stuhl stürzte um. Die kasachischen Spüler hinter dem Tresen erhoben die Köpfe, die anderen Gäste unterbrachen ihre Gespräche. Der Russe griff die Wodkaflasche am Hals und musterte die Umgebung. Den finster dreinblickenden Igor, die fünf Spüler, Alika, ihre Bilder an den Wänden. Er fand ein besonders großes, hob langsam den Arm und zerschmetterte die Flasche an dem Gemälde.
Fockemeyers armenische Flamme kreischte.
»Das wäre dann Sachbeschädigung«, sagte der Kriminalrat. »Was für ein Glück für Sie, daß ich nicht im Dienst bin, sondern nur meinen Geburtstag feiere.«
Seine Gäste lachten verkrampft, der Russe fixierte ihn.
»Wenn Sie Alika den Schaden ersetzen, wollen wir den Vorfall gern vergessen. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Nicht wahr, Alika?«
Die zwei russischen Begleiter standen auf und hoben dabei den Tisch an. Gläser rutschten und zerbrachen klirrend am Boden. In die Reihe der fünf Spüler kam Bewegung. Zwei sprangen synchron über den Tresen, drei nahmen den Landweg, gemeinsam stürzten sie sich auf die Begleiter.
Der Russe nahm einen Stuhl und zerschlug ihn auf dem Tisch. Mit einem zersplitterten Stuhlbein in der Hand ging er auf Fockemeyer zu. Die anderen Gäste sprangen auf. »Willst Du eine aufʼs Maul, Polizist?«, fragte der Russe.
»Aber, aber«, sagte Fockemeyer, »Sie wollen doch nicht wirklich Ärger? Schon wegen der Aufenthaltsgenehmigung.«
Der Russe warf das Stuhlbein weg und lachte. Stieß Fockemeyer vor die Brust, der rückwärts fiel. Seine armenische Flamme kreischte wieder, griff ihre pinkfarbene Handtasche, ihr blaues Pelzjäckchen und flüchtete aus der Apotheke.
»Die biste los«, sagte der Russe. »Nimm Dir ʼne Russin, sind mehr gewöhnt.« Er lachte dröhnend.
»Ich rufe jetzt die Polizei«, sagte Boltz-Kercher und wischte hektisch über das Display seines Smartphones.
Der Russe schlug es ihm aus der Hand, hob den in Spanien gestählten Baulöwen hoch und warf ihn zur Tür hinaus. Von draußen stürmte seine wartende russische Verstärkung die Apotheke. Alika flüchtete hinter den Tresen. Die fünf Spüler warfen sich mit kasachischem Kampfgeheul der Übermacht entgegen.
Der Russe kehrte zur Geburtstagstafel zurück, beugte sich über den am Boden liegenden Fockemeyer und zog ihn am Hemdkragen hoch. Focke baumelte an seiner Hand wie eine klapprige Marionette.
»Na«, sagte er, »was macht Aufenthaltsgenehmigung, Polizist?«
Alikas Chefkoch Igor umfaßte von hinten den Hals des Russen und drückte zu. »Igor«, schrie Alika, »nicht!«
Igor öffnete seinen Würgegriff, der Russe ließ Focke auf den Tisch fallen, Igor griff ein herumliegendes Stuhlbein und zog es dem Russen über den Schädel.
Die Kasachen verloren an der Apothekentür zusehends an Boden. Männer brüllten, Tische zerbrachen, Stühle fielen übereinander. Die Horde kam der Geburtstagstafel, auf der Focke lag, immer näher. Hinter ihnen bot die offenstehende Tür einen Fluchtweg.
Fockemeyers Geburtstagsgäste rafften ihre Handys, Taschen und Jacken. Stiegen über Stühle, Tische und Bänke, stolperten über zerschlagene Flaschen und Gläser, rutschten über verstreutes Essen, schlitterten durch Wein- und Ölpfützen. Alle in eine Richtung, ab durch die Mitte und die Apothekentür.
Focke robbte sich auf seinem Geburtstagstisch, vorsichtig Gläser und Flaschen zur Seite schiebend, aus vorderster Kampflinie. Vor der Dessertplatte scheiterte er, zu viel Pudding. Er richtete sich auf und sah in ein kasachisches wütendes Gesicht. Aber wir sind doch auf der gleichen Seite, dachte er, als ihn eine Faust am Auge traf. Wie ein nasser Sack plumpste er auf den Boden.
Als er wieder zu sich kam, sah er Füße und Beine, Scherben und Chaos. Hörte Gebrüll und klatschende Schläge. Er robbte wieder. Jemand trat auf seine Hand, es knirschte darin, er jaulte. Ich will nach Hause. Die Toiletten, hinten waren die Toiletten. Und der Notausgang. Er kroch wie ein Käfer, sah immer weniger, sein kasachisch getroffenes Auge schwoll zu.
Er hatte die rettende Tür fast erreicht, als ihn jemand an der Schulter packte und umdrehte. Es ist mein Geburtstag. Ich hab genug. Focke hob die Hände vorʼs Gesicht und linste mit seinem verbliebenen Auge durch die Finger. Ein Russe. Die Aufenthaltsgenehmigung. Wenigstens der richtige Gegner.
»Wo willste hin, Polizei?«, fragte der und holte aus. »Sind noch nicht fertig mit Termin.« Er versetzte ihm einen krachenden Kinnhaken. Fockemeyer knallte gegen eine Tür, die Klinke erwischte seinen Nasenrücken, der Kriminalrat sank auf die Schwelle zu Alikas Pissoir und in die Bewußtlosigkeit. Super Geburtstag, war das letzte, was er dachte.
II
Hauptkommissar Oskar Blum wich Terminen mit seinem Chef Kriminalrat Fockemeyer so lange aus wie möglich. Doch dieses Mal hatte die Sekretärin ihn und seine junge Kollegin Tanja Wehland persönlich abgeholt und versprochen, es erwarte sie eine Überraschung. Was bei Focke nichts Gutes verhieß.
Oskar Blum war gebürtiger Neuköllner. Die rauhe Herkunft hatte ihm einen gelassenen Umgang mit Niederlagen und kompakte Unerschütterlichkeit mit auf den Weg gegeben. Beides war ihm auf seinem hindernisreichen Weg zu den Berliner Mordermittlern in die Keithstraße nützlich gewesen.
Wenn etwas aus dem Ruder lief, griff er zu, war sich für nichts zu schade, hängte niemanden hin, besuchte kranke Kollegen und alte im Ruhestand. Niemals murrte er über Dienstpläne, war im Einsatz ein verläßlicher Partner, gedachte der Geburts- und Ehrentage, lud zu Currywürsten ein, teilte Stullen und Thermoskannen. Solange man Humor hatte und nichts Ungesetzliches tat, auf beiden Seiten der Kriposchranke, war Oskar Blum ein echter Kumpel.
Er hatte sein gesamtes Leben in Berlin verbracht und wollte, daß das auch so blieb. Sich immer wieder neu in seiner sich ununterbrochen verändernden Heimatstadt zurechtzufinden, fand er aufregend genug. Und bis er dereinst die Familiengrabstelle auf dem Friedhof in der Hermannstraße beziehen würde, gab es innerhalb der Stadtgrenzen noch viel zu entdecken, er mußte die Bürgersteige von New York nicht unter seine Sohlen nehmen und brauchte keine Uckermark.
Nach Tanjas Klopfen warteten sie wie üblich lange auf Kriminalrat Fockemeyers Antwort. Oskar stieß endlich die Tür auf und sah die von der Sekretärin angekündigte Überraschung. Ein tiefblau blühendes Veilchen schmückte Fockes linkes Auge. Auf der Nase prangte ein großes Pflaster, die linke Hand war geschient, die aufgeplatzte Oberlippe monströs geschwollen. Kriminalrat Fockemeyer schien sich auf einem Neuköllner Spielplatz geprügelt zu haben. Und im Gegensatz zu Oskar wußte er offensichtlich nicht, wie man dem Kampf mit einem deutlich überlegenen Gegner auswich.
»Ich weiß, wie ich aussehe. Kein Wort, sonst landen Sie beide im Archiv.«
»Geht nicht«, sagte Oskar und plumpste auf den Stuhl, »da sitzt schon der Kollege Hagedorn.«
Jakob Hagedorn war Oskar Blums Freund, und er war seine Achillesferse. Der struppige Neuköllner Bodenbrüter hatte den Paradiesvogel, der in die Keithstraße flatterte wie ein Wesen von einem anderen Stern, vom ersten Tag an geliebt. Jakob wußte nicht gleich alles besser, hatte keine vorgestanzten Lösungen parat, sondern fragte nach und wartete ab. Kriminalhauptkommissar Hagedorn war lang wie eine Bohnenstange, trug eine verträumte altmodische Brille, und er hatte studiert.
Sah mit seinem gründelnden Blick in die Menschen hinein und knöpfte sie auf. Dachte viel und redete wenig. Stieg durch den Wald oder die Straßen der Stadt, vergaß dabei in strömendem Regen seinen Mantel, regelmäßig sein Handy, grundsätzlich den Dienstausweis und leider auch die Geburtstage der Kollegen. Er war anders und allein das war eine Provokation für jeden mittelmäßigen Beamten. Seine Augen waren zu warm und unverschämt, sein Gang zu entspannt, sein Schlag bei Frauen unheimlich, und er war zu erfolgreich als Kriminaler.
Manchmal stöhnte Oskar innerlich, wenn Jakob mal wieder eine Frau ansah, als sei sie die Wiedergeburt der Jungfrau Maria oder mit einem Verdächtigen redete, als sei der sein einziger Bruder. Jakobs Ich-Welt-Grenze hatte ein riesengroßes Loch. Er war den Menschen nah, kannte keine Distanz, und durch das Grenzloch polterten ungefragt Ganoven, jede Menge Mordopfer, einige Täter, eine hübsche Ladung knackiger Frauen und ab und an ein Brandenburger Wolf.
Auf einem Neuköllner Spielplatz hätte der wehrlose Jakob hoffnungslos den Kürzeren gezogen. Aber vielleicht hätten sich auch alle tätowierten Brüllaffen um ihn versammelt, wären lammfromm auf den Boden gesunken und hätten ihm, dem großen Mann, der sich zu ihnen hinunterbeugte und sie verstand, ihre wilden Leben erzählt.
Es war egal, ob Oskar Blum, der Neuköllner Currywurstverdrücker, verstand, was Jakob umtrieb, warum er sich immer wieder in andere Seelen vertiefen mußte und dadurch kein Fettnäpfchen ausließ. Er liebte diesen lattenlangen Träumer, und er war vom ersten Aufeinandertreffen bis zum Familiengrab sein bester Freund.
Die Kollegen dagegen erkannten in Jakob den Anderen, empfanden ihn als Bedrohung ihrer seit dem Mittelalter bewährten Ermittlungsmethoden, rückten gegen den Fremdling zusammen und warteten auf einen Fehler.
Als Jakob schließlich beim Einsatz in einer Weddinger Oberschule erst die geladene Dienstwaffe einem Geiselnehmer überließ und dann in seinen ersten epileptischen Anfall stürzte, stießen sie den Kranken und Verunsicherten in den Abgrund. Erst wurde er suspendiert, dann vor Gericht wegen Unterschlagung von Beweismaterial angeklagt. Kriminalrat Fockemeyer war dabei die treibende Kraft im Hintergrund gewesen.
Als Jakob freigesprochen wurde und zurückkehrte, immer noch zu groß, zu intelligent, mit denselben gründelnden Augen und jetzt auch noch ein Fallsüchtiger, verbannte Focke ihn in den Keller, zu den archivierten Akten, weit weg von den Kollegen und der eigentlichen Arbeit.
Tanja saß vor dem Schreibtisch des Kriminalrats und bemühte sich, angesichts der Fratze, zu der russische Fäuste Fockes Gesicht gemacht hatten, ernst zu bleiben.
»Ich habe einen Fall für Sie«, sagte der Kriminalrat. »Mit Priorität. Woran arbeiten Sie zur Zeit eigentlich?«
»Wieder am Weihnachtsfall«, sagte Tanja.
»Sehr gut, offene Fälle verderben die Statistik. Habe ich gar nicht verstanden, warum das damals so schwer war. Ist schließlich am Fest der Liebe ein überschaubarer Täterkreis.«
»Kollege Hagedorn fand einen neuen Aspekt«, sagte Oskar.
Focke lief rot an. »Der ist in der Wiedereingliederung. Was mischt der sich in den operativen Betrieb ein?«
»Hat er ja nicht, der Fall lag im Archiv.«
»Es war das Lametta«, sagte Tanja. »Niemand hat es vermißt.«
»Das was?« Das blaue Auge und die dicke Oberlippe ließen Focke nicht intelligenter aussehen.
»Der Flitterkram am Weihnachtsbaum«, sagte Oskar.
»Den benutzt doch kein Mensch mehr.«
»Die Tegeler schon.«
»Zum Ersticken«, sagte Tanja. »Deshalb hat es ja am Weihnachtsbaum gefehlt.«
»Sie konnten es nicht mehr aufhängen«, sagte Oskar.
»Nachdem sie Oma damit umgebracht hatten.«
»Mit Lametta?«, fragte Focke.
»Sie haben ihr den Mund damit vollgestopft, sie hat es in Panik eingeatmet und ist daran erstickt.«
»Nicht zu fassen.«
»Wir haben auf Hagedorns Rat hin Dr. Cumloosen gebeten, nachzuobduzieren. Tief in der Lunge fand er was.«
»Und die Kollegen haben ein Kissen gesucht«, sagte Focke.
»Hat allen das Weihnachtsfest versaut, das unauffindbare Ding«, sagte Oskar.
»Ich erinnere mich, so viele Überstunden, sah nicht gut aus.« Focke schüttelte den Kopf. »Auch noch für einen ungelösten Fall.«
»Hagedorn hat ihn gelöst«, sagte Tanja.
»Es war der Sohn«, sagte Oskar. »Aber wir brauchen noch das Geständnis.«
»Warum?«
»Hagedorn hat nur das Opfer als Geist gesehen. Und den Sohn, wie er das Lametta aus ihrem Mund geholt hat. Und dann unterʼs Bett damit.«
»Geister?« Fockes Stimme kippte. »Geht das wieder los?«
Es waren nicht nur Jakobs gründelnde Augen, seine Streifzüge durch die Stadt und nicht nur die Epilepsie. Jakob Hagedorns Ich-Welt-Grenze überstiegen auch regelmäßig die Geister Ermordeter. Ob das was mit seinem in Unordnung geratenen Gehirn oder seinen zappelnden Gliedern zu tun hatte, wußte Oskar nicht. Angefangen hatte es jedenfalls mit den Geistern, die Epilepsie kam hinterher.
»Das Lametta war unter dem Bett«, sagte Tanja ruhig, »genau wie Hagedorn gesagt hat.«
»Auf der Staubsaugertüte sind nur Sohnemanns Fingerabdrücke«, sagte Oskar.
»Aber er hat noch nicht gestanden«, sagte Tanja.
»Wenn wir vielleicht Hagedorn dazu …«
»Auf gar keinen Fall«, brüllte Focke. »Der bleibt im Keller.«
Oskar lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. »Dann kann das natürlich dauern. Sie wissen ja, ich bin nicht so der Interviewprofi.«
»Befragt ihn eben Frau Wehland.«
»Schwierig«, sagte Tanja. »Der Sohn mag mich nicht.«
»Sie kann nicht berlinern«, sagte Oskar. »Tegel, das ist das Problem.«
Sie schwiegen. Fockes Kiefer mahlten.
»Nach zwanzig Uhr. Verhörraum. Hagedorn über die Feuertreppe. Zwei Stunden, mehr nicht.«
Tanja nickte. »Das reicht ihm. Sie wissen ja, wie er ist.«
»Und dann der andere Fall«, sagte Focke schmal.
Oskar nickte. »Der mit der Priorität.«
»Ein Georgier ist verschwunden.«
»Und was geht das die Mordkommission an?«, fragte Oskar und studierte das blaue Auge.
»Oder ist er schon tot?«, fragte Tanja.
»Sie wissen ja, wie die Kollegen von der Vermißtenstelle sind. Alle Nase lang verschwindet wer im Orkus, die machen erst mal keinen Finger krumm. Aber Guram Geladse ist ein bekannter georgischer Politiker und Volksheld, der mächtige Feinde hat. Außerdem ist er Vater der angesagtesten Wirtin der Stadt. Bei Alika taucht jeder auf, der wichtig ist.«
»Ober- oder Unterwelt?«, fragte Oskar.
»Die Grenzen fließen«, sagte Tanja.
»Die halbe Polizeiführung, die leitende Staatsanwaltschaft und alle wichtigen Richter lassen sich von ihr bekochen. Wenn ihrem Vater etwas zustößt, und wir haben es nicht verhindert, schlägt das auf uns zurück«, sagte Focke.
»Uns?«, fragte Oskar.
»Die gesamte Kripo. Es geht um internationale Politik und Organisierte Kriminalität. Ich mag keine schlechte Presse. Außerdem lasse ich mich nicht gern von der Russenmafia vorführen.«
»Gibtʼs da nicht irgendwo zuständigere Kollegen?«
»Für so jemanden kann man schon mal die besten Mordermittler der Stadt beschäftigen. Wenn er nicht ohnehin längst tot ist. Dann wird es sowieso unser Fall. Aber es braucht Fingerspitzengefühl. Lauter lauernde Fettnäpfchen. Und Alika ist eine phantastische Frau. Künstlerin eigentlich.«
Oskar verschränkte die Arme hinter dem Kopf. »Also mit den Fingerspitzen tu ich mich schwer als Neuköllner. Falsche Sozialisation, das holt man nie wieder auf.«
»Sie haben doch die Kollegin Wehland.«
Tanja kratzte sich am Kopf. »Ich bin ja aus Westdeutschland. Kunst kann ich eher nicht. Ein Schirmständer ist für mich ein Schirmständer, auch wenn er in der Galerie steht.«
»Die Bilder von Alika verstehen sogar Sie. Zumindest an der Oberfläche. Georgische Landschaft, Religion, Kultur. Alles abstrakt natürlich.«
»Die Kollegin kommt aus der Landwirtschaft«, sagte Oskar.
»Verdammt, was können Sie überhaupt?« An Fockes Hals schwoll eine Ader. »Und das sollen meine besten Beamten sein?«
»Der Hagedorn, der hat ja studiert«, sagte Oskar.
»Nein«, brüllte Focke.
»Wie der die Leute mit seiner gebildeten Klappe um den Finger wickelt, das habe ich immer bewundert.«
»Der findet jeden«, sagte Tanja.
»Und sei es als Geist.«
»Und mit Frauen kann er, das muß man ihm lassen.«
Hinter den Bahnhof Zoo kam nie die Sonne. Sie hatten trotzdem einen Sonnenschirm aufgestellt. In seinen Jugendtagen war er einmal optimistisch rot gewesen, arthritische Reste seiner Troddeln wehten, wenn ein vorbeifahrender ICE sie anpustete.
Nicht, daß Hannas Gäste davon etwas mitbekommen hätten. Wind, Regen, Schnee und Hitze drangen nicht mehr in ihre breitgespritzten Hirne und zu ihren in Alkohol ertrinkenden Leberlappen. Aber wo sie Hilfe bekamen, das wußten sie.
Hanna liebte ihren Beruf. Nie war sie sinnvoller Ärztin gewesen als hier. Offiziell hatte man sie, deren Approbation während eines Gerichtsverfahrens ruhte, als Putzfrau und Fahrerin eines ehemaligen Pferdetransporters eingestellt, in dessen Innerem sie als Ärztin arbeitete.
Vor zehn Jahren hatte ein Sozialarbeiter nach dem fünften Alkoholentzug mit diesem Transporter sein Leben auf den Kopf gestellt. Er las die Ankündigung einer Zwangsversteigerung, stutzte über das Sammelsurium an Ungewöhnlichkeiten, ging hin, um der trockenen Unruhe etwas Abwechslung entgegenzusetzen und wurde für dreitausendachthundertfünfundsiebzig Euro Eigentümer eines rostigen Pferdetransporters, ohne jemals geritten zu sein. Er fegte Äppel, Stroh und Hafer hinaus, baute ihn um zur Seelsorgestation für im Drogensand Gestrandete und stellte ihn hinter dem Bahnhof Zoo auf.
Eines Tages stieg eine frühverrentete Hebamme in seine Pferdekutsche und sagte, sie spränge aus dem Fenster, wenn sie nicht sofort etwas Sinnvolles zu tun bekäme. Das ist hier Erdgeschoß, sagte der trockene Sozialarbeiter, und entbunden wird auch nicht.
Trotzdem war die Hebamme die postsozialistische Seele des Ladens geworden. Niemand im Schatten des Zoos war vor ihren rauhbeinigen Kommentaren sicher. Unter der Kundschaft erwarb sie sich alsbald den respektvollen Spitznamen Genossin. Sie versorgte Wunden. Desinfizierte, flickte, und verband, was das Zeug hielt. Den ausströmenden Gerüchen begegnete sie mit einer Kippe im Mundwinkel. Manchmal fiel Asche auf Verbandszeug und Wundränder, die sie mit rauchigem Atem wegblies.
Alles lief rund, bis das Ordnungsamt die Pferdekutsche entdeckte. Möglicherweise hätten die Obdachlosen sich nicht immer wieder im Flur des Hauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite erleichtern dürfen.
Das Amt störte sich am Dauerparkplatz des Transporters. Der Sozialarbeiter fuhr ihn also täglich einsfuffzig nach vorn und einsfuffzig nach hinten. Dann forderte das Gesundheitsamt einen beaufsichtigenden Arzt.
Der Sozialarbeiter hielt es für ausgeschlossen, einen zu finden, der ohne Lohn bei ihm arbeiten würde. Aber die Genossin aktivierte alte Kontakte und bald stand ein Urologe vor ihnen. Nicht ganz die passende Fachrichtung, aber wenigstens dramatische Anblicke gewohnt.
Die Genossin und der Sozialarbeiter fragten sich, warum ein so gut angezogener Endfünfziger an ihrem Schattendasein teilhaben wollte, bis sie ihm bei der Arbeit zusahen. Ihn hatte eine Parkinsonerkrankung zum Frührentner gemacht, ihm aber nicht die Approbation genommen. Also zielte er ab sofort auf Patienten hinter dem Bahnhof Zoo. Und mußte es mal schnell gehen, half die Genossin.
So richteten die Drei sich ein. Der Sozialarbeiter fuhr vor und zurück, flickte Seelen und kämmte die alten Sonnenschirmtroddeln, die Genossin jagte Tetanusspritzen in obdachlose Hinterteile und der Urologe zappelte an den Patienten vorbei.
Vielleicht war es zu idyllisch für den Sozialarbeiter. Vielleicht mußte er plötzlich zu wenig kämpfen. Vielleicht gab es auch zu viele Sonnenflecken. Er blieb nicht trocken. Schlief immer öfter am Lenkrad ein, bis er eines Morgens sturzbetrunken zwischen eins und fuffzig vom Ordnungsamt erwischt wurde. Er verlor Führerschein und Halt, trank sich aus der Wohnung und verschwand im alkoholischen Orkus.
Die Genossin und der zitternde Urologe übernahmen den Transporter, hatten aber nicht den vom Amt geforderten LKW-Führerschein für die täglichen drei Meter. Die zwei Frührentner fürchteten um ihren zwar unbezahlten aber Seelenfrieden stiftenden Arbeitsplatz und hängten Zettelchen im Bahnhof Zoo aus.
Einen dieser schiefen Zettel – der Urologe hatte darauf bestanden, sie anzukleben – sah die während ihres Gerichtsverfahrens beschäftigungslose Hanna und dankte mal wieder ihrer alten Mitbewohnerin Grete, die ihr zum achtzehnten Geburtstag Fahrstunden für Motorrad und LKW geschenkt hatte, falls die schlechten Zeiten zurückkämen und sie würden fliehen müssen.
Über die Frage, ob in Kriegszeiten irgendwer nach Führerscheinen fragte, hatten sie ausgiebig gestritten. Grete hatte das eigene Erlebnis des Zweiten Weltkriegs in die Waagschale geworfen, auf der anderen Seite kämpfte eine neunmalkluge Nachgeborene. Hanna nahm die Stunden. Und kam so, über zwanzig Jahre später, mit Führerschein für alle Lebenslagen in die Pferdekutsche ohne Sonne.
Dr. med. Johanna von Bredow wuchs in einer Altbauwohnung am Rüdesheimer Platz auf. Sie flitzte durch zahllose Zimmer, schlitterte über langgestreckte Dielen und hüpfte unter großen Fenstern, durch die das Sonnenlicht blinzelte. Als Nesthäkchen wurde sie umschwirrt und geherzt von fünf älteren Schwestern, erzogen von der Mutter Tilla, einer Biologieprofessorin an der FU, und behütet von Grete, Kreuzberger Lehrerin und seit ewigen Zeiten engste Freundin Tillas.
Die kleine Hanna war das blubbernde Herz dieser Familie, ihre mit Liebe gefüllte Brutkugel. Sie war glücklich, wenn es allen gut ging, krabbelte auf einen der sich bietenden Schöße und rollte sich ein. Und ihre Liebe machte nicht an der Wohnungstür halt. Hanna brachte in die familiäre Weiberwelt angeschlagene Wesen, die sie glaubte erretten zu müssen. Ein auf der Straße aufgelesener einsamer Turnschuh, ein aus dem Mülleimer geklaubter Wanderstock, ein vom Sperrmüll eingesammelter alter Koffer mit Aufklebern aus aller Herren Länder. Eine humpelnde Streifenmaus mit nur einem Hinterbein, eine Siebenpunkt-Marienkäferkolonie, der beim Überqueren des Bürgersteigs die Ausrottung drohte. Versuchte eine der Schwestern, die kleine Hanna vor Überbelegung der Wohnung zu warnen, schob das Nesthäkchen die Unterlippe vor, zog die Augenbrauen zusammen und ballte die Fäuste.
Denn Hanna war nicht nur mitfühlend, sondern auch zornig. Mied geöffnete Türen und rammte mit Wucht die nächstbeste Wand, bis Tilla, Grete und die fünf älteren Schwestern lachend die Hände hoben. Hanna baute unter den fernen Stuckdecken Terrarien, Höhlen und Nester, sammelte Löwenzahn, fütterte Samen und Nüsse und entließ tränenüberströmt in Freiheit.
Der gesamte Stolz der weitverstreuten Bredows lag, nachdem der Krieg von Gütern und Landbesitz nichts übriggelassen hatte, in der Intelligenz und beachtlichen Körpergröße ihrer Frauen. Als auch Hanna zu einer dunklen und grazilen Schönheit von nahezu einem Meter neunzig herangewachsen war, mit knapp achtzehn ein einsnuller Abitur hinlegte, wollte sie, die Helfende und Mitfühlende, Medizin studieren. Die mütterliche Freundin Grete, als Kriegskind an Stabsärzten geschult, fand das die Schnapsidee des Jahrzehnts. Aber es war sinnlos, Hanna brach durch die Wand.
Das Medizinstudium hatte Hanna eingesponnen in ein immer undurchdringlicheres Netz aus Diagnosen, Verfahren und Hierarchien. Als sie schließlich am Patienten landete, um endlich anwenden zu können, was sie gelernt hatte, war ihre Brust eng und sie atmete flach. Aber sie bat sich selbst um Geduld, glaubte, hinter der letzten Prüfung werde sich schon jenes Berufsleben verbergen, das sie erhofft hatte.
Hanna kam als junge Assistenzärztin an ein Krankenhaus. Ihr Chef, Professor Magahn, war in allem ihr genaues Gegenteil. Von der gedrungenen Statur eines kleinwüchsigen Stieres, ohne Hals, und mit rotem, zu einer Bürste rasiertem Haar um eine immer weiter ausufernde, rosig glänzende Glatze.
Magahn hatte sich durch das Medizinstudium gequält, um aus der Enge seiner Herkunft aufzusteigen an das für ihn höchstmögliche Ende der gesellschaftlichen Hierarchie. Er war Chirurg geworden, um über Leben oder Tod zu entscheiden. Ein kleiner Gott mit stoppeligem rotem Haar.
Die unter Frauen aufgewachsene Hanna, angerührt von einer auf dem Bürgersteig bedrohten Marienkäferkolonie, verstand ihren Beruf als Berufung und war am Ende ihrer Ausbildung, nach Jahren des Lernens und Wartens auf einen machtversessenen, cholerischen und rachsüchtigen Kobold getroffen.
Professor Magahn war erfahren in jeder Intrigenvariante, bewandert in jedem hinterhältigen Schachzug, kannte jedes stinkende Winkelchen des Systems, jede faulende Leiche im Keller der wichtigen Menschen der Stadt. Der Chefarzt war eine unausweichliche Größe in der Berliner Ärzteschaft, er war Hannas Alptraum, ihre personifizierte berufliche Sackgasse, und er hatte ein Problem mit Frauen.
Hanna stand es inʼs Gesicht geschrieben, weshalb sie Ärztin geworden war. Magahn hatte schon viele junge Frauen mit warmherzigen Motiven an seinem OP-Tisch stehen gehabt, und er hatte sie alle zerstört. Aber Hannas Körpergröße, ihr adliger Name und ihre Attraktivität waren eine besondere Herausforderung für den kurzbeinigen Stier. Professor Dr. Magahn mußte zu seiner Assistenzärztin aufsehen, das konnte nicht gut gehen.
Hanna erkannte das Problem sofort, versteckte, was sie von diesem Chef hielt und zügelte ihren Zorn. Sie senkte den Kopf, war ausgesucht höflich, ertrug Magahns Angriffe, erfüllte klaglos seine sie abstrafenden Dienstpläne, erlitt seine Anzüglichkeiten, wich seinen Intrigen aus, duckte sich unter seinen Schlägen und verlor niemals die Kontrolle.
Magahn war eine überzeugt cholerische Natur, und er erwartete Unterwerfung. Das Brüllen war seine Profession, die Niedertracht sein Alltag, der Ausbruch seine Methode. Er herrschte durch Schrecken, verbreitete durch willkürliche Entscheidungen Angst und führte, indem er fallen ließ. Je öfter Hanna ruhig blieb, je mehr sie den Kopf hob in ihrer lichten Höhe, desto giftiger sprühte Magahn unter ihr Funken.
Er verweigerte ihr die für die Facharztprüfung erforderlichen Operationen, schob sie viel zu oft in Nachtdienste, ließ sie jedes Wochenende arbeiten, und als sie ihn trotzdem, sichtbar schmaler und blasser werdend, nicht um Gnade bat, geschweige denn ihre Fassung verlor, versetzte er sie auf die Innere II.
Die Station war reserviert für mißliebige Kollegen, die sich mit absurden medizinischen Handlungen an hoffnungslosen internistischen Fällen abarbeiteten. Heraus führte für Patienten der Weg nur in Pflegeheime oder auf Friedhöfe, für die sie betreuenden Ärzte in ein Burnout.
Und dann rollte ein Pfleger der schönen, großen, hilfsbereiten Gräfin, die vor Müdigkeit inzwischen nicht einmal mehr schlafen konnte, die 94jährige Hermine Neuhaus auf die Station.
Man hatte hinter ihrer anhaltenden Darmblutung einen Tumor entdeckt, vermutete seine Bösartigkeit, fand eine OP zu riskant für die Hochbetagte und fragte die Patientin, was sie wollte. Hermine verwies auf ihre Patientenverfügung, fand, sie hätte lange genug auf dieser Erde ausgeharrt und wählte den Tod durch Verbluten. Sie wurde ein Fall für die Innere II. Hanna räumte dem Findling ein Zimmer frei, dimmte das Licht und hielt ihre Hand.
Aber Hermine blutete nur langsam aus und Hannas Schicht endete. Sie saß noch eine Weile an ihrer Seite, bis Hannas Nachfolger die Kollegin gereizt nach Hause schickte. Der war ein aufmerksamer Lehrling Magahns, entschied, die Alte wisse nicht, was für sie das Beste sei, schnallte die protestierende Hermine fest, spritzte ihr den letzten Widerstandsgeist aus dem Leib und schaffte sie in einen Operationssaal.
Als Hanna zu ihrem nächsten Dienst im Krankenhaus erschien, schob ein Pfleger Hermines Bett zurück auf die Station. Sie hatten den Tumor entfernt, die Blutung war gestoppt, aber Hermine durch die Operation im Koma gelandet. Sie hatten den eindeutig ausgesprochenen Sterbewunsch der Patientin mißachtet. Sie hatten sie geschunden und gequält. Und sie hatten ihr, für die nächsten Monate oder gar Jahre in tiefer Bewußtlosigkeit, eine Magensonde gelegt.
Da verlor Hanna die Kontrolle. All die angestaute Wut über das, was sie seit Jahren half, Menschen in Not anzutun, brach sich Bahn. Sie schrie und schlug um sich. Warf Infusionslösungen an Wände, schleuderte Stühle den Flur hinunter. Trat gegen Spritzenkartons, zerschlug einen Mülleimer auf dem Tisch, zog der inʼs Leben zurückgezwungenen Hermine die Magensonde aus der Bauchdecke, schob sie in ein Zimmer, schloß von außen die Tür ab, stieg über die Spuren der Verwüstung in das Schwesternzimmer, öffnete ein Fenster, warf den Schlüssel zu Hermines Zimmer weit hinaus und atmete tief die eiskalte Berliner Winterluft ein.
Das war, worauf Professor Magahn gewartet hatte.
Als Hanna mit der Kripo das Krankenhaus verlassen hatte, inspizierte er die Station und grunzte vor Zufriedenheit. Er sah seine uneingeschränkte Herrschaft wiederhergestellt. Er aktivierte seine Kontakte, sorgte dafür, daß Hannas Approbation ruhte und man sie anklagte, lehnte sich zurück und freute sich darauf, dem Untergang der großen, adligen und stolzen Frau zusehen zu können.
Hanna stand im Pferdetransporter hinter dem Bahnhof Zoo und fixierte einen fiesen grünen Glassplitter, der in einem rabenschwarzen Großzehenballen steckte. »Das kann jetzt ein bißchen wehtun«, sagte sie.
Der Mann zum Zeh lachte. »Fußpflege von ʼner Gräfin, ich bin noch nichʼ am Ende.«
Hanna sah ihn an und legte die Stirn in Falten. »Wenn Sie nicht mit dem Fusel aufhören, ist Ihre Leber am Ende.« Sie wies auf seine Zehen. »Und wenn ich den zweiten Zeh auch noch amputieren muß, können Sie auf dem Bein nicht mehr stehen.«
Er hob die Hand zum Schwur. »Ich würde ja. Wenn nur die Weltlage nicht so deprimierend wäre.«
Hanna lachte und desinfizierte die Wunde, so gut es ging. Die Jodtinktur war schon wieder alle. Solange der Sozialarbeiter noch nicht verschollen war, trudelten hin und wieder Spenden ein. Inzwischen aber saßen sie weitgehend auf dem Trockenen. Die Genossin stibitzte in ihrer alten Poliklinik Verbandsmaterial, der Urologe brachte abgelaufene Medikamente von einer befreundeten Apothekerin mit. Aber es war nie genug.
»Das ist die netteste Ausrede des Tages«, sagte Hanna und sah auf den verdreckten Fuß. »Dafür schenke ich Ihnen ein Paar neue Socken.« Sie zog einen Karton unter dem Sitz hervor und hielt schwarze hoch. »Vierundvierzig?«
»Aber junge Frau, sehe ich aus, als würde ich Trauer tragen?«
Hanna sah auf den löchrigen Haufen neben sich, der eben noch notdürftig die Füße des Mannes bedeckt hatte. »Die sind auch traurig.«
»Na gut, Gräfin, weil Sie es sind.«
Sie zog vorsichtig den Socken über das Pflaster. »Wenn Sie morgen zur Kontrolle wiederkommen, schenke ich Ihnen ein rotes Paar zum Wechseln.«
Er stand ächzend auf. »Sie sind ʼn Engel, Frau Doktor. Ich würd Sie jetzt gern küssen.«
»Halt die Klappe, Fittich«, sagte die Hebamme. »Nimm Deinen Beutel und verschwinde.«
»Sehʼn Se, so gehen andʼre Frauen mit mir um.«
Hanna lachte.
»Keen Mitleid mit den Runtergekommenen dieser Erde.«
»Fang bloß nicht wieder mit Deinen sozialistischen Kampfliedern an.« Die Hebamme guckte streng.
Fittich versuchte, die Hacken zusammenzuschlagen, geriet inʼs Taumeln, Hanna hielt ihn fest. »Jawoll, Frau Genossin.« Er beugte sich zu Hanna hinunter, sein Atem schlug ihr entgegen. Aldiwein und Karies. »Sie müssen nämlich wissen, wir waren mal Kollegen.«
»Vergiß nicht zu erzählen«, sagte die Hebamme, »daß Du in der Partei warst.«
Er winkte ab. »Die große Linie zählt.«
Die Hebamme schob ihn zur Tür, er schaukelte die Stufen zur Straße hinunter. Unter seinen hochgekrempelten Hosenbeinen leuchteten die neuen Socken. Ob er sie wohl bis morgen verteidigen konnte? Fittich drehte sich noch einmal zu den Frauen um. »Geschützt hab ich Dich immer«, sagte er. »Und Deinen Oberarzt.«
»Guck nach vorne«, sagte die Hebamme. »Und renn nicht wieder einfach auf die Straße.«
Er verbeugte sich andeutungsweise. »Mach ick, schon wegen der alten Tage. Und schön, daß Du Dich um mich sorgst.«
Sie steckte sich die nächste Kippe an. »Nun hau schon ab. Wir sehen uns morgen.«
Er wackelte die Straße hinunter, theatralisch hob er das verarztete Bein. Die Hebamme schüttelte den Kopf.
»Meinst Du, er kommt wirklich?«, fragte Hanna.
»An der nächsten Straßenecke hat er uns vergessen.« Die Hebamme nahm einen tiefen Zug, Asche flatterte davon. »Furchtbar, wenn man denkt, was für ein Mannsbild das war. Hat allen Röcken nachgestellt. Nahm sie unter seine Fittiche.«
»So lange ist die DDR schon untergegangen, aber der Spitzname hält sich.«
Die Hebamme schnippte die Zigarettenasche in Richtung Osten. »Das Land mag futsch sein. Aber wir sind alle noch da. Mit unserer Vergangenheit und der untergegangenen Heimat.«
III
Sie hatten Jakob lebendig begraben. Er hatte den Prozeß gewonnen, seine Suspendierung war aufgehoben, er wieder im Dienst und trotzdem hatte er alles verloren. Sie wollten ihn nicht zurück, ließen ihn nicht auf die Straßen der Stadt.
Kriminalhauptkommissar Jakob Hagedorns neuer Arbeitsplatz war ein zur Außenstelle des Archivs ernanntes vollgestopftes Zimmer im Keller, am Ende eines schmalen Ganges. Darin rangelten abgearbeitete Bürostühle, alte Tische auf drei Beinen, ausrangierte Registrierschränke, brüchige Halfter und klemmende Handschellen um den wenigen Platz. Von den Wänden bröckelte der schimmelige Putz, das winzige Fenster war vergittert und mündete in einen Schacht. Ein mittelalterliches Verlies, ein Sterbezimmer, extra für Jakob Hagedorn.
Sie stellten ihm einen Stuhl in den Kerker und luden Berge von Akten ab. Am Ende des Flurs ohne Licht und ohne Luft. Und das Jakob, der das Draußen brauchte als Lebenselixier. Der gehen mußte, um zu denken. Der nahenden Regen roch, Schnee spürte. Immer wußte, selbst in der tiefsten Straßenschlucht, wie voll der Mond war, wo die Sonne auf- und wo sie unterging.
Aber Jakob wollte nicht sterben, und er wollte seinen Beruf zurück. Also räumte er das Gerümpel aus dem Kerker, fegte Unrat aus dem Fensterschacht, schlug Putz von den Wänden, isolierte Schimmel, strich alles sonnengelb, kaufte eine Tageslichtlampe, stellte schattenliebende Pflanzen auf eine selbstgezimmerte Fensterbank, schloß eine Kaffeemaschine an und begann mit seiner Arbeit.
Jakob sollte Teile des Archivs neu ordnen. All die alten Akten hatten digitalisiert werden sollen, aber es gab niemanden, der Zeit dafür fand. Zu viele neue Fälle schubsten die alten von der Bühne und in den Keller, an den Platz für Gestriges.
Es gab keine Anweisung, wie Jakob vorgehen sollte. Alphabetisch, nach Jahreszahlen, Dezernaten, Bezirken, Namen der Täter oder Opfer, Art der Verbrechen. Er hatte den Verdacht, entschiede er sich für eine Variante, käme kurz nach Fertigstellung eine Weisung, das Gegenteil zu beginnen.
Aber Jakob war keine Figur von Kafka und Akten, erst recht vergilbte, hatten ihn schon immer interessiert. Der Versuch, eine papierne Ordnung über chaotisch gelebtes Leben zu legen. Sinn zu finden im Sinnlosen, Respekt zu zeigen den Geopferten, indem man ihnen ein Aktenzeichen, eine letzte Ruhestätte zumindest im schimmeligen Keller der Keithstraße gab.
Also pfiff Jakob auf die neu einzurichtende Ordnung und machte, was er mit am liebsten tat, er las Eingestaubtes in der gesamten vom Senat bezahlten dreitägigen Wochenarbeitszeit, zur Wiedereingliederung nach seiner langen Krankschreibung.
An den vier freien Wochentagen war Jakob so oft wie möglich unterwegs. Luft tanken, Licht einfangen, Menschen schnuppern, Kontakt aufnehmen. Er lief die Straßen seiner Stadt auf und ab. Streunte durch Läden, Parks und Ausstellungen. Schimmel abschütteln. Das Verlies keine Macht über sich gewinnen, die Düsternis nicht die Seele kapern lassen. Trotzdem schien es ihm manchmal, als kröchen Fäulnis und Verwesung in seinen Körper. Er wechselte täglich die Kleidung, vorsichtshalber.
Jakob las ohne System, von früh bis spät. Ließ sich von Namen leiten, Farben der Aktendeckel. Las über Leben und Katastrophen, Volten, Schlangenlinien, ungeharkte Wege. Über auf den Kopf gestellte Familien, eingebrochene Zeitläufte. Er las, was Menschen einander antaten, las, was Polizisten daran für bemerkenswert hielten und aufschrieben. Jahrzehntelang, mit sich ändernder Sprache, sich wandelnden Gesetzen.
So fand er den Weihnachtsfall. Eine verschweißte Familie, die ihre Tragödie in die Mitte nahm wie einen Schatz. Unerreichbar für Jakobs Kollegen, ein unlösbarer unnatürlicher Tod am Fest der Liebe. Jakob las sich fest, der Weihnachtsfall zog ihm in den Schlaf.
Eines Morgens saß das alte Opfer in Kittelschürze an Jakobs Küchentisch und schälte Kartoffeln. Eine unendliche Zahl plumpste in einen angeschlagenen Emailletopf, ein immer größerer Berg Kartoffelschalen umringelte schlangengleich am Küchenboden die mageren Beine der Großmutter. Jakob stieg über die Schalen hinweg und wartete. Kochte seinen Kaffee, sah ihr zu und wartete. Ging zur Arbeit, kehrte zurück aus seinem Sterbezimmer. Oma saß da und schälte Kartoffeln.
Am dritten Morgen waren die Kartoffelschalen vom Küchenboden verschwunden. Stattdessen überall Lametta. Jakob kochte seinen Kaffee und setzte sich ihr gegenüber. Die Großmutter fegte Lamettareste vom Tisch und sah Jakob an. »Es ist nicht seine Schuld«, sagte sie, »ich konnte einfach nicht sterben.«
Jakob ging in sein Kellerloch und las die Akten noch einmal. Als er nach Hause kam, war die Küche leer. In der Spüle lag ein Lamettafaden und das Küchenmesser. Er legte den Faden vorsichtig in einen Umschlag und ging zu ihrem Grab. Viele Blumen, ein großer Grabstein. In Liebe, Dein Sohn, Deine Schwiegertochter, Deine Enkel. Er ging zur Wohnung der Familie. Oma stand noch am Klingelschild. Drei Zimmer, Küche, Bad. Ein Paar, seine zwei Kinder und die Großmutter. Gepflegt, versorgt, geliebt. Jahr für Jahr. Viele Jahre. Die Kinder wachsen, die Wohnung nicht. Sie konnte einfach nicht sterben.
Jakob warf den Umschlag mit dem Lamettafaden durch den Briefschlitz der Wohnungstür. Zwei Tage später holten sie den Sohn zur Vernehmung ab. Erleichtert war er. Hielt sich fest an Jakobs Augen. Töten aus Liebe. Töten trotz Liebe. Jakob hatte wieder ein offenes Ende gefunden, es hatte ihn gefunden, sogar im Sterbezimmer, sogar im letzten Kellerloch. Die Großmutter hatte Jakob gefunden, den Geisterseher, Endenzusammenknüpper. Mein Sohn kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür.
Hauptkommissar Oskar Blum stieg täglich aus seinem Büro in den Keithstraßenkeller hinab und schaute in Jakobs Sterbezimmer vorbei. Er sorgte sich um seinen besten Freund. Brachte Schrippen, erzählte von der Welt oben. Seufzte, wenn er seinen Geisterseher sitzen und lesen sah vor aufmüpfig gelben Wänden inmitten der grauen Düsternis.
Wie hatten sie nur glauben können, der Apparat sei ein guter Verlierer und könne so jemanden wie Jakob Hagedorn in seiner Mitte auf Dauer dulden? Seine aufreizende Entspanntheit, seine vermeintlich schläfrige Abwesenheit, seine Unabhängigkeit, seinen scharfen Verstand, sein überschwappendes Mitgefühl mit jedem Eierbecher? Ganz zu schweigen von seinen Geistern.
Bei der Berliner Kripo gab es nichts Übersinnliches und ein Ei köpfte man, daß es überlief. Wie der Eierbecher damit zurechtkam, interessierte niemanden.
Und jetzt hatte Jakob sich in diesem Rattenloch eingerichtet, als wäre es eine Finca direkt am Meer. Las in seinen Akten und wartete, daß das Leben ihn da rausholte. Aber ihr Vorgesetzter Fockemeyer bewachte seine Tür. Focke, der gegen Jakob vor Gericht verloren hatte, der nicht hatte verhindern können, daß dieser akademisch gebildete Paradiesvogel in die Keithstraße zurückkehrte.
Auch die junge Kollegin Tanja Wehland machte schnell allen deutlich, auf wessen Seite sie stand. Schließlich war sie damals wegen Jakob aus Westdeutschland nach Berlin gekommen. Sie hatte erfahren, wie Jakob im fernen Berlin einem Kollegen einen Mord nachwies, für den ein anderer einsaß.
Das war sogar in ihrer Heimatstadt Münster Flurgespräch gewesen. Kollegenschwein hatten sie Hagedorn genannt und die Fäuste geballt. Tanja wunderte sich nicht, daß niemand des Mordopfers oder des zu Unrecht Verurteilten gedachte. Sie hatte in den wenigen Jahren ihres Berufsdaseins genug über Korpsgeist und Korruption erfahren, schnitt sich ein Photo von Jakob aus, hängte es in ihren Spind und bewarb sich in Berlin.
Tanja Wehland erzählte jedem, der nicht schnell genug ausweichen konnte, was für ein großartiger und für den Nachwuchs vorbildlicher Kommissar da drei Tage die Woche ungenutzt im Keller saß. Und sie schenkte ihm einen dicken Teppich gegen die aufsteigende Kälte des Kellerfußbodens und einen Heizlüfter gegen die feuchten Wände.
Oskar und Tanja hatten es tatsächlich geschafft, Jakob für einen Außentermin ans Tageslicht zu zerren. Sie hatten ihn sogar mitten auf die Bühne der derzeit angesagtesten Kripo-, Staatsanwaltschafts- und Richterkneipe geschoben, in Alika Geladses Apotheke am Stuttgarter Platz.
Und nun saß Jakob, als wäre das Sterbezimmer ein böser Traum, an einem sich vor köstlich duftendem Essen biegenden Tisch, als neues Gesicht in Alikas Welt belinst von zahllosen Augen anderer Gäste. Blinzelnd ob so viel ungewohnter Öffentlichkeit sah er seinen Freunden beim Essen zu und hörte sie die Zeugin befragen, kellergeschädigt fremdelnd mit dieser ganz alltäglichen Kripowelt.
Ein Vater war verschwunden. Seine Tochter Alika, eine schöne Frau mit geteiltem Gesicht, stand neben dem Tisch der drei Kommissare und sprach mit schwankender Stimme von ihm. Jakob spürte sie vibrieren, als wäre sie von der Energie der Nachmittagssonne angefüllt. Hin und wieder schoß ein Arm hoch und ihre langen Finger tanzten. Nur mühsam zügelte sie ihr Temperament und den Körper, der ihre Schilderungen durch Bewegungen untermalen wollte.
Volles schwarzes Haar verbarg die gezeichnete Stirn und hob sie doch nur hervor. Liebe, Sorge, Angst und Trauer um den verschwundenen Vater flossen ihr über die Schultern. Jakob fühlte sich in dieser Trauer zuhause wie in seinem Archiv. Er hatte noch nie über Georgien nachgedacht. Ein Land, das es gab, mehr nicht. Und doch war ihm Alika und die Welt, von der sie sprach und die in ihrem Restaurant lebte, vertraut.
»Natürlich kümmern wir uns um Ihren Vater, aber finden Sie nicht, er ist alt genug, um sich eine Auszeit zu gönnen?« Oskar zog Lammfleischstücken mit einer Gabel vom Mzwadi-Spieß.
»Und stellt sein Handy aus, obwohl er weiß, daß ich ihn erwarte?« Alika schüttelte den Kopf.
»Vielleicht wollte er ungestört sein?«, fragte Oskar.
Guram Geladse liebte es, unter Menschen zu sein. Er war ein Schrank von einem Mann, mit breiter Brust, großen Händen und schwerblütigen Augen, der nie in seinem Leben allein gewesen war. Als Kind hatte er mit anderen Schafe gehütet, Pferde beritten und wilden Honig gesammelt. Als Jugendlicher aus den Hölzern der Umgebung Häuser mitgezimmert, Öfen gesetzt, Rinder getrieben und Schafe geschoren. Er wuchs heran unter Verwandten, Freunden und Nachbarn, wurde schlauer als alle anderen Kinder der Umgebung, und er wurde bärenstark.
Als gerade ausgewachsener junger Mann saß er eines Abends auf der Friedhofsmauer seines Heimatdorfes, zählte die Handvoll Häuser, skizzierte das Leben ihrer Bewohner in den nächsten fünfzig Jahren, fand kaum offene Fragen und in seiner starken Brust wurde ihm das Herz eng. Zwei Jahre später verließ er das Dorf seiner Kindheit zum Studium im fernen Tiflis. Er wollte mehr von der Welt sehen, und er wollte viel mehr Menschen kennenlernen. Er küßte seine krummgearbeiteten Bauerneltern, legte die große Hand ein letztes Mal an sein verrußtes Elternhaus, sah mit seinen dunklen Augen trauernd zurück auf die fernen Berge, die Felder und Wiesen seiner Heimat und machte sich auf, die Welt zu erobern.
Die Universität nahm er als erstes. Das Lernen in der großen Stadt fiel ihm schwer, er studierte langsam aber konzentriert und wurde schließlich Chemiker und Mitglied der georgischen Akademie der Wissenschaften.
Dann sah er sich in Ruhe nach einer Frau um und traf schließlich Alikas Mutter, einzige Tochter eines armen, hoch gebildeten und stolzen jüdischen Ehepaars, das für sein Kind einen Juden aus der Stadt und keinen Bären vom Dorf vorgesehen hatte.
Aber Guram, inzwischen ein angesehener Wissenschaftler und immer noch Welteneroberer, erkannte in der blutjungen Jüdin die Frau seines Lebens und kämpfte. Er reparierte den Eltern bei schneidender Kälte Fenster und Heizung, besorgte im tiefsten Winter frisches Obst und im Frühjahr ein geschlachtetes Lamm. Er lernte die jüdischen Feiertage, wartete vor der Synagoge, kaufte eine Kippa, besorgte seltene Bücher und unerreichbare Eintrittskarten und trug die jüdische Tochter auf seinen Bauernhänden.
Die Eltern gaben, überwältigt vom unendlichen Willen und der strotzenden Kraft Gurams, endlich nach und der Tochter den Segen. Guram brüllte vor Glück, packte Zelt und Rucksack ein, nahm seine Frau an der Hand und zeigte dem Kind der Stadt das Land und die Berge. Sie aßen Äpfel vom Wegesrand, übernachteten unter freiem Himmel, badeten in Flüssen, wurden in Dörfern an Tische geladen, liebten sich in den Bergen und hatten die ganze Welt vor sich.
Alika entstand in diesem glücklichen Sommer. Bei ihrer Geburt weinte Guram wie ein Kind, strich immer wieder sanft über das schwarze Haar seiner Tochter und wachte im Krankenhaus an ihrer Seite, aus Sorge, sie könne wieder dahin verschwinden, von wo das Schicksal sie ihm in die Hände gelegt hatte.





























