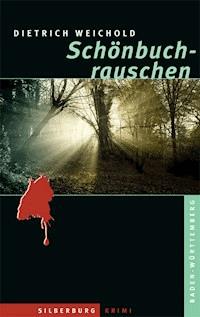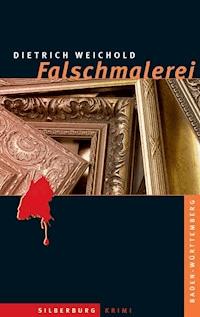Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Schönbuch werden Hochsitzleitern angesägt, ein Jagdpächter verunglückt, Mountainbiker stürzen über heimtückisch gespannte Drahtseile. Es hat den Anschein, dass radikale Naturschützer Jäger und Sportler bedrohen. Dann aber wird ein Jagdpächter ermordet. Die groteske Anordnung seiner Leiche und seines toten Hunds weisen auf einen geplanten Racheakt hin. Hauptkommissar Siegfried Kupfer von der Polizeidirektion Böblingen sucht die Täter nicht unter Jägern oder fanatischen Naturschützern, sondern im geschäftlichen Umfeld des Ermordeten, der eine Leiharbeitsfirma in der Baubranche betrieben hat. Kupfers Ermittlungen ziehen weite Kreise bis zu international operierenden Firmen, die als moderne Sklavenhalter ihre dunklen Geschäfte betreiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietrich Weichold
Fallwild
Dietrich Weichold
Fallwild
Ein Baden-Württemberg-Krimi
Dietrich Weichold, geboren 1944, studierte in Tübingen Germanistik und Anglistik. Bis zu seiner Pensionierung 2008 unterrichtete er Deutsch, Englisch und Spanisch an verschiedenen Gymnasien in Tübingen, Madrid und Rottenburg. Neben kleineren Veröffentlichungen für den Schulgebrauch sind bisher auch einige Kriminalromane von ihm erschienen. Er lebt mit seiner Frau in Ammerbuch-Entringen.
1. Auflage 2015
© 2015 by Silberburg-Verlag GmbH,Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.Alle Rechte vorbehalten.Lektorat: Michael Raffel, Tübingen; Gertrud Menczel, Böblingen. Umschlaggestaltung: Christoph Wöhler, Tübingen. Coverfoto: © bonciutoma – Fotolia.
E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1680-9 E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1681-6 Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-1429-4
Besuchen Sie uns im Internet und entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:www.silberburg.de
Ihre Meinung ist wichtig …
Inhalt
Autor
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Weitere Bücher und E-Books aus dem Silberburg-Verlag
1
Die Sau fiel um und war weg. Edgar Steiger ließ die Büchse aufgelegt und hob leicht den Kopf. Über sein Zielfernrohr mit Restlichtaufheller hinweg bohrte er seinen Blick durch das Morgengrauen und konzentrierte sich auf die Stelle, wo die Sau eben noch gestanden hatte, bis seine Augen tränten. Er sah sie nicht mehr. Dabei hatte er doch getroffen, dessen war er sich ganz sicher. Und weggelaufen war sie nicht. Die Sau hatte ihm zwar nicht die Flanke geboten, worauf er lange gewartet hatte. Aber sein Schuss hatte gesessen. Das war eindeutig. Er schoss nie daneben, er nicht. Und noch länger warten konnte er auch nicht. Die Sau war drauf und dran gewesen, aus dem Schussfeld zu laufen. Da musste er es krachen lassen, und er hatte sie im spitzen Winkel von hinten erwischt.
Aber wo war sie nun? Er spähte durch sein Jagdglas und sah nichts. Verärgert fluchte er leise vor sich hin. Er hörte noch, wie die übrige Rotte davonstob. Es mussten mehr gewesen sein, als er gesehen hatte, was bei dem Unterholz in diesem Windbruch nicht verwunderlich war. Da, wo er heute ansaß, hörte er immer mehr von den Sauen, als er sehen konnte, und so hatte sein Herz höher geschlagen, als sich der Umriss dieser Bache plötzlich deutlich vom dem dürren Buchenlaub abhob, das überall die Erde bedeckte. Er hatte gezielt und gewartet. Er wollte nichts riskieren und erst abdrücken, wenn er einen Blattschuss setzen konnte – direkt hinterm Ansatz des Vorderlaufs, durch die Rippen in die Herzgegend.
Dafür sollte sie ihm die Seite bieten. Aber den Gefallen hatte sie ihm nicht getan. Sie streckte ihm nur ihr Hinterteil entgegen, und wie sie so mit ihrem Brecher das Buchenlaub durchwühlte, spannte sie ihn auf die Folter, indem sie sich leicht hin und her drehte, aber nie so weit, dass sie ihm ihre Seite richtig dargeboten hätte. Als sie schließlich etwas schräger stand und sich auf das Unterholz zubewegte, da konnte es keinen Aufschub mehr geben. Eddi Steiger machte den Finger krumm.
Er war sich unschlüssig. Sollte er nun warten, bis die Sau verendet war? Das wäre aber nur sinnvoll, wenn er sie sehen würde. Oder sollte er lieber gleich abbaumen und schussbereit an die Stelle vorpirschen, wo sie vom Erdboden verschwunden war? Er zögerte. Nach einer Weile hielt es ihn nicht länger auf seinem Hochsitz. Vorsichtig jedes Geräusch vermeidend, stieg er ab und wollte, die entsicherte Büchse unterm Arm, auf die fragliche Stelle zuschleichen. Nur gab es hier dummerweise keinen präparierten Pirschweg.
Dürre Äste lagen kreuz und quer, die er nicht knacken lassen durfte, und er musste aufpassen, dass er nicht über vermodernde Stämme stolperte. Er fluchte innerlich über die Förster und Waldarbeiter, die keine Fläche mehr richtig abräumten und den Jägern damit Hindernisse in den Weg legten. Pest und Cholera wünschte er ihnen auf den Leib, diesen Idioten, für die der Wald nur eine Baumplantage oder Holzfabrik war. Wie anstrengend es war, hier leise voranzukommen! Er traute sich kaum zu atmen. Als er sich unter einem Zweig durchducken musste, trat er auf einen dürren Ast. Es knackte. Er erstarrte vor Schreck und hatte sich noch nicht wieder ganz aufgerichtet, da tauchte die Sau wie aus dem Nichts auf, grunzte und lief auf das Unterholz zu. Er riss die Büchse hoch und schoss und fehlte. Er stand da und hörte nur noch, in welche Richtung die Sau floh. Ausgerechnet auf die Reviergrenze zu!
Noch zehn Schritte, und dann lüftete sich das Geheimnis. Keine zwei Meter neben der Stelle, wo er die Sau angeschossen hatte, senkte sich der Boden zu einer flachen Kuhle. Da hinein musste die waidwund geschossene Sau gestürzt sein. Sie hatte stark geschweißt. Er trat näher heran und erkannte an den hellen, blasigen Blutspuren in ihrem Bett, dass er der Sau einen Lungenschuss verpasst hatte, wahrscheinlich sogar einen Lungendurchschuss. Weit würde sie damit nicht kommen, dachte er erleichtert. Schon wieder hatte er eine zur Strecke gebracht, bereits die fünfte in diesem Winter. Das schaffte sonst kaum einer, eigentlich gar keiner. Er war schon der Beste.
Viel Zeit wollte er sich nicht mehr lassen. Schnell ging er zu seinem Wagen und holte Aaron, seinen Drahthaarvorstehhund, um die Wildfolge hinter sich zu bringen, möglichst, ehe er damit rechnen musste, jemandem zu begegnen.
Zwanzig Minuten später war er zurück und setzte Aaron auf die Fährte. Dessen feine Nase nahm sofort Witterung auf, und zitternd vor Erregung zerrte ihn sein Hund geradewegs durchs Dickicht, durchs Stangenholz und, wie er befürchtet hatte, durch den Rotbuchenbestand an der Reviergrenze. Hier verharrte Steiger einen Moment, sagte dann laut: »Scheiß drauf«, und ließ sich in das Nachbarrevier hineinziehen, wo das Gelände steil anstieg. Er hatte Glück. Es war nicht mehr weit, bis er die Sau liegen sah. Er band den Hund an einen Baum, hielt die Waffe schussbereit im Anschlag und näherte sich dem Tier. Es lag in seinem Schweiß und rührte sich nicht mehr.
Eddi Steiger machte kehrt. Er brachte seine Büchse in sein eigenes Revier zurück, wie auch seinen Hund, den er an einem Baum anleinte. Dann ging er zu der verendeten Sau zurück und band mit einem dicken Seil ihre Hinterläufe zusammen. Zunächst zog er sie etwas von der Stelle und deckte die Blutlache mit einer dicken Laubschicht zu. Dann schleifte er unter großen Anstrengungen die tote Sau über die Grenze zurück in sein Revier. Mit einem abgebrochenen Ast verwischte er die Schleifspur von der Fundstelle bis an die Grenze und noch ein gutes Stück in sein Revier hinein, wo er das Seil von den Hinterläufen der Sau losgebunden und sie liegengelassen hatte.
Aaron war aufgeregt. Er winselte. Noch war er mit seinen drei Jahren nicht so gut abgerichtet, dass er stillgehalten hätte. Er musste zunächst ins Auto zurückgebracht werden. Aber vorher musste die Sau verblasen werden. Steiger nahm sein Jagdhorn aus dem Rucksack, nahm Haltung an, als würde ihm die halbe Welt zuschauen, und stieß ins Horn. Er ließ das Signal »Sau tot« erklingen. Ob es jemand hören würde, war fraglich. Aber das gehörte für ihn einfach dazu. Und wenn jemand zu dieser frühen Stunde doch hören sollte, dass er, Edgar Steiger, wieder ein Wildschwein erlegt hatte, dann hatte es auch noch einen Zweck erfüllt.
Steiger brachte seinen Hund zum Auto zurück, griff zu seinem Handy, das er immer im Handschuhfach zurückließ, und rief einen Jagdkameraden zu Hilfe.
»Clemens, du musst kommen. Alleine kriege ich sie nicht fort. Ich warte am Parkplatz auf dich.«
Sein Mitpächter und Jagdfreund Clemens Gutbrod versprach, alles stehen und liegen zu lassen, und war schon eine knappe Stunde später zur Stelle, um ihm bei der anstrengenden Bergung zur Hand zu gehen. Er gratulierte Steiger zum Abschuss dieser kapitalen Sau. Dass die Bache, die mit einem Lungendurchschuss erlegt worden war, nicht in ihrem Blut lag, fiel Gutbrod allerdings sofort auf. Mit hochgezogenen Brauen warf er Steiger einen fragenden Blick zu: »Hier?«
Steiger lachte verächtlich und winkte ab.
»Vergiss es! Ich habe ja keinen Markstein versetzt.«
Steiger drehte das tote Tier auf den Rücken, um es aufzubrechen. Gutbrod packte mit an und bemerkte, als er die großen Zitzen sah, in unüberhörbar kritischem Ton:
»Eine trächtige Bache.«
»Ich habe absolut keine Lust, dieses Jahr wieder so viel Wildschaden zu bezahlen«, wies Steiger den Tadel schroff zurück.
Die Skrupellosigkeit seines Mitpächters war Gutbrod unangenehm. Auf die ständigen Anfeindungen der Tierschützer, die man immer häufiger lesen musste, reagierte er empfindlich und wollte alles vermeiden, was Jäger und Jagd noch weiter in Verruf brachte. Steiger hatte in dieser Hinsicht ein wesentlich dickeres Fell.
»Und wer soll die jetzt verwerten?«, fragte Gutbrod vorsichtig.
»Das lass mal meine Sorge sein«, entgegnete Steiger mit einem überlegenen Grinsen, als handelte es sich dabei um eine ganz besondere Aufgabe, mit der man nur hochgradige Spezialisten betrauen konnte.
2
Dass der Winter so mild gewesen war, war gar nicht gut, weder für den Wald noch für die Jagd. Besonders schlecht war es für die Jagd auf Wildschweine gewesen, die sich nun ungebremst weiter vermehren konnten. Man war ihnen einfach nicht beigekommen. Der Schnee hatte gefehlt, von dem sich die Schwarzkittel in den Vollmondnächten gut abgehoben hätten, so dass sich die Chance geboten hätte, sie bei Nacht vom Hochsitz aus zu erlegen. Auch das Kirren mit Mais hatte wenig geholfen. Es hatte zu viel geregnet. Und so konnten die Schweine überall den weichen Boden aufbrechen und fanden Käfer, Larven, Engerlinge, Schnecken und was sich ihnen sonst noch im Erdreich bot. Wenn es ihnen nicht an Nahrung fehlte, konnte man trotz ausgelegtem Mais nächtelang auf derselben Kanzel sitzen, ohne auch nur ein Wildschwein zu hören. Und wegen der ständigen Bewölkung fehlten einfach die klaren Mondnächte. Es war frustrierend.
Die frühen Morgenstunden eines Sonntags Ende Februar versprachen endlich gutes Jagdwetter. Die Nacht war wolkenlos und kalt gewesen, der abnehmende Mond stand knapp überm Horizont, der Sternhimmel war noch zu sehen. Das war kein schlechtes Büchsenlicht. Ein Jäger, der es auf Wildschweine abgesehen hatte, durfte diesen klaren, frischen Morgen nicht verschlafen.
Clemens Gutbrod hatte sich am Vorabend den Wetterbericht angeschaut. Bei der guten Prognose war für ihn alles klar.
»Morgen früh lohnt es sich vielleicht, wieder einmal früh aufzustehen«, sagte er zu seiner Frau.
»Dann muss ich mit Ohrstöpseln schlafen, oder du schläfst im Gästezimmer«, antwortete sie, wobei sie leicht gereizt die Augenbrauen hochzog. Denn grundsätzlich war es ihr lieber, wenn ihr Mann am Sonntag ausschlief und mit ihr gemütlich frühstückte, anstatt am späten Vormittag müde und dazu noch unrasiert heimzukommen und den halben Nachmittag zu verschlafen.
»Was hab ich denn von deinem so genannten Jägervergnügen? Einen Mann, der sonntags oft müde und schlecht gelaunt ist.«
Und manchmal, wenn er besonders schlecht gelaunt war, weil er trotz guten Anlaufs wieder einmal nicht zum Schuss gekommen war, griff sie nach der CD mit den Opernchören und ließ den Jägerchor aus dem »Freischütz« durchs Haus schallen. »Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnü-hügen«, sang sie dann lauthals mit, was ihn vollends auf die Palme brachte. Er verschwand dann immer im oberen Stockwerk und knallte die Tür des Gästezimmers hinter sich zu. Der Haussegen hing bei den Gutbrods nicht prinzipiell schief – bis Sonntagabend besserte sich die Stimmung meistens wieder –, aber daran, dass Ingrid die ganze Jägerei gestohlen bleiben konnte, gab es keinen Zweifel.
Die Nacht im Gästezimmer war Gutbrod gar nicht so unrecht. Es hatte ein Fenster nach Südwesten hin, von dem aus er ein bisschen Waldrand sehen konnte, der von ihrem Haus in Holzgerlingen ungefähr drei Kilometer entfernt lag. Vor allem aber hatte er eine gute Sicht auf den westlichen Himmel. Damit konnte er am frühen Morgen mit einem Blick entscheiden, ob es sich lohnte, das warme Bett nun wirklich mit der harten Sitzbank eines Hochsitzes zu vertauschen.
Ehe er nach oben verschwand, braute er sich eine Thermoskanne starken Kaffee und richtete sich das kleine Früh-stück, das er auf dem Hochsitz einzunehmen pflegte, nachdem er direkt aus dem Bett, ohne einen Bissen zu essen, aufgebrochen war. Manchmal verzichtete er sogar auf die Katzenwäsche. Vom Bett möglichst schnell auf den Hochsitz, lautete seine Devise.
Er war schon um halb fünf Uhr aufgestanden, hatte den üblichen prüfenden Blick aus dem Fenster geworfen, hatte sich schnell angezogen, Waffe und Rucksack gepackt und das Haus verlassen.
Er stand vor der Tür, sog die frische Morgenluft durch die Nase ein und holte, so leise es ging, seinen Wagen aus der Doppelgarage. Dann fuhr er vorsichtig aus der Siedlung – er musste mit Reifglätte rechnen – und bog nach links in die B 464 ein. Frohgemut atmete er durch und steuerte auf den Waldrand zu. Im Licht der Scheinwerfer glänzte die hauchdünne Reifschicht auf den Wiesen und Feldern. Gutbrod freute sich. Nach diesem Wetter hatte er sich lange gesehnt.
Langsam fuhr er ein geschottertes Waldsträßchen entlang. Und dann, gerade ein halbe Stunde nachdem er aus dem Bett gestiegen war, stellte er sein Auto an der Kreuzung zweier Waldwege ab. Das war die Stelle, wo Steiger und er immer parkten, wenn sie auf den Ansitz gingen. Es stimmte ihn fröhlich, dass er heute früher dran war als sein Jagdkamerad. Denn so konnte er frei wählen, auf welche Kanzel er sich setzen würde. Er schrieb die entsprechende Information auf einen kleinen Zettel und klemmte ihn hinter den Scheibenwischer. Steiger würde ihn finden und einen anderen Hochsitz wählen müssen.
Auf seinem Gang zum Hochsitz stellte er befriedigt fest, dass der Boden heute wenigstens ein klein wenig gefroren war. Das war ihm recht, denn der Weg zum Hochsitz war von den Rückefahrzeugen der Waldarbeiter stark verunstaltet worden: am linken und rechten Rand Radspuren von einem halben Meter Breite und Tiefe, dazwischen matschige Schleifspuren, die wenigstens heute, leicht angefroren, seine Stiefel nicht so stark beschmutzen würden. Er hasste es, wenn richtige Dreckklumpen von seinen Sohlen an den Sprossen der Hochsitzleiter kleben blieben, in die er dann beim Abstieg manchmal hineinfasste, weil er sich gerade auf etwas anderes konzentrierte. Und das geschah immer wieder, weil ihn die Gedanken an seine Geschäfte oft auf dem Ansitz einholten.
Von seinem Weg aus hatte er linker Hand gute Sicht in einen Bestand alter Rotbuchen. Kleinere Bäume und Unterholz hatte man entfernt, und das schwache Mondlicht hellte den bereiften Waldboden etwas auf, so dass sich die Baumstämme gut davon abhoben. Wenn hier jetzt ein Wildschwein käme! Es würde ein deutliches Ziel bieten. Doch es kam keines.
Nur auf der anderen Seite seines Weges hörte er ein deutliches Rascheln in dem ungepflegten Mischwaldgestrüpp, das kein Blick durchdringen konnte, weil das rotbraune Buchenlaub erst im Frühjahr abfiel. Dort bewegte sich etwas. Gutbrod verharrte, nahm die Büchse von der Schulter und entsicherte sie. Er hielt den Atem an und lauschte. Zweige knackten, Laub raschelte. Ein Wildschwein? Ein Reh? Das war nicht auszumachen. Er hörte nur, wie sich die Geräusche langsam entfernten.
Enttäuscht sicherte er seine Büchse, hängte sie sich wieder um und ging weiter. Es wäre auch zu schön gewesen! Na ja, der Morgen war noch nicht vorüber.
Ein Rückefahrzeug, vielleicht war es auch ein Vollernter gewesen, war direkt an seinem Hochsitz vorbeigefahren und hatte einen richtigen Dreckwall hinterlassen, über den Gutbrod bedächtig hinwegstieg, um an die Hochsitzleiter zu gelangen. Er wollte heute so lange sitzen bleiben, bis die ersten Jogger, Mountainbikefahrer oder Wanderer Unruhe ins Revier brachten und längeres Ausharren sinnlos machten.
Er ergriff die Leiterholme auf Augenhöhe und wollte zügig aufsteigen. Als er aber mit seinem ganzen Gewicht die vierte Sprosse belastete, gab sie nach, als würde er ein Aststück vor sich herkicken. Er bekam Rücklage, konnte sich nicht halten und stürzte rücklings ab. Sein linkes Bein schlug zwischen Ferse und Wade hart auf der untersten Sprosse auf, und er landete mit dem Rücken auf dem Dreckwall, was nicht so einen schlimmen Schmerz ausgelöst hätte, wäre da nicht zwischen Lehm und Lodenmantel noch etwas sehr Hartes gewesen: die Büchse mit dem aufgesetzten Zielfernrohr.
Gutbrod stieß einen Schmerzensschrei aus und schnappte nach Luft. Aber Einatmen ging gar nicht gut. Der Schmerz im Rücken nahm ihm die Besinnung.
Ganz allmählich kam er wieder zu sich und vermisste zunächst seinen Hut. Sein Kopf war kalt und tat höllisch weh, vor allem der Hinterkopf. Als er die schmerzende Stelle abtasten wollte, durchzuckte ein so starker Schmerz seine Rippen, dass ihm wieder schwarz vor den Augen wurde.
Die Kälte weckte ihn. Er musste aufstehen, aber sein linkes Bein schmerzte bei der geringsten Bewegung. Er musste es ruhig halten. Ihm wurde klar, dass er nicht allein aufstehen konnte. Mühsam und qualvoll, Zentimeter um Zentimeter, drehte er sich auf die linke Seite und streifte dabei seinen Rucksack ab. Er fror. Die Kälte schüttelte ihn durch. Seine Zähne klapperten. Er musste dagegen ankämpfen.
Er angelte, immer noch auf der Seite liegend, seine Thermosflasche aus dem Rucksack, schraubte sie mühsam auf und flößte sich langsam, Schluck für Schluck, die heiße Flüssigkeit ein, bis nichts mehr da war. Das tat gut. Der Tremor in seinen Händen ließ etwas nach. Aber er spürte, dass er am ganzen Körper nass war. Die Schmerzen, der Schock und die Anstrengung brachten ihn ins Schwitzen. Dafür war seine Hand nun ruhiger, sein Kopf wurde klarer.
Jetzt erst konnte er einen vernünftigen Gedanken fassen. Er sah auf seine Uhr. Inzwischen war es sechs. Demnach musste er einige Zeit ohne Besinnung gewesen sein. Mit verbissener Anstrengung und bei jeder Bewegung schmerzgepeinigt, öffnete er seinen Rucksack und nahm die Signalpistole heraus, die er immer geladen mit sich führte. Sechs Patronen steckten im Magazin. Zwei hintereinander abschießen, auf dreißig zählen, dann wieder zwei, auf dreißig zählen, dann wieder zwei. Das hatten sie als Signal für ernste Notsituationen ausgemacht. Er hoffte nur, dass sein Jagdkamerad Steiger inzwischen auch im Revier war. Seinen Wagen hatte er noch nicht stehen sehen, als er dort ausgestiegen war, wo sie immer parkten. Aber es war ja schon eine Weile her.
Gutbrod ließ die Platzpatronen krachen und lauschte. Die Zeit dehnte sich. Wie lange brauchte man, um eine Signalpistole aus dem Rucksack zu nehmen und sie eventuell zu laden? Das durfte doch nicht so lange dauern. Wieder spürte er die Kälte, vor allem an seinem Rücken, und geriet in Panik. Er fing wieder an zu zittern. Da endlich schallten zwei Platzpatronendetonationen an sein Ohr. Steiger war im Revier. Gutbrod wurde ruhiger und schloss erleichtert die Augen. Er wollte tief durchatmen, aber der Schmerz unterhalb seines rechten Schulterblatts erlaubte ihm nur flache Atemzüge. Es wurde ihm bewusst, dass er nur noch hechelte, statt durchzuatmen.
Endlich hörte er Steigers Schritte.
»Was ist mit dir passiert?«
»Die Leiter. Irgend so ein Schwein hat die Leiter angesägt.«
»Geht’s dir gut?«
»Super geht’s mir, siehst du doch. Hilf mir endlich hoch. Aber vorsichtig. Ich hab tierische Schmerzen. Ich glaub, ich hab ein paar Rippen gebrochen, und das linke Bein.«
»Na dann prost Mahlzeit«, sagte Steiger sarkastisch, stellte sein Gewehr an einen Baum und beugte sich über Gutbrod, der ihm den linken Arm entgegenstreckte. Steiger zog und Gutbrod schrie auf. Vor Schmerzen wusste Gutbrod nicht, wie ihm geschah, und war froh, als er sich schließlich mit angezogenem rechten Bein in Sitzposition wiederfand.
»Clemens, jetzt gilt’s«, sagte Steiger aufmunternd und trat hinter ihn. Er griff ihm unter die Achseln.
»Auf geht’s«, kommandierte er und zog Gutbrod, der wieder laut aufschrie, hoch. Unsicher auf einem Bein stand der Verletzte vor ihm und zitterte am ganzen Leib. Und Steiger keuchte von der Anstrengung.
»Allein kriege ich dich nicht fort. Ausgeschlossen. Ich muss dich hinsetzen und Hilfe holen. Bleib stehen und halt dich an mir fest«, japste er.
Durch Gutbrod, der sich an seinem Hosenbund festhielt, leicht behindert, machte Steiger aus seinem Mantel und Gutbrods Rucksack ein Sitzkissen, das er auf den Dreckwall legte. Darauf setzte er seinen Kameraden. Dann schnitt er mit seinem Jagdmesser zwei Stöcke zurecht, mit denen er das lädierte Bein schienen wollte. Aber bei jedem Versuch schrie Gutbrod laut auf, so dass er es aufgab.
»Hier, nimm einen Schluck Oban. Der nimmt die Schmerzen und tut dir gut«, sagte Steiger und reichte ihm seinen Flachmann mit dem Whisky. »Jetzt wär’s gut, wenn man das Handy in der Tasche hätte. Dann müsstest du nicht so lange hier herumhocken. Aber jetzt muss ich dich allein gelassen, da hilft alles Beten nichts. Ich beeil mich. Trink noch einen Schluck. Das hilft dir so lange.«
Gutbrod sah Steiger nach, wie er mit schnellen Schritten zwischen den Stämmen verschwand. Es dauerte. Noch nie war ihm der Wald so tot und still erschienen wie jetzt.
Er hörte keinen Laut und hatte den Eindruck, dass es gar nicht heller wurde. Als er auf die Uhr sah, stellte er fest, dass seit seinen Signalschüssen nur zehn Minuten vergangen waren, die längsten zehn Minuten, die er je erlebt hatte. Bis Hilfe kam, würde es mindestens noch einmal so lange dauern, oder noch viel länger. Er griff nach dem Flachmann und nahm einen weiteren Schluck. Vielleicht würde der Whisky ihn etwas wärmen. Doch davon spürte er nichts.
Als er viel später, die Zeit kam ihm endlos vor, noch einmal nachheizen wollte, wurde ihm so übel, dass er fast die Motorengeräusche überhört hätte. Mit trübem Blick starrte er in die Richtung, aus der die Hilfe kommen musste. Wo blieb das Licht der Scheinwerfer? Plötzlich hörte das Motorengeräusch auf, und ihm wurde klar, dass der Sanka nicht zu ihm herfahren konnte. Die Holzernter hatten den Weg für jedes andere Fahrzeug unpassierbar gemacht. Er musste sich weiter gedulden. Es kostete ihn große Mühe, nicht umzusinken. Nur der höllische Schmerz im Brustkorb, der sich sofort einstellte, wenn er sich nur ein klein wenig nach der Seite neigte, hielt ihn senkrecht, wobei er sich mit dem linken Arm abstützte und den rechten kraftlos hängen ließ.
Es kam ihm unendlich lang vor, bis er im Grau des Morgens drei Gestalten auf sich zukommen sah, die eine Trage mitbrachten. Je näher sie kamen, umso mehr verschwammen ihre Konturen.
»Ihnen geht es aber gar nicht gut. Kein Wunder, wenn …«, hörte er einen Rettungssanitäter noch sagen. Dann wurde ihm schwarz vor Augen.
Als der Rettungswagen durch eine scharfe Kurve jagte, weckte ihn der Schmerz in den Rippen. Es erstaunte ihn, dass man ihm eine Sauerstoffmaske aufgesetzt hatte. Stand es denn so schlecht um ihn? Mit aufgerissenen Augen schaute er den Sanitäter an, der gerade dabei war, seinen Blutdruck zu messen. Der las ihm die Frage von den Augen ab und erklärte: »Tja, Herr Gutbrod, der Whisky hat Ihnen leider nicht sehr gut getan. Gegen Kälte mag der mal einen Moment ganz gut sein, aber nie und nimmer bei einem traumatischen Schock. Sie sind uns ohnmächtig geworden.«
Dann las er den Blutdruck und bemerkte: »110 zu 70, gut, noch immer sehr niedrig, aber wir haben Sie wieder. Sie bekommen gerade auch etwas zur Stabilisierung des Kreislaufs.«
Jetzt erst bemerkte Gutbrod den Infusionsständer und die Kanüle, die in seiner Armbeuge steckte. Sein Bein schmerzte nicht mehr. Es steckte in einer Vakuumschiene und war fürs Erste versorgt. Trotzdem war ihm im Moment alles zu viel. Er schloss die Augen und ließ sich fallen.
3
Ingrid Gutbrod hatte ausgeschlafen. Sie hatte ein Kännchen Tee und etwas Toast zubereitet und sich damit ins Schlafzimmer zurückgezogen. Langsam, Schlückchen für Schlückchen, das warme Getränk zu sich zu nehmen, zwischendurch ein Häppchen vom gebutterten Toast abzubeißen und dabei in einer Frauenzeitschrift herumzublättern, war der Luxus, den sie sich immer gönnte, wenn Clemens sonntagmorgens das Bett mit der Kanzel vertauscht hatte. Wäre er zu Hause gewesen, dann hätte sie ein opulentes Frühstück vorbereiten müssen, vor allem für ihn, denn sie hielt sich morgens beim Essen zurück. Sie leistete ihm gerne am Frühstückstisch Gesellschaft, denn dabei konnte sie alles mit ihm bereden, was die Woche über unausgesprochen geblieben war. Trotzdem genoss sie jetzt den ruhigen Morgen. Zu irgendetwas musste es ja gut sein, dass Clemens in aller Herrgottsfrühe in den Wald rannte, sagte sie sich.
Als aber ihr Teekännchen längst leer getrunken war und vom Toast nur noch ein paar Krümel auf dem Teller lagen, schaute sie auf die Uhr. Es war schon gegen elf. In der nächsten halben Stunde müsste Clemens nach Hause kommen. Sie stand auf und ging ins Badezimmer, um sich zurechtzumachen. Wie immer, wenn er müde aus dem Wald kam, wollte sie ihm gut angezogen und gestylt den Eindruck vermitteln, dass der Sonntag schon längst begonnen hatte, und ihn fühlen lassen, dass er etwas verpasst hatte – natürlich ohne sagen zu können, was es eigentlich wäre.
Kochen würde sie heute nicht. Sie hatten sich für ein Uhr mit einem befreundeten Ehepaar zum Mittagessen verabredet, im Waldhorn in Bebenhausen. Solche Verabredungen waren ebenso angenehm wie nützlich. Man gönnte sich etwas Gutes und pflegte gleichzeitig Beziehungen, die einem einmal von Vorteil sein konnten, falls man nicht sogar bereits von ihnen abhängig war. Heute, das hatte Clemens deutlich gesagt, handelte es sich, genau betrachtet, um ein Geschäftsessen. Wenn die Plauderei gut lief, konnte dabei ein Auftrag herausspringen. Deswegen konnte sie es sich auch nicht erklären, dass Clemens um halb zwölf immer noch nicht zurückgekommen war. Und so war sie schon recht angespannt, als das Telefon klingelte. Es war Edgar Steiger.
»Ingrid, erschrick nicht, Clemens ist im Krankenhaus, aber es geht ihm gut«, fiel er mit der Tür ins Haus, so dass ihr vor Schreck fast das Telefon aus der Hand fiel.
»Was ist? Was hat er?«
»Er hat ein Bein gebrochen, wahrscheinlich auch ein paar Rippen, und eine Gehirnerschütterung hat er auch.«
Ingrid dachte an einen Verkehrsunfall. »Was ist denn passiert? Ist er gerutscht? Ist er zu schnell gefahren?«
»Nein. Es ist nicht mit dem Auto passiert. Er ist im Wald gestürzt. Irgendein Dreckschwein hat die Hochsitzleiter angesägt. Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, ich war ja nicht dabei.«
»Was? Die Hochsitzleiter? Wieso denn das?«
»Das weiß ich auch nicht. Das muss untersucht werden. Ich hab es schon der Kripo gemeldet.«
»Wo ist Clemens?«
»Im Böblinger Krankenhaus.«
»Warst du bei ihm?«
»Nein. Noch nicht. Seit sie ihn im Rettungswagen abtransportiert haben, habe ich ihn noch nicht wieder gesehen. Da ging es ihm schon wieder besser. Ich denke, jetzt musst du hin. Er wird dir genau sagen können, was los war. Ich war, wie gesagt, nicht dabei.«
»Klar, sofort.«
Damit drückte sie den Anruf weg.
Obwohl Ingrid Gutbrod sich auf dem Weg ins Krankenhaus bereits alles Mögliche vorgestellt hatte, erschrak sie doch, als sie das Krankenzimmer betrat. Auf den Verband an Clemens’ Kopf war sie nicht gefasst gewesen. Er sah ihr ihren Schrecken an und versuchte zu lächeln.
»Es sieht schlimmer aus, als es ist«, sagte er zur Begrüßung.
»Clemens, was ist mit deinem Kopf?«
»Eine Platzwunde am Hinterkopf, nichts weiter. Sie mussten halt nähen.«
Sie wollte ihn küssen und beugte sich über das Bett.
»Vorsicht, stütz dich bitte nicht auf«, sagte er und streckte ihr seine Wange so weit entgegen, wie es ohne Schmerzen möglich war.
Da erst entdeckte sie die Vakuumschiene an seinem linken Bein, das unter der Bettdecke hervorschaute.
»Und das hier?«
»Stark geprellt und angebrochen. Das muss erst abschwellen. Dann gipsen sie vielleicht. Das ist alles nicht so schlimm. Übel sind nur die angeknacksten Rippen. Wenn ich ruhig liege und nicht huste oder lache, ist es gut auszuhalten. Bring mich also bloß nicht zum Lachen«, sagte er mit einem sauren Lächeln.
»Keine Angst, zum Lachen gibt es nichts«, sagte sie sarkastisch.
Dann schilderte er seinen Unfall in aller Ausführlichkeit, nur die Sache mit dem Whisky ließ er lieber aus. Das war keine Geschichte für Frauen, das musste unter Männern bleiben.
»Das war also ein Anschlag auf dich?«, folgerte Ingrid aus seiner Darstellung.
»Oder auf Edgar. Es kann doch niemand voraussagen, wer zuerst da hochsteigen will.«
»Clemens, überleg doch mal, wer dir in letzter Zeit in die Quere gekommen ist.«
»Niemand, ich sag dir, niemand. Die Reibereien wegen des letzten Auftrags kennst du ja selber. Aber das sind doch alles keine Kriminellen, die Hochsitzleitern ansägen.«
»Und die Leute, die wir entlassen haben?«
»Die meisten sind bei Edgar untergekommen, auf die übliche Art und Weise.«
»Weißt du das genau?«
»Natürlich nicht. Was weiß ich, wo die bleiben? Aber du glaubst doch nicht, dass diese Leute wissen, wo wir jagen. Die wissen nicht einmal, dass wir jagen. Wie sollen sie dann einen solchen Anschlag auf uns machen?«
»Bei den vielen Arbeitskräften, die bei uns durchgehen, wäre ich mir nicht so sicher.«
»Jetzt hör doch auf und setz mir keinen Floh ins Ohr. Seit ich wieder ganz wach bin, habe ich über nichts anderes nachgedacht. Ich hab das schon abgehakt – abgehakt, hörst du? Also lass mich bitte mit solchen abwegigen Gedanken in Ruhe.«
»Wie du meinst. Du wirst ja sehen, was dich die Kripo alles fragt.«
Eine Weile schwiegen sie, jeder weit weg vom andern in seine Gedanken versunken.
»Hast du dran gedacht, das Mittagessen abzusagen?«
»Natürlich. Ich hab sie sofort angerufen. Soll dich grüßen und gute Besserung wünschen. Sie fanden es ungeheuerlich, was dir passiert ist. Wir gehen dann miteinander essen, wenn du hier wieder raus bist, hat er gemeint.«
»Aber kümmer dich drum, dass wir den Auftrag auch ohne diese Einladung kriegen. Wir brauchen den, und zwar dringend.«
»Weiß ich. Ich kenne die Bücher genauso gut wie du.«
»Der Laden muss weiterlaufen, auch wenn ich ein paar Tage ausfalle.«
Ingrid versicherte, nach Kräften dafür zu sorgen.
Die Schmerzmittel verstärkten Gutbrods Bedürfnis nach seinem Sonntagmittagsschläfchen. Seine Frau beobachtete, wie er immer weniger und langsamer sprach und seine Augenlider in immer kürzeren Abständen zuklappten.
»Ich lass dich jetzt schlafen und komme morgen wieder«, sagte sie und verabschiedete sich mit einem Kuss, der trotz aller vorsichtigen Zartheit einen leichten roten Abdruck auf seiner Wange hinterließ. Sie übersah ihn. Und als sie die Tür hinter sich zuzog, hörte er sie auch schon gar nicht mehr.
Man weckte ihn um fünf, als das Abendbrot gebracht wurde. Es schmeckte ihm nicht, er war Besseres gewohnt. Aber da er den ganzen Tag nichts gegessen hatte, schlang er es hinunter und bat den Krankenpfleger sogar um eine zweite Portion.
Dann war er wach und wollte reden. Er griff nach dem Telefon, rief die Reviernachbarn an und schilderte den Anschlag mit pedantischer Genauigkeit.
»Absolut heimtückisch das. Einfach die vierte Sprosse auf beiden Seiten angesägt. Das siehst du doch nicht. Es war ja noch gar nicht hell, und dann noch der Reif. Ich steig also auf die Leiter und denk nichts Böses. Und wie ich mit dem einen Fuß auf dieser Sprosse stehe und den anderen Fuß nachziehe, geht die nach vorne weg. Ich habe keinen Halt mehr und falle auf einmal rückwärts, das ist ein saublödes Gefühl, sag ich dir. Es ging so schnell, dass ich mich gar nicht festhalten konnte. Und dann war ich erst mal weg …«
Irgendwie tat es ihm gut, immer wieder diese Geschichte zu erzählen, wobei er selbst merkte, dass er dabei immer dieselben Worte benutzte. Am Ende hätte er sie aufschreiben können, ohne auch nur einen Moment nachzudenken. Aber auf die immer wiederkehrenden Fragen – »Jetzt sag mal, kannst du dir erklären, warum das gerade dir passiert ist? Wer hat es denn auf dich abgesehen?« – wusste er keine Antwort.
»Keine Ahnung. Was denkst du, woran ich die ganze Zeit herumgrüble? Ich sag es dir ja auch, damit du aufpasst.«
Alle bedankten sich für die Warnung, aber eigentlich glaubte keiner, dass der Attentäter auch in seinem Revier gewesen war. Denn die Kanzel, auf der Steiger am Morgen kurz gesessen hatte, war auch nicht angesägt gewesen.
Zufälligerweise war in den angrenzenden Revieren an diesem Morgen niemand auf dem Ansitz gewesen, ausnahmsweise, worauf jeder Gesprächspartner besonders hinwies. Denn eigentlich hätte man bei diesem Wetter ja unbedingt hinausgemusst. Aber am Vorabend war es halt spät geworden, aber man hatte ausgerechnet an diesem Wochenende Besuch von der Verwandtschaft, man war zur Zeit stark erkältet – aber, aber, aber …
4
Die Anzeige Steigers, die Kupfer vorfand, als er kurz vor Mittag von einem Außentermin ins Büro kam, war knapp und trocken gewesen: Sein Mitpächter Gutbrod sei verunglückt, weil jemand eine jagdliche Einrichtung, sprich: einen Hochsitz, beschädigt habe. Gutbrod sei im Böblinger Krankenhaus jederzeit erreichbar. Er, Steiger, erstatte hiermit Anzeige gegen unbekannt. Der Anruf kam am Montag kurz vor Mittag.
»Auch das noch«, sagte Kupfer genervt und hätte gern einen Kollegen zu Gutbrod ins Krankenhaus geschickt. Um Krankenhäuser, Kliniken und Altersheime machte er, wenn es nur ging, einen großen Bogen. Glücklicherweise erfreute er sich einer stabilen Gesundheit, wofür er dankbar war. Aber schon sein TÜV, wie er die ärztliche Untersuchung nannte, der er sich alle zwei Jahre unterzog, beunruhigte ihn jedes Mal, brauchte er doch nur eine Arztpraxis zu betreten, um sich nicht mehr ganz so gesund zu fühlen. Die Welt der Mediziner und Apotheker versuchte er samt ihrer Kundschaft einfach auszuklammern. Umso unangenehmer war es für ihn, wenn er um einen Besuch im Krankenhaus nicht herumkam.
Einen noch größeren Bogen machte er um die Rechtsmedizin. Seit er damals als Anfänger ohnmächtig geworden war, als der Pathologe ein Brustbein durchsägte, hatte er ein besonderes Geschick darin entwickelt, seine Anwesenheit bei Obduktionen entbehrlich zu machen, indem er immer einen Kollegen fand, der im Moment weniger unabkömmlich war als er. Und glücklicherweise waren, wie Paula Kußmaul immer sagte, wenn ein neuer Fall hereinkam, alle Menschen verschieden. Dank der Vielfalt menschlicher Charaktere gab es in der Dienststelle auch den Kollegen Leichen-Schulz, der sein Etikett der Tatsache verdankte, dass er so etwas wie der Spezialist für Leichenschauen geworden war. Mit der lebendigen Kundschaft befasste er sich nicht so gern. Die tote sei ihm lieber, sagte er, die gebe einem keine dummen Antworten und widerstandslos alle Informationen, die sie zu bieten habe. Und da er ohnehin ein etwas emotionsarmer Mensch war, rührte ihn der Anblick von Leichen nur wenig, mochte er auch noch so grausig sein.
Um einen Besuch im Krankenhaus kam Kupfer aber heute nicht herum. Wenn er schon dort hinmusste, sagte er sich, dann konnte er vorher zu Hause Mittag machen. Marie hatte zwar nicht mit ihm gerechnet, aber vom Sonntag waren noch ein paar Reste übrig, die sie ihm schnell aufwärmte. Das war allemal besser als Kantinenessen. Und damit konnte er dem Ganzen wenigstens ein bisschen etwas abgewinnen.
Trotzdem fuhr er dann recht missmutig die Bunsenstraße hinauf. Denn lieber hätte er nach dem guten Essen die Beine ausgestreckt und die Augen ein halbes Stündchen zugemacht als sofort in die neue Ermittlung einzusteigen.
Als er durch den Korridor der chirurgischen Abteilung auf Gutbrods Krankenzimmer zuging, hatte er einen Moment das Gefühl, das Mittagessen sei ihm nicht bekommen. Aber er kannte sich gut genug, um zu wissen, dass er sich das nur einbildete. Er riss sich zusammen und ging resolut auf das Zimmer zu, wobei sich seine Laune allerdings nicht verbesserte.
Clemens Gutbrod saß halb aufrecht im Bett und starrte an die Decke, als Kupfer anklopfte. Er wirkte fast überrascht, als der Kripobeamte sich vorstellte.
»Natürlich, die Kriminalpolizei. Ich nehme an, Herr Steiger, mein Mitpächter, hat Anzeige erstattet. Das hätte ich auch noch getan. Aber bis jetzt war mir noch nicht danach. Sie sehen ja …« Damit deutete er auf sein gebrochenes Bein. »Und die Rippen und das hier. Das ist sehr schmerzhaft«, fügte er hinzu und machte eine vage Handbewegung Richtung Thorax und Kopfverband.
»Das ist doch klar«, beruhigte ihn Kupfer. »Das sind wir gewohnt. Sie haben Recht, Herr Steiger hat uns informiert – und Ihre Anzeige können Sie noch erstatten, wenn Sie sich besser fühlen. Die meisten Hinweise auf Verbrechen bekommen wir nicht von den Opfern, sondern von ihren Angehörigen oder Freunden.« Manchmal können die Opfer ohnehin nichts mehr sagen, dachte er, was er aber lieber für sich behielt. Er wollte seinen verletzten Gesprächspartner ja nicht aufregen.
Dann erzählte Gutbrod das, was sich zur Standardversion seiner Geschichte verfestigt hatte.
»Und ich habe natürlich keine Ahnung, wer hinter diesem heimtückischen Attentat steckt. Wirklich keine Ahnung«, schloss er.
»Wenn das so ist, dann müssen wir ganz systematisch Ihr Umfeld anschauen, alles: Beruf, Familie, Jagd.«
»Also die Familie können Sie herauslassen«, wandte Gutbrod sofort ein. »Sie glauben doch nicht im Ernst, dass meine Frau oder mein Sohn mit einer Säge in den Wald gehen und… ausgeschlossen! So einfach ist es nicht. Was denken Sie!«
Gutbrods Ton gefiel Kupfer gar nicht, aber er schluckte sein Missfallen hinunter.
»Gut. Lassen wir das einmal aus«, gab er gelassen zurück. »Aber Sie verstehen doch, dass wir nach den Familienverhältnissen, den Ehepartnern und eventuellen Expartnern schon fragen müssen. Manchmal gibt es die bizarrsten Eifersuchtsgeschichten. Das können Sie mir glauben.«
»Bei uns aber nicht. Wir sind seit vielen Jahren glücklich verheiratet, wenn ich so sagen darf. Da hat es keine Seitensprünge gegeben, nie«, beteuerte Gutbrod wie ein Angeklagter, der sich verteidigen muss.
»Und Ihre Frau geht sicher auch mit auf die Jagd?«
»Das allerdings nicht, das muss ich zugeben. Ehrlich gesagt, wäre es ihr lieber, wenn ich kein Jäger wäre. Aber sie weiß, dass ich die Jagd zum Ausspannen brauche, und hat nichts dagegen, auch wenn sie manchmal auf meine Gesellschaft verzichten muss.«
»Was machen Sie beruflich?«
»Wir, also meine Frau und ich, wir betreiben eine kleine Baufirma.«
»Klein? Wie klein? Wie groß darf ich mir diese kleine Firma vorstellen? Ich habe von dieser Branche wenig Ahnung.«
»Was wollen Sie wissen? Auftragsvolumen? Belegschaft?«
Gespannt darauf, was nun kommen würde, zuckte Kupfer einfach mit den Achseln. Es schien, als hätte er Gutbrod ein wenig in Verlegenheit gebracht.
»Es ist so: Wir nehmen keine großen Aufträge an, wir bauen also keine ganzen Häuser, nicht einmal ganze Rohbauten. Wir arbeiten mit Kolonnen von Betonbauern oder Leuten, die die Eisengitter binden. Wir übernehmen Teilaufgaben. Wir sind Subunternehmer.«
»Und da brauchen Sie eine große Belegschaft?«
»Manchmal ja, manchmal nein. So, wie es gerade läuft. Wir brauchen natürlich eine stabile Kerntruppe, die als Vorarbeiter funktioniert, die Poliere. Wir haben vier Poliere, die machen unser Stammpersonal aus. Die andern sind Leiharbeiter, die immer wieder mal wechseln.«
»Wie groß ist so eine Kolonne?«
»Das wechselt natürlich je nach Größe des Auftrags. Wir versuchen natürlich, ständig mit verschiedenen Aufträgen im Geschäft zu bleiben, so dass wir alle Leute halten können. Nur klappt das nicht immer.«
»Und wie viele Eisenbinder oder Betonbauer beschäftigen Sie zur Zeit?«
»Das kann ich Ihnen nicht einmal genau sagen. Vier Kolonnen von ungefähr zehn Arbeitern plus jeweils ein Polier. Rund fünfundvierzig also.«
»Und was passiert, wenn ein Auftrag abgearbeitet ist und noch kein neuer da ist?«
»Na ja, das sollte eigentlich nicht passieren. Da muss man Fuchs und Has sein, damit das reibungslos weiterläuft.«
»Und das läuft immer weiter?«
»Schon. Aber nicht immer ganz rund.«
»Und was passiert dann?«
»Dann vermittelt die Firma, die die Arbeitskräfte verleiht, den Leuten eine andere Arbeitsstelle. Damit haben wir aber kaum etwas zu tun. Wir melden nur, dass wir ein paar Kräfte freisetzen wollen.«
»Freisetzen, hmm, die Freiheit nehmen Sie sich dann«, sagte Kupfer spitz und fügte nach einer kleinen Pause hinzu: »Das heißt, Sie geben überschüssige Arbeitskräfte einfach an die Leihfirma zurück?«
Gutbrod nickte.
»So, wie ich einen Leihwagen zurückgebe, wenn ich ihn nicht mehr brauche?«
Gutbrod schüttelte gereizt den Kopf und zuckte sofort zusammen, weil er seinen Brustkorb zu sehr bewegt hatte.
»Nein, ganz so einfach natürlich nicht«, sagte er stöhnend. »Da sind ja finanzielle Dinge zu klären, Krankenversicherung, Sozialversicherung, Verdienstausfall, Urlaubsgeld.«
»Das ist ja interessant«, sagte Kupfer, als hätte Gutbrod ihm eine spannende Geschichte erzählt. »Aber sagen Sie, würden Sie völlig ausschließen, dass ein entlassener Arbeiter sich an Ihnen rächt, weil er nicht versteht, warum er nicht mehr für Sie arbeiten kann – oder darf?«
»Das ist absolut ausgeschlossen. Die Leute kennen mich ja kaum. Sie verbringen die ganze Zeit auf der Baustelle oder in den Containern, wo sie untergebracht sind. Von der Gegend sehen sie wenig. Das interessiert die auch gar nicht. Die bekommen ihr Geld und sind damit zufrieden. Und wenn sie genug haben, dann fahren sie wieder nach Hause. Da weiß doch keiner, dass ich auf die Jagd gehe, geschweige denn wo.«
»Wo kommen denn die Leute her?«
»Zur Zeit aus Rumänien und Bulgarien. Früher hatten wir Leute aus Polen und der Ukraine.«
»Und Sie sind also sicher, dass wir in dieser Richtung nicht zu ermitteln brauchen?«
»Absolut.«
»Und Ihre Poliere sind zuverlässige Leute, zu denen Sie ein gutes Verhältnis haben?«
»Alle. Für die würde ich meine Hand ins Feuer legen.«
»Und wie sieht es mit geschäftlichen Konflikten aus, ich meine mit konkurrierenden Unternehmen? Gibt es da nicht manchmal Reibereien?«
»Na ja, manchmal muss man schon einen Konkurrenten unterbieten, damit man einen Auftrag bekommt. Sonst kann man seine Leute nicht beschäftigen. Da wird scharf kalkuliert. Das ist gang und gäbe in unserem Geschäft. Aber das nimmt niemand persönlich. Der Konkurrent versucht dann eben bei der nächsten Ausschreibung, einen zu unterbieten. Ein Attentat hat es deshalb noch nie gegeben.«
»Um ganz systematisch vorzugehen«, kam Kupfer auf einen anderen Punkt zu sprechen, »muss ich Ihnen noch ein paar Fragen zur Jagd stellen. Vielleicht bringt uns das weiter. Irgendwo müssen wir ja miteinander einen Anhaltspunkt finden. Fangen wir mal mit Herrn Steiger an, den ich kurz am Telefon kennengelernt habe.«
»An den brauchen Sie nicht zu denken. Wir haben das Revier seit fünf Jahren zusammen gepachtet. Jeder zahlt seinen Teil und schießt, was er erlegen kann, das heißt im Rahmen dessen, was zulässig ist. Da gibt es keine Probleme.«
»Sie sind also richtige Jagdfreunde?«
»Natürlich.«
»Und wie kam diese Partnerschaft zustande?«
»Über geschäftliche Beziehungen. Wir hatten früher häufig miteinander zu tun.«
»Und in Ihrem Revier jagen nur Sie beide?«
»Nein, natürlich nicht. Wir haben immer mal wieder Jagdgäste da, gute Bekannte, die auch jagen. Da lädt man sich gegenseitig immer wieder mal ein. Man verkehrt freundschaftlich miteinander.«
»Wie sieht es mit Ihren Reviernachbarn aus? Gibt es da vielleicht Reibereien?«
»Nein. Absolut nicht. Gut, da kommt vielleicht mal ein bisschen Schussneid auf, wenn man erfährt, dass ein kapitaler Bock im Nachbarrevier gefallen ist, einer, hinter dem man selbst her war. Aber deswegen wird man nicht böse, weil es das nächste Mal wieder andersherum sein kann. Wenn ich hier irgendeinen Anhaltspunkt finden würde, würde ich es Ihnen sagen. Aber es fällt mir absolut nichts ein.«
Das Wort »Schussneid« überraschte Kupfer. Das hatte er noch nie gehört. Ob vielleicht auch Fußballspieler das sagten? Er konnte dem Gedanken im Moment nicht nachgehen, obwohl er den Eindruck hatte, dass dieses Gespräch keine weiteren Ergebnisse bringen würde, und verabschiedete sich. Allerdings wandte er sich unter der Tür noch einmal um.
»Noch eine Frage hätte ich: Wo befindet sich Ihr Betrieb?«
»In Weil im Schönbuch, im Gewerbegebiet Lachental. Gleich links am Ortseingang, wenn Sie von der B 464 her kommen.«
5
Kupfer sah auf die Uhr und ärgerte sich über die vergeudete Zeit. Aber da es erst früh am Nachmittag war, fand er, dass er für eine kurze Besichtigung dieses Betriebs genug Zeit hatte, wo er schon einmal unterwegs war.
Er fuhr hin. Als er Holzgerlingen passierte, schaute er argwöhnisch auf die Autoschlangen, die sich auf der Gegenfahrbahn an den Ampeln gebildet hatten. Er konnte nur hoffen, dass der Verkehr bis zu seiner Rückfahrt sich etwas auflösen würde. Die Schlange reichte fast bis zum Schaichhof, wo er dann links abbog.
Das Gewerbegebiet war kleiner, als er es sich vorgestellt hatte. Daher erwartete er, im Vorüberfahren irgendwo den Namenszug Gutbrod zu finden. Doch dem war nicht so. Als er alle Straßen abgefahren hatte, konzentrierte er sich daher auf eine relativ kleine Gewerbefläche, einen an drei Seiten eingezäunten, betonierten Hof, an dessen Ende zwei abgestellte Wohncontainer aufeinandersaßen.
Neben der Einfahrt stand ein flaches Bürogebäude, dahinter eine etwas größere Lagerhalle. Das war alles. Nur ein weißer Mercedes-Sportwagen, ein Zweisitzer mit roten Lederbezügen, wies darauf hin, dass das Betriebsgelände nicht ganz verlassen war. Kupfer parkte neben dem Sportwagen, stieg aus und schlenderte langsam wie ein betagter Tourist, der auf einem Marktplatz ein Straßencafé auswählt, auf den Eingang des Büros zu. Er konnte durchs Fenster sehen, wie eine sehr blonde Frau von ihrem Monitor aufsah, sofort aufstand und zur Tür ging. Und schon stand sie vor ihm, auf hochhackigen Schuhen in kobaltblauem Hosenanzug und rosa Bluse. An ihrem Handgelenk glänzte eine etwas zu schwere Goldkette, wie man sie auf Märkten im Orient angeboten bekommt. Und von dort hätten auch die großen Ohrringe stammen können, die durch den kurzen Haarschnitt leicht überdimensioniert wirkten.
Die passt so wenig zu dieser Umgebung wie ihr Auto, dachte Kupfer.
»Ich habe eben Ihren Mann besucht und würde mich auch gerne mit Ihnen etwas unterhalten«, sagte Kupfer nach der kurzen Begrüßung.
»Dann kommen Sie doch bitte herein in unser Besprechungszimmer.«
Sie führte ihn in einen kleinen, kahlen Raum. Weiß gekalkte Wände, grauer Linoleumboden, ein Resopaltisch, um den vier Plastikstühle standen. Es roch nach kaltem Zigarettenrauch. Geschäfte wurden hier wohl kaum angebahnt. Hier wurden höchstens die Poliere eingewiesen. Der Unterschied zwischen dem Raum und der Aufmachung der Hausherrin hätte größer nicht sein können.
»Wie war er denn heut Nachmittag drauf?«, fragte Ingrid Gutbrod, als erkundigte sie sich nach einem launischen Altersheiminsassen.
»Den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen. Geklagt hat er eigentlich nicht. Er ist aber schon bedauernswert, wie er so im Bett liegt und sich kaum rühren kann.«
»Tja, das hätte alles nicht sein müssen, wenn er an dem Morgen im Bett geblieben wäre. Aber er musste ja auf seinen Hochsitz, solang es noch stockfinster war. Bei Tag wär ihm das nicht passiert.«
Kupfer lauschte auf einen Anflug von Mitleid und hörte ihn nicht. Ihre Stimme klang eher sarkastisch.
»Und Sie sind jetzt allein hier?«, fragte er, als würde er sie auch bedauern.
»Ja, ich habe jetzt den ganzen Laden am Hals. Und das ist nicht einfach, kann ich Ihnen sagen.«
»Aber Sie haben doch sicher eine Sekretärin.«
»Ja, wir haben eine, aber die genießt gerade Mutterschutz, und mir steht die Arbeit bis zum Hals.«
Sie steckte sich eine Zigarette zwischen die geschminkten Lippen.
»Sie haben doch nichts dagegen«, sagte sie und knipste ihr goldenes Feuerzeug an, ohne Kupfer auch nur anzusehen, geschweige denn seine Antwort abzuwarten.
»Was wollen Sie denn von mir wissen?«, fragte sie nach dem ersten Zug, indem sie den Kopf in den Nacken legte und eine Wolke gegen die Decke blies.
»Das ist schnell gesagt. Ich möchte Sie fragen, wie Sie den Fall sehen und ob Sie sich diesen Unfug mit der Hochsitzleiter irgendwie erklären können.«
»Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Diese ganze Jägerei interessiert mich überhaupt nicht. Wenn es da Ärger gibt, dann soll er mit seinen Jagdfreunden darüber reden. Mir reicht schon, was hier immer anfällt.«
»Von was für Ärger reden Sie denn?«