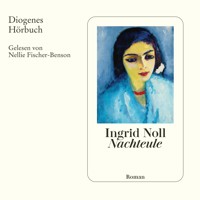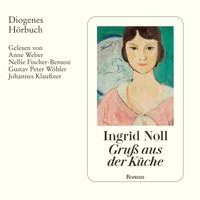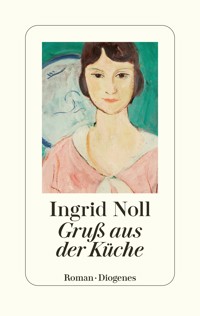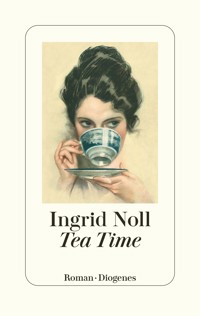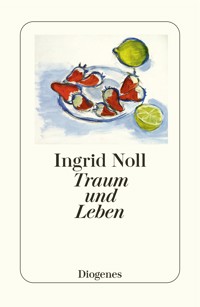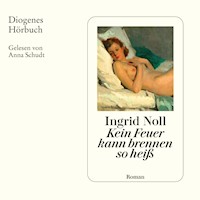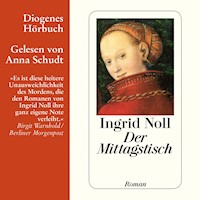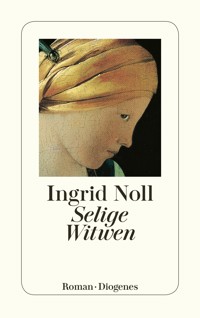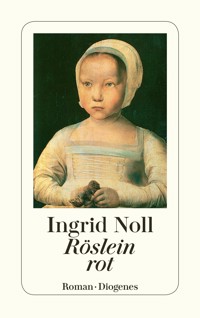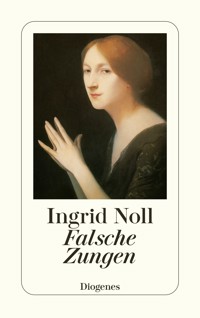
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nicht nur um Mord geht es in diesen Geschichten, auch wenn selten alles glimpflich abgeht. Denn keine Idylle ohne Engelszungen – und falsche Zungen. Zwischen Kleinkrieg und Kindersegen suchen sonderbare Leute nach Liebesglück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ingrid Noll
Falsche Zungen
Gesammelte Geschichten
Diogenes
Für Julia
Mütter mit Macken
Falsche Zungen
Zu seinem zehnten Geburtstag bekam Holger ein Tagebuch geschenkt, und ein paar Wochen lang schrieb mein Sohn wie ein artiges Mädchen seine kindlichen Erlebnisse auf.
Es war absehbar, daß er bald die Lust daran verlor. Erst drei Jahre später tauchte das Buch wieder auf, zufällig entdeckte ich es unter Holgers Schlafanzügen. Seine ersten sexuellen Selbsterfahrungen haben mich eher belustigt als beunruhigt, denn Holger bemühte sich, sie auf englisch zu formulieren. Zu faul, um ein Lexikon zu benutzen, übertrug er umgangssprachliche Ausdrücke wortwörtlich in die fremde Sprache. Welche Mutter hätte sich über diese unfreiwillige Komik nicht ebenso amüsiert wie ich!
Aber auch mit den englischen Dokumentarberichten hatte es bald ein Ende. Das Tagebuch ruhte eine Weile, bis es Holger mit etwa fünfzehn Jahren erneut zur Hand nahm. Inzwischen hatte ich längst herausgefunden, daß er sein Diarium in einer verschlossenen Schublade aufbewahrte. Der Schlüssel hing jedoch – welch unbewußte Symbolik! – unter einem gerahmten Foto direkt über seinem Schreibtisch. Abgelichtet bin darauf ich mit meinem winzigen, noch gar nicht fetten Söhnchen auf dem Arm. Es hat mich immer gerührt, daß Holger ausgerechnet dieses Foto ausgesucht hat, denn eigentlich hätte man ein Pin-up-Girl oder die Abbildung eines Rennwagens erwarten können. Erst sehr viel später wurde mir klar, daß er das plumpe Arrangement extra für mich installiert hatte.
Was er aufschrieb, war oft langweilig, gelegentlich aber auch zu Herzen gehend. Wenn ich nur wüßte, ob ich schwul bin? vertraute mein Sohn seinem Tagebuch an.
Selbstverständlich muß man davon ausgehen, daß sich sehr viele junge Menschen mit dieser Frage herumquälen. Die eigene Identität ist noch nicht geklärt, die Sorge, wie wohl die Eltern über ihre eventuelle Homosexualität urteilen würden, bereitet schlaflose Nächte. Hatten wir je über solche Probleme gesprochen? Ich konnte mich nicht daran erinnern, meine Antipathie gegen widernatürliche Praktiken auch nur ein einziges Mal geäußert zu haben.
Aber jetzt gelang mir ein Bravourstückchen der Verstellung, denn ich brachte bald darauf die Rede auf einen lieben Jugendfreund in Amerika, den es zwar in der Realität nicht gab, über dessen Schwulsein ich aber völlig beiläufig und unbefangen sprach. Holger konnte aus meinem Bericht mühelos entnehmen, daß ich überhaupt keine Probleme mit Homosexualität hatte, sondern sie für eine normale Möglichkeit menschlicher Beziehungen hielt und sie respektierte.
Zwei Tage später las ich: In Mathe kriege ich wahrscheinlich eine Fünf, Mama wird sich wahnsinnig aufregen.
Beim Zwiebelschneiden und Speckauslassen sprach ich ganz nebenbei über meine eigenen Zeugnisse und erzählte ihm, wie sehr ich vor den Wutausbrüchen meines strengen Vaters gezittert hatte. Zum Glück sei das ja heute anders, sagte ich, sicher hätten seine Klassenkameraden – ebenso wie er selbst – keine Prügel zu befürchten.
»Das nicht gerade«, meinte er, »ihr habt subtilere Methoden, um uns fertigzumachen.«
Nichts macht mir mehr angst als Liebesverlust, und ich erkannte in Holgers Worten eine Drohung. Als das fatale Mangelhaft tatsächlich im Zeugnis stand, zuckte ich nicht mit der Wimper.
»Halb so schlimm«, tröstete ich und lud Holger zu McDonald’s ein.
Fast alle haben einen eigenen Laptop, las ich, oder dürfen zumindest den ihrer Eltern benutzen. Mama ist in dieser Hinsicht leider eine Niete.
Das war allerdings richtig, denn bisher hatte ich nie einen Anlaß gehabt, mich mit Computern zu beschäftigen. Es mag daran liegen, daß ich wesentlich älter bin als die Väter und Mütter von Holgers Klassenkameraden. Aber ich sah ein, daß ich egoistisch war; man durfte seinen Kindern nicht den Zugang zu modernen Medien verbauen. Also begleitete ich meinen Sohn in ein Fachgeschäft und bezahlte anstandslos ein ziemlich teures Gerät, mit dem ich nichts anfangen konnte. Aus pädagogischen Gründen bestand ich jedoch darauf, daß ich offiziell als Besitzerin fungierte. Bereits in der darauffolgenden Nacht kamen mir jedoch Bedenken. Wie, wenn Holger nun alle Aufzeichnungen auf seiner Festplatte speicherte und es nie wieder möglich war, auf diskrete Weise seine Ängste, Wünsche und Sehnsüchte zu erfahren?
Vielleicht hätte ich mißtrauisch werden müssen, daß es trotzdem bei den handschriftlichen Eintragungen blieb. Ein einziges Mal, als er sein Handy in der Küche vergessen hatte und die Treppe hinunterlief, konnte ich rasch in sein Zimmer huschen und einen Blick auf den Bildschirm werfen. Der Computer war diesmal noch eingeschaltet, und ich konnte überfliegen, was mein Sohn notiert hatte. Leider handelte es sich um eine Liste, mit der ich nichts anzufangen wußte. Regelmäßige Einnahmen und Ausgaben waren ordentlich vermerkt, Daten und wohl die Initialen irgendwelcher Personen aufgeführt. Als ich Holger trapsen hörte, verschwand ich ebenso lautlos, wie ich gekommen war.
Immerhin wuchs in mir der Verdacht, mein Sohn könnte brisante Geheimnisse verbergen. Am nächsten Schultag, wo er laut Stundenplan bis zum Nachmittag nicht zu Hause war, begann ich mit einer umfassenden Razzia.
Auf einem Elternabend hatte uns Holgers Klassenlehrer über die Gefahren von Designerdrogen und Disco-Cocktails aufgeklärt, wofür Jugendliche in diesem Alter leider sehr empfänglich seien. Eine der Mütter, die ich wegen ihrer übertrieben liberalen Meinungen wenig schätze, fuhr mich anschließend nach Hause. »Von Haschisch war seltsamerweise nicht die Rede«, sagte sie und erzählte, daß ihr Sohn Gras rauche, ein reines Naturprodukt und längst nicht so gefährlich wie jenes Zeug, vor dem der Lehrer gewarnt habe. In ihrer eigenen Jugend habe sie auch alles ausprobieren müssen.
Da sich Holger nie in Diskotheken herumtrieb, hätte auch ich Haschisch erwartet, als ich auf die Plastiktütchen stieß. Aber worum mochte es sich bei diesen namenlosen Pillen handeln? Tranquilizer, Anabolika, Halluzinogene, Weckamine? Am ehesten Appetitzügler, beruhigte ich mich selbst.
Nach dieser Entdeckung wollte ich mich fast schon wieder der liebevollen Dekoration einer Schwarzwälder Kirschtorte widmen, als ich fast zufällig in den ausgedienten Kachelofen griff. Seit langem wurde er nicht mehr befeuert und diente Holger als Schuhschrank. Ich muß gestehen, daß ich einen leichten Ekel vor den Turnschuhen pubertierender Knaben habe, selbst wenn es sich um die des eigenen Sprößlings handelt. Unter einem kunterbunten Gemenge unterschiedlicher Treter angelte ich einen artfremden Gegenstand hervor. Es war eine Brieftasche aus rehbraunem Leder, weder neu noch alt, weder teuer noch billig. Ich setzte mich auf die Ofenbank und öffnete die Börse, die auf jeden Fall nicht aus meinem Haushalt stammte. Innen befanden sich ein Führerschein, ein Personalausweis, eine Kreditkarte und etwa vierhundert Euro. Der Name des Besitzers, Matthias Rinkel, kam mir bekannt vor. Nach einigem Nachdenken erinnerte ich mich, daß es Holgers Sportlehrer war. Dabei hatte ich meinem Sohn schon vor längerer Zeit ein ärztliches Attest besorgt, um ihm die demütigende Turnstunde zu ersparen.
Mein Junge dealte und stahl. Sollte ich einen Psychologen einschalten? Besser als ein studierter Seelenklempner kann eine Mutter die Gedanken ihres Kindes lesen. Holger war kein schlechter Mensch, sondern stand vermutlich unter dem Einfluß einer kriminellen Bande. Ich beschloß, nach bewährter Methode vorzugehen, und sprach zwei Tage später von einem eigenen Jugenderlebnis, das ich mir zugegebenermaßen bloß ausgedacht hatte.
Holger hörte sich die Geschichte vom Sparstrumpf seiner Urgroßmutter mit unbewegtem Gesicht an. »Wieviel Kohle war drin?« fragte er.
»Genug, um mir endlich einen eigenen Plattenspieler zu kaufen«, sagte ich, »aber ich wurde schließlich doch von Skrupeln geplagt. Meine Oma hatte ja ebenfalls Pläne, was sie mit diesem Geld anfangen wollte. Sie brauchte dringend einen neuen Kühlschrank.«
»Und?« fragte Holger und stopfte sich fünf Scheiben Serrano-Schinken in den Mund.
»Nach einigen Tagen habe ich Omas Ersparnisse klammheimlich wieder unter ihre Matratze gelegt«, sagte ich, »und glaube mir! Ich war glücklich und erleichtert über diese Entscheidung.«
Holger gähnte. »Und der CD-Player?« fragte er.
So etwas gab es damals noch gar nicht, belehrte ich ihn, aber es sei wie ein Wunder gewesen, daß mir meine Oma zu Weihnachten den ersehnten Plattenspieler geschenkt habe.
Als ich ein paar Tage später das Tagebuch aufschlug, kamen mir fast die Tränen. Als alleinerziehende Mutter hat man es nicht immer leicht, aber nun war ich bestimmt auf dem richtigen Weg. Habe die Brieftasche in R.s Schließfach geworfen und kann endlich wieder ruhig schlafen. Ohne es zu ahnen, hat mir Mama dabei geholfen.
Das Corpus delicti lag tatsächlich nicht mehr im Versteck. Auch schien mir fast, als hätte Holger sein Schuhlager ein wenig aufgeräumt. Einen winzigen Anflug von Verdacht habe ich damals gleich wieder verdrängt, obwohl es eigentlich auf der Hand lag, daß er bei seinem reumütigen Eintrag ein bißchen dick aufgetragen hatte.
Das war ihm aber wahrscheinlich selbst schon aufgefallen, denn er schrieb kurz darauf von einem Vergehen, das ich bei Gott nicht ernst nehmen mochte. Blumen auf dem Friedhof zu pflücken ist zwar nicht die feine englische Art, kann aber sicherlich als Jugendsünde zu den Akten gelegt werden. Ich verkniff es mir, von eigenen geringfügigen Delikten zu sprechen. Im Grunde war ich davon überzeugt, daß er den Frühlingsstrauß einer Angebeteten überreichen wollte, und das hatte schließlich eine sehr charmante, ja erfreuliche Komponente.
Kurz darauf verlangte er Geld für ein T-Shirt, denn das alte sei ihm zu eng geworden. Bei unserem abendlichen Entenbraten hatte er das neue bereits an. Auf rosa Untergrund glitzerte mir eine silberne Inschrift entgegen: I HATE MY MA. Über seinen skurrilen Humor hätte ich mich kranklachen können, aber ich verzog lieber keine Miene.
Vielleicht enttäuschte es ihn, daß ich weder auf den entwendeten Grabschmuck noch auf das T-Shirt reagiert habe. Als ich das nächste Mal sein Tagebuch aufschlug, erkannte ich aber mein listiges Söhnchen wieder und mußte schmunzeln. Er hatte mein Spiel genauso durchschaut wie ich das seine. Und weil er sich wünschte, daß ich sein geniales Tagebuch auch weiterhin las, erfand er haarsträubende Lügengeschichten und bezichtigte sich sogar, bei Folterungen mitgewirkt zu haben.
In den Nachrichten sieht man täglich, wie überall auf der Welt Greueltaten begangen werden, sei es von perversen Menschenfressern, sei es von fanatischen Selbstmordattentätern. Obwohl Holger ja Tag für Tag in der Schule hockte, schilderte er doch ausführlich, wie er in einem anderen Erdteil an bestialischen Verbrechen teilnahm. Ein sensibler Junge war er schon immer gewesen, nun schickte er sich offenkundig an, alle Schuld der Welt auf sich zu laden.
Wollte er womöglich seine realen Missetaten durch erfundene Geschichten ad absurdum führen? Ich nahm es nicht besonders ernst, daß er jetzt in die Rolle eines Monsters schlüpfte. Durch einen Kindskopf ließ ich mich auf keinen Fall provozieren; Gelassenheit war von jeher meine besondere Stärke. Allerdings habe ich es mir von da an völlig verkniffen, auf seine geschmacklosen Botschaften auch nur andeutungsweise einzugehen – dummes Geschwätz muß man einfach ignorieren.
Eines Tages las ich: Demnächst werde ich Kikki umbringen.
Dieser Satz gefiel mir gar nicht. Kikki war kein Phantom, sondern ein geistig zurückgebliebenes Mädchen aus unserer Straße, zwei Jahre älter als Holger. Täglich wurde sie von einem Bus zur Behindertenwerkstatt gefahren und nachmittags wieder heimgebracht. An freien Tagen lungerte sie gern vor ihrem Elternhaus herum und sprach Passanten an. Da sie arglos und gutmütig war, ließen sich viele auf einen kleinen Plausch ein, wenn ich persönlich auch keine Lust dazu hätte. In der Nachbarschaft munkelte man, daß Kikki neuerdings Interesse am anderen Geschlecht zeige. Wahrscheinlich hatte Holger das läppische Gegurre auf die Palme gebracht, was von einem Gymnasiasten auch nicht anders zu erwarten war. Ich konnte seine Abneigung gut nachvollziehen und hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, daß er seine Aggressionen bloß verbal abreagieren wollte. Deswegen hielt ich es zunächst für überflüssig, die Rede auf Kretins zu bringen.
Zwei Wochen später las ich in der Zeitung, daß Kikki vermißt wurde, und konnte es anfangs kaum glauben. Aber meine strapazierten Nerven hatten mir keinen Streich gespielt, unter dem abgebildeten Foto stand tatsächlich Erika Dietrich. Die Bevölkerung wurde gebeten, auf ein Mädchen im blauen Anorak zu achten, das älter war, als es den Anschein hatte. Nach Kikkis Verschwinden fühlte ich mich tagelang überfordert und ratlos und wagte nicht, meinem Sohn in die Augen zu sehen.
Heute früh mußte ich lesen, daß man Kikkis Leiche im Stadtwald gefunden hat, kann mir aber immer noch nicht vorstellen, daß mein Sohn etwas damit zu tun haben könnte. Ich weiß ja aus Erfahrung, daß Holgers Selbstbezichtigungen immer nur haltlose Phantastereien waren.
Doch kann ich mich wirklich darauf verlassen? Seit einer Stunde sitze ich nun schon am Küchentisch und grübele, ob es nicht eine einleuchtende Erklärung für Holgers Mordandrohung gibt. Hatte er die Tat vielleicht beobachtet oder die Leiche noch vor der Polizei entdeckt?
Aber leider erweisen sich meine psychologischen Argumente als haltlos, denn Kikki wurde ja noch gar nicht vermißt, als Holger ihren Tod ankündigte. Hals über Kopf renne ich in Holgers Zimmer. Ich muß mich noch einmal vergewissern, ob ich jenen verhängnisvollen Satz wirklich gelesen oder alles nur geträumt habe.
Das Tagebuch liegt nicht in der Schublade. Zum ersten Mal steht sie offen und ist leer, aber im Kachelofen werde ich fündig. Dort entdeckte ich auch Holgers erdverkrustete Handschuhe und eine kleine Bernsteinkette. Nach fieberhaftem Blättern komme ich an die richtige Stelle im Tagebuch. Holger hat heute nur einen einzigen Satz an mich gerichtet: Und als nächste bist du dran!
La Barbuda
Mein Name ist Magdalena Ventura, aber seit mich der Spanier Ribera gemalt hat, nennen sie mich alle nur noch: La Barbuda, die Bärtige. Bis zu meinem 37. Lebensjahr war ich eine Frau wie jede andere. Meine drei Kinder waren fast erwachsen und gut geraten, mein Mann und ich konnten trotz schwerer Arbeit ganz zufrieden mit unserem Leben sein. Ob mich der liebe Gott oder der Teufel strafen wollte, vermag ich nicht zu sagen, aber ich will mich nicht durch Flüche versündigen. Eines Tages entdeckte ich, daß mir die Haare an der Stirn ausfielen, gleichzeitig aber am Kinn zu sprießen begannen. Anfangs scherzten wir noch darüber, aber bald wurde mir die Sache unheimlich.
In unserem Städtchen in den Abruzzen gibt es zwar keinen Medikus, jedoch eine tüchtige Hebamme. Seit meinen Schwangerschaften bin ich mit ihr ganz gut bekannt, und anfangs vermochte sie mich zu trösten. Sie hatte schon von anderen Frauen gehört, die bereits vor dem vierzigsten Lebensjahr eine Veränderung durchmachten und oft unter zunehmender Gesichtsbehaarung zu leiden hatten. Eine harmlose Laune der Natur, die angeblich nichts mit einer Krankheit oder einer göttlichen Prüfung zu tun hatte. Die Hebamme, Cecilia heißt sie, lieh mir ihren kostbaren Handspiegel und eine zierliche Schere. Jeden Morgen begann ich, an mir herumzuzupfen und zu -schneiden, kam aber bald nicht mehr nach.
Mein Gemahl, Felice de Amici, konnte sich auch nicht so recht mit meiner Vermännlichung abfinden und befragte seinerseits einen Bader und Zahnreißer, der auf dem Markt Tinkturen feilbot. Stolz kam er mit einer teuren Salbe aus Murmeltierfett nach Hause, die schauerlich stank und überhaupt keine Wirkung zeigte.
Ich versuchte es mit kirchlichem Beistand. Der Pfarrer verordnete mir eine Wallfahrt, und ich pilgerte vergebens zur Madonna dei Miracoli.
Auch Cecilia brachte sich wieder ins Spiel und kochte eigenhändig ein Gebräu aus Eidechsenschwänzen, Wasserpastinaken, Seidelbast und Brechnuß. Tagelang war ich krank von dem Zeug, nur meinem Bart schien die Roßkur zu bekommen. Als ich wieder auf den Beinen stand, wäre ich indes lieber tot gewesen.
Inzwischen hatte ich nämlich eine traurige Berühmtheit in unserem Ort erlangt. Die Gassenjungen johlten, wenn ich auftauchte, die Mädchen riefen: »Schnell weg, die Hex’ kommt!«
Auch im Wirtshaus war ich anscheinend ein bevorzugtes Thema und Anlaß zu derben Späßen. »Wißt ihr schon, dass Magdalena und Felice nicht mehr zu unterscheiden sind? Die gute Frau ist über Nacht zum Zwilling ihres Mannes geworden.«
Ein Fremder, der von mir gehört hatte, klopfte eines Tages etwas zaghaft an unsere Tür und bat meinen Mann, mich anschauen zu dürfen. Felice hat zwar immer zu mir gehalten, aber seine Geduld ging allmählich zu Ende.
»Von mir aus könnt Ihr sie sehen, aber nur wenn Ihr dafür bezahlt«, sagte er und verlangte zwecks Abschreckung eine astronomische Summe. Ob man es nun glaubt oder nicht, der Fremde aus Neapel öffnete seinen Beutel bereitwillig, ohne den Preis herunterzuhandeln. Da wir im Laufe der Zeit ja viel Geld für meine Heilung ausgegeben hatten, dachte mein Mann wohl: Warum nicht, wenn der Kerl so dumm ist.
Der Neugierige trat also ein, verbeugte sich vor mir und setzte sich zu uns an den Tisch. Er sah mich lange und kritisch an und meinte dann zu Felice, er brauche einen Beweis, dass ich tatsächlich eine Frau sei. Mein Mann überlegte eine Weile, schüttelte aber dann den Kopf.
Angesichts des hohen Betrags, den der Neapolitaner für die Besichtigung gezahlt hatte, bekam ich Gewissensbisse. Mußte man ihm nicht etwas mehr anbieten als einen harten Küchenstuhl? Und war ich meinem Mann, der stets für mich aufkommen mußte, nicht ebenfalls etwas schuldig? Ganz langsam löste ich die Spangen meines Kleides und ließ den Träger des Untergewandes zur Seite gleiten. Dann griff ich unter die Stoffbahnen und nestelte meine linke Brust hervor. »Soll es auch noch die rechte sein?« fragte ich.
Doch dem Fremden hatte es vor Staunen die Sprache verschlagen.
Auch mit meiner Fassung war es vorbei. Weinend verließ ich den Raum, hörte allerdings noch, was der Neapolitaner sagte. Mein Fall werde bestimmt den spanischen Vizekönig interessieren, behauptete er, das sei nämlich ein Gelehrter, der sich oft und gern mit den vielfältigen Wundern der Natur beschäftige.
Danach hörten wir nichts mehr von unserem Besucher, aber durch ihn war Felice auf eine fatale Idee gekommen. Am nächsten Markttag mußte ich mich hinter ihn auf das Maultier schwingen und mit nach Aquila reiten. Dort einigte er sich mit dem Quacksalber, daß ich in dessen Zelt zur Schau gestellt werden durfte.
Es wurde eine qualvolle Premiere für mich, auch Felice litt. Unser ganzes Leben lang hatten wir nichts als Plackerei und kaum Zeit für Vergnügungen gehabt, den Rummel auf dem Markt empfanden wir als ungewohnt, ja bedrohlich. Zudem waren wir beide keine Menschen, die gern im Rampenlicht standen, und Leute aus der Stadt mochten wir sowieso nicht besonders.
Trotzdem. Felice wurde irgendwie vom Teufel geritten. Wenn er schon als lächerlicher Trottel galt, der mit einer bärtigen Frau zusammenlebte, so wollte er wenigstens daran verdienen.
Als wir abends wieder zu Hause waren, mochte ich mit niemandem mehr reden, so tief fühlte ich mich gedemütigt und verletzt. Aber Felice zählte die Münzen und kam zu einem erstaunlichen Ergebnis. »Ab jetzt soll dein Bart wachsen, wachsen, wachsen!« rief er. »Wehe, du rückst ihm je wieder mit einer Schere zu Leibe! Wer hätte auch geahnt, daß dein Pelz eine Goldgrube ist!« Zum ersten Mal nach langer Zeit küßte er mich, wobei uns beiden die Tränen herunterliefen.
Wir wurden bekannt und verdienten auf allen Märkten in der Region, mal mehr, mal weniger, so daß wir es fast zu bescheidenem Wohlstand brachten. Inzwischen gewöhnte ich mich ein bißchen an meinen neuen Beruf und starrte einfach so lange zurück, bis die Gaffer sich ihrerseits schämten.
Ich glaube, es war im Jahr 1631 als man mich nach Neapel brachte. Der Vizekönig Ferdinand 11. hatte den berühmten Jusepe de Ribera damit beauftragt, mich zu porträtieren. Angst hatte ich schon davor, aber ich fühlte mich auch ein wenig geehrt.
Bei der ersten Sitzung machte der Maler nur Skizzen, die er später seinem Gönner vorlegen wollte. Ribera, den man Lo Spagnoletto nennt, weil er seinen seltsamen spanischen Akzent nicht ablegen kann, ist ein eher schamhafter Mann, vielleicht zehn Jahre jünger als ich. Nie wagte er es, mit mir zu plaudern oder mich um ein Lächeln zu bitten, mit großem Ernst konzentrierte er sich auf die Arbeit. Seine Farben passen zu meiner Stimmung, sie sind gedämpft, von erdiger Tönung und wie mit gemahlenem Rötel überpudert. Nur meine gelichtete Stirn weist einen leichten Glanz auf.
Am vierten Tag sagte er: »Hör zu, Barbuda! Der Vizekönig war gestern abend im Atelier. Er ist nicht zufrieden, denn auf meinem Bild siehst du aus wie ein Mann in Frauenkleidern. Mein Gönner meint, die Betrachter sollten schließlich staunen, daß die Natur ein Wunder wie dich zustande gebracht hat. Aber niemand kann verlangen, daß du ohne Kleider Modell stehst.« Er sagte es tief besorgt, und ich sah ihm an, wie er litt. Ein negatives Urteil seines Auftraggebers konnte das Ende seiner Karriere bedeuten.
»Ein Wunder der Natur? Wahrscheinlich hat mich der Leibhaftige so übel entstellt«, sagte ich bitter.
»Nein«, meinte er, »daran glaube ich nicht. Du leidest an einem Gebrechen, das unsere Ärzte nur noch nicht kennen. Als Maler habe ich einen scharfen Blick und sehe, daß du unheilbar krank bist.«
Ribera hatte zwar eine erstaunlich hohe Meinung von seinen Fähigkeiten, war aber der erste Mensch, der mich verstand. Schon seit langem hatte ich das Gefühl, daß meine zunehmende Verwandlung eine bösartige Ursache hatte.
»Auf den Märkten habe ich schon häufig meine Brust entblößen müssen«, sagte ich leise, »weil man mein wahres Geschlecht ja sonst nicht erkennen könnte. Eigentlich möchte ich es nie wieder tun, vor allem jetzt nicht, weil ein Gemälde für alle Ewigkeit meine Schande festhalten würde.«
»Auf keinen Fall will ich dein Unglück noch vergrößern«, sagte er, »aber vielleicht könntest du mir gestatten, einen einzigen Blick auf deinen Busen zu werfen.« Ich tat ihm den Gefallen, denn ich wußte sehr wohl, daß er ein Mann von Anstand war, der mich bisher mit großem Respekt behandelt hatte.
Meine Brust ist zwar welk und schlaff, wie es einer gebrochenen Frau von 52 Jahren zusteht, aber dennoch ein untrüglicher Beweis meiner Weiblichkeit. Ribera schüttelte dennoch den Kopf. »So etwas darf man gar nicht malen! Der gesamte Klerus würde kopfstehen.« Damit hatte er mich aber bei meiner Ehre gepackt. »In meiner Jugend«, sagte ich, »war auch meine Brust voll und rund und hat drei Kinder monatelang ernähren können.«
Meine Worte schienen den Maler für einige Sekunden sprachlos zu machen, dann knallte er den Pinsel mit solcher Wucht an die Wand, daß die sepiabraune Farbe in alle Ecken spritzte. »Fantástico! Fabuloso!« rief er triumphierend. »Das ist die Lösung! Du nimmst einen Säugling auf den Arm, und eine nackte Brust ist plötzlich keine Sünde mehr!«
Jusepe de Ribera setzte mir ein gesticktes Käppchen auf den Kahlkopf und verpaßte mir den würdigen Ausdruck eines Gelehrten. Er malte mich in meinen besten Kleidern, ohne dass ich meine Jacke aufzuknöpfen brauchte, denn es war kein Problem für ihn, eine fast kreisrunde Fläche auszusparen. Als sein Kunstwerk schon halb vollendet war, legte man mir das Kind meiner Tochter in die Arme, das vergeblich nach einer Milchquelle suchte. Erst nachträglich und allzu mittig setzte der Maler eine prall gefüllte Mutterbrust in das sonderbare Bildnis ein. Viel Ahnung hat er wohl nicht von weiblicher Anatomie, aber er ist ein liebenswerter und einfühlsamer Künstler, dem ich auch ein zweites Mal meinen Hängebusen zeigen würde. Um das Bild einer Familie abzurunden, ließ er auch meinen Mann kommen. Felice steht wie der heilige Joseph im dämmrigen Hintergrund des Gemäldes und blickt mit finsterem Gleichmut über meine Schulter hinweg. Unsere Nachkommen werden sich wohl eines Tages viele Fragen stellen und sich den Kopf zerbrechen, wenn sie dieses Bild betrachten.[1]
Der gelbe Macho
Wahrscheinlich war es von Oswald beabsichtigt, daß wir zufällig auf das Tierheim stießen. Wir hatten Urlaub und erkundeten mit den Rädern die nähere Umgebung unseres Hotels. Ich nehme an, mein Mann hatte längst auf einem Stadtplan alles ins Auge gefaßt. Seine spontanen Ideen sind meist langfristig geplant.
Es waren Osterferien. Bereitwillig führte uns eine tiernärrische Schülerin zu den Hundeboxen. Verständlicherweise hatte das Mädchen seine Lieblinge; die mürrischen alten Tiere, die uns keines Blickes würdigten, überließ sie ihrer barmherzigeren Schwester. Ohne zu verweilen, brachte sie uns zu einer Hundemutter, die man trächtig an einer Autobahnraststelle ausgesetzt hatte und die nun hier ihre Jungen aufziehen durfte. Jeder weiß es: Wer nur andeutungsweise ein Herz im Leibe hat, dem steigt glückselige Rührung (fast wie bei einem Kitschfilm) als Wasser in die Augen. Ich verfiel sofort diesem Bild der reinen Lust, den wuseligen Wollkugeln, der besorgten Hundemama. Man suche dringend Abnehmer für die Kleinen, erklärte unsere Kustodin.
Oswald muß es geahnt haben. Ich konnte mich kaum trennen, ich sprach auf dem Heimweg kein Wort, aber es arbeitete in mir. »Könnten wir nicht vielleicht …«, sagte ich abends im Bett. Er erlaubte es.
Natürlich wollte er mich auf diese (vergleichsweise billige) Art von meinem Wunsch nach einem eigenen Kind ablenken. Wir waren seit sechs Jahren verheiratet. Er besaß aus erster Ehe bereits zwei, wie er behauptete, gut geratene Kinder. Anfangs hatten wir verhütet, schließlich wollte ich nach einem langen Studium erst einmal im Beruf Fuß fassen. Aber als ich die Pille absetzte, sorgte er seinerseits dafür, daß ich nicht schwanger wurde. Es kam zum großen Krach. Nach langer Abstinenz schliefen wir nun wieder gelegentlich und etwas krampfig miteinander. Wahrscheinlich dachte Oswald, ein Hündchen würde meinem Muttertrieb genügen.
Als wir Klärchen abholten, fragte Oswald nach der Rasse. Die Leiterin des Tierheims lachte. »Sehen Sie sich die Mutter an, sie ist durch und durch ein Bastard. Von Rasse kann man bei ihren Jungen schon gar nicht sprechen.«
Mir war das gerade recht. Immer wieder hört man, daß Mischlinge seltener degeneriert, jedoch klüger, lustiger und unkomplizierter sind als überzüchtete Rassehunde. »Wir sind doch keine Rassisten«, scherzte ich, »uns ist jeder Hund recht, Schäferhunde allerdings ausgenommen.« Ich sah bei diesen Kampfmaschinen unwillkürlich marschierende Soldatenstiefel, Polizei, Diktatoren vor mir.
Übrigens wurde der weitere Urlaub mit dem kleinen Hundekind ein Erfolg. Meistens hatte ich das schlafende Klärchen wie einen Säugling auf dem Schoß und ließ mir meinen Rock versauen. Alles drehte sich um sie. Es gab nichts, was mir mehr Freude bereitete, als dem spielenden Winzling zuzuschauen. Nun, was soll ich lange reden, diese schöne Zeit ging schnell vorbei. Erstens mußten wir wieder arbeiten, zweitens wurde Klärchen rasch eine stattliche Klara. Morgens eilte Oswald zu seiner Kanzlei, ich zum Krankenhaus, und Klärchen blieb jaulend im Haus. Extra ihretwegen mußte Maria jetzt täglich kommen, mehr als Babysitter denn als Putzfrau. Obwohl uns Klärchens riesige Pfoten hätten warnen sollen, gestanden wir uns erst nach einem halben Jahr ein, daß ihr Vater ein Schäferhund gewesen sein mußte. Klara hatte zwar die langen Eselsohren und den Ringelschwanz ihrer Mama, aber sonst war sie ihr keineswegs nachgeraten.
Das Klischee vom Herrn Doktor in den besten Jahren, der mit einer jungen Krankenschwester anbändelt, ist nicht nur in vielen Arztromanen und Fernsehserien, sondern auch in der Realität anzutreffen. Unter meinen Kollegen habe ich so manche Romanze mit Happy-End oder auch Tragödie beobachtet – wenn es zu Hause eine Frau und Kinder gab – und im letzteren Fall streng verurteilt. (Mein eigener Mann war bereits geschieden, als ich ihn kennenlernte.) Deswegen traf es mich ziemlich überraschend, daß ich jetzt ganz persönlich etwas Ähnliches erlebte. Jens machte Zivildienst an unserem Krankenhaus. Er war zwar nicht achtzehn, sondern bereits zwanzig, aber auch bei diesem Alter hätte ich beinahe seine Mutter sein können. Ich beschloß, nie mehr Pauschalurteile über Liebende abzugeben, jeder einzelne Fall hatte unterschiedliche Aspekte. Speziell bei mir wäre ohne die gute Klara alles anders gelaufen.
Jens war flink und angenehm. Wenn ich ihm eine Aufgabe übertrug, dann wurde sie exakt und vorbildlich ausgeführt. Auch die Patienten liebten ihn. Er trug weder eine Rastafrisur noch Ohrringe, weder Clogs noch umgedrehte Schirmmützen. Dafür besaß er einen kleinen gelben Hund, der nicht zu Hause, sondern im Auto die Mittagspause seines Herrn erwartete. Ich hatte Jens eines Tages ausführlich erklärt, worauf man beim Anlegen einer Infusion zu achten habe, als mein Blick auf die Uhr fiel. »Ach Gott«, sagte ich, »wir machen später weiter. Ich muß schnell heimflitzen, um meinen Hund auszuführen.«
Genau das hatte er seinerseits auch vorgehabt. Ich begleitete ihn zu seinem zerbeulten Wagen, sah den gelben Köter und bot spontan an, zu mir zu fahren, Klara abzuholen und mit beiden Hunden einen Spaziergang zu machen. Es war erstaunlich, daß sich Klärchen und Macho sofort gut verstanden. Seite an Seite wie zwei Pferde im Geschirr liefen sie vor uns her, fast schien es, als würden sie sich genau wie wir angeregt unterhalten. Als die Mittagspause beendet war und Jens die Autotür öffnete, sprang Macho mit einem geübten Satz auf den Rücksitz. Zu meiner Verwunderung tat Klara es ihm nach. »Komm heraus«, lockte ich, »du mußt nach Hause!« Aber sie dachte nicht daran. Beide Tiere saßen nebeneinander auf der Bank und drehten uns sozusagen eine lange Nase.
»Von mir aus kann sie liegenbleiben«, sagte Jens, »falls wir gemeinsam Dienstschluß haben.«
So kam es, daß wir nun jeden Tag ein Mittagsgängelchen zu viert unternahmen. Die Hunde schienen vollkommen zufrieden auf der haarigen grauen Wolldecke im R4 auf uns zu warten. Ich nahm nun, genauso wie Jens, das Dosenmahl für Klara mit ins Krankenhaus und fütterte sie nicht mehr zu Hause. Jene Kollegen, die ebenfalls auf dem Krankenhaushof parkten, waren gerührt über die beiden schlafenden Gesellen, die sich stets eng aneinanderkuschelten.
Natürlich erzählte ich Oswald, daß ich den Hund von nun an mit zur Arbeit nahm. Im Grunde interessierte ihn das wenig. Für die Spaziergänge und das Fressen war ich zuständig. Aber auf einmal kamen ihm doch Bedenken. »Eigentlich soll Klara unser Haus bewachen«, meinte er, »dafür haben wir sie schließlich angeschafft.« Wahrscheinlich hatte er beruflich gerade mit einem Einbruch zu tun. »Maria ist jetzt täglich hier«, sagte ich, »die ist furchterregender als jeder Bluthund.«
Beim Laufen sprachen Jens und ich gleichermaßen über Patienten und Hunde. Ich erfuhr, daß Macho – ähnlich wie Klaras Mutter – ein Findelkind war. Jens hatte ihn allerdings von einem Urlaub am Mittelmeer mitgebracht, wo er den kranken Welpen gefunden und aufgepäppelt hatte, um ihn schließlich heimzuschmuggeln. »Macho« bedeute auf spanisch so viel wie »männliches Tier«, erklärte mir Jens, während ich ihm klarmachte, warum man nicht »Herzversagen« als Diagnose auf den Totenschein schreiben dürfe, weil das sozusagen immer zutreffe.
Eines Morgens erwartete mich Jens zwar wie stets am Parkplatz, aber der Gelbe war diesmal nicht dabei. Klara war sichtlich enttäuscht. »Meine Freundin hat den Hund zum Tierarzt gebracht, sie hat die ersten beiden Stunden frei. Macho wird geimpft.«
Ich fuhr zusammen. Erstens hatte Jens eine Freundin – warum eigentlich nicht? –, und zweitens besuchte sie noch die Schule.
In der Mittagspause ging ich etwas einsam mit der trauernden Klara spazieren. Ohne Machos Gesellschaft hatte sie ungern die lange Wartezeit verbracht. Jens hupte plötzlich hinter uns. Er fahre jetzt heim, den Hund holen. Ohne zu fackeln, stiegen wir dazu. Ich war äußerst neugierig auf seine Wohnung.
Jens wohnte nicht mit seiner Freundin zusammen, aber Macho war bereits anwesend, also mußte sie einen Schlüssel besitzen. Ich war gerührt, denn ich befand mich plötzlich in einem Zimmer, das mir die Jugendlichkeit seines Besitzers deutlich vor Augen führte. Regenwaldposter an den Wänden, Gardinen aus grünem Tüll mit Plastikblumen zu einer Sommerwiese arrangiert, eine Saxophonsammlung, ein Hochbett mit zwei Kopfkissen, die Wäsche auf Körbe verteilt. In der Küche nicht der erwartete Berg schmutziges Geschirr. Jens lud mich zu einer Tasse Kaffee, Klara zu einer kleinen Dose Futter ein. Jeder Hund bekam ein bemaltes Tonschälchen hingestellt, sie fraßen beide gierig. Als es zweimal klingelte, liefen Jens und Klara an die Wohnungstür; er, um zu öffnen, sie, um pflichtgemäß zu bellen. Eigentlich wäre das Machos Pflicht, dachte ich, hier in seinem Reich nach dem Rechten zu sehen. Aber er achtete nicht auf den Postboten, sondern machte sich blitzschnell über Klaras Fressen her. Als sie wieder in der Küche erschien, schluckte er heuchlerisch weiter an den eigenen Brocken. Klara merkte nicht, daß ihr Napf so gut wie leer war.