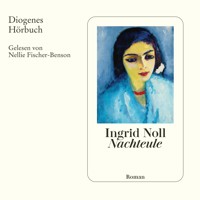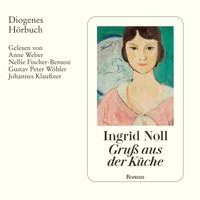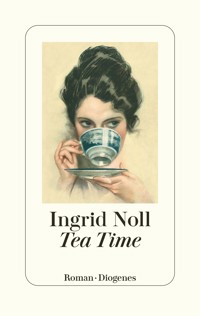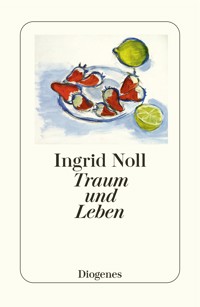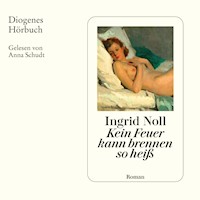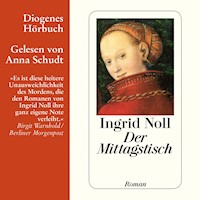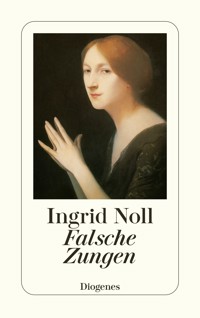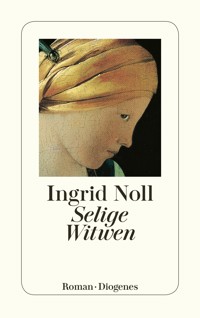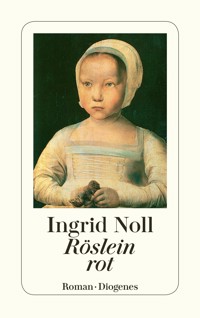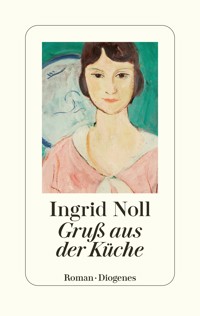
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Irma, 40, hat aus dem Gasthaus »Zum Hirschen« die beliebte vegetarische »Aubergine« gemacht. Die kreative Inhaberin beschäftigt eine bunte Truppe: eine 17-jährige Schulverweigerin als Mädchen für alles; eine tratschfreudige Hilfsköchin; einen Ex-Weltenbummler als Kellner und Manager. Und den 80-jährigen »Gemüsemann«, der beim Gemüseschnippeln hilft und angeblich fast taub ist. Und wie in jeder engen Gemeinschaft herrschen nicht nur positive Vibes, sondern gibt es einige Turbulenzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ingrid Noll
Gruß aus der Küche
Roman
Diogenes
Für meine Enkelkinder
Mira, Ruben, Jakob
und Mathilda
1Nudeldicke Dirn
Leider hatte ich von Haus aus keine Gelegenheit gehabt, eine Fremdsprache zu erlernen. Ein wenig Englisch in der Hauptschule, das war alles. Aber ich hole auf und finde es spannend, hin und wieder mit einem Ausländer ins Gespräch zu kommen und meinen Wortschatz um ein paar Ausdrücke zu erweitern, auch mein Lebensmensch, der hochgebildete Josch, liebt es, mich zu belehren. Als Köchin hat man es sowieso mit Begriffen aus der französischen Küche zu tun, so dass mir diese Sprache fast ein wenig vertraut vorkommt. Meine Ausbildung habe ich schließlich im Badischen Hof absolviert und dort nicht nur die bürgerliche, sondern auch die gehobene Gastronomie von der Pike auf erlernt.
Als ich den kleinen Gasthof meines hessischen Heimatortes übernehmen konnte, wollte ich den traditionellen Namen Zum Hirschen auf keinen Fall beibehalten, denn ich war dort durch das jahrelange Braten von Jägerschnitzeln zur Vegetarierin geworden. Mein Chef hatte wenig Wert auf eine raffinierte Zubereitung gelegt. »Salzen, salzen, salzen« hieß sein Motto, denn am Durst der Gäste war mehr zu verdienen als an der Schlachtplatte.
Josch meinte, man könne den altbekannten Namen des Lokals mit einem einzigen Wort modernisieren, nämlich: Zum vegetarischen Hirschen, denn der König des Waldes sei schließlich seinerseits kein Fleischfresser.
Aber ich nannte den Gasthof nach der Übergabe Aubergine. Anfangs war mir gar nicht bewusst, dass es bereits mehrere berühmte Restaurants mit diesem Namen gab. Erst als Josch mich aufklärte, wollte ich etwas ganz Besonderes aus meinem Laden machen und beschränkte mich nicht nur auf fleischlose Küche, sondern überraschte die Kundschaft sowohl mit exotischen als auch traditionellen oder selbsterfundenen Gemüsegerichten. Vegetarische Moussaka stand nun an erster Stelle auf meiner kleinen Speisekarte, wahrscheinlich nicht zur Freude der griechischen Konkurrenz. Fast ebenso beliebt wie die fleischlose Moussaka war meine italienische Parmigiana. Nach und nach probierte ich die unterschiedlichsten Auberginenrezepte aus, denn man kann dieses Gemüse grillen, braten, überbacken, panieren, schnitzeln, auf türkische Art füllen, mit Mozzarella verfeinern oder als Creme pürieren. Schon bald standen bei mir die asiatischen Eierfrüchte auf Platz eins der Speisekarte, wenn auch zur Abwechslung unter anderen Namen wie etwa Eggplants oder Melanzane. Grundsätzlich lehne ich es aber ab, pflanzliche Produkte durch spezielle Formgebung in Würste und Steaks zu verwandeln. Falsche Schnitzel als optischer Ersatz sind mir genauso suspekt wie magere Köche.
Fast gleichzeitig kam mir die Idee, mich passend zum namensgebenden Gemüse einzukleiden. Ich kaufte also mehrere übergroße violette Arbeitskittel und ließ mir dazu passende Kappen mit grünen Kelchblättern aus Filz anfertigen, die ich allerdings nur im Restaurant und nicht in der Küche aufsetze. Es steht mir gut, ein wenig sehe ich wie eine Märchenfigur in einem Trickfilm aus. Eines Tages taufte mich ein kanadischer Student Humpty Dumpty, weil er fand, ich gleiche trotz meiner Verkleidung eher einem lila Ei als einer Aubergine. Ich tat so, als würde ich es mit Humor nehmen, denn eigentlich war es kein Kompliment, auf meine fehlende Taille anzuspielen; aber da meine anderen Gäste das englische Kindergedicht nicht kannten, geriet dieser Spitzname rasch wieder in Vergessenheit. Als mich einmal eine junge Mutter mit verschwörerischem Lächeln fragte, wann es denn so weit sei, hätte ich sie erwürgen können. Schon in meiner Schulzeit wurde mein Name »Krugel« in »Kugel« umgewandelt, selbst mein Grundschullehrer sagte schon mal Irma Kugel zu mir. Früher kam er jeden Samstag mit Gitarre und Blockflöte in mein Lokal, dabei sang er wie schon vor dreißig Jahren das saublöde Lied für Erstklässler: Spannenlanger Hansel, nudeldicke Dirn. Ich weiß, dass er dabei sowohl mich als auch den groß gewachsenen Josch verarschen wollte. Leider amüsierten sich meine Gäste köstlich über seine Gesangseinlagen. Deswegen ließ ich ihn gewähren, auch wenn er mit Trinkgeldern geizte und noch nie etwas anderes als Kartoffelgratin bestellt hatte, den ich nur samstags anbiete. Als Beilage verlangte er immer eine Extraportion geriebenen Parmesan; meine wunderbaren Auberginen wollte er gar nicht erst probieren. Trotz allem machte ich aber gute Miene zum bösen Spiel. Josch lachte über solche Empfindlichkeiten, denn er fand es anfangs nicht weiter schlimm, als langer Lulatsch oder spannenlanger Hansel bezeichnet zu werden. Nudeldick ist dagegen wenig schmeichelhaft und auch unpassend, denn bei mir gibt es Pasta hauptsächlich für die Kinderteller.
Nach der Neueröffnung und Neubenennung war die traditionelle Kundschaft leider oder zum Glück ausgeblieben, denn die früheren Stammtischgäste wollten nicht auf ihre gewohnten Fleischberge verzichten. Es kam jedoch nicht zu einer ruinösen Überschuldung, denn es stellten sich bald völlig andere Gäste ein, allerdings keine hippen Jungunternehmer. Es sind Teenager, Vegetarier, Grüne, Linke, Künstler, Tierschützer. Unter den wenigen älteren Gästen sind zwei alte Kiffer aus der Nachbarschaft und eine Zeit lang auch der besagte, längst pensionierte Grundschullehrer, der seine Klampfe malträtierte und altmodische Wanderlieder dazu sang. Kurz gesagt, es ist ein buntes und munteres Völkchen, aber vor allem sind es auch viele junge Frauen, die weder Schnaps noch Schweinebraten mögen und sich begeistert auf meine Auberginen stürzen. Ja, die Überzahl attraktiver Mädels macht mein Lokal auch für jene jungen Männer interessant, die sich im Grunde eher für Fußball, Bier und Burger begeistern. Umweltdemonstrationen werden bei mir geplant und hinterher die Erfolge gefeiert. Die einen stoßen mit naturreiner Apfelsaftschorle, Smoothies und Bionade an, die anderen trinken Bier oder Wein, alle riechen nach Knoblauch, die Stimmung ist fröhlich. Reich kann ich mit meinem preiswerten Angebot nicht werden, die Kundschaft gehört schließlich nicht zu den Millionären, aber darauf kam es mir nie an.
Da der Laden schon bald sehr gut lief, konnte oder musste ich Hilfskräfte einstellen, denn ich war ja hauptsächlich in der Küche beschäftigt. Ohne meine Schulfreundin Nicole würde ich es kaum schaffen, und auch der Gemüsemann war ein zuverlässiger Helfer. Natürlich ist es ein Vorteil, dass meine beliebten Aufläufe schon am Vormittag vorbereitet und in den Stoßzeiten bloß in den Ofen geschoben werden. Die Mikrowelle habe ich ein wenig versteckt, weil es immer wieder Esoteriker gibt, die eine Bestrahlung befürchten und jegliche moderne Technik verteufeln. Manchmal treibt es militante Besserwisser sogar bis ins Allerheiligste, und dort empfehlen sie mir, etwa Algenpulver, Hafermilch, Mandelmus oder Kokoswasser einzusetzen. Grundsätzlich will ich jedoch nicht auf Milchprodukte und Eier verzichten, orthodoxe Veganer werden bei mir nicht glücklich. Ohne mein Betthupferl, nämlich eine ordentliche Portion alter Gouda, könnte ich sowieso nicht einschlafen. Josch, der von Anfang an bei mir kellnert, soll es allerdings nicht mitkriegen, sonst spottet er wieder: »A moment on the lips, forever on the hips.«
Übrigens hat Josch über meine spezielle Begabung sehr gestaunt. Ich brauche nämlich keine Uhr. Wenn mich am frühen Morgen mein Schwarzwälder Kuckuck erst einmal angeleiert hat, weiß ich von früh bis spät, was die Stunde geschlagen hat. Das ist beim Kochen und Backen sehr praktisch, weil selbst erfahrene Hausfrauen nicht ohne Küchenwecker auskommen. Natürlich haben moderne Geräte eine Zeitschaltuhr, aber ich benutze sie fast nie. Im Märchen von Frau Holle kann der Ofen sprechen und sagt zur fleißigen Marie: Ach bitte, hol mein Brot heraus, es ist schon fertig gebacken! Genauso geht es mir, nur dass es nicht der Backofen ist, sondern der Gemüseauflauf, der mit herrischem Unterton befiehlt: »Zieh mich jetzt raus!« An mir liegt es natürlich, ob ich sofort gehorche. Aber warum sollte ich mich weigern?
Bald hatte es sich herumgesprochen, dass an Samstagen in meiner Aubergine oft gesungen wurde, allerdings eher laut als schön. Auch unbegabte, ja sogar äußerst unmusikalische Gäste fühlten sich ermuntert, einer heimlichen Leidenschaft frönen zu können. Angesteckt durch andere Dilettanten, trauten sie sich endlich, mal die Sau rauszulassen – grölten, schmetterten und brummten, was das Zeug hielt. Es kam, wie es kommen musste: Etwas feinsinnigere Besucher blieben an diesem Tag lieber weg, aber neue kamen dazu. Man hatte sich leider angewöhnt, das verhasste Lied als Leitmotiv oder Erkennungsmelodie regelmäßig anzustimmen; natürlich nur mir zu Ehren, wie man allen Ernstes behauptete.
Spannenlanger Hansel, nudeldicke Dirn!
Geh’n wir in den Garten, schütteln wir die Birn’.
Schüttel ich die großen, schüttelst du die klein’n,
wenn das Säcklein voll ist, gehn wir wieder heim.
Es war bis in den Keller zu hören, in der Küche gab es sowieso keine Chance zur Flucht. Manchmal hatte ich Lust, laut zu brüllen: »Das Säcklein ist längst voll!«
»Was regst du dich so auf«, sagte Josch. »Singen macht durstig, das ist doch ganz in unserem Sinn!«
»Salzen macht auch durstig, aber für derartig billige Tricks bin ich mir wirklich zu schade! Manchmal überlege ich sogar, ob ich gar keinen Alkohol ausschenken sollte …«
»Dann wären wir schon in wenigen Wochen pleite«, meinte Josch. »Ganz abgesehen davon können mir lustfeindliche Abstinenzler gestohlen bleiben.«
Doch auch er wurde langsam ärgerlich, wenn man an den Samstagen rief: »Hansel, bring mir noch ein Bier«, oder: »Hansel, bitte zahlen!« Es war augenscheinlich, dass dieser Name stets etwas abwertend eingesetzt wurde. In puncto Berufsehre war Josch nämlich empfindlich, denn er war kein gelernter Kellner, sondern ein Quereinsteiger, der jahrelang studiert und gejobbt hatte sowie viel gereist war, aber seine Arbeit im Restaurant zwar unkonventioneller, doch besser und fröhlicher erledigte als so mancher altgediente Ober.
Am wenigsten gefiel uns aber, dass sich gewisse Unsitten jetzt auch an den Wochentagen ausbreiteten. Es ging leider wieder um das schwachsinnige Lied von der nudeldicken Dirn und dem spannenlangen Hansel, wobei das Verb hänseln zu einem armen Hansel ja passt. Irgendwie hatten ein paar Stammgäste dafür gesorgt, dass wir den hässlichen Gesang auch ohne Gitarrenbegleitung fast jeden Abend zu hören bekamen und dass man nach »Hansel« rief oder »Frau Kugel« begrüßte.
Und so kam es, dass der besonnene Josch eines Tages überreagierte, als der pensionierte Lehrer bereits zweimal gesungen hatte und mit durchdringender Stimme brüllte: »Hansel, noch ein Bier, aber dalli, dalli!«
Da ich in der Küche arbeitete, konnte ich leider nicht sehen, wie Josch den gefüllten Maßkrug durchaus nicht aus Versehen über Lehrer, Gitarre und Flöte kippte. Erst durch einen Aufschrei und den hörbaren Tumult im Restaurant wurde ich alarmiert und eilte herbei.
In meiner großen Schadenfreude hätte ich Josch zwar am liebsten auf den Rücken geklopft und Bravo! gerufen, musste aber den Schein wahren und mich für das Missgeschick meines Angestellten vielmals entschuldigen. Auf meinen Wink hin brachte Nicole eine Küchenrolle, damit sich der erzürnte Sänger notdürftig abtupfen konnte. Ich wiederum nahm Flöte und Klampfe an mich und versprach, beide Instrumente schonend zu trocknen.
In einer Profiküche gibt es mehr als nur einen Herd, insgesamt sind es bei mir sogar vier unterschiedliche Exemplare. Einer war ausgeschaltet. Ich legte die Gitarre auf die Platten, weil sie noch etwas Restwärme ausstrahlten, die Flöte schob ich in den lauwarmen Ofen, denn ich hatte Besseres zu tun, als die verhassten Folterinstrumente mit Geschirrtüchern abzureiben. Wenn der Lehrer sein frisches Bier ausgetrunken hatte, würde er hoffentlich die Rechnung verlangen und beleidigt das Lokal verlassen. »Geht natürlich aufs Haus«, würde ich sagen und ihm seine getrockneten Lieblinge überreichen.
Ein Psychologe hätte wohl eine Erklärung für meine Fehlleistung, die ich sicher nicht geplant habe, die mir aber mein aufgewühltes Unterbewusstsein suggeriert haben muss. An diesem Samstag ging es besonders stressig zu, nach der Aufregung über das verschüttete Bier schien sich der Appetit meiner Gäste plötzlich zu steigern, zweite und dritte Portionen wurden verlangt, ich wusste kaum, wo mir der Kopf stand. Aus Versehen habe ich wohl den ausgeschalteten Herd wieder angestellt. Als ich endlich den gewohnten Befehl Hol mich raus! gleich zweimal vernahm, war die Gitarre gut durchgebraten, während der Holzgeruch der knusprig gerösteten Mollenhauer-Flöte bis in die Gaststube waberte.
»Die Chefin kreiert gerade ein ganz neues Gericht für den Gruß aus der Küche«, beruhigte Josch meine irritierten Gäste.
Mit den Folgen meines Kontrollverlustes kann ich leben. Zwar musste ich den Schaden selbst bezahlen, weil sich meine Versicherung weigerte. Der singende Rentner kam nie mehr wieder. Für Josch und mich war das natürlich ein Triumph, denn das verhasste Lied von der nudeldicken Dirn verschwand schon bald in der Versenkung.
2Die Kichererbse Lucy
In der zehnten Klasse blieb ich sitzen und hatte von da an keinen Bock mehr, mich noch länger quälen zu lassen. Ich wusste ja, dass die Lehrer nur nach einem Grund suchten, um mich loszuwerden. In Deutsch war ich sogar ziemlich gut und kann mich auch gebildet ausdrücken, aber man stufte mich als mathebehindert ein und brummte mir ein Ungenügend auf. Auch wenn ich im Rechnen scheiße bin, hätte eine Fünf dicke gereicht. Der Direktor hielt meinen Einfluss auf lahme Freizeitkiller für vollpanne, dabei hatte ich nur dafür gesorgt, dass es auf Klassenfahrten oder -partys etwas crazy zuging.
Meine Eltern wollten mich in ein Internat stecken, auch weil sie meine Clique für prollig hielten. Doch ich weigerte mich standhaft. Als Übergangslösung versprach ich, erst einmal einen Job anzunehmen und dabei zu überlegen, wie es mit mir weitergehen sollte. In seinem akademischen Dünkel hoffte mein Vater wahrscheinlich, dass ich von körperlich anstrengenden Arbeiten sicherlich bald die Schnauze voll hätte und reumütig etwas später das Abi machen würde. Aber hier im Restaurant gefällt es mir auf jeden Fall besser als in dieser fucking Schule, ja eigentlich bin ich mega happy.
Das liegt zum Teil an meiner Arbeitgeberin Irma, einer horizontal benachteiligten Person, aber irgendwie sweet und keine Stressbombe wie meine Mutter. Für ein bisschen Nonsens ist sie auch manchmal zu haben. In ihrem violetten Kittel und der freaky Mütze sieht sie ziemlich spooky aus, doch das gefällt mir. Wenn noch keine Gäste da sind, bevorzugt sie aber den Obelixstyle; von Body-shaming hat sie wohl noch nie gehört. Ich mag keinen Mainstream, keine stylish angezogenen Snobs, aber auch keine Jack-Wolfskin-Muttis.
Hier ist alles anders. Vor allem der Kellner Josch ist hammergeil und reinstes Boyfriend-Material. Seine Stimme ist cremig wie Softeis. Zwischen seinen Augen hat er eine nachdenkliche Falte, die ihn besonders cool aussehen lässt. In seiner Gegenwart bin ich voll on fire und spüre bloß positive Vibes. Ob er manchmal mit Irma schläft, würde ich ganz gern wissen. Die beiden tun sehr vertraut miteinander, aber wohl mehr auf kollegialem Level. Ich konnte noch nie beobachten, dass sie sich umarmen oder sogar küssen. Vielleicht wäre das auch ein Anblick, bei dem ich laut herausplatzen würde, denn er ist lang und dünn, sie dagegen klein und dick. In meiner Klasse nannte man mich die Kichererbse, weil ich mich oft sehr hörbar amüsiere. Es sind vor allem die Pannen meiner Mitmenschen, die bei mir einen Lachanfall auslösen; Freunde macht man sich dadurch allerdings nicht gerade. Einmal rutschte Josch auf verschüttetem Bier aus und knallte mitsamt vollem Tablett auf den Hintern. Ich konnte mich bei diesem jämmerlichen Anblick nicht mehr bremsen, was er mir aber nicht besonders krummnahm. Ich musste bloß die Scherben aufsammeln und den Boden aufwischen.
Irma bezeichnet mich als Mädchen für alles. Ich muss Gläser spülen und polieren, aber auch mal servieren, abräumen, Tische decken oder den Müll entsorgen. Da ich flink bin, bleibt immer noch ein bisschen Zeit, um den früh kommenden Gästen den Gruß aus der Küche zu bringen und mit ihnen anzubändeln, Irma hat auch nichts dagegen. Sie ist nicht nur sehr dick, sondern auch großzügig, lacht gern und flippt nur selten aus. Ich kann essen und trinken, so viel ich will, wenn wenig zu tun ist, darf ich auch mal ganz entspannte Botengänge machen und mir dabei endlich eine Zigarette anzünden. Obwohl ich mehr oder weniger illegal hier arbeite und auch nur den Mindestlohn erhalte, beachtet Irma das Jugendarbeitsschutzgesetz. Abends besteht sie sogar darauf, dass ich spätestens um zwanzig Uhr abdampfe. Wenn es gerade anfängt, richtig lustig und laut zuzugehen, werde ich vor die Tür gesetzt, weil ich noch nicht volljährig bin. Aber ich schleiche mich natürlich nicht sofort nach Hause, sondern chille lieber mit meinen Kumpeln. Das Gute ist, dass ich nicht mehr um sieben Uhr earlybirden muss, sondern ausschlafen kann. Das Lokal öffnet um achtzehn Uhr, ich muss erst gegen Mittag antreten und als Erstes immer die Spülmaschinen ausräumen.
Das Einzige, was mir an meinem Job nicht besonders schmeckt, ist das Essen. Viele Mädels in meinem Alter sind inzwischen Vegetarierinnen, sogar bei den Jungs nimmt der Trend zum Blümchenkiller immer mehr zu. Damit kann ich mich nicht anfreunden, ich mag nichts lieber als ein gegrilltes Hähnchen oder ein Steak mit Zwiebeln. Zum Glück bin ich wenigstens in diesem Punkt mit meinem Vater einer Meinung, meine Ma fängt leider auch schon damit an, dass wir zweimal pro Woche auf Fleisch verzichten müssen. Neulich wollte sie Papa und mich sogar mit gebratenen Tofu-Tieren reinlegen. An solchen Tagen ist für mich Dönerwetter mit Karussellfleisch.
Bollig war es, als ich mir vor Dienstbeginn noch einen Snack bei McDonald’s organisieren wollte und dort sofort eine bekannte Gestalt aus der Schlange herausragen sah: Josch! Und zwar verlangte er keinen einfachen Cheeseburger, sondern den teuersten Rindfleisch Grand Bacon! Auch er hatte mich entdeckt, zwinkerte mir zu und legte verschwörerisch den Zeigefinger an die fettigen Lippen. Wir grinsten beide und machten uns kauend und schmatzend auf den Weg zur Aubergine, einem alten Fachwerkhaus. Im Gegensatz zu mir kann Josch seine Arbeitszeiten nach Bedarf und eigenem Ermessen einteilen. Er hat im obersten Stock eine kleine Wohnung, wo er auch die Buchführung für das Restaurant erledigt. Seit Langem haust er schon dort oben, während Irma direkt über dem Restaurant wohnt und sehr viel mehr Platz hat.
»Die Chefin hat behauptet, sie rieche es sofort, wenn jemand Fleisch gegessen hat«, bemerkte ich. »Aber sie hat es bei mir wohl noch nie erschnüffelt. Verbieten kann sie es mir sowieso nicht! Was sagt sie denn zu dir, wenn du Kalorien tanken gehst?«
Josch schluckte den letzten Bissen hinunter, zog eine Zehe Knofi aus der Hosentasche und steckte sie in den Mund. »Das ist mein Parfüm und ein Deo, das alles überdeckt«, sagte er. »Ich nehme an, Irma wittert es trotzdem, hat aber keine Lust, mit mir zu diskutieren. Zum Glück ist sie keine Missionarin, sondern lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Meistens schmecken mir ihre Gemüsegerichte recht gut, aber heute macht sie Veggie-Flammkuchen, ohne Speck natürlich, das ist mir einfach zu fade. Übrigens gibt es unter unseren Gästen nicht bloß Gemüse-Talibans, sondern auch viele Flexitarier und sogar bekennende Fleischesser, die gar nicht wegen der Speisekarte, sondern wegen der lockeren Atmosphäre kommen.«
»Wie alt ist die Irma eigentlich?«
»Ach, Lucy, das weiß ich nicht, frag sie doch selbst! Wir sind ein agiles Team, da spielt das Alter keine Rolle.«
Dann erfuhr ich, dass sich für diesen Abend eine Gruppe Männer zum JGA angesagt habe; natürlich wusste ich nicht, was man darunter verstehen sollte.
»Junggesellenabschied oder Bachelor-Party«, erklärte Josch. »Im Grunde eine immer aufwendigere Sauftour mit anrüchigen Überraschungen, neuerdings große Mode, hat sich wohl aus den USA in alle Welt verbreitet. In unserer Aubergine hat dieses Event noch nie stattgefunden, ich bin mal gespannt! Zum Glück kommen sie zuerst zu uns und wollen um acht bereits weiterziehen, so dass wir die Exzesse nicht mitbekommen. Sonst hätte Irma wohl gar nicht erst eingewilligt. Außerdem werden es keine reichen Muttersöhnchen sein, sonst hätten sie ihren Trip niemals in ein vegetarisches Restaurant, sondern nach Prag oder Amsterdam verlegt.«
Das raffte ich sowieso nicht. Wenn man von vornherein vorhatte, die Nacht durchzusumpfen, dann war ein deftiges Fleischgericht doch die beste Grundlage. Josch fand das auch.
»Vielleicht war um achtzehn Uhr noch kein anderes Lokal geöffnet«, überlegte er. »Oder es sind tatsächlich ein paar Vegetarier dabei, was ich fast annehme. Kann auch sein, dass wir nur für die Vorspeise zuständig sind, im Ratskeller gibt es dann einen fetten Schweinebraten und die Süßspeisen beim Tabledance in einem Stripschuppen …«
Natürlich war ich sehr neugierig geworden und stellte mir eine geile Horde vor, die sich von der üblichen Kundschaft sicherlich stark unterschied. Bei dem Auftritt der sechs Nerds war ich aber tief enttäuscht.
Es waren nämlich voll uncoole Typen, die sich mit großem Ernst an den reservierten Tisch setzten. Alle trugen langweilige schwarze T-Shirts, auf denen ihre Namen in leichenblasser Altschrift aufgedruckt waren. Ich las: Gerhart Hauptmann, Paul Heyse, Thomas Mann, Hermann Hesse, Heinrich Böll, Günter Grass.
»Irgendwie kommen mir ihre Namen ziemlich fame vor, ich tippe auf klassische Musik«, flüsterte ich Josch zu. Er schüttelte missbilligend den Kopf.
»Jetzt weiß ich endlich, warum du sitzengeblieben bist. Und zwar nicht bloß wegen Mathe!«, sagte er. »Das sind alles Schriftsteller, und zwar deutsche Nobelpreisträger für Literatur.«
»Ich dachte, das waren Schiller und Goethe!«
»Zur Zeit der Klassiker gab es noch keinen Nobelpreis. Und in Wirklichkeit heißen die Jungs bestimmt ganz anders, ich ahne, dass irgendein Joke dahintersteckt.«
Josch schien aber auch neugierig zu werden, denn er latschte nicht in der üblichen lässigen Haltung zu den Gästen, sondern total straight. Während er unsere aktuellen Speisezettel verteilte, schienen die Männer schon über die Getränke zu diskutieren, für die es keine extra Karte gibt. Wenigstens schienen es keine Aquaholiker zu sein.
»Wir bevorzugen einen französischen Rotspon, körperreich, aber geschmeidig«, sagte Paul Heyse, »welche Provenienzen haben Sie anzubieten?«
Nun guckte der erfahrene Josch doch etwas bescheuert aus der Wäsche. »Wir haben bisher nur Rot oder Weiß«, sagte er. »Aber ich kann beide empfehlen. Ich plane jedoch, demnächst ein erweitertes Sortiment anzubieten.«
»Dann lassen Sie uns den Roten probieren«, sagte Thomas Mann und zupfte an seinem aufgeklebten Schnauzbart.
Gerhart Hauptmann verlangte als Einziger ein Bier. »Sei mir gegrüßt, du Held im Schaumgelock!«, rief er.
»Guter Mann, im Gegensatz zu Ihren flüssigen Angeboten sind die lukullischen fast formidabel«, meinte Paul Heyse, der ebenfalls einen falschen Gesichtsflokati trug. »Ich nehme eine Artischocke, bevorzuge jedoch die welsche Art der Zubereitung.«
Auch die anderen bestellten nur eine halbe Portion Flammkuchen, Kürbis-Crostini oder das erdige Rote-Bete-Carpaccio, mit dem man mich jagen kann. Josch schien mit seiner Annahme recht zu behalten, dass wir nur eine vorläufige Sammelstelle waren und die Sau in einer anderen Location rausgelassen werden sollte.
Leider wurde ich in der Küche gebraucht und konnte das Verhalten der neuen Gäste nicht aus nächster Nähe beobachten. Aber wenn Josch hereinkam, brachte er uns auf den neuesten Stand, denn auch Irma spitzte die Ohren.
»Die Hauptperson ist ein Fan der Literatur und schreibt Gedichte«, sagte er. »Dieser falsche Hermann Hesse will demnächst heiraten. Ihm zu Ehren hat sich sein bester Freund, der gefakte Günter Grass, den ganzen Schwachsinn ausgedacht. Den kenne ich sogar, wir saßen vor ewigen Zeiten mal im gleichen Proseminar.«
Nachdem die Dichter ihre fade Diät verdrückt hatten, schlug Günter Grass mit dem Messer an ein Weinglas, weil er offensichtlich solo labern wollte. Fast alle unsere Gäste legten das Besteck beiseite und lauschten interessiert.
»Unser lieber Freund Hermann wird uns an diesem denkwürdigen Abend mit einem Gedicht erfreuen«, sagte er und zog Hermann Hesse am Hosenbund in die Senkrechte. »Die Älteren unter uns kennen diese Verse mit Sicherheit und werden den Vortrag genießen! Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt: Seltsam, im Nebel zu wandern …«
Der gelinkte Hermann Hesse räusperte sich und bekam eine Fresse wie ein Pavianarsch. Als er mit leiser Stimme mit seinem bescheuerten Gesäusel begann, stieg plötzlich weißer Nebel auf und füllte die Gaststube so schnell, dass man die Hand vor den Augen kaum noch sehen konnte. Der schüchterne Poet brachte vor Schreck keinen Pieps mehr heraus. In diesem Moment witterte Josch seine große Chance. Ohne Zögern sprang er für den unfähigen Hermann ein und rappte das traurige Gefasel wie ein gefeierter Hitmaker. Als er am Schluss Jeder ist allein stöhnte, brüllte er gleich darauf mit ganz normaler Stimme: »Rauchbomben sind in geschlossenen Räumen verboten! Bitte lüften!«
Das Publikum war völlig gecatcht und jubelte. Soweit es möglich war, wurden dann die Fenster aufgerissen. Als sich die Nebelschwaden verzogen hatten, waren auch die sechs Typen verschwunden, und die Zeche blieb unbezahlt.
3Josch
Vielleicht ist es nicht gerade der Jackpot, aber doch eine erfreuliche Tatsache, dass die rothaarige Lucy seit Kurzem bei uns aushilft. Zwar musste die Chefin ihr gleich am ersten Tag erklären, dass eine transparente Bluse für die Arbeit in unserem Restaurant ungeeignet ist, aber Irma und ich finden es erfrischend, einen Teenager anzuleiten und sogar ein bisschen zu erziehen. Klar, das hübsche Kind ist launisch und aufmüpfig, aber andererseits nicht ungeschickt und vor allem keine lahme Ente. Ich kann mir denken, dass die Gymnasiallehrer keine rechte Freude an ihr hatten, denn Lucy kann weder still sitzen noch den Mund halten. Aber ihr übermütiges Lachen hat es mir irgendwie angetan, ich empfand es zwar nicht wie ein kosmisches Blitzgewitter, sondern eher als prickelndes Gefühl zwischen fürsorglicher Zuneigung und fragwürdiger Verlockung.
Meine Großmutter bezeichnete Mädels in ihrem Alter als Backfische, das habe ich ihr erzählt, und sie wiederum verriet, dass man sie Kichererbse nannte. Wenn sie mich in Irmas Abwesenheit um eine Zigarette anbettelt, dann macht sie mir schöne Augen und sülzt: »Lieber Josch, sei kein Frosch!« Welcher Mann könnte da widerstehen! Aber zum Spaß ziehe ich erst mal eine Knoblauchzehe aus der Hosentasche.
Es macht mir viel Vergnügen, sie hin und wieder aufs Glatteis zu führen. Ich habe ihr zum Beispiel nicht verraten, dass ich bei einer Bachelor-Party mit dem Anführer unter einer Decke steckte. Selbstverständlich wurde die Rechnung für Speisen und Getränke am nächsten Tag bezahlt, auch konnte ich ein Gedicht von Hermann Hesse in aller Ruhe einüben und mit meiner angeblich spontanen Performance große Bewunderung erwecken. Lucy war hin und weg, ich muss zugeben, dass es mir guttat. Aber natürlich ist mir klar, dass ich keine falschen Signale setzen darf, das Mädchen ist erst sechzehn, steht eindeutig in einem Abhängigkeitsverhältnis, und abgesehen davon hat Irma stets ein wachsames Auge auf ihre Mitarbeiter. Leider ist sie immer noch eifersüchtig, wenn ich mit dem Personal und den Gästen ein wenig flirte. Ich hoffe, sie wird bald einsehen, dass es nur geschieht, um für eine heitere Stimmung zu sorgen.
Wenn ich mich mit Jugendlichen unterhalte und von ihnen wohlwollend akzeptiert werde, dann bedauere ich manchmal, dass ich kein Lehrer geworden bin. Zugegebenermaßen habe ich zu lange, aber nicht ungern studiert, doch als mein Vater mir Druck machte und nicht mehr zahlen wollte, habe ich mehr oder weniger aus Trotz alles hingeschmissen. Deswegen kann ich Lucy einerseits gut verstehen, andererseits möchte ich sie vor einem großen Fehler bewahren.
Ihr Problem sei Mathe gewesen, sagte sie. Als ich bei einem Gespräch – ich glaube, es ging um Hygiene im Gastgewerbe und die Verbreitung von Viren – das Wort exponentiell in den Mund nahm, verstand sie nur Bahnhof. Daraufhin habe ich ihr die uralte Sage vom Schachbrett und den Reiskörnern erzählt, die sie tatsächlich noch nicht kannte. Es geht darum, auf das erste Feld ein einziges Korn zu legen, auf das nächste zwei Körner, auf das dritte die doppelte Anzahl und immer so weiter, bis alle vierundsechzig Spielfelder belegt sind. Als ich Lucy fragte, wie viel Körner es dann am Ende wohl sein könnten, schätzte sie die Zahl auf hundert. Sie staunte nicht schlecht, als ich nicht von Milliarden, sondern von Trillionen sprach.
»Also ein ganzes Haus voller Reis?«, fragte sie ungläubig.
»Sehr viel mehr, unser ganzes Städtchen würde zugeschüttet«, meinte ich, »so ähnlich wie im Märchen vom Süßen Brei. Aber ehrlich gesagt kann ich mir das auch nicht vorstellen, da geht es mir wie dir: Mathe war nicht gerade mein Lieblingsfach!«
Es gelingt mir anscheinend, das Mädchen Tag für Tag ein bisschen weiterzubilden, ohne dass sie es merkt und aufsässig wird. Sie hat sich sogar darauf eingelassen, dass wir alle gelegentlich englisch untereinander sprechen, denn auch Irma möchte ihren Wortschatz verbessern. Dabei geht es häufig um Fachausdrücke, also um Gerichte, Zutaten und Rezepte. Es kommt immer wieder vor, dass Gäste ohne Deutschkenntnisse bei uns essen wollen, allerdings sind es in den wenigsten Fällen Native English Speakers, sondern eher Asiaten, Osteuropäer oder Afrikaner. Mit denen kommt Irma gut zurecht, wenn sie aus der Küche heraustritt und auf Englisch erklären muss, welche Gewürze sie für ein bestimmtes Gericht verwendet hat.
Bei Irmas Freundin Nicole ist beim Englischunterricht leider Hopfen und Malz verloren. Ich muss gestehen, dass ich mir einen Running Gag erlaube und ihr eine deutsche Redewendung wörtlich ins Englische übersetze, die sie dann ganz ahnungslos verwendet. So fragt sie uns am Morgen: »How goes?« oder »Tomorrow together!« Und zum Abschied: »I wish you what.«
Eigentlich könnte ich mit meinem Job mehr als zufrieden sein, denn ich bin zwar als Oberkellner angestellt, aber irgendwie auch als Hausmeister und Manager. Als Irma den Laden übernahm, kannte sie sich mit der finanziellen Seite überhaupt nicht aus, vertraute etwas blauäugig einem windigen Steuerberater und schriebe ohne mich wohl immer noch rote Zahlen. Irma ist zwar ein herzensguter Mensch, aber alles andere als geschäftstüchtig. Schon bald bestand sie darauf, mich am Gewinn prozentual zu beteiligen. Sicherlich würde ich zwar als beamteter Studienrat besser verdienen, dafür aber fast täglich um acht Uhr vor ebenso unausgeschlafenen Schülern auf der Matte stehen müssen. Ich gehörte noch nie zu den Lerchen, und da ich ganz oben im Haus wohne, höre ich es nicht, wenn die robuste Irma schon früh am Morgen aktiv wird und den Wagen startet, um zum Großmarkt zu fahren. Sie wiederum gönnt sich, wann immer es sich machen lässt, ein kurzes Powernapping.
Immer wieder muss ich mich über Irmas explosive Mischung aus Temperament und übertriebener Gutmütigkeit wundern. Hin und wieder flippt sie aus, kann donnern und blitzen. Gelegentlich hat sie sogar einen Teller an die Wand geknallt. Doch sie stellt Aushilfskräfte ein, die kaum lesen und schreiben können, Flüchtlinge, die nur Arabisch sprechen, Behinderte, die stottern oder hinken, Wohnsitzlose, die im Gastraum campieren. Meistens und zum Glück bleiben sie auch nicht lange, nur der sogenannte Gemüsemann wird uns wohl bis zu seinem Tod erhalten bleiben. Irma hat einen Narren an ihm gefressen und ihm sogar ihr zweitliebstes geschmiedetes Messer und das große Schneidebrett aus Olivenholz überlassen. Einmal stülpte sie ihm sogar ihre lila Kappe mit den grünen Kelchblättern über seine hässliche Mütze, was mich ein wenig an das Outfit brasilianischer Cannabis-Demonstranten erinnert. Am liebsten mampft das bucklige Männlein Risottobällchen mit Safran-Mayo, die Irma in der Mikrowelle auftaut und warm macht.
Natürlich hat der alte Herr einen richtigen Namen und sogar einen akademischen Titel: Dr. Vinzent Soloth. Lucy nennt ihn Professor Salat. Er ist verwitwet, stocktaub, wohl schon weit über achtzig, wohnt ganz in der Nähe, tickt nicht mehr ganz richtig und ist bestimmt sehr einsam. Anfangs kam er jeden Tag Punkt achtzehn Uhr zum Essen, irgendwann fragte er, ob er nicht am Vormittag in der Küche helfen könne, ihm falle manchmal die Decke auf den Kopf. Angeblich soll er gesagt haben: »Das Einzige, was mich noch am Leben erhält, ist die Möglichkeit des Selbstmords.«
Inzwischen hat sich ein seltsames Agreement ergeben: Ab zehn Uhr sitzt der Gemüsemann in der Küche und putzt, schnipselt, schält, raspelt und schneidet mit großer Sorgfalt und ebensolcher Langsamkeit alles, was ihm vor die Nase gelegt wird. Dafür bekommt er dann seine geliebten Reisbällchen und die Reste vom Vortag aufgewärmt und kann sich das Abendessen sparen. Ob der Gemüsemann nur äußerst schwerhörig oder eher weitgehend dement ist, führte sogar zu einem Disput zwischen Irma und mir. Sie behauptet, er sei von überragender Intelligenz und universeller Bildung, nur etwas wortkarg. Ich wiederum befürchte, dass ihm die passenden Vokabeln mehr und mehr entfallen. »Heute keine gelben …?«, fragt er zum Beispiel, und man muss raten, ob er Petersilienwurzeln, Paprika, Pastinaken oder Wachsbohnen meint. Irgendwie gehört das kleine Männlein fast schon zum Inventar, wenn es krumm und schief in seiner Ecke hockt und vor sich hin werkelt. Tag für Tag trägt Dr. Soloth eine Mütze, weiße Frotteesocken und über seinem schmuddeligen Glencheck-Anzug einen von Irmas zeltgroßen, violetten Kitteln. »Damit er sich nicht noch mehr einsaut«, sagt Nicole, die Hilfsköchin.