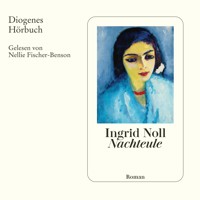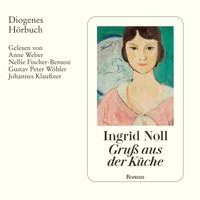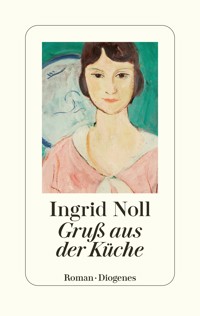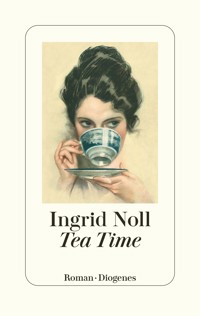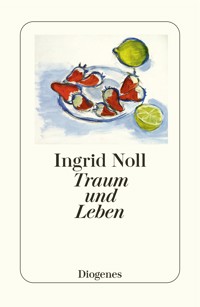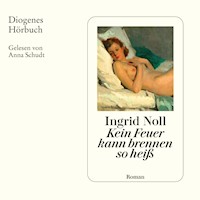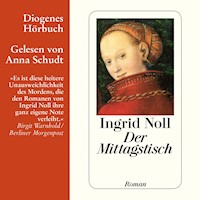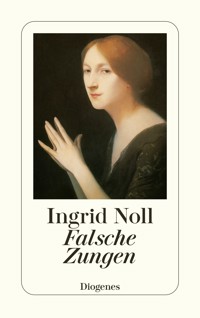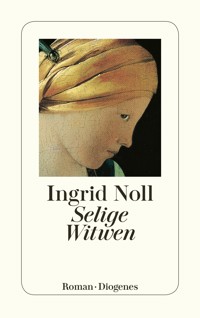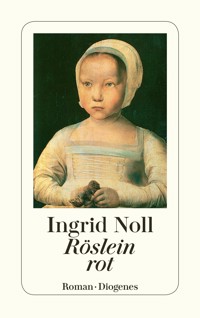
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Rosenkrieg in der deutschen Provinz! Wieder einmal klappt Ingrid Noll eine ihrer bitterbösen Beziehungskisten auf – und beim Zuklappen liegt natürlich eine Leiche drin. Als die brave Hausfrau Annerose hinter das Dreifachleben ihres spießigen Ehemanns kommt und sich selbst auf den Kriegspfad begibt, zeigt sich, wozu bürgerliche Gattinnen fähig sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ingrid Noll
Röslein rot
Roman
Diogenes
1Röslein rot
Ein lichter Strauß aus rosa und weißen Rosen, einer Kornblume, gelb-rot geflammten Tulpen, einer Narzisse, einem winzigen Stiefmütterchen und einigen Jasminblüten in einem durchsichtigen Pokal. Durch das Glas schimmern grünliche Blätter und Stengel, das Wasser hat die trübe schwarzgrüne Färbung des abgedunkelten Hintergrunds, das volle Licht fällt auf das helle Kolorit der Blüten. Jede führt ein Eigenleben, wendet sich nach rechts oder links, entfaltet sich, hebt selbstbewußt das Köpfchen oder verbirgt es hinter prächtigeren Schwestern. Eine Ausnahme macht die einzige Knospe unter den Blumen: Geknickt wendet sich das Röslein nach unten, gerade so, als wollte es sich verschämt in der untersten Ecke verkriechen.
Obwohl rote Rosen eine verhängnisvolle Rolle in meinem Leben spielten, ist diese Knospe mein Liebling. Das zarte Altrosa geht am Stiel in cremiges Gelb über, umgeben von frühlingsgrünen spitzen Kelchblättern. Ein Blättchen rollt sich schüchtern auf, aber das geneigte Köpfchen zeigt, daß die Blume zum Welken verurteilt ist. Daniel Seghers hat dieses Bild vor gut dreihundertfünfzig Jahren gemalt, aber sein Blumenstrauß ist so taufrisch, als hätte man ihn heute im Garten gepflückt. Lilie, Iris und Pfingstrose – die Blumen der Madonna – tauchen hier nicht auf, so daß ich nicht annehme, daß es sich um eine symbolische Anbetung handelt. Der Strauß war für eine ganz normale Frau bestimmt. So wie ich eine bin.
Aber schon kommen mir wieder Zweifel. Welche normale Frau liebt schon Spinnen und Mäuse? Schon als kleines Mädchen war ich verrückt nach Tieren. Nein, keine Teddys und Plüschtiere, es waren kleine und kleinste Lebewesen, die mich durch ihre zappelige Bewegung zum Jagen und Fangen animierten. Nach Insekten aller Art haschte ich furchtlos in staubigen Ecken, ja sogar eine Hummel ließ ich fasziniert in meinen hohlen Händchen brummen. Noch interessanter waren natürlich Tiere, die sich warm und weich anfühlten – kleine Nager und Vögel. Allerdings gelang es mir nie, ein gesundes Tierchen zu erwischen, es waren stets verletzte, sterbende, hochschwangere. Mein Friedhof war so groß wie Mutters Kräuterbeet, und der Verlust jedes verendeten Gefangenen wurde durch ein allerliebstes Grab gelindert, das ich mit Gänseblümchen und Steinchen zierlich schmückte. Zwar hätte ich, um einer gewissen Sammelleidenschaft Rechnung zu tragen, lieber ein Säugetier statt der fünften Amsel begraben. Dieser Wunsch ging jedoch erst durch ein kompliziertes Tauschgeschäft mit Nachbarskindern in Erfüllung. Sie verlangten für ein totes Meerschwein den Lippenstift meiner Mutter, was sich einrichten ließ.
Ich habe als Kind einiges angestellt: geöffnete Honiggläser im Garten für die Bienen verteilt, Vaters Bier ausgetrunken, mit Hausaufgaben Handel getrieben, Geld aus dem mütterlichen Portemonnaie genommen, häufig auch gelogen. Das meiste kam nie ans Tageslicht. Falls sie mich aber doch erwischten, blieben meine Eltern völlig gelassen. »Eingedenk dessen, daß du an einem gehobenen Lebensstandard partizipierst«, sagte mein Vater, »solltest du zufrieden sein und nicht gegen Gesetze verstoßen.« Mutter schimpfte sowieso nie, sondern seufzte bloß gelegentlich: »Ach, du dummes Mäuschen!« Manchmal gierte ich geradezu nach Strafe, nach Zorn, nach heftigen Gefühlen meiner Eltern, aber dazu waren beide nicht fähig.
Mein Vater hat sich im Alter von 55 Jahren zum zweiten Mal verheiratet – mit meiner Mutter, einer um viele Jahre jüngeren Krankenschwester. Ich war kaum auf der Welt, da wurde er bettlägerig, und meine Mutter pflegte ihn fünfzehn Jahre lang, bis zu seinem Tod.
Seitdem hat meine Mutter ein krankes und ein gesundes Bett; nur uns Familienangehörigen ist der Sinn dieser Begriffe klar. Das herrenlose Bett meines verstorbenen Erzeugers wurde nie aus dem Schlafzimmer entfernt. Ich mußte darin schlafen, bis ich mein Elternhaus verließ. Sicher, in jener Nacht, als mein Vater nach seinem dritten Schlaganfall im Krankenhaus starb, flüchtete ich mich freiwillig in sein Bett, an die Seite meiner Mutter. Aber alle Versuche, mich später wieder in mein eigenes Zimmer zurückzuziehen, scheiterten. Meine Mutter bekam Schwindelanfälle, Kopfschmerzen, panische Attacken, Alpträume. Vielleicht hätte ich mich gegen ihren Terror heftiger wehren müssen, aber ich wurde fortan für das Wohl und Wehe meiner Mutter verantwortlich gemacht und gab nach. Unterschwellig suggerierte sie mir, sie werde ebenfalls sterben, wenn ich ihr nicht Gesellschaft leistete.
Das Bett meines Vaters wird heute noch frisch bezogen. Es hieß eine Weile »Papas Bett«, und schließlich nannte Mutter es »das kranke Bett«. Noch zu Lebzeiten meines Vaters war sein Krankenlager nämlich mit einigen Extras ausgestattet worden – einem Lattenrost, den man verstellen und aufrichten kann, einer besonders biegsamen Unterlage und einem schwenkbaren Tablett. Als Mutter nach meinem Auszug das Schlafzimmer wohl oder übel allein bewohnen mußte, entdeckte sie die Vorzüge des kranken Betts. Wenn die Grippe sie übermannte, pflegte sie ins Nachbarbett umzusiedeln. Später rüstete sie es mit einer Latexmatratze und einem neuen Lattenrost aus, der mittels Motorkraft sowohl am Fuß- als auch am Kopfende in jede beliebige Höhe gehievt werden konnte. Wer sich in der Terminologie meiner Mutter nicht auskennt, würde das kranke Bett eigentlich für das gesündere halten, denn das gesunde Bett besitzt eine uralte, durchgelegene Matratze. Selbst ein muskulöser junger Rücken würde auf dieser Unterlage bald an Kreuzschmerzen leiden.
Ich nehme an, daß meine Mutter immer einige Tage im gesunden Bett verbringt, um dann durch ihre völlig verspannte Rückenmuskulatur einen Grund zu haben, aufs kranke Bett umzusteigen. Dort kann sie mit ruhigem Gewissen stundenlang faulenzen und lesen, frühstücken und fernsehen. Mal stellt sie mittels Knopfdruck das untere Ende steil in die Höhe, so daß bereits ihre Oberschenkel abheben und die Waden im rechten Winkel dazu flach aufliegen, mal läßt sie sich in sitzende Position aufrichten, dann wieder oben und unten erhöhen, so daß sie fast wie ein Klappmesser daliegt. Nach mehrtägiger Lust im kranken Bett ist sie wieder fit genug, um die Strapazen des gesunden Betts auf sich zu nehmen.
Natürlich steht das Telefon meiner Mutter auf dem Nachttisch des kranken Betts, damit sie es in ihrer Sterbestunde zur Hand hat. Dafür nimmt sie in Kauf, daß sie bei jedem Klingeln ins Schlafzimmer stürzen muß. Dort läßt sie sich fallen und greift zum Hörer. Ich kenne Raucher, die sich beim Telefonieren sofort eine Zigarette anstecken müssen; man merkt es an einer sekundenlangen Unaufmerksamkeit, am Klicken des Feuerzeugs und am anschließenden tiefen Einatmen. Bei meiner Mutter vernimmt man ein leise surrendes Geräusch – sie stellt sich bei einem Schwatz mit mir stets das Kopfteil hoch.
Wahrscheinlich war es das kranke Bett, das mich frühzeitig aus dem Haus getrieben hat. Bis zu meinem fünfzehnten Lebensjahr konnte ich im eigenen Zimmer schlafen und meine Freundinnen gelegentlich zum Übernachten einladen. Meine Eltern erlaubten mir auch, in den Ferien oder nach Geburtstagsfeiern bei anderen Mädchen zu logieren. Doch nach Vaters Tod war es damit vorbei, was zwangsweise zu Isolierung führte.
Wenn ich auf Klassenfesten oder Teenagerpartys auf die Pauke hauen wollte, dann ließ mich Mutter Punkt zehn von einem Taxi abholen. Wahrscheinlich stand weniger die Sorge um mich im Vordergrund als vielmehr die Angst, stundenlang auf die Besetzung des Bettes neben ihr warten zu müssen. Brachten mich die Eltern einer Freundin nach Hause, dann lag sie stets noch wach und sah mich mit vorwurfsvollen Augen an.
Nach dem Abitur kam für mich nur eine Ausbildung in Frage, die ich außerhalb unserer Stadt machen mußte. Ich beschloß, in Heidelberg Biologie zu studieren. Obwohl mir dieses Fach nicht sonderlich am Herzen lag, tat ich zu Hause doch, als hinge meine Seligkeit davon ab.
Mutter liebt mich vielleicht. Sie gab nach, beziehungsweise sah ein, daß ihr einziges Kind nicht ein Leben lang an ihrer Seite schlafen konnte. Selbstverständlich fuhr ich anfangs am Wochenende nach Hause und legte mich neben sie. Aber nach etwa einem Jahr war Mutter entwöhnt, rief nicht mehr täglich an, kontrollierte auch nicht durch ein zusätzliches Telefonat mein abendliches Heimkommen, schickte mir keine Päckchen mit Zervelatwurst und Haselnußmakronen mehr und machte kein Theater, als ich in den Semesterferien mit einer Freundin eine Schottlandreise unternahm. Ich hatte sehr viel nachzuholen.
Nach einem weiteren Jahr brach ich das Studium wegen einer Asbestallergie, einem ungerechten Professor und der Unlust, mich mit der verhaßten Mathematik, mit Physik und Chemie zu befassen, einfach ab. Meiner Mutter sagte ich nichts davon; ich würde ihr, wenn ich erst einmal wußte, was aus mir werden sollte, alles erklären.
Von da an lag ich vormittags im Bett – wie sie –, am Nachmittag ging ich in einem Café kellnern. Dabei lernte ich viele Leute kennen, Ausländer und Einheimische, Studenten und Schüler. Nicht eben selten führte ich ganz privat einige auserlesene Touristen durch die Stadt und ließ mich dafür zum Abendessen einladen. Solche Freunde verschliß ich so rasch wie meine schwarzen Strumpfhosen. Es war zwar eine Zeit der großen Freiheit, der ich nachtrauere, aber ich hatte ständig ein schlechtes Gewissen, weil meine Mutter mir weiterhin das Studiengeld überwies. Wenn ich sie an ihrem Geburtstag und an Weihnachten besuchte, mußte ich lügen. Beim Telefonieren fiel mir das nicht weiter schwer, aber wenn ich ihr Auge in Auge gegenübersaß, war es gräßlich. Doch ich tröstete mich damit, daß sie immerhin nicht arm ist.
Mein erster Freund hatte den vielversprechenden Namen Gerd Triebhaber. Er nannte mich »Röslein«, weil er den Namen »Annerose« für unzumutbar hielt. Ich glaubte lange, ich würde der lieblichen Weise »Sah ein Knab’ ein Röslein stehn« diesen Kosenamen verdanken. Eine Freundin klärte mich darüber auf, daß Goethe eine nur leicht verkappte Vergewaltigungsszene geschildert habe. Nun wollte ich nicht mehr »Röslein« heißen, wenn auch Gerd behauptete, daß es nichts mit unserer ersten Nacht zu tun habe, sondern einzig die Kurzform für »Neuröslein« sei. Er hielt mich für ziemlich gestört.
Nun, wenn man in einem kranken Bett aufgewachsen ist, hat man wohl das Recht auf ein paar kleine Überspanntheiten. Ich ekle mich zum Beispiel vor Milch, vertrage keine Wimperntusche und reagiere allergisch auf diverse Substanzen; dafür kann ich trinken wie der Zwerg Perkeo, ohne daß man mir etwas anmerkt. Ich bitte andere Leute darum, meinen Wagen vollzutanken, weil ich den Anblick des gefräßigen Geldanzeigers nicht aushalte. Ich kann nur addieren und nicht subtrahieren. Es gibt noch ein paar weitere Macken, die ich nicht alle verraten möchte – aber es ginge zu weit, wenn man mich als neurotisch bezeichnen würde.
Viel eher kann man das von meiner Mutter behaupten. Meinen Vorschlag, das gesunde Bett abzuschaffen und nur noch im kranken zu schlafen, da es doch komfortabler sei, lehnte sie entrüstet ab. Der Grund war eine neue Marotte. In der Adventszeit hatte sie einen Teddybär-Bastelkurs besucht, um ein hübsches Geschenk für die Enkelkinder herzustellen. Aber sie konnte sich nicht von ihrem plüschigen erstgeborenen Petz trennen, sondern zeigte Ehrgeiz, weitere Zotteltiere zu erzeugen. Nach und nach wurde das zweite Bett von Braun-, Schwarz- und Eisbären besiedelt, von Grislys, Pandas und Koalas, brummenden Kragen- und Waschbären. Es erfordert mittlerweile schon einen vehementen Einsatz, um abends abwechselnd das gesunde oder das kranke Bett zu entvölkern. Und jetzt will sie auch noch einen Puppenkurs absolvieren. Ich nehme an, daß sie irgendwann ein Drittbett braucht.
Ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Wenn das allerdings so klingt, als ob ich keine Geschwister hätte, dann stimmt das nicht ganz. Mein Vater hatte aus erster Ehe eine Tochter, meine Halbschwester. Sie ist älter als meine Mutter. Dieses Wesen – Ellen heißt es – hatte ich in meiner Jugend genau viermal gesehen, und anläßlich von Vaters Beerdigung saßen wir immerhin eine Stunde lang nebeneinander. Zu Weihnachten schrieben wir uns nichtssagende Karten. Ellen verübelte es mir bestimmt, daß unser gemeinsamer Vater ihre Mutter verließ, um die meine zu heiraten, obwohl es zwei Jahre vor meiner Geburt geschah. Doch falls sie meine Mutter für einen mannstollen Vamp hielt und ihr unterstellte, die intakte Ehe ihrer Eltern zerstört zu haben, so konnte ich mir keinen absurderen Verdacht vorstellen. Meine Mutter ist ein Schaf, das meinen Papa allenfalls durch Blöken in den Stall gelockt hat. Weiß der Himmel, wie es geschah, daß sie schwanger von ihm wurde. Als dann mein Bruder zur Welt kam, ließ Vater sich von seiner ersten Frau scheiden. Er hatte sich ein Leben lang einen Sohn gewünscht.
Tragischerweise starb der kleine Junge nach etwa einem Jahr durch einen Unfall. Ohne lange Wartezeit wurde ich gezeugt. Als mein Vater hörte, daß das Ersatzkind ein Mädchen war, wurde er krank; ich habe ihn fünfzehn Jahre lang nur mehr oder weniger bettlägerig und leidend erlebt. Woran er litt, erfuhr ich erst, als ich ins Gymnasium kam und von heute auf morgen als »großes Mädchen« galt: Das goldgerahmte Foto auf seinem Nachtkasten zeigte seinen einzigen Sohn, den verstorbenen Malte.
Ich hatte also einen toten Bruder und eine lebende Schwester, aber zu beiden keine positive Einstellung. Leider war es immer klar, daß ich den Jungen nicht ersetzen konnte. Als besonders schlimm empfand ich, daß man niemals über ihn und die Todesursache sprach. Heute erst erkenne ich, daß dieses Schweigen meine Kindheit zerstört hat.
Als ich dann später selbst heiratete und schwanger wurde, stellte ich mir mein künftiges Kind stets wie jenes vor, dessen Bild auf dem Nachttisch gestanden hatte: ein blondgelockter Engel mit verträumten Blauaugen. Doch so verträumt Malte auf dem Foto auch dreinblickte, die Zukunft des Stammhalters war genau vorherbestimmt: Malte war dazu ausersehen, Vaters Geschäft für Großküchenzubehör zu übernehmen. Als sich dann das Ersatzkind als Mädchen erwies, verkaufte mein Vater noch vor meiner Taufe sein Geschäft und verbrachte den Rest seines Lebens als Invalide. Kein Gedanke daran, daß auch seine Tochter einen kaufmännischen Beruf ausüben könnte. Mein Brüderchen wiederum hat sich durch seinen frühen Tod wohl allerhand Ärger erspart. Wenn ich mir sein feines Kindergesicht betrachte, dann kann ich mir gut denken, daß in Malte alles andere als kommerzielle Talente schlummerten.
Zu diesen traurigen Erinnerungen kommt hinzu, daß meine häusliche Situation anders als die meiner Freundinnen war, deren Väter stets zuwenig Zeit für die Familie hatten. Mein Vater beeindruckte meine Klassenkameraden sowohl durch ständige Anwesenheit als auch durch absolutes Desinteresse. Die meisten meiner Freundinnen bekamen ihn fast nie zu Gesicht, wußten aber, daß man sich bei uns ruhig zu verhalten hatte – keine laut aufgedrehte Musik, kein Toben im Treppenhaus, kein Tanzen und Singen oder gar gackerndes Gelächter.
Gelegentlich mußte ich Vater vorlesen, weil er nebst allen anderen Gebrechen auch noch über »müde Augen« klagte. Wenn ich ihn fragte, was er hören wolle, beteuerte er milde, das sei ihm egal. Also las ich aus Mädchen- und Tierbüchern vor, aus den Lurchi-Heften von Salamander und sogar aus Schulbüchern. Es ist die Frage, ob er je zugehört hat oder nur den Drang verspürte, mich an sein Bett zu fesseln. Aber wahrscheinlich war ich ihm genauso egal wie die Bücher.
Neulich fragte ich meine Mutter, was das eigentlich für ein Mann gewesen sei, den sie da geheiratet habe. Sie sah mich mit äußerster Verblüffung an. Ich hätte ihn doch immerhin fünfzehn Jahre lang gekannt und müsse wissen, was für einen gütigen und verständnisvollen Vater ich hatte! Immerhin räumte sie ein, daß er oft unter Beruhigungsmitteln gestanden hatte, wodurch er wahrscheinlich eine gewisse Distanz zu den banalen Realitäten des Alltags bekam. Die reale Banalität war ich.
Es gab eine Ausnahme, wo mir seine Gesellschaft ein wenig Spaß machte, und das waren die gelegentlichen Spielchen am Freitagnachmittag. Vater saß im Bett, ich zu seinen Füßen, Mutter war beim Friseur. Das schwenkbare Tablett diente als Tisch. Unsere Spiele waren von simpler Art, hießen ›Schnipp-Schnapp‹ oder ›Tod und Leben‹, als ich etwas älter war auch ›Stadt, Land, Fluß‹; dazu aß ich Salzstangen und Nußschokolade, Vater trank Bier. Wenn Mutter kam, schimpfte sie regelmäßig über die vollgekrümelte Bettwäsche. Aber Vater nahm sowieso alle Mahlzeiten im Bett ein, verschüttete Kaffee, verstreute Asche, ließ fette Schinkenränder und Wurstpellen, Nußschalen und Käserinden einfach in den Falten seiner Steppdecke verschwinden. Obwohl dauernd frisch bezogen wurde, lockte dieses unhygienische Verhalten die Fliegen an, die bei uns weder in der Küche noch im Klo zu finden waren, sondern stets im Dunstkreis von Vaters Bett. So wie man Neptun mit einem Dreizack malt, so müßte man Vater mit einer Fliegenklatsche darstellen. Wenn ich – täglich einmal – an sein Bett trat und fragte: »Papa, wie geht’s dir?«, dann bekam ich regelmäßig die Antwort, er sei des Lebens müde. Viel an Weisheit oder Wissen hat er mir nicht mitgegeben, aber des Genitivs war ich bereits mit fünf Jahren mächtig.
Heute hätte ich vielleicht den Mut, die erste Frau meines Vaters zu besuchen und auszuhorchen, aber sie starb wenige Jahre nach ihm. Vor der Begegnung mit meiner Halbschwester Ellen, die ihn immerhin als gesunden Papa erlebt hat, fürchtete ich mich. Ich hätte es kaum ertragen können, wenn sie mir von einer unbeschwerten, fröhlichen Kindheit berichtet hätte, von einem Vater, der ihr ein Puppenhaus bastelte und sie um den ersten Tanz ihres Lebens bat. Immerhin war sie längst erwachsen, als sich Papa meiner Mutter – oder vielmehr meinem neugeborenen Bruder – zuwandte; die Scheidung ihrer Eltern konnte bestimmt keine wirkliche Katastrophe für Ellen gewesen sein. Sie hat einen gesunden Vater in blauen Anzügen erlebt. Ich kannte nur seine gestreiften Schlafanzüge und die Bademäntel in Bordeaux oder Oliv. Sie war mit ihm im Kino gewesen, auf der Kirmes, an der See und auf dem Tanzstundenball. Ich dagegen saß immer nur an seinem Krankenbett, und nach seinem Tod lag ich selbst darin.
Wenn es heißt, daß ein kleines Mädchen die erste große Liebe durch seinen Vater erfährt, dann bin ich hoffnungslos verkorkst. Er liebte mich nicht und ich ihn genausowenig. Als er starb, war ich erleichtert, ohne allerdings zu ahnen, daß er postum einen negativen Einfluß auf meine künftigen Liebeserlebnisse ausüben sollte.
Meine Mutter kann es nicht lassen, immer wieder eines meiner Kinder in den Ferien zu sich einzuladen. Obwohl genug Platz in meinem Elternhaus ist und die Kinder sicher ganz gern in meinem ehemaligen Zimmer schlafen würden, weiß ich doch genau, daß Mutter ihre Enkel neben sich ins kranke Bett zwingen würde. Ich habe unter windigen Ausreden stets verhindert, daß sie bei meiner Mutter übernachten. Soll sie doch mit den Teddys glücklich werden.
Im übrigen habe ich die Theorie, daß das kranke Bett an meinen bösen Träumen schuld ist. Gewiß führen alle Menschen im Schlaf ein zweites Dasein, aber bei den meisten wechselt sich doch Unangenehmes mit Erfreulichem ab. Meine Freundin Silvia berichtet immer wieder von lustvollen Erlebnissen im Traum, bei denen sie nicht sicher ist, ob sie ihr tatsächlich einen echten Höhepunkt bescheren, so daß sie für die nächsten Tage befriedigt ist. Auch meine Kinder träumen von Goldmedaillen, lebenslanger Freundschaft mit Winnetou oder einem zwei Meter großen Gummibären. Nichts davon bei mir. Peinlichkeiten, Demütigungen, Liebesverlust, Erwischtwerden, häufig sogar Todesangst beherrschen mein Nachtleben. Es gibt Menschen, die sich vor solchen Vampiren mit Kruzifixen oder Knoblauch schützen, doch das hat bei mir nicht funktioniert. Neuerdings versuche ich, mich in die Betrachtung eines Gemäldes zu versenken, um zur Ruhe zu kommen und eine traumlose Nacht zu verbringen. Ich besitze zwei dicke Kunstbücher mit Abbildungen barocker Stilleben.
2Mäuschenstill
Obwohl ein Stilleben eigentlich nur leblose oder unbewegte Gegenstände beinhalten soll, gibt es Ausnahmen wie die kleinen Nager auf meinem zweiten Lieblingsbild. Die drei braunen Mäuse sind dem Maler Ludovico di Susio derart winzig geraten, daß sie beinahe in einem Fingerhut Platz fänden. Um so größer fallen die Zitrusfrüchte aus – die goldgelbe Zitrone, die leuchtende feinporige Orange. Rotglänzende Äpfel, Nüsse, mit Puderzucker bestreutes Naschwerk, ein Obstmesserchen auf dem blankpolierten Zinnteller laden zum Zugreifen ein. Erst auf den zweiten Blick ertappt man die Mäuschen, die sich eine Mandel teilen. Ganz leise huschen sie spätnachts herein und mausen, was das Zeug hält. Wer feine Ohren hat, wird sie knuspern und wispern hören, wer fest schläft, wird sicherlich nicht geweckt.
Wahrscheinlich gibt es viele Eltern, die ihre kleine Tochter »Mäuschen« nennen; doch bei mir hatte es die besondere Bewandtnis, daß ich bereits mehrmals eine vergiftete Maus gefangen und so lange im Puppenwagen gepflegt und spazierengefahren hatte, bis ich sie ohne schlechtes Gewissen beerdigen konnte. Meine Freundin Lucie hat, wie sie erzählte, im selben Alter Friseuse gespielt und einem Kater die Schnurrbarthaare abgeschnitten – wir hätten uns schon damals gut ergänzt.
Wenn meine Eltern schon lange im Bett lagen, wurde ich aktiv. Im Hemd geisterte ich durchs Haus, stibitzte Pralinen, tanzte vorm Fernseher, der ohne Ton lief, öffnete den Safe, um mit Bargeld zu spielen, und trennte ein Stück des Pullovers auf, an dem meine Mutter tagsüber strickte. Bei diesen Taten verspürte ich stets große Angst und noch größere Lust. Eigentlich wollte ich irgendwann ertappt werden und vor Schreck maßlos schreien. Aber es war alles vergeblich, auch am nächsten Tag wurden die Spuren meiner nächtlichen Ausschweifungen nie wahrgenommen. Ich gab auf. Das Flämmchen meines Temperaments erlosch unter einer dicken Glasglocke, meine Gefühle erstickten unter einer Watteschicht. Ohne jemals persönliche Anteilnahme zu zeigen, waren meine Eltern professionell gütig zu mir.
Der Alptraum vom verwahrlosten Säugling ist fast allen Müttern bekannt: Mit einem entsetzlichen Schrecken erinnern wir uns, daß es in einer finsteren Kammer ein Baby gibt, für das wir verantwortlich sind und das wir einfach vergessen haben. Ist es tot? Es hat über Tage keine Nahrung bekommen, wurde weder gewindelt noch geherzt. Wenn wir es schließlich hochheben, gibt es nur noch schwache Lebenszeichen von sich, und wir erwachen tränenüberströmt.
Als ich Silvia, einer entfernten Verwandten von mir und – seit sie hierher gezogen ist, die dritte in unserem Freundschaftsbund – diesen Traum erzählte, winkte sie gleich ab: Schon hundertmal in allen Variationen geträumt. Aber ich wollte ihr klarmachen, daß ich nicht etwa eine Rabenmutter bin, die bis in den Schlaf von Gewissensbissen verfolgt wird, sondern daß mein Unterbewußtsein eine Botschaft aussendet: Das verkümmerte Kind bin ich selbst. Wie viele andere Frauen habe auch ich über Jahre oder gar Jahrzehnte nur an die Familie gedacht und mich selbst vernachlässigt. Das halbtote Baby muß jetzt mit aller Liebe gepäppelt und umsorgt werden, sonst ist es vielleicht zu spät.
Silvia staunte. »Glaub’ ich dir nicht! Typisches Geschwätz von Hobby-Psychologen, ich kann mir schon denken, daß dir Lucie so etwas einbläst! Als ob nicht jeder ein schlechtes Gewissen gegenüber seinen Kindern hätte! Denen kann man es doch nie recht machen.«
Ich schwieg. Meinen anderen Traum mochte ich ihr gar nicht erst erzählen, denn sie kam selbst darin vor:
Wir stehen im Badezimmer vorm Spiegel und probieren eine neue Frisur aus, während ich mein jüngstes Kind in einer Zinkbadewanne planschen lasse. Wir schimpfen über unsere Schwiegermütter, trällern zur Musik aus dem Radio, schnuppern an meinem neuen Parfüm. Als ich nach dem Baby schaue, ist es schon lange untergetaucht. Mein Herz setzt aus, ich reiße das Kleine in die Höhe – kein Atem –, packe es an den Beinen und versuche, das Wasser aus seiner Lunge laufen zu lassen. Es strömt und strömt aus dem winzigen Mund. Schließlich treten Organe aus. Herz, Leber und Niere fallen ins Badewasser. Silvia sammelt alles auf und wirft die blutigen Klümpchen ins Klo. Ich wache schreiend auf.
Silvia schien nicht zu bemerken, welch düsteren Gedanken ich nachhing – wohl vor lauter Wut, weil sie in einem ausrangierten Koffer die Fotosammlung ihres Mannes entdeckt hatte. Vergeblich versuchte ich ihr klarzumachen, daß man Pornos in fast jedem Haushalt finden kann. Aber ich verstand sie gut, denn auch ich war während meiner Ehe schon einmal auf unangenehmes Treibgut gestoßen.
Wahrscheinlich reifte damals in mir der Entschluß, die Angstträume zu verbannen und endlich das halbtote Kind in mir wieder zum Leben zu erwecken. Für Silvia war dieses Problem leichter zu lösen, denn ihre Liebe galt seit vielen Jahren den Pferden. Als Mädchen war sie eine begeisterte Amazone gewesen, und nun sattelte sie dieses Steckenpferd aufs neue. Jeden Vormittag, wenn ihre Kinder in die Schule mußten, war sie in der Reithalle zu finden. Ich nahm an, daß sie sich für diese Sportart entschieden hatte, weil die Natur sie bereits mit dem sogenannten Reithosenspeck ausgestattet hatte. Es gelang ihr jedoch nicht, mich zu ihrer Passion zu bekehren. Ich bin reichlich unsportlich und wollte es lieber mit etwas Kreativem versuchen.
Reinhard, mein Mann, hatte nach dem Realschulabschluß eine Schreinerlehre absolviert, dann die Fachhochschulreife nachgeholt und schließlich Architektur studiert. Von seiner Lehrzeit sprach er mit Ernüchterung, da er monatelang nur Türen aus Rüster abhobeln mußte, wo sein Herz doch für Eichenbohlen schlug.
In seinem späteren Beruf kam es ihm aber durchaus zugute, daß er etwas von Holz verstand. Seit wir ein eigenes altes Häuschen besaßen, konnte er seine Visionen in Szene setzen: die Balken des Fachwerks freilegen und restaurieren, originalgetreue Sprossenfenster herstellen und tagelang Pläne für die Neugestaltung des Dachbodens entwerfen.
Es gibt wenig Architekten, die meiner Meinung nach einen guten Geschmack haben, mein Mann gehört sicherlich nicht zu dieser Minderheit. Was er in unserer Gegend verbrochen hat, kann man nicht so leicht übersehen. Es ist postmoderne Massenware billigster Art, die die innerstädtischen Baulücken flächendeckend füllt. Aber natürlich konnte er sich als Angestellter bei einer Baufirma die Aufträge nicht aussuchen, und das war wohl auch der Grund, daß unser eigenes kleines Haus langsam, aber sicher zu einer Art Heimatmuseum wurde.
Anfangs war ich hingerissen. Was gibt es Netteres als ein Fachwerkhaus mit bäuerlichem Garten? Als wir das Häuschen besichtigten, blühten Phlox und Margeriten, Rittersporn und Levkojen in Eintracht mit Lauch und Petersilie. Die Besitzerin hatte den Garten bis zu ihrem Tod liebevoll gepflegt; ihre Erben zeigten kein Interesse an einer Weiterführung der Idylle, wohl aber an einem gesalzenen Preis. Nun gut, was soll ich lange jammern, mit der Blindheit von frisch Verliebten kauften wir, ohne groß zu feilschen.
Was mein neues Hobby anging, so sollte es sich durchaus in Reinhards Traum von der heilen Welt einfügen. Bäuerlich sollte unser Haus eingerichtet sein, um sich von den Stahlrohrstühlen, Corbusier-Liegen und Büromöbeln im Bauhausstil zu unterscheiden, die seine Kollegen favorisierten. Wenn ich nicht aufgepaßt hätte, wären meine ererbten Biedermeiermöbel aus hellem Kirschholz nach und nach durch knorrige Zirbelkieferbänke, Melkschemel und Spinnräder ersetzt worden. Eines Tages brachte Reinhard vom Flohmarkt eine Wanduhr mit bemaltem Zifferblatt, deren Glas einen Sprung aufwies. Kein Problem, meinte er und öffnete den Uhrenkasten. Aber es ging nicht darum, bloß eine neue Scheibe zu kaufen, wir entdeckten mit Bedauern, daß es sich um Hinterglasmalerei handelte, die nicht zu retten war. Nicht nur das Abdeckglas, sondern das Bildchen selbst war zerbrochen. Reinhard war so betrübt, daß ich ihm einen Rettungsversuch vorschlug.
Vom Glaser ließ ich mir ein passendes Stück Glas zurechtschneiden und mit einem Loch für die Uhrzeiger versehen. Ich beschloß, das Gemälde zu kopieren. Das Motiv – eine heitere Ruderpartie auf einem bayerischen See – war so anmutig und nett anzuschauen, daß ich nicht vorhatte, es durch ein paar naive Bauernrosen zu ersetzen.
Ich kaufte mir Marderpinsel, Dispersions- und Ölfarben sowie Klarlack zum Sprühen. Es würde wohl nicht allzu schwer sein, das zersprungene Original unter die neue Glasplatte zu legen und sozusagen durchzupausen. Die Konturen zeichnete ich mit schwarzer Tusche, ließ sie trocknen und begann – wie man es mir im Bastelgeschäft empfohlen hatte – zuerst mit dem Zifferblatt und dann mit den Figuren im Vordergrund.
Reinhard war anfangs skeptisch. Aber als er sah, wie leuchtend sich die Farben auf dem Glas ausnahmen, lobte und ermunterte er mich aus ehrlicher Überzeugung. Jeder Betrachter mußte zugeben, daß mir mein allererstes Stück zwar seitenverkehrt (bis auf die Zahlen), aber gar trefflich gelungen war. Noch lange hatte diese Uhr einen Ehrenplatz über der Eßecke.
Nach diesem Anfängerglück kam ich auf den Geschmack. Es mußten ja nicht weitere Uhren sein; in unser Haus paßten auch andere Hinterglasbilder mit dörflichen Szenen.
So hatten wir schließlich alle zur Verbauerung unseres Anwesens beigetragen: Reinhard mit Balken, ich mit Bildern, meine Schwiegermutter mit Spitzengardinen, die sie aus naturweißer Baumwolle für uns häkelte, meine Mutter mit Teddybären in Dirndlkleidern und Lederhosen.
Um wenigstens einen Tiroler Bären loszuwerden, besuchte ich an den Weihnachtstagen meine alte Freundin Lucie. Ihr Kater Orfeo und die einjährige Eva spielten unterm Tannenbaum, es war ein bezauberndes Bild. Was den Geschmack angeht, waren die beiden auf etwa gleichem Niveau. Süße, lauwarme Milch für den Gaumen, Glöckchengebimmel fürs Ohr und rote Christbaumkugeln fürs Auge. Beide waren versessen auf das funkelnde Glas, das bald in Gestalt eines gefährlichen Scherbenhäufchens beseitigt werden mußte.
Wie bildete sich wohl der Geschmack heraus? ging es mir durch den Kopf. Ein Kleinkind, das noch kein Museum betreten hat, strebt wie viele Vögel und Insekten nach dem Bunten, Schillernden, nach funkelndem Gold und Silber. Noch bei achtjährigen Mädchen gehören Glanzbilder mit flammenden Herzen, Vergißmeinnichtkränzen und schnäbelnden Tauben zu den größten Schätzen, die gerade noch von Adventskalendern mit Glitzerschnee übertroffen werden. Auch mir gefallen solche Dinge als heimliche sentimentale Herzenszuflucht immer noch; mit Rührung sehe ich, wie meine Tochter Lara ganz ähnliche Bildchen tauscht und hortet wie ich in ihrem Alter.
Zu Beginn meiner Malbegeisterung benutzte ich Vorlagen aus einem Kunstband über Votivbilder, aber mit der Zeit wurden mir die Motive zu fromm. Man konnte nicht gut in alle Ecken den heiligen Sebastian hängen, auch brennende Herzen und ›Maria hilf!‹ überm Bett gefielen mir nicht mehr. Ich begann, frei zu malen.
Meine Kinder Lara und Jost schleppten mir vom Sperrmüll die geschliffene Glastür eines Küchenschranks an, Reinhard brachte die Erkerfenster eines Abbruchhauses mit, die er mir passend zurechtschnitt.
Anfangs unterstützte mich die ganze Familie. Ich malte die vier Jahreszeiten, dörfliche Feste, Hochzeiten im Mai, Hänsel und Gretel. Meiner Freundin Silvia, für die nichts fein genug ist, schenkte ich vier rotberockte Teilnehmer einer Fuchsjagd, darunter sie selbst auf ihrem asthmatischen Schecken. Lucie, die von Beruf Lehrerin ist, bekam eine altmodische Schule mit niedlichen ABC-Schützen, Pulten, einer Tafel und einem Rechenbrett. Gelegentlich arbeitete ich mit der Lupe, denn meine Bilder waren meist kleinformatig. Es war wohl die glücklichste Zeit meines Lebens, wenn Mann und Kinder morgens das Haus verließen und ich am Küchentisch zu malen anfing. Ich vergaß mich selbst und mein Los als geplagte Ehefrau und Mutter, ich vergaß auch gelegentlich, daß es Zeit zum Kochen war.
Eines Abends überraschte mich Reinhard mit dem Vorschlag, sich selbständig zu machen; schon lange pflegte ihm sein Chef die unangenehmsten Aufgaben – zum Beispiel den Windmühlenkampf mit den Bauämtern – zuzuschieben. Ich fand die Idee gut, wenn auch riskant. Einige ihm gewogene Kunden würde Reinhard übernehmen können, hoffte er.
Anfangs würde ein kleines Büro reichen, natürlich mit erstklassigen Lichtverhältnissen. Telefon, Fax und einige Möbel, ein Schild an der Tür – eine Zeichenmaschine besaß er ja bereits –, das würde nicht die Welt kosten. Das computergestützte Zeichenprogramm konnte noch etwas warten.
»Angestellte?« fragte ich.
Reinhard schüttelte den Kopf. »Das bißchen Sekretariatsarbeit kannst du übernehmen, Termine machen, Mahnungen schreiben, Anträge für Baugenehmigungen. Wenn die Kinder in der Schule sind, hast du doch Zeit genug.«
Was für eine seltsam piepsige Fistelstimme er hatte, dachte ich, die so gar nicht zu seinem maskulinen Auftreten passen wollte. Aber er setzte sich auch piepsend durch.
Vor unserer Ehe hatte ich nicht bloß gekellnert, sondern auch in Büros gearbeitet, weder gut noch gern; immerhin war eine Schreibmaschine kein Fremdkörper für mich. Sollte ich jetzt meine karge Freizeit am Vormittag, in der ich ganz und gar fürs Malen lebte, für eine verhaßtere Tätigkeit als das Kochen aufgeben? Aber hatte ich andererseits nicht die Pflicht, meinen Mann in seinem Beruf und in seiner Eigenschaft als Familienernährer zu unterstützen? Ich sagte weder ja noch nein, Reinhard hatte mich auch gar nicht nach meiner Meinung gefragt. Meine Mitarbeit war für ihn selbstverständlich, woraus ich schloß, daß er meine künstlerischen Versuche nicht allzu ernst nahm. Ohnedies hatte ich als Frau eines Architekten mitunter stark verschmutzte Hemden und Hosen zu waschen, und das hatte ich stets als Solidaritätsbeitrag geleistet. Nun wurde ich obendrein als Sekretärin eingespannt.
Ansonsten war die erste Zeit, als wir das Büro einrichteten – es lag günstigerweise in unserer Nähe –, von einem hoffnungsvollen Pioniergeist erfüllt. Natürlich durfte Reinhards Arbeitsstätte nichts von seiner Neigung zu rustikalem Ambiente verraten, die sich für einen Architekten geradezu pervers ausnahm. Stahl, Plexiglas und Leder bestimmten die nicht originelle, eher steril-neutrale Ausstattung. In einem Anflug von Großmut wollte ich Gardinen nähen, aber Reinhard entschied sich für silbergraue Plastiklamellen. Die zukünftigen Bauherren sollten sich unbeeinflußt für ihre eigenen Vorlieben entscheiden können. Mir überließ er die Auswahl der Topfpflanzen.
Silvia hatte sich in der Zwischenzeit in ihren Reitlehrer verliebt. Nach vierzehnjähriger Ehe war das wohl normal. Ich beneidete sie um die Intensität ihrer Gefühle, ihr mädchenhaftes Erröten, das Glitzern ihrer Augen und die Spekulationen, die sie über die Gefühle des viel jüngeren Reitersmannes anstellte. Wir braven Hausfrauen hatten im Gegensatz zu unseren Männern nicht viel Gelegenheit zu einem Flirt, wenn man nicht gerade den amtlichen Gasableser oder den Schornsteinfeger ins Bett locken wollte. Silvias Mann verließ morgens das Haus, eilte in seine Firma und blieb oft bis in die Nacht fort; kein Mensch ahnte, was er dort eigentlich trieb. Aber daß es hübsche Sekretärinnen und willige Praktikantinnen gab, war wohl keine Frage. Und ebenso sicher nahm Silvia an, daß ihr gutaussehender Udo nichts anbrennen ließ. Obwohl sie gelegentlich übertrieb, mochte sie in diesem Fall durchaus recht haben: Selbst mir hat er Avancen gemacht.
Auch Reinhard hatte diesbezüglich keine schlechten Karten. Architekten bilden einen reizvollen Gegensatz zu Ehemännern im grauen Flanell, sie tragen Stiefel, Lederjacken, karierte Hemden, wehende Schals und strömen die Aura des Outdoor-Typs aus, obgleich sie die meiste Zeit in krummer Haltung über ihrem Reißbrett hängen.
Und ich? Früher hatte ich mich einmal um unseren Hausarzt bemüht, das heißt, ich war unnötig oft mit dem kleinen Jost dort aufgekreuzt. Aber es ergab sich rein gar nichts. Eine meiner Freundinnen liebt ihren Pfarrer und engagiert sich in der Gemeindearbeit, Lucie eilt neuerdings auffallend oft zum Friseur – aber sie werden alle ebenso glücklos wie Silvia agieren, denn letzten Endes sind Mütter mit Kindern keine besonders begehrten Kandidatinnen. Abends können sie nicht weg, im Urlaub verreisen sie mit der Familie, und ins Bett trauen sie sich nur unter Gewissensbissen, Tränen und zu unromantischen Tageszeiten.
Ich betrachte mein Mäusebild. Die Heimlichkeit hat es mir angetan, die kleinen Täuschungen, das Anschleichen. Lucie ist mir auch in dieser Hinsicht ähnlich. Sie spricht nicht viel über ihre Vergangenheit, aber ich habe den Verdacht, daß der Dreijährige nicht von Gottfried stammt. Ein seltsamer Junge, der kleine Moritz, sicher wird er noch Probleme machen. Als wir mit ihren vier und meinen zwei Kindern über die Kirmes bummelten, habe ich einmal überschlagen, wie viele Mütter und Väter insgesamt an dieser Schar beteiligt sein könnten. Etwa sechs?
3Schlüsselerlebnis
Vor meiner Ehe habe ich es mit vielen Männern versucht. Es wäre allerdings ein Trugschluß, wollte man mich deswegen für eine besonders triebhafte Frau halten. Eher war das Gegenteil der Fall. Ich wollte einfach nicht akzeptieren, daß mir Sex keinen Spaß machte; es mußte an den Männern liegen. Also habe ich einen nach dem anderen getestet.
Reinhard ist die Schlüsselfigur, bei ihm kam der Durchbruch; erst später wurde mir die Ursache klar. Bisher war ich – weil es am praktischsten war – mit meinen Liebhabern ins Bett gegangen, bei Reinhard lag ich auf einem Baugerüst. Nicht daß ich einen gefährlichen Kitzel gebraucht hätte, um abzuheben, nein, die simple Tatsache war, daß ich keinen Mann im Bett erblicken konnte, ohne daß sich das Bild meines kranken Vaters einstellte. Ödipus hin oder her, die Vorstellung, mit meinem Papa zu schlafen, war für mich unerträglich.
Doch seit den Tagen des Baugerüsts war ich Reinhard verfallen und konnte auch auf einer herkömmlichen Matratze glücklich werden.
Nach zwei Jahren begann zwar meine Euphorie nachzulassen, aber unsere Ehe ging lange ganz gut. Erst seit dem Beginn seiner beruflichen Selbständigkeit wurde Reinhard von allerhand Verarmungsängsten geplagt. Die Aufträge tröpfelten kümmerlich, Ersparnisse waren nicht vorhanden. Wenn Rechnungen mit Verzögerung bezahlt wurden, ging uns finanziell die Puste aus. Mein Mann wurde Mitglied im teuersten Tennisklub, um solvente Kunden kennenzulernen.
»Gottfried singt in einem sehr netten Chor«, empfahl Lucie, »da gibt es an die fünfzig Mitglieder …«