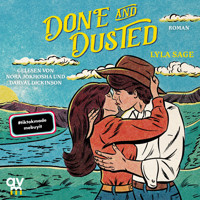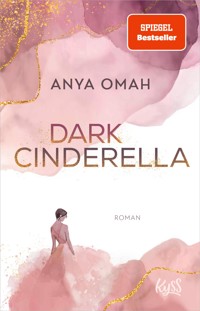6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Anais
- Sprache: Deutsch
'Ich weiß nicht, wie lange Max und ich tatsächlich telefonierten, aber ich konnte von der Fensterbank meines Schlafzimmers, auf der ich am Ende des Gesprächs wieder saß, sehen, dass die Sonne am anderen Ende des Flughafengeländes versank und irgendwann ganz verschwunden war. Was blieb, war der helle Nachthimmel. Ich schaute auf die Uhr, es war fast halb zwei. Wenn Max und ich zusammen waren, dann liefen die Uhren irgendwie schneller. Es schien so, als hätte die Zeit für unsere gemeinsamen Stunden eine ganz besondere Uhr angefertigt.' Was ist die Liebe?, grübelt Lou, die gerade ganz frisch von Köln nach Berlin in eine kleine Altbauwohnung unweit des ehemaligen Flughafens Tempelhof gezogen ist. Hier in der Hauptstadt will sie ihre Doktorarbeit schreiben und ganz neu anfangen. Das könnte klappen, wäre da nicht ihr Exfreund Daniel, der sie nicht loslassen kann und dem sie es trotzdem nicht abkauft, wenn er 'Ich liebe dich' sagt. Mit ihm erlebt sie richtig guten Sex, aber auch ein Wechselbad der Gefühle. Doch dann lernt sie Max kennen, der über ein ähnliches Thema promoviert und ganz anders als Daniel zu sein scheint: geradlinig und ohne Angst vor Bindung. Gemeinsam erleben sie glückliche Momente - vielleicht so etwas wie Liebe, mutmaßt Lou -, bis Max sich plötzlich von ihr abwendet. Zu allem Überfluss taucht auch noch Lous verschollener Vater auf, was ihr Gefühlschaos endgültig komplett macht, aber Lou findet ihren Weg. Eine junge Frau hat Flugzeuge im Bauch und sucht den Mann zum Abheben
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Katharina Silbermann
Fast wie fliegen
Roman
INHALT
Für meine Freundinnen Und für alle Jungs, die auf der Insel hocken (zieht eure T-Shirts aus)
»Der Flug ist das Leben wert.« Marga von Etzdorf (1907–1933), deutsche Fliegerin
Kapitel 1
»Pussi, Klit, Labien, von mir aus Fotze. Lieber Fotze als Vulva, aber bitte auf keinen Fall irgendein Wort, das mit Scham anfängt. Scham macht krank und vor allem hässlich.« Karsten
Meine Kommode mit den drei großen Spiegeln, das Bett und den Plattenspieler habe ich gleich heute aufgebaut. Alles andere liegt noch in den Umzugskisten oder steht irgendwo in der neuen Wohnung herum und wartet darauf, eingerichtet zu werden.
Ich weiß nicht, wieso Zofia und ich auf der langen Fahrt fast die ganze Zeit über Schamhaare und Schamhaarfrisuren geredet haben. Es fing damit an, dass Zofia von einem Friseur in Berlin erzählte, der sich auf Schamhaarfrisuren spezialisiert hat. Kaiserschnitt heißt dieser Friseur, er schneidet, rasiert und färbt sogar.
»Das heißt nicht Schamhaarfrisur, sondern Intimfrisur«, sagte Karsten, der bis dahin still hinterm Lenkrad gesessen und geraucht hatte. Wir saßen zu dritt auf dem engen Vordersitz des Umzugswagens. Vor uns tauchte endlich ein blaues Autobahnschild mit der Aufschrift Hannover auf. Von hinten konnte ich leise das schmiedeeiserne Gitter meines Betts scheppern hören. »Schamhaar, Schambein, Schamhügel, dieses ganze Geschäme ist doch zum Kotzen.«
»Ach ja? Was sagst du denn?«, fragte ich.
»Wozu?«, sagte Karsten, ohne den Blick von der Straße abzuwenden.
»Na, was sagst du für Vagina, Vulva, Klitoris, Schamlippen statt des ganzen antiseptisch klingenden Wortschatzes?«
»Pff. Also, Pussi, Klit, Labien, von mir aus Fotze. Lieber Fotze oder Vulva, aber bitte auf keinen Fall irgendein Wort, das mit Scham anfängt. Scham macht krank und vor allem hässlich«, antwortete Karsten.
»Stimmt«, sagte Zofia, küsste Karsten auf die Wange und zwinkerte mir zu. Ja, das wusste ich bereits, Karsten war ein aufgeklärter Vorzeigefreund, einer von denen, die das Wort Klitoris nicht nur aussprechen konnten, sondern zusätzlich dazu auch noch wussten, wo das Ding saß.
»Klitoris klingt besonders schlimm, finde ich«, sagte Zofia. »Klitoris klingt nach irgendeiner widerlichen Krankheit! Klitoris, Soriasis, Syphilis.«
»Klit find ich gut.Das klingt wie der Spitzname für ein Mädchen«, sagte ich.
»Stimmt«, ergänzte Zofia, »für ein Mädchen, das gern ein Junge wär. Und Vagina?«
»Vagina find ich okay.«
»Solange du keine Vagina dentata hast«, sagte Karsten.
»Eine was?«, fragte ich.
»Vagina dentata«, rief Zofia, »kennst du das nicht? Die Vagina dentata, das ist ein Mythos, der in fast allen Kulturen der Welt existiert. Angeblich soll es Frauen geben, die Zähne in der Vagina haben, kleine Zähne, die nebeneinander sitzen wie ein kleines Gebiss. Und diese Zähne können zubeißen. Das heißt, wenn ein Mann mit einer Frau schläft, die eine Vagina dentata hat, dann kann sie ihn kastrieren. Das tut sie aber nur, wenn der Typ ein Idiot ist. Denn die Vagina dentata weiß, wenn der Richtige da ist, und dann beißt sie natürlich auch nicht zu.«
»Den letzten Teil hast du dir ausgedacht«, sagte Karsten und grinste Zofia an.
»Ja, aber das ist doch die Konsequenz aus allem! Sonst macht die ganze Konstruktion mit den Zähnen doch gar keinen Sinn. Und außerdem, gesetzt den Fall, ich hätte eine Vagina dentata, dann sagt das doch ziemlich viel über dich aus, schon mal darüber nachgedacht?«, sagte Zofia und küsste Karsten zärtlich auf die Wange. »Aber vielleicht hat Lou eine Vagina dentata!«
Meine Vagina hat keine Zähne. Nein, ich habe eine stinknormale, rosa, zahnlose Vagina. Eigentlich ist vieles an mir stinknormal, rosa und zahnlos. Klar habe ich Zähne im Mund, aber ansonsten nirgendwo, soviel ich weiß. Dass ich jedenfalls keine Zähne zwischen den Beinen habe, weiß ich deswegen so genau, weil ich glaube, dass die mit Sicherheit schon das eine oder andere Mal zugebissen hätten. Außerdem weiß ich es, weil ich eine von denen bin, die sich zumindest schon einmal in ihrem Leben einen Spiegel zwischen die Beine gehalten hat. Auch sonst funktioniert an mir alles relativ normal. Meinen ersten Orgasmus hatte ich mit zehn Jahren, als meine Mutter bei der Krankengymnastik war, während ich im Wartezimmer saß, mich langweilte und mir ein Aufklärungsbuch für Kinder anschaute. Den Titel hab ich leider vergessen. Was ich aber nicht vergessen habe, ist, dass ich lange Zeit dachte, mit meinem ersten Orgasmus hätte ich etwas überirdisch Geheimes entdeckt. Ich war fest davon überzeugt, dass niemand sonst auf der Welt wusste, was man mit seiner Pussi alles anstellen konnte. Ich hatte das ja schließlich auch alles nur durch Zufall entdeckt. Wer macht sich denn schon die Mühe, ja, wer hat überhaupt die Zeit dafür, so lange an seiner Pussi herumzuspielen, bis man herausbekommt, dass das Ding explodieren kann, wenn man nur lange genug daran herumfummelt, dachte ich. Woran ich mich nicht mehr erinnern kann, ist, wie ich erfuhr, dass mein überirdisches Geheimnis überhaupt kein Geheimnis war. Es muss aber ähnlich enttäuschend gewesen sein, wie wenn man erfährt, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt.
Inzwischen gibt es glücklicherweise in meinem Leben aber auch noch andere Dinge, die mich beschäftigen. Zurzeit macht mir vor allem eins Sorgen: Ich muss nach Berlin ziehen, dabei hasse ich Berlin. Ich war nur ein paar Mal da, weil meine Mutter inzwischen dort lebt – so wie alle inzwischen in Berlin leben oder es gern täten. Von mir aus kann die ganze Republik nach Berlin ziehen, verschrottete Altbauwohnungen und Ofenheizungen mögen, Dreck geil finden, die ganze Nacht Technomusik hören und viel zu große Brillen tragen, dachte ich bis vor Kurzem. Jetzt wohne ich selbst in einer Altbauwohnung mit hohen Decken und Ofen. Das hat mit der Doktorandenstelle zu tun, die ich hier bekommen habe. Was wiederum gut ist, glaube ich. Und dass ich jetzt in derselben Stadt lebe wie Zofia, das ist natürlich auch gut. Denn Zofia ist meine beste Freundin.
Als alle Möbel und Kisten in der Wohnung waren und Zofia und Karsten sich verabschiedet hatten, um den Umzugswagen wegzubringen, fuhr ich mit der U-Bahn nach Mitte zum Friseur und ließ mir die Haare schneiden. Zum U-Bahnhof musste ich gar nicht weit laufen und außerdem über schönes Kopfsteinpflaster und an alten Häusern und Bäumen vorbei. Der U-Bahnhof selber ist herrlich abgeranzt. Das riesige Emailleschild, das an der Wand gegenüber dem Bahnsteig befestigt ist, sieht aus, als hätte sich ein Ungeheuer aus der Unterwelt – möglicherweise eine Art urbanes Äquivalent zu Loch Ness – nach einer durchzechten Nacht daran vergriffen und seine überdimensionale Notdurft genau über dem Schild verrichtet. Frequentiert wird der Bahnsteig hauptsächlich von Alkoholikern, ungesund aussehenden Studenten, Künstlertypen oder von Leuten mit einer ordentlichen Kifferpsychose.
Aber ich weiß nicht wieso, irgendwie roch es auf dem Bahnsteig gut. Es roch nach dem Duft, der die ganze Stadt überzieht: Kohle, Ruß, Winterluft, Gebackenes. Noch waren die Bäume am Straßenrand kahl und warteten im Halbschlaf auf den Frühling. Es war noch sehr kalt an diesem späten Nachmittag und der Wind blies kräftig, also trieb ich mich nach dem Friseurbesuch nicht lange herum, sondern fuhr zurück nach Hause. Auf dem Weg kaufte ich mir einen Jägermeister und eine Zeitung. Ich musste mir immer wieder mit den Händen durch die frisch geschnittenen Haare fahren. Außerdem fragte ich mich, was Daniel wohl zu der neuen Frisur sagen würde und was er wohl gerade machte. Es war ein komisches Gefühl zu wissen, dass er auch gerade irgendwo in dieser Stadt unterwegs war. Dabei war ich doch gerade erst noch so froh gewesen, als ich gehört hatte, dass er auch umgezogen sei. Wieder einer, den die Hauptstadt verschlucken würde. Und wenn ich das jemandem wünschte, dann Daniel!
Zu Hause angekommen, las ich Zeitung, trank Jägermeister und aß dazu die gebrannten Mandeln, die ich mir an der Autobahnraststätte in Hannover gekauft hatte. Ich legte eine Platte auf und setzte mich vor meine Kommode. Karsten hatte seine Zigaretten vergessen, sie lagen verloren auf der Ablage herum. Eigentlich rauche ich nicht mehr, aber neben den Zigaretten lag mein Lippenstift und der Geschmack von Lippenstift und Zigarettenrauch ist einfach einmalig. Langsam inhalierte ich den scharfen Tabakrauch. Mein Plattenspieler knisterte mit der Zigarettenglut um die Wette und Alexis, die Sängerin meiner Lieblingsband Andante, sang dazu.
Manchmal glaube ich, dass ich unsterblich in Alexis verliebt bin und dass ich vielleicht gar nicht auf Männer stehe, sondern auf Frauen. Dabei ist das gar nicht so. Lesbischer Sex – ich weiß nicht. Lesbe, ich bin eine Lesbe. Schon allein dieses Wort mag ich nicht. Dann dieses Liebliche, dieses weibliche Vanillefeeling, weiche rosige Haut, unter der die Östrogene lauern und auf den nächsten Eisprung warten, dieser Geschmack von Kuchen und Schokolade, von diesem schlechten süßen Wein, den viele Frauen immer so gern trinken – Mädchentraube, nein. Ich mag keine Süßigkeiten, ich mag Bier und Chips und Erdnüsse, ich mag Salziges, Salzwassergeschmack und Tannenharzgeruch. Aber bei Alexis ist das anders. Sie ist keine Vanillelesbe, die Süßes in sich reinstopft, wenn sie sich zu dick fühlt, menstruiert oder wegen sonst was frustriert ist. Ich kann mich noch gut an meine erste Begegnung mit ihr erinnern. Es war auch das erste Mal, dass Daniel und ich allein unterwegs waren, es kam mir vor wie ein erstes Rendezvous, obwohl wir ja schon seit Wochen Sex miteinander hatten und uns regelmäßig trafen. Woran ich mich noch erinnere, ist, dass ich todmüde war, weil ich den ganzen Nachmittag im Institutskolloquium gesessen und mich mit dämlichen Bachelorarbeitsthemen herumgeschlagen hatte und dass ich deswegen nach einem Drink schon völlig angesäuselt war. Vielleicht lag es aber auch an dem ganzen Abend, der so völlig verzaubert war, dass ich das Gefühl hatte, jemand hätte mir was ins Getränk getan.
Der schäbige Club, den Andante sich damals für ihren Auftritt ausgesucht hatten, hieß Lady Hamilton. Dunkelrote Samtvorhänge, kleine goldene Lämpchen auf den Tischen, eine fast bis zum Boden hängende Stuckdecke und eine winzig kleine Bühne. Daniel und ich tranken Wodka-Longdrinks und hielten Händchen. Ich glaube, es war der einzige Abend, an dem Daniel mir immer und immer wieder in die Augen schaute. Wenn ich heute an Daniel denke, dann sehe ich ihn im Geiste eigentlich immer nur von der Seite, ich kann seine langen Wimpern erkennen, weil seine Augen abgewandt sind, abgewandt, woanders, ich weiß nicht wo, irgendwo anders eben.
Es war schon sehr spät, als Andante anfingen zu spielen. Alexis trug ein dunkelblaues, mit Glitzerpaillettenbesetztes Kleid, ihre langen Haare fielen ihr über die Schultern. Tiago, der Gitarrist, stöpselte sein Instrument ein, die Show begann. Alexis schlug einen Akkord auf ihrem Keyboard an, die Bühne versank im roten Scheinwerferlicht. Gleichzeitig ging eine Nebelmaschine an, der Nebel bewegte sich langsam von der Bühne in den Zuschauerraum hinunter. Wir standen in einer versteckten dunklen Ecke, gleich neben den großen Lautsprechern an der Bühne. Plötzlich fiel mir auf, wie warm es in dem kleinen niedrigen Raum inzwischen geworden war, ich sah auf die Bühne zu Alexis und ich weiß noch, dass ich mich in diesem Moment fragte, wie sie es wohl macht, die Haare bei der Hitze offen zu lassen.
Und dann spürte ich Daniels kühle Hände an meinen Schultern. Sie streichelten meinen Nacken, ich bekam eine Gänsehaut. Er beugte sich zu mir herunter, küsste mich aufs Ohr und am Hals und drückte mein Becken gegen seins. Ich konnte an meinem Hintern seine Erektion spüren. Alexis sang wie eine Meerjungfrau und ihr Keyboard hörte sich an wie ein Nebelhorn. Ich bemerkte zunächst kaum, dass Daniel langsam den Reißverschluss meines Kleides öffnete. Er achtete darauf, dass die Ärmel mir nicht von den Schultern rutschten. Ich hörte die Eiswürfel in seinem Drink klirren, als er das Glas zum Mund führte, und dann spürte ich die Kälte des Eiswürfels an meinem Nacken. Der Eiswürfel verschwand wieder im Glas und Daniels Hände glitten über meine Schulterblätter zu meinen Brüsten.
Zum ersten Mal schaute ich den Gitarristen Tiago an, der gleich neben Alexis stand. Ich konnte nur seinen Oberkörper sehen und seine Gitarre, der Rest verschwand hinter dem Lautsprecher. Er hatte dickes dunkles Haar, das ich mir weich vorstellte, dunkle Augen und blasse Haut. Kaum spürbar war Daniel an meinem Po angelangt.
Er beugte sich zu mir und flüsterte: »Ich werde jetzt anklopfen und du wirst mich hoffentlich reinlassen.«
Er strich sanft bis zu meinem anschwellenden Venushügel und legte einen Finger auf den Eingang meiner Vagina. Mit einem Finger glitt er sanft in sie hinein, mit dem anderen begann er auf meiner Klit zu klopfen wie ein Telegraf. Aus Spaß hatten Daniel und ich uns gegenseitig das Morsealphabet beigebracht, daher konnte ich entschlüsseln, was Daniel auf meiner Pussi morste, und er wusste, dass ich es verstand. Ich weiß noch genau, was es war: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Nach jedem Wort machte er eine kurze Pause, meine Beine zitterten, ich wurde immer atemloser. Es dauerte entsprechend lange, bis ich kam, aber das war mit Sicherheit auch Daniels Absicht. Ich erinnere mich, dass Alexis mir genau in die Augen sah, so als wüsste sie, was Daniel und ich da taten. Und in ihren Augen glaubte ich zu erkennen, dass sie gern mitgemacht hätte, zumindest bildete ich mir das ein. Wichtig ist jedoch, dass ich es mir gewünscht hätte, dass ich sie gern hätte mitmachen lassen.
Das alles kam mir so wahnsinnig lange her vor und Daniel, der war so weit weg wie nie zuvor. Und jetzt? Jetzt lebte ich doch in derselben Stadt wie er. Dabei war ich noch vor einigen Monaten so erleichtert gewesen, als er wegzog. Daniel kann zwar mehr als virtuos auf Pussis morsen, aber verlieben darf man sich in ihn nicht. Daran dachte ich, als ich in meiner neuen Wohnung vor meiner Kommode mit den drei Spiegeln saß.
Plötzlich klingelte mein Telefon, es war Mama mit der obligatorischen Frage, ob ich gut angekommen sei. Sie teilte mir mit, dass sie in nächster Zeit leider nicht in Berlin sein würde. Es klang wie eine Entschuldigung, dabei ist sie sowieso selten hier, weil sie fast ausschließlich für die Redaktion in Bonn arbeitet. Sie hat mir aber schöne Vorhänge geschenkt, die sich in meinem Wohnzimmer wunderbar machen werden. Lang, weiß, Mama meinte, dass – auch wenn man nackt ist – von draußen nur die Silhouette zu erkennen ist. Mir kann eh niemand ins Fenster schauen, denn meiner Wohnung gegenüber erstreckt sich das weite Tempelhofer Feld, das ehemalige Flughafengelände. In der Dunkelheit kann man leider nur wenig erkennen. Aber ganz weit in der Ferne, am anderen Ende des Feldes, blitzen kleine Lichter, dort, wo das ehemalige Flughafengebäude steht.
Der Raum mit der Sicht auf den Flughafen soll mein Schlafzimmer werden. Da kommen die weißen Vorhänge dran, dort stehen meine Kommode und der Plattenspieler. Das Zimmer mit dem Fenster zum Hof wird mein Arbeits- und Wohnzimmer. Die Küche ist so geräumig, dass ein großer Esstisch hineinpasst. Ich bin froh, dass ich die Vermieterin dazu überreden konnte, die Küchenhexe und die alten Armaturen im Bad nicht herauszureißen.
Ich vermisse Daniel. Ich merke, dass ich ihm so gern die Wohnung zeigen würde, so gern würde ich sein Gesicht sehen, so gern seinen Hintern anfassen und mich ein bisschen mit ihm betrinken. Die Vorstellung, dass er jetzt irgendwo ganz in meiner Nähe in dieser Stadt auf seiner Matratze liegt, in einem der vielen Kinos hockt, an seinem Fahrrad herumbastelt oder in einem Café sitzt und liest, macht mich furchtbar nervös. Jetzt ist es schon drei Monate her, dass ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Aber ich habe Zofia Stein und Bein geschworen, dass ich ihn nicht anrufen werde.
»Das bringt doch nichts!«, hat Zofia gesagt. Überhaupt scheint das Zofias Lieblingssatz zu sein. Sie weiß immer, wann etwas was bringt und wann nicht. Manchmal wünsche ich, ich wäre so abgeklärt und aufgeräumt wie sie. Wir kennen uns schon lange, seit der Zeit, als Zofia in den Achtzigern aus Kattowitz nach Deutschland gekommen ist. Mama hat damals eine Sendung fürs Radio gemacht, über Zofias Familie. Ich war noch sehr klein, aber ich kann mich erinnern, dass Mama mich in die leerstehende Schule mitnahm, in der Zofia, ihre Eltern und ihr kleiner Bruder lebten. Genau genommen wohnten sie im Mädchenumkleideraum der alten, asbestverseuchten Sporthalle. Mama war damals noch eine ambitionierte Journalistin, die daran glaubte, dass man mit Schreiben die Welt verändern kann. Damals war es ihr noch egal, dass überall an ihrer Kleidung Katzenhaare klebten. Und als die Grünen ins Parlament gewählt wurden, da zerrte sie mich mitten in der Nacht aus dem Bett und ich durfte an ihrem Bier nippen. Heute gehört sie zu diesen Leuten, die mindestens einmal im Jahr in die Toskana fahren müssen und ständig »Ich liebe Pasta!« sagen.
Zofia und ich sind immer noch befreundet, obwohl wir unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie fällt beispielsweise nie auf komische Typen rein, das war schon in der Schule so. Jahrelang hat Zofia mit René Schmeyer auf dem Schulhof Händchen gehalten, bis sie merkte, dass sie nicht mit jemandem ihr Leben verbringen will, der irgendwann einmal die Tankstelle seines Vaters übernehmen würde. Gleich nach dem Abi ging sie nach Berlin, studierte Sozialpädagogik und lernte Karsten kennen, mit dem sie noch heute zusammen ist. Zofia ist eben wahnsinnig vernünftig.
Ich habe in der gleichen Zeit mindestens zwei Dutzend Jungs verschlissen und auch mal das eine oder andere Herz gebrochen. Bis schließlich Daniel kam, der mir mein Herz gebrochen hat. Dabei sieht Daniel noch nicht einmal besonders gut aus, auch nicht schlecht, eben normal. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich bisher damit verbracht habe, darüber nachzudenken, was es ist, das mich so an ihn bindet. Vielleicht, weil Daniel mich immer mit der besten Musik der Welt versorgt hat, vielleicht, weil es so seltsam ist, dass er einen grünen Daumen hat und seine Zimmerpflanzen zum Blühen bringt, obwohl seine sozialen Kontakte so welk sind, und vielleicht auch, weil er der Pfadfinder aller guten Bücher und Filme ist und dies so gar nicht angeberisch vor sich her trägt. Und sicherlich auch deswegen, weil wir wirklich guten Sex hatten.
Zofia hat Daniel nie wirklich gemocht.
»Das ist doch überhaupt kein richtiger Mann«, hat sie immer gesagt. Ich weiß aber gar nicht, was das bedeuten soll. Was ist das denn überhaupt, ein »richtiger« Mann? Keine Ahnung, aber es kann schon sein, dass Daniel das nicht ist. Jedenfalls bin ich froh, dass Zofia und Karsten auch hier in Berlin sind. Und außerdem kann es mir egal sein, was Zofia von Daniel denkt, denn den sehe ich ja sowieso wahrscheinlich, hoffentlich, sicherlich, eh nie wieder.
Kapitel 2
»Jede Entscheidung ist Verneinung.« Baruch Spinoza
Mein Kommodenspiegel besteht aus einem großen Hauptspiegel und zwei schmalen beweglichen Seitenspiegeln. Daniel hat immer gesagt, dass diese Spiegel aussehen wie das Triptychon eines Flügelaltars. Und tatsächlich besitzt meine Kommode eine fast schon religiöse Funktion. Davor kann ich am besten innehalten und Gedanken sortieren. Während ich mich im Spiegel betrachte, kann ich gut nachdenken. Wenn ich vor meiner Kommode sitze und mich anschaue, dann bin ich selbst das Gemälde, das man sonst auf Triptychen sieht – eine Madonna oder eine dieser heiligen Frauen, die auf alten Bildern immer in Weiß gekleidet sind und meistens einen Heiligenschein haben. Diese perfekten rosa Brüste, die unter dem weißen Stoff hervorlugen. Nur sieht mein Spiegelbild nicht so glatt aus wie das der rosa Frauen, dafür habe ich zu viele Sommersprossen und dafür sind meine Haare zu dunkel und zerzaust. Diese mittelalterlichen Schönheiten sind ja doch meistens blond.
Heute bin ich mitten in der Nacht wach geworden und konnte nicht mehr einschlafen, also setzte ich mich vor meine Kommode und versuchte, wieder müde zu werden. Als das nicht half, hängte ich die Vorhänge auf und öffnete anschließend die Fenster. Es sah so hübsch aus, wie die kühle Frühlingsluft den dünnen Stoff bauschte. Ich löschte das Licht, zog die Vorhänge zur Seite und blickte auf das riesige Flughafenfeld. Stockdunkel und still lag es vor mir. Ganz weit in der Ferne, am anderen Ende des Feldes, konnte ich die Umrisse des ehemaligen Flughafengebäudes erkennen. Ab und zu blitzten kleine Lichter am Tower auf. Er blinkte wie ein ausrangierter Leuchtturm, so, als habe er sich noch nicht daran gewöhnt, dass ihn keine Flugzeuge mehr anflogen. Ein in Zwangsrente geschickter Kapitän. Ich kramte die Kisten mit den Uni-Unterlagen hervor und begann, den Schreibtisch aufzubauen. Ganz unten in der Kiste fand ich meine alte Stiftebox, ein rot-schwarzes Ding aus Plastik, das einst in meiner Schultüte gesteckt hatte und heute – übersät mit Aufklebern von Mein kleines Pony bis zu Oasis, den Schlaglichtern meines Lebens – immer noch auf meinem Schreibtisch stand. Und während ich meine Bleistifte anspitzte, bis sie ohne Weiteres als Mordwaffen hätten durchgehen können, überlegte ich mir, was eigentlich wäre, wenn ich im letzten Moment alles hinschmeißen würde. Vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, wegen einer dieser Stresskrankheiten: Borderline, Burnout, Bulimie, wegen Schwangerschaft, am besten gleich mit Drillingen. Zumindest die Bundesregierung wäre stolz auf mich, denn junge, gebildete Frauen bekommen ja angeblich viel zu wenige Kinder.
Drei Jahre sind eine lange Zeit, aber nicht für jemanden, der weiterhin ausschlafen, trinken, tanzen und faulenzen will. Ich bin wie die zwar wunderschöne, aber eigentlich total durchgedrehte Holly Golightly aus Frühstück bei Tiffany, mir fehlt nur noch ein gescheiterter Schriftsteller als Liebhaber und ein Knastbruder in Tegel. Einer, den ich einmal die Woche besuche und der mir für den regelmäßigen Wetterbericht à la »Schneeverwehungen über Neukölln« ein ordentliches Geldbündel zusteckt. Zugegeben, so schön wie Holly Golightly bin ich lange nicht. Sie sieht im Film aber auch nur deshalb so gut aus, weil Göttin Audrey Hepburn sie verkörpert. In Truman Capotes Originalvorlage hat Holly Golightly ein ungefähr so schräges Gesicht wie ich. Allerdings haben meine Augen die Farbe von Audrey Hepburn, und immerhin ähnelt mein Mund nicht »den Lippen eines Clowns«. So schlimm steht es dann doch wieder nicht um mich.
Mit der Uni und mir ist es ein bisschen so wie in einer langweiligen Beziehung, in der man aber schon zu lange steckt, um noch den Absprung zu schaffen. Man hat sich eingerichtet und es sich irgendwie gemütlich gemacht. Man hat sich zwar nichts mehr zu sagen, aber aus Angst davor, keinen mehr abzukriegen, oder weil man es sich nicht eingestehen will, mit was für einem Langweiler man die besten Jahre seines Lebens verschwendet hat, lässt man lieber alles weiterplätschern wie bisher. Wenn man sich jedoch umschaut, merkt man, dass das Leben der anderen auch nicht viel aufregender ist. Ich zitiere an dieser Stelle immer gern Karl Lagerfeld, der seinerseits immer gern Baruch Spinoza zitiert: »Jede Entscheidung ist Verneinung«.
Nachdem ich vom Möbelrücken müde geworden war und der Philosoph in mir endlich aufgehört hatte zu philosophieren, legte ich mich wieder auf meine Matratze und schlief traumlos ein. Bis ich am Morgen von einem lauten Klopfen an meiner Tür geweckt wurde. Schlaftrunken tappte ich durch den Flur. Eigentlich mache ich nie die Tür auf, wenn ich keinen Besuch erwarte. Einfach klingeln, so etwas Unhöfliches gibt es nur bei den Zeugen Jehovas, der GEZ oder irgendwelchen Rotkreuzdeppen. Die folgende Begegnung lehrte mich jedoch, dass in Berlin noch eine vierte Spezies existiert, vor der man sich in Acht nehmen muss: der preußische Blockwart aus dem Erdgeschoss.
Der Mensch, der vor mir stand, roch nach Hochprozentigem. Auf dem Arm hatte er einen winzigen Hund mit verklebten Augen, stumpfem Fell und Unterkieferüberbiss.
»Sach mal, dir hamse wohl mit’m Klammerbeutel jepudert!«, schrie der Blockwart los. »Jeht’s noch oder wat? Wenne Hummeln im Arsch hast, dann jeh raus, den Mond anjaulen oder wat, aber hier is nischt mit Möbeljerucke nachts!«
Ich war sprachlos.
»Ooch Türkin oder wat? Du deutsch oda wie?«
»Ja, ich sehr gut deutsch, danke.«
»Na, ick dacht nur wegen die dunkle Haare. Kinder hamse aber keene, wa?«
Neugierig stierte er mich durch seine dicken Brillengläser an. Ich musste an eine Schlagzeile denken, die ich auf dem Weg zum Friseur auf einem dieser U-Bahn-Fernseher gelesen hatte: Das Max-Planck-Institut in Leipzig hat vor einiger Zeit in der Denisova-Höhle in Südsibirien Knochen einer unbekannten Menschenart entdeckt. Könnte es etwa sein, dass die Kreatur, die da vor mir stand, von ebenjener Menschenart abstammte?
»Ich bin gestern erst eingezogen und da habe ich ein bisschen angefangen aufzuräumen. Tut mir leid, wenn ich Sie geweckt hab«, sagte ich.
»Aufräumen, du bist jut. Dit sind meene Nerven, uff denen du rumtrampelst. Also dit passiert nich noch ma, is det klar?«
»Ja, das habe ich jetzt verstanden, es tut mir auch wirklich leid. Aber Sie müssen ja trotzdem nicht gleich so lospoltern.«
»Wat?«
»Ich meine, es geht ja auch ein bisschen freundlicher, bitte schön.«
»Pass ma uff, wann ick freundlich bin, dit hat ma keene halbstarke Jöre zu sag’n. Ooch von ’ne Deutsche lass ick mir det nich sag’n. Dit hört jetzt uff mit den Sperenzchen. Dit war’s, basta!«
Nach dieser warmen Begegnung verspürte ich das dringende Bedürfnis, die Wohnung zu verlassen. Ich zog mich an, schmiss mich in die U-Bahn und fuhr zur Friedrichstraße, meinem neuen akademischen Quartier. Im Immatrikulationsbüro erhielt ich einen Studentenausweis, obwohl ich ja gar keine Studentin mehr bin.
»Trotzdem, det is hier so. Det jilt ooch für die Doktoranden. Müssense einjeschrieben sein, fertig.«
Die Dame, die mir die Formulare aushändigte, nach meinem Geburtsdatum und meiner Adresse fragte und mich schließlich bat, hier und dort zu unterschreiben, schrie zumindest nicht. In der Mensa Unter den Linden probierte ich das Essen, es schmeckte fürchterlich. Danach machte ich einen Abstecher zur Bibliothek. Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum stand über dem grauen Gebäude, das die Bibliothek beherbergte. Ich war todmüde und außerdem war mir schlecht, das zerkochte Kaisergemüse lag mir schwer im Magen, obwohl ich meinen Teller noch nicht einmal leer gegessen hatte. Vor der Bibliothek nahm ich auf einer der unbequemen Holzbänke Platz und wartete darauf, dass ich kotzen müsste. Ich versuchte, tief durchzuatmen, dann stand ich langsam wieder auf. Ein hübscher Kerl mit dunklen Locken schaute verstohlen zu mir herüber, während er sein verklappertes Fahrrad abschloss.
»Kannst du mir vielleicht sagen, wo die Toiletten sind?«
»Einfach durch die Drehtür und dann links die Treppe runter. Ist alles in Ordnung?«, sagte der Lockenkopf. Er sah ein bisschen besorgt aus.
»Ja, danke«, antwortet ich und lief los, so schnell ich konnte.
Glücklicherweise war die Toilette vollkommen leer. Ich lehnte meinen Kopf gegen die kühlen Kacheln und trank anschließend einen Schluck Wasser. Die Übelkeit verschwand langsam, ich schaute in den Spiegel und stellte fest, dass ich ganz schön fertig aussah. Als ich wieder vor die Bibliothek trat, bemerkte ich, dass der Lockenkopf immer noch an seinem Fahrrad stand. An irgendwen erinnerte er mich. Es dauerte eine Weile, bis ich darauf kam. Richtig, der Hinzel. Er erinnerte mich an den Hinzel! Das war der erste Mann in meinem Leben. Als ich zwölf war, war ich in Hinzel unsterblich verliebt. Das einzige Problem war, dass es den Hinzel gar nicht gab, er ist nämlich eine Figur aus einem Buch. Ich weiß noch, dass ich schwer davon beeindruckt war, dass der Hinzel einen Kohlweißling auf die Wange tätowiert hatte. Vielleicht waren es die Locken, vielleicht die langen Beine, vielleicht war es aber auch die blasse Haut, auf der ich mir den Kohlweißling besonders gut vorstellen konnte, jedenfalls erinnerte der hübsche Lockenkopf an den Hinzel und das war irgendwie schön. Er schaute noch mal zu mir herüber und einen kurzen Moment dachte ich, dass er mich ansprechen würde, doch dann verschwand er hinter der Drehtür in der Bibliothek.
Ich wurde dann aber auch abgelenkt von einem, der auf den ersten Blick aussah wie Daniel. Überhaupt hatte ich den ganzen Tag ständig das Gefühl, Daniel zu sehen. Er war es natürlich nie, immer nur eine Fata Morgana.
Über mir ratterte die S-Bahn von Ost nach West und wieder zurück, unermüdlich. Der S-Bahn kann alles egal sein, dachte ich, die ist aus Metall, niemand kann ihr was anhaben, nur ein Terroranschlag oder so. Ich sehnte mich mit einem Mal schrecklich nach Daniel. Ich suchte seine Nummer in meinem Telefonbuch, nur um seinen Namen auf dem Display zu sehen, um kurz das Gefühl zu verspüren, wie es war, als er mich noch regelmäßig anrief, als es noch gar nichts Besonderes war, seinen Namen auf dem Display zu sehen. Traurig saß ich vor der Bibliothek herum. Ich rief Zofia an, aber die ging nicht ran. Nachdem ich ihr auf den Anrufbeantworter gesprochen hatte, trottete ich zurück zur U-Bahn.
Der Untergrund spuckte mich an der Boddinstraße wieder aus und ich beschloss, noch ein wenig spazieren zu gehen. In einer der türkischen Bäckereien holte ich mir einen starken Tee und überzeugte mich davon, dass es durchaus auch freundliche Bewohner in meiner Nachbarschaft gab. Es regnete leicht, während ich am Flughafengelände entlangspazierte. Ich rauchte Karstens letzte Zigarette und blickte durch die kleinen viereckigen Gitterverschlingungen der Umzäunung. In der Ferne konnte ich einen Fuchs entdecken. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass sich auf dem Flughafengelände seltene Tiere angesiedelt haben. Tiere, von denen man dachte, dass sie schon lange ausgestorben sind. Vielleicht bin ich ja auch so ein Tier, das sich am Flughafen angesiedelt hat. Wahrscheinlich bin ich aber eher seltsam als selten.
Daniel ist jedenfalls kein ausgestorbenes Tier, sondern irgendwas ganz Gewöhnliches, Lästiges. Ein Ohrwurm. Der gemeine Ohrwurm ist nachts aktiv und verbirgt sich tagsüber, er verfügt über eine Zange am Hinterteil, um sich zu verteidigen. Außerdem kriechen Ohrwürmer in anderer Leute Ohren herum und kneifen ihnen ins Trommelfell – das dachte ich zumindest als Kind. In Wirklichkeit sind Ohrwürmer für den Menschen wohl eher harmlos, aber aus meiner Erfahrung mit Daniel würde ich Ohrwürmer trotzdem nicht unterschätzen.
Bei Zofia ist das schon einfacher, die ist auf jeden Fall was Nützliches. Aber keine Spinne. Vielleicht eher eine Pflanze, ein Brombeerbusch, an dem man sich satt essen kann, der überall wächst, was sehr Robustes, das aber auch kratzen kann. Und Karsten? Karsten ist Beifuß: Stängel aufrecht, Blütenkörbchen klein, häufig zu finden, vor allem an feuchten Wegrändern und Schuttstellen. Mama ist mal anhänglich wie Klebkraut und dann wieder selten wie eine Nachtigall.
Und ich? Ich bin der Weinschwärmer. Der Weinschwärmer ist ein Falter, einer bei dem es nicht so ganz zum Schmetterling gereicht hat – zumindest nicht in diesem Leben. Diese tragischen Tierchen, die sich vom elektrischen Licht blenden lassen, flattern ungebeten in fremde Wohnungen, aus denen sie nie wieder herausfinden. Nie wissen sie, wohin mit sich, sie scheinen keine Orientierung zu haben, außer dass sie auf das tödliche Licht zuflattern. Man schlägt sie nicht tot, weil sie dazu zu bemitleidenswert sind. Das ist auch gar nicht nötig, denn beim Frühjahrsputz stößt man hinter der Heizung von ganz allein auf die toten Falter des vergangenen Sommers. Der Weinschwärmer sieht für einen Falter jedoch zumindest halbwegs hübsch aus. Er ist olivgrün mit einem gesprenkelten pinken Muster auf den Flügeln. An Sommerabenden fliegt der Weinschwärmer zwischen stark duftenden Blumen umher. Er kommt nicht häufig vor und wenn, findet er sich an Schuttplätzen und wüsten Stellen. Für die kommende Zeit nehme ich mir unbedingt vor: fernhalten von gemeinen Ohrwürmern und stattdessen nützliche Stadtpflanzen ausfindig machen. Viele Brombeeren essen. Schluss mit dem Schwärmen an wüsten Stellen.
Kapitel 3
»Ich geh jetzt. Kommst du mit?« Daniel
Jetzt bin ich schon ein paar Wochen hier, aber meine Vorsätze, mich nicht an wüsten Stellen herumzutreiben, sind ordentlich nach hinten losgegangen. Wo soll ich nur anfangen? Es begann alles damit, dass vor einigen Tagen in aller Herrgottsfrühe mein Telefon piepste. Als ich die Nachricht öffnete, stand da:
Bist du tatsächlich in Berlin?
Daniel. Ich hatte seit Monaten nichts von ihm gehört, er musste irgendwie von meinem Umzug erfahren haben. Ich schaute auf die Uhr, es war fünf Uhr morgens. Wahrscheinlich hockte er betrunken und deprimiert in irgendeinem Club auf dem Klo. Wieso musste er in diesen Momenten immer an mich denken? Was hatte ich mit dieser Erbärmlichkeit zu tun, wieso hatte ausgerechnet ich die Ehre, in Daniels Gemüt gleich neben dieser Verliererverzweiflung zu residieren?, dachte ich. Für Daniel war ich wohl so etwas wie eine Malteser-Schwester, die einen Dauerbereitschaftsdienst für ihn eingerichtete hatte, diese permanente letzte Retterin, in deren Arme er sich werfen konnte, kurz bevor sein Seelenschiff mal wieder kenterte.
Erst jetzt sah ich, dass er kurz zuvor schon mal angerufen und mir etwas auf den Anrufbeantworter gesprochen hatte. Ich konnte mir schon denken was. Irgendwas wie, dass er den neuen Roman von David Foster Wallace fertig gelesen habe, dass der ganz toll sei, aber dass er den eigentlich nicht hätte lesen dürfen, weil er jetzt Angst habe, sich auch bald umbringen zu müssen, weil er das so gut verstehen könnte, was der da schreibt. Ich hasse diesen armseligen Scheiß, aber gleichzeitig tut Daniel mir so leid, weil – ja, warum eigentlich? Jedenfalls lässt es mich immer wieder weich werden und irgendein Teil in mir versteht diesen ganzen Blödsinn, den er in solchen Momenten verzapft. Das macht mir, ehrlich gesagt, ein bisschen Sorgen.
Auf dem Anrufbeantworter war nichts außer dumpfem Techno-Beat zu hören. Ich hasse Techno, ich kann verstehen, dass die Leute darauf nur tanzen können, wenn sie irgendwelche Pillen eingeschmissen haben. Eine Weile lauschte ich einfach in mein Telefon hinein und stellte mir vor, dass der stampfende Rhythmus Daniels Herzschlag sei, ein verzweifeltes Herz musste das sein. Ich legte auf, drehte mich auf die andere Seite und versuchte, wieder einzuschlafen. Ich kannte das Theater schon aus Köln und hatte keine Lust, dieses erbärmliche Stück noch mal in mein Repertoire aufzunehmen. Von einem Tag auf den anderen war er verschwunden, nachdem er wochenlang bei mir gewohnt hatte. Dann rief er wieder mitten in der Nacht an und wimmerte, wie sehr er mich vermissen würde, um dann wieder für Wochen unterzutauchen.
Glücklicherweise schlief ich schnell wieder ein. Am nächsten Morgen hatte ich die Angelegenheit schon fast wieder vergessen. Ich kochte mir eine große Kanne Tee und setzte mich auf die Fensterbank. In meinem Hinterhof steht eine große Kastanie und ich hatte in den letzten Tagen beobachten können, wie die Knospen an den Zweigen immer dicker wurden. Bald würden die Blätter anfangen zu wachsen. Ich nahm einen großen Schluck Tee und dachte an Daniels Nachricht. Was fiel ihm nur ein? Als ich zum Telefon griff, um Zofias Nummer zu wählen, piepste es plötzlich.
Bitte sei nicht bös und antworte mir.
Daniel. Ich musste schlucken, mein Herz klopfte, meine Hände prickelten. Siegerstimmung. Alles in mir wurde stahlhart und butterweich zugleich. Hastig tippte ich zurück:
– Ja, ich bin in Berlin.
Das musste reichen.
– Geht es auch ein bisschen detaillierter?
– Am Flughafen. Doktorarbeit.
– Sexy, piepste es zurück. Und kurz darauf:
– Fährst du mit mir in den Plänterwald? Ich muss dir was zeigen, das wirst du lieben. Ich komm dich abholen.
Gut. Ich war also schon mittendrin, jetzt konnte ich auch nichts mehr ändern. Und es fühlte sich so gut an, von Daniel zu hören. Wer weiß, vielleicht können wir ja Freunde werden, dachte ich. Wer weiß, vielleicht würde ich ihn sehen und gar nichts mehr an ihm finden. Es war ja jetzt schon vier Monate her. Irgendwann muss ich ihn ja mal wiedersehen. Man könnte das Ganze ja auch als Teil eines Ichweißnichtwas betrachten, die erste normale Begegnung könnte ja vielleicht auch therapeutisch auf mich wirken. Erst nach dieser Begegnung würde ich vollkommen mit Daniel abschließen können. Odersoähnlich. Dachte ich. Wobei ich vermutlich gar nicht so viel dachte, denn schneller, als ich denken konnte, tippte ich meine Adresse ins Telefon und drückte auf »Senden«.
Ich hatte kaum Zeit zu verarbeiten, was eigentlich gerade geschehen war, geschweige denn, mir mal sachte an die Stirn zu tippen oder im Geiste Zofia auftreten zu lassen, die mich wütend fragen würde, ob ich eigentlich noch alle Tassen im Schrank hätte. Als es eine Viertelstunde später läutete, stand ich immer noch wie ein Mahnmal in der Küche und hielt meine kalt gewordene Teetasse in den Händen – ich hatte mich noch nicht einmal angezogen. Ich rannte ins Wohnzimmer. Über dem Stuhl neben der Staffelei hing ein altes Männerhemd, das ich zum Malen benutzte. Schnell zog ich es über und lief zur Gegensprechanlage.
»Hallo?«
Keine Antwort. Das war Daniel, klar. Manchmal glaube ich, dass er was an den Ohren hat, er antwortet nie, wenn man durch eine Gegensprechanlage mit ihm spricht.
»Vorderhaus, drittes Stockwerk«, sagte ich, hängte ein und öffnete die Tür. Ich konnte hören, wie sie aufschnappte, jetzt stand Daniel in meinem Erdgeschoss. Weit entfernt hörte ich Schritte. Leise Turnschuhgummisohlenschritte, unauffällige Schritte, die sich höflich vorbeischleichen konnten. Schritte, die sich vordrängelten, ohne dabei unverschämt zu wirken, Schritte, die nie jemandem auf den Fuß traten, Schritte, die begleitet wurden von Händen, die sich sanft auf Schultern legten und diese freundlich, aber eindringlich beiseite schoben. Hände, die – drehte man sich ungläubig nach ihnen um – von einem betäubend charmanten Blick flankiert wurden, von diesem Blick, der an Robin Hood erinnerte, wenn er den reichen Frauen die teuren Ringe von den Fingern zieht und sagt, eine Frau von ihrer Schönheit braucht solchen Schmuck nicht. Mit diesem Blick, der einen selber immer so dumm ausschauen lässt, so schaut Daniel in die Welt.