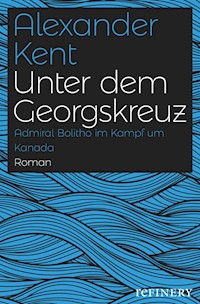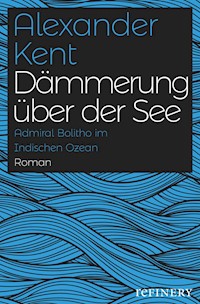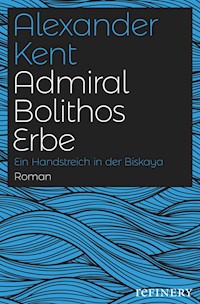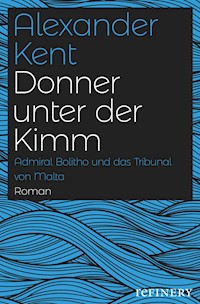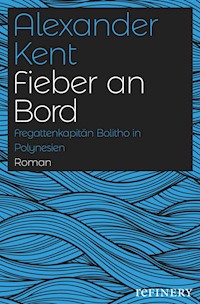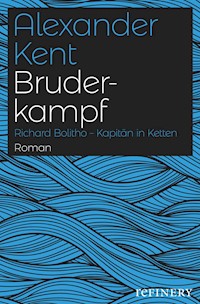6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Adam-Bolitho-Roman
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Um 1815: Napoleon hat Elba verlassen, und im Mittelmeer flackern alle Feindseligkeiten erneut auf. Adam Bolitho, Neffe des legendären Seehelden Richard Bolitho und Kommandant der Fregatte "Unrivalled", vermisst den Ratschlag seines gefallenen Onkel bitterlich. Französische, spanische und holländische Schiffe werden zu unberechenbaren Gegnern für die Briten, während Piraten und Sklavenhändler immer dreister ihre eigenen Interessen verfolgen - doch Adam macht seinen berühmten Vorfahren alle Ehre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Ähnliche
Das Buch
1815: Die Order, die Kapitän Adam Bolitho erhält, ist eindeutig. Mit seiner mit 46 Geschützen bestückten Fregatte Unrivalled soll er Kurs Westafrika nehmen und unter den Schiffen der skrupellosen Sklavenhändler, die von Freetown aus operieren, ein für allemal aufräumen. Keine einfache Mission, denn bisher waren den Briten kaum Erfolge im Kampf gegen die mit allen Wassern gewaschenen Menschenhändler und deren wendige Schnellsegler beschieden gewesen. Adam Bolithos Kühnheit und ganze Seemannschaft sind wieder einmal gefordert.
Der Autor
Alexander Kent kämpfte im Zweiten Weltkrieg als Marineoffizier im Atlantik und erwarb sich danach einen weltweiten Ruf als Verfasser spannender Seekriegsromane. Er veröffentlichte über 50 Titel (die meisten bei Ullstein erschienen), die in 14 Sprachen übersetzt wurden, und gilt als einer der meistgelesenen Autoren dieses Genres neben G.S. Forester. Alexander Kent, dessen richtiger Name Douglas Reeman lautet, war Mitglied der Royal Navy Sailing Association und Governor der Fregatte »Foudroyant« in Portsmouth, des ältesten noch schwimmenden Kriegsschiffs.
Alexander Kent
Feindhafen Algier
Geheimauprag für Adam Bolitho
Roman
Aus dem Englischenvon Dieter Bromund
Ullstein
Neuausgabe bei Refinery
www.ullstein-buchverlage.de/verlage/refinery
Refinery ist ein Digitalverlag
der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
November 2017 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2006
© Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München 2000
© Bolitho Maritime Productions 1999
Titel der Originalausgabe: Second to None
(William Heinemann, London)
Covergestaltung:
© Sabine Wimmer, Berlin
ISBN 978-3-96048-116-4
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Ganz besonders für dich, Kim.Mit meiner ganzen Liebe.
Inhalt
Prolog
I
Ein Held, an den man sich erinnert
II
Kein Fremder mehr
III
Eine Frage des Stolzes
IV
Ein neuer Anfang
V
Ein Wettkampf
VI
Keiner ist tapferer
VII
Ein schlimmes Schiff
VIII
Kein Entkommen
IX
Mehr Glück als die meisten
X
Kommandant an Kommandant
XI
Ein letztes Lebewohl
XII
Nachwehen
XIII
Neid
XIV
Bestimmung
XV
Nahkampf
XVI
In guten Händen
XVII
Die Familie
XVIII
Eine Mannschaft
XIX
»Verlaß dich auf mich …«
So schreie denn die Woge, so schreie der Wind, die weiten Wasser der Sturmseeschwalbe und des Delphins. In meinem Ende liegt mein Anfang.
T. S. Eliot:
Prolog
Der Midshipman stand unter dem Skylight der Kajüte und hatte sich an die schweren Bewegungen des Schiffes bereits gewöhnt. Nach der engen Unterkunft der Midshipmen auf der Fregatte, die ihn von Plymouth hierher gebracht hatte, erschienen ihm dieses gewaltige Kriegsschiff wie ein Fels und die große Heckkajüte im Vergleich wie ein Palast.
Was der Junge hier erwartete, hatte ihm die Kraft verliehen, als alles andere verloren schien. Hoffnung, Verzweiflung, ja sogar Angst waren bis zu diesem Augenblick seine willigen Begleiter gewesen.
Die Geräusche des Schiffes waren gedämpft, weit weg, die Stimmen klangen fern, bedeuteten nichts, verlangten nichts. Jemand hatte ihn vorgewarnt: Wer neu auf ein Schiff kommt, das bereits in Dienst gestellt ist, hat es immer schwer. Er würde weder Freunde noch bekannte Gesichter treffen, die ihm halfen, sich an das neue Leben mit all seinen Ecken und Kanten zu gewöhnen. Und dies war überhaupt sein erstes Schiff!
Er konnte immer noch kaum glauben, daß er wirklich hier stand. Vorsichtig bewegte er den Kopf und schielte auf den Mann, der hier in der Kajüte hinter einem Tisch saß und die Dokumente las, die der Midshipman so achtsam unter dem Mantel befördert hatte, damit sie von den Spritzern der Riemen nicht naß wurden. Der Lesende hielt sie gegen das Licht, das durch die schrägen Heckfenster aus der glitzernden Weite von See und Himmel fiel.
Der Kapitän. Auf ihn hatte der Junge so große Hoffnung gesetzt, auf einen Mann, dem er noch nie begegnet war. Sein Körper war gespannt wie eine Signalleine, sein Mund staubtrocken. Und wenn seine Hoffnungen nun nicht wahr würden? Zu einer bitteren Enttäuschung führten? Das wäre das Ende von allem!
Plötzlich merkte er, daß der Kommandant ihn anschaute und ihn etwas gefragt hatte. Sein Alter?
»Vierzehn, Sir.« Seine eigene Stimme klang ihm fremd. Zum erstenmal sah er dem Kapitän genau in die Augen, sie waren eher grau als blau, nicht unähnlich der See hinter den gischtbesprühten Fenstern.
Andere Stimmen wurden hörbar, kamen näher. Der Midshipman hatte keine Zeit mehr. Wild entschlossen schob er seine Hand wieder in die Uniformjacke und zog den Brief heraus, auf den er den langen Weg von Falmouth her so besonders geachtet hatte.
»Der ist für Sie, Sir. Ich habe den Auftrag, ihn ausschließlich Ihnen auszuhändigen!«
Er sah, wie der Kommandant den Umschlag aufschlitzte und plötzlich sehr auf der Hut zu sein schien. Was dachte der Kapitän jetzt wohl gerade? Der Junge wünschte, er hätte ihn ungelesen zerrissen!
Die braune Hand des Kapitäns ballte sich plötzlich auf dem Papier, das im spiegelnden Licht zu zittern schien. Wut, Ablehnung, andere Gefühle? Der Junge wußte nicht mehr, was er erwarten konnte. Er mußte an seine Mutter denken, wie sie ihm ein zerknittertes Stück Papier in die Hand drückte – Minuten vor ihrem Tod. Wie lange war das her? Wochen, Monate? Ihm erschien es wie gestern. Eine Adresse in Falmouth, zwanzig Meilen von Penzance, ihrem Wohnort entfernt. Er war den langen Weg zu Fuß gegangen, die Zeilen seiner Mutter gaben ihm Kraft und leiteten ihn.
Der Kommandant faltete den Brief und schob ihn in die Tasche. Wieder diese suchenden Blicke, doch ganz ohne Feindschaft. Wenn überhaupt etwas, dann zeigten sie nur Trauer.
»Ihr Vater, mein Junge? Was wissen Sie über ihn?«
Der Midshipman hatte die Frage nicht erwartet, zögerte und spürte, daß die Stimmung sich änderte: »Er war Offizier des Königs, Sir. In Amerika hat ihn ein durchgehendes Pferd getötet.« Wieder sah er seine Mutter in ihren letzten Augenblicken, sie streckte ihre Arme aus, um ihn zu umarmen und um ihn dann wegzuschieben, ehe sie beide zusammenbrachen. Ruhig wie eben fuhr er fort: »Meine Mutter hat oft von ihm gesprochen. Als sie starb, sagte sie mir, ich müsse nach Falmouth gehen und nach Ihrer Familie fragen, Sir. Ich weiß, meine Mutter hatte den Mann nicht geheiratet, Sir, das wußte ich immer, aber…«
Er stoppte, weil er nicht weitersprechen konnte. Der Kommandant stand jetzt vor ihm, legte ihm eine Hand auf den Arm, und sein Gesicht war ganz dicht vor ihm. So sahen ihn sicher nur wenige Menschen.
Kapitän Richard Bolitho sagte bewegt: »Du mußt wissen, dein Vater war mein Bruder.«
Das Bild verschwamm. Es klopfte an der Tür. Jemand hatte dem Kommandanten eine Meldung zu machen.
Adam Bolitho erwachte aus seinem Traum ganz und gar gespannt und spürte die unsichere Hand auf seinem Arm. Plötzlich war ihm alles klar. Die Bewegungen des Schiffes wurden unruhiger, die See meldete sich. Mit geübten Sinnen schätzte er beides ein.
Im schwachen, abgeschirmten Licht der Laterne sah er die Gestalt neben seiner Koje schwanken, erkannte die weißen Flecken des Midshipman. Er knurrte und versuchte, den Traum zu verscheuchen. Dann schwang er seine Füße aufs Deck und suchte in der immer noch unvertrauten Kajüte nach seinen langschäftigen Stiefeln.
»Was ist, Mr. Fielding?« Er konnte sich sogar an den Namen des Midshipman erinnern und mußte fast lächeln. Fielding war ganze vierzehn Jahre alt. So alt wie der Midshipman in dem Traum, der ihn immer noch nicht loslassen wollte.
»Gruß von Mr. Wynter, Sir. Der Wind nimmt zu, und er meinte…«
Adam Bolitho tippte ihm auf den Arm und griff nach seinem ausgeblichenen Wachmantel.
»Gut, daß er mich wecken ließ. Ich verliere lieber eine Stunde Schlaf als mein Schiff. Ich bin gleich oben.«
Der Junge stob davon.
Adam erhob sich und paßte sich den Bewegungen Seiner Britannischen Majestät Fregatte Unrivalled an. Mein Schiff! Sein geliebter Onkel hatte von einem Schiff immer als der wertvollsten aller Gaben gesprochen.
Und die Fregatte war auch sein größter Besitz. Das Schiff war noch so neu und die Farbe kaum trocken, als er sich auf ihm eingelesen hatte, eine Fregatte mit dem schönsten Riß, schnell und mächtig. Er schaute auf das dunkle Heckfenster, als sei er immer noch in der großen Kajüte der Hyperion, in der sein Leben sich so plötzlich geändert hatte – durch einen einzigen Mann.
Er tastete seine Taschen ab, ohne es recht zu bemerken, um sicherzugehen, daß er alles bei sich hatte, was er bräuchte. Er würde jetzt an Deck gehen, wo der wachhabende Offizier vorsichtig seine Stimmung einschätzen würde. Seinen Kommandanten gestört zu haben würde ihn mehr beunruhigen als der zunehmende Wind.
Das war zum größten Teil sein eigener Fehler, wie Adam wohl wußte. Seit er das Kommando übernommen hatte, hielt er sich fern von seinen Offizieren. Doch das konnte so, das durfte so nicht weitergehen.
Er wandte sich vom Heckfenster ab. Alles andere war ein Traum. Sein Onkel war tot. Realität war nur das Schiff. Und er, Kapitän Adam Bolitho, war mutterseelenallein.
I Ein Held, an den man sich erinnert
Leutnant Leigh Galbraith schritt über das Oberdeck der Fregatte in den Schatten des Achterdecks. Er achtete darauf, nicht zu schnell zu gehen oder eine besondere Betroffenheit zu zeigen, die zu Gerüchten unter den Seeleuten und Seesoldaten führen würde, die hier ihren vormittäglichen Aufgaben nachgingen.
Galbraith war groß und kräftig. An die niedrigen Decksbalken an Bord Seiner Majestät Kriegsschiffe hatte er sich erst schmerzhaft gewöhnen müssen. Es war seine Aufgabe als Erster Offizier der Unrivalled, Ordnung und Disziplin im Schiff aufrechtzuerhalten und für die Ausbildung der neu zusammengestellten Mannschaft zu sorgen. Von ihm erwartete der Kommandant, daß das Schiff in jeder Hinsicht ein einsatzbereiter Teil der Flotte war und daß er als sein Stellvertreter das Kommando übernehmen könnte, wenn der Kommandant aus irgendeinem Grund ausfiel.
Der Erste Offizier war jetzt neunundzwanzig Jahre alt und gehörte der Marine seit dem zarten Alter von zwölf Jahren an, ein üblicher Lebenslauf für viele seiner Zeitgenossen. Er kannte nur dieses Leben, hatte nie etwas anderes angestrebt, und als er zum diensttuenden Kommandanten befördert wurde und ein eigenes Schiff bekam, hielt er sich selbst für den glücklichsten Menschen der Welt. Ein höherer Offizier hatte ihm versichert, daß er, sobald es ging, den nächsten Schritt tun und zum Kapitän befördert würde – was ihm damals wie ein Traum erschienen war.
Er hielt an einer der offenen Kanonenpforten und lehnte sich auf eine der Achtunddreißigerkanonen der Fregatte, sah auf den Hafen und die anderen Schiffe. Carrick Roads, Falmouth, Cornwall glitzerten im Mai-Sonnenschein. Er versuchte, die wiederkehrende Bitterkeit und die Wut zu unterdrücken. Er hätte ein Schiff wie dieses haben können. Können, hätte haben können… Unter seinen Fingern fühlte der Lauf der Kanone sich warm an, als sei aus ihr gefeuert worden, wie damals – unter Duncan bei Camperdown und vor Kopenhagen unter Nelsons Flagge. Er war gelobt worden, weil er im Feuer so kühl blieb, weil er gefährliche Situationen beherrschte, wenn sein Schiff im Kampf mit dem Feind stand. Sein letzter Kommandant hatte ihn zur Beförderung empfohlen. Das war auf der Brigg Vixen gewesen, einem der Arbeitstiere der Flotte. Trotz ihrer beschränkten Mittel hatte sie die Leistungen einer Fregatte erbracht.
Ehe Galbraith auf die Unrivalled abkommandiert wurde, hatte er sein altes Schiff liegen sehen wie ein Wrack, dem Ausmusterung und Schlimmeres bevorstanden. Der Krieg mit Frankreich war vorbei, Napoleon war abgetreten und ins Exil auf Elba geschickt worden. Das Unmögliche war wahr geworden. Glücklicherweise war auch der Konflikt in Nordamerika zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten beigelegt – doch der Frieden war schwer zu akzeptieren. Galbraith machte da keine Ausnahme, er kannte nur den Krieg. Und er hatte Glück, auf dieses Schiff kommandiert worden zu sein. So viele Schiffe wurden außer Dienst gestellt, so viele Männer mit unziemlicher Hast verabschiedet, die anderswo kaum Aussichten hatten, weil ihre Erfahrungen sich ausschließlich auf ihren Seedienst bezogen. Manche meinten hinter Galbraith’ Rücken, dies sei mehr, als er verdiene.
Vor einer Stunde war er in der Jolle um die Unrivalled herum gerudert worden, um den Trimm zu überprüfen. Bewegungslos lag sie über ihrem eigenen Spiegelbild. Vor fünf Monaten war sie in Dienst gestellt worden, Rigg und Stagen pechschwarz, jedes Segel sauber an den Rahen aufgetucht – das perfekte Bild der Kunst der Schiffbauer. Selbst ihre Galionsfigur war atemberaubend – der nackte Körper einer schönen Frau. Er drängte sich unter dem Bugspriet nach vorn. Die Frau hielt die Hände hinter dem Kopf und drückte auffordernd die Brüste vor. Unrivalled war die erste ihres Namens in den Verzeichnissen der Marine, die erste der größeren Fregatten, die hastig auf Kiel gelegt worden waren, um der amerikanischen Bedrohung zu widerstehen. Der Krieg, den keine Seite gewinnen konnte, war beide teuer zu stehen gekommen. Doch der Konflikt gehörte jetzt bereits der Geschichte an.
Galbraith zupfte seine Jacke von der Brust weg und versuchte, sich auch von seinen Enttäuschungen zu trennen. Er hatteja in der Tat Glück. Er kannte nur die Marine, hatte nie etwas anderes gewollt. Das durfte er niemals vergessen.
Er hörte, wie der Seesoldat die Hacken zusammenknallte, als der Vorgesetzte sich der leichten Tür vor der Achterkajüte näherte.
»Der Erste Offizier, Sir!«
Galbraith nickte ihm zu, doch der Posten zuckte unter dem Schirm seines ledernen Tschakos nicht mal mit den Augen.
Ein Diener öffnete die Tür und verschwand zur Seite, als Galbraith den Raum des Kommandanten betrat. Jeder wäre stolz und geehrt, hier leben zu können. Galbraith hatte versucht, alle Neidgefühle zu unterdrücken und den Mann zu akzeptieren, unter dem er dienen würde, als der sich eingelesen hatte. In Anwesenheit der gesamten Besatzung und einiger Gäste hatte Galbraith den neuen Kapitän beobachtet, den ersten Kapitän, der mit dem Verlesen der Rolle das Kommando übernahm.
Nach fünf Monaten war ihm klar, daß Kapitän Adam Bolitho immer noch ein Fremder an Bord war – und das nach all dem Drill und dem Exerzieren, nach all der Mühe, die Lücken in der Mannschaft mit Leuten vom Land zu füllen, nachdem all die entlassen worden waren, die man zum Dienst an Bord gepreßt hatte. In einem Linienschiff konnte man vom Kapitän Distanz erwarten, besonders wenn die ganze Besatzung neu war, aber auf Fregatten oder kleineren Schiffen wie der Vixen war so etwas selten.
Galbraith beobachtete Adam Bolitho betroffen und genau. Er war schlank und hatte so dunkles Haar, daß es fast schwarz sein konnte. Als er sich jetzt vom Heckfenster und den grünen Spiegelungen des Landes wegwandte, bemerkte er die gleiche Unruhe wie bei ihrer ersten Begegnung. Galbraith wußte wie die meisten Marineoffiziere viel über die Familie der Bolithos, besonders über Sir Richard, dessen Ruhm man im ganzen Land kannte. Die Nation war wie betäubt, als sie von seinem Tod im Mittelmeer erfuhr. Ein Scharfschütze aus dem Rigg des Feindes hatte ihn genau an dem Tag getötet, als Napoleon nach der Flucht aus Elba seinen Fuß wieder in Frankreich an Land setzte und der Frieden nur noch eine Erinnerung war.
Von diesem Mann allerdings, von Sir Richards Neffen, wußte man nur wenig und nur Bruchstückchen, obwohl in der Flotte wenig lange verborgen blieb. Der beste Kommandant einer Fregatte, sagten manche. Kühn bis zur Tollkühnheit, sagten andere ihm nach. Sein erstes Kommando – über eine ähnliche Brigg wie die von Galbraith – hatte er bereits mit dreiundzwanzig Jahren bekommen. Die Fregatte Anemone hatte er später im Kampf mit einem gewaltig überlegenen amerikanischen Gegner verloren. Er wurde gefangengenommen, konnte aber fliehen und wurde Flaggkapitän des Mannes, der jetzt Flaggoffizier von Plymouth war.
Adam sah Galbraith jetzt an. Seine dunklen Augen verrieten Anstrengung, obwohl er sich mit einem Lächeln Mühe gab. Ein junges, waches Gesicht, das Frauen sicher sehr anzog, entschied Galbraith. Und wenn man einigen Gerüchten Glauben schenken konnte, dann stimmte das auch.
»Die Gig ist im Wasser, Sir. Die Mannschaft tritt um vier Glasen an, es sei denn…«
Adam Bolitho trat an den Tisch und faßte den Säbel an, der dort lag. Er war alt, mit gerader Klinge, leichter als die heute vorgeschriebenen, und als Säbel, der schon von so vielen aus der Familie getragen worden war, Teil der Bolitho-Legende. Richard Bolitho hatte ihn getragen, als der Feind ihn niederstreckte.
Galbraith sah sich in der Kabine um, in die die Achtzehnpfünder ebenfalls eingedrungen waren. Wenn sie vom Bug bis zum Heck gefechtsklar war, präsentierte die Unrivalled eine beeindruckende Breitseite, selbst wenn sie so unterbesetzt waren wie jetzt. Er biß sich auf die Lippen. Er sah Kisten mit Wein, die geöffnet und deren Inhalt gestaut werden mußte. Er hatte beobachtet, wie sie kürzlich an Bord gehievt worden waren, und wußte, daß sie vom Bolitho-Besitz in Falmouth kamen, der jetzt wahrscheinlich dem Kommandanten gehörte. Irgendwie schien das nicht zu diesem jugendlichen Mann mit den glänzenden Epauletten zu passen. Galbraith bemerkte auch, daß die Kisten eine Londoner Adresse trugen, aus der St. James Street.
Galbraith preßte die Faust zusammen. Er war einmal dort gewesen. Als er London besuchte und seine Welt zusammenzubrechen begann…
Adam zwang seine Gedanken in die Gegenwart zurück. »Danke, Mr. Galbraith, das paßt sehr gut.« Bolitho wartete, weil er dem Ersten Offizier seine Fragen an den Augen ansah. Ein guter Mann, dachte er, unnachgiebig mit den neuen Männern, aber nicht ungeduldig, und auf der Hut vor den alten Blaujacken, die bei einem unbekannten Offizier gerne ihre Vorteile suchten.
Adam spürte, wie sich das Schiff sehr sanft unter seinen Füßen bewegte. Als wolle es sich endlich frei vom Land machen. Und von mir auch, ihrem Kommandanten?
Er hatte bemerkt, daß Galbraith auf den Wein blickte. Er kam von Catherine. Trotz allem, was geschehen war, trotz ihrer Verzweiflung über ihren unendlichen Verlust, hatte sie an Adam gedacht. Oder an den, der sie für immer verlassen hatte?
»Liegt noch etwas an?« Eigentlich wollte er nicht ungeduldig klingen, doch er schien seinen Tonfall nicht beherrschen zu können.
Galbraith war aber offenbar nichts aufgefallen. Oder hatte er sich bereits an die Stimmungen seines neuen Herrn und Meisters gewöhnt?
Galbraith sagte: »Wenn es keine Zumutung darstellt, Sir, würde ich gern wissen…« Er zögerte, als Adam ihn kühl ansah.
»Bitte«, meinte Adam, »bitte sprechen Sie ganz offen.«
»Ich möchte Ihnen mein Mitgefühl ausdrücken, Sir. Im Namen der Schiffsbesatzung.« Galbraith ließ sich durch eine Stimme nicht unterbrechen, die einem der Bumboote obszön zurief, es solle sich davonmachen. »Und auch im eigenen!«
Adam zog seine Uhr aus der Tasche und wußte, daß Galbraith sie bemerkt hatte. Sie war schwer und alt, und er erinnerte sich noch an den Augenblick, da er sie zum erstenmal in jenem Laden in Halifax gesehen hatte. Überall um ihn herum tickten Uhren, schlugen an, und doch war es ein Ort des Friedens. Ein Fluchtpunkt, wie so oft. Beim Wachwechsel an Deck, beim Reffen oder Setzen von Segeln, beim Kurswechsel, beim Einlaufen in einen Hafen nach erfolgreicher Überfahrt… Diese alte Uhr hatte einst einem anderen seefahrenden Offizier gehört. Doch in einem unterschied sie sich von allen anderen Uhren – es gab eine kleine Meermaid, die in den Sprungdeckel eingraviert war.
»Meinen Sie, wir können beide das Schiff verlassen?« fragte Adam. Eigentlich hatte er das so nicht sagen wollen, die Meermaid hatte ihn abgelenkt, das Gesicht des Mädchens, so deutlich wie damals im Laden. Zenoria. Dann fügte er hinzu: »Ich würde es sehr begrüßen, Mr. Galbraith.« Er sah ihn fest an und meinte einen Augenblick lang Wärme zu spüren, etwas, das er eigentlich nicht fördern wollte. »Machen Sie den Offizieren klar: Höchste Wachsamkeit. Wir haben bereits unsere Befehle. Ich will niemanden desertieren sehen. Wir hätten sonst nicht genügend Männer für unser Schiff und für die Kämpfe schon gar nicht.«
»Ich werde mich darum kümmern, Sir.« Galbraith bewegte sich in Richtung Tür. Viel war zwischen ihnen beiden nicht geschehen, doch so nahe waren sie sich noch nie gewesen.
Adam wartete, bis die Tür zufiel, dann trat er an ein kleines offenes Fenster achtern und schaute auf das Wässer, das sich unter der Galerie kräuselte.
Ein schönes Schiff. Als er mit dem Geschwader hier arbeitete, hatte er die ganze Kraft gespürt. Diese Fregatte war das schnellste Schiff, das er je hatte. Bald würden aus den unbekannten Gesichtern an Bord Menschen geworden sein, Individuen, die Stärke und Schwäche jedes Schiffes. Aber nicht zu nahe, nicht wieder. Ihm schien, als habe jemand diese Warnung geflüstert.
Er seufzte und blickte auf die Weinkisten. Wie würde es Catherine gehen, was für ein Leben würde sie ohne den Mann führen, der ihr alles bedeutet hatte?
Vom Vorschiff hörte er leise drei Glasen schlagen.
Es würde schlimm werden, sehr viel schlimmer, als er erwartet hatte. Die Leute würden ihn beobachten, wie sie seinen Onkel beobachtet hatten – liebevoll, hassend, bewundernd, beneidend. All solche Gefühle waren immer ganz nahe gewesen.
Er kannte Galbraiths Geschichte und wußte, was seine Beförderung zu dem heiß ersehnten Rang eines Kapitäns zerstört hatte. Es könnte jedem passieren. Auch mir. Wieder dachte er an Zenoria und was er getan hatte, doch er fühlte keine Scham, nur den großen Verlust.
Er wollte gerade unter das offene Skylight treten, als er Galbraiths Stimme hörte.
»Wenn die Pendennis-Batterie ihren Schuß feuert, Mr. Massie, dann werden Sie die Flagge und die Kriegsflagge dippen, und alle Mann werden mit Blick nach achtern stehen und die Mützen abnehmen.«
Adam wartete. Es schien ihm wie ein Eindringen, doch er konnte sich nicht bewegen. Massie war der Zweite Offizier, ein ernster junger Mann, der diesen Posten bekommen hatte, weil sein Vater Vizeadmiral war. Er war, jedenfalls bisher, eine unbekannte Größe.
Massie sagte: »Ob Sir Richards Dame wohl da ist, würde ich gerne wissen.«
Er hörte die beiden weggehen. Eine belanglose Bemerkung? Und wen meinte er damit, Catherine oder Belinda, Lady Bolitho?
Und es würde größte Verachtung geben. Kurz nachdem die Unrivalled in Dienst gestellt worden war, hatte man den Tod von Emma Hamilton erfahren. Sie war Nelsons Geliebte, seine Inspiration gewesen, der Liebling der ganzen Nation, aber man hatte sie einsam in Calais sterben lassen, arm und von allen sogenannten Freunden verlassen, auch von denen, die sich eigentlich um sie kümmern sollten.
Das Schiff ruckte leicht gegen die Ankerkette, und im dicken Glas sah Adam ein Spiegelbild.
Gebrochen flüsterte er: »Ich werde es nie vergessen, Onkel!«
Das Schiff ruckte wieder, und er war allein.
Bryan Ferguson, der einarmige Inspektor des Bolitho-Besitzes, starrte auf die beiden Hauptbücher auf seinem Tisch, beide noch ungeöffnet. Es war schon spät am Abend, aber er konnte durch die Fenster immer noch die hohen Bäume vor dem Himmel sehen, als zögere der Tag seinen Abschied hinaus. Er erhob sich und trat an den Schrank, hielt inne, als er draußen das Schlinggewächs an der Wand rascheln hörte. Endlich Wind, aus Südost und zunehmend, wie einige Fischer vorhergesagt hatten, nach all der Stille. Ferguson öffnete den Schrank, nahm eine irdene Flasche heraus und ein Glas. Und nach all der Trauer.
Ein zweites Glas stand noch dort, reserviert für seinen Freund John Allday, der gelegentlich mit der einen oder anderen Ausrede von seinem kleinen Gasthaus in Fallowfield am Helford, dem »Old Hyperion«, herüberkam. Auch dieser Name hatte jetzt eine tiefere Bedeutung.
Doch jetzt würde es sicher eine Weile dauern, ehe John Allday hier auftauchte. Die Frobisher, das Flaggschiff Sir Richard Bolithos, kehrte zurück, um außer Dienst gestellt zu werden. Oder vielleicht auch nicht, nachdem Napoleon wieder in Frankreich auf dem Marsch war.
Im letzten Jahr war die Stadt bei der Siegesnachricht fast durchgedreht: Die verbündeten Armeen waren in Paris, Bonaparte war am Ende. Doch das Exil auf Elba war nichts für ihn. Ferguson hatte Lady Catherine sagen gehört, es sei, als ob man einen Adler in einen Vogelkäfig sperre. Andere waren der Meinung, Bonaparte gehöre nach all dem Elend und den Morden, die auf sein Konto gingen, an den Galgen.
Doch Allday wollte auf dem Schiff nicht bleiben, auf dem Sir Richard gefallen war. Wenn er zurück war und hier am Tisch saß, das Glas in seinen großen Händen, würde man die wahre Geschichte hören. Seine Frau Unis, die das Gasthaus »Old Hyperion« führte, bekam häufig Post von ihm, obwohl Allday selber nicht schreiben konnte. Also stammten seine Zeilen von Avery, Bolithos Flaggleutnant. Ihre Beziehungen waren in den strengen Grenzen der Marine selten und seltsam. Allday hatte mal gemeint, es sei irgendwie nicht richtig, daß der Flaggleutnant selber nie Post bekam, obwohl er ihm die Briefe schrieb und vorlas. Von dem Augenblick an, da die schreckliche Nachricht Falmouth erreicht hatte, wußte Ferguson, daß Allday den Augenblick niemandem anvertrauen, ihn mit keinem teilen und schon gar nicht zu Papier bringen würde. Er würde es ihm nur selber erzählen, von Angesicht zu Angesicht, falls er dazu überhaupt in der Lage war.
Er hustete. Er hatte ein gutes Maß Rum geschluckt, ohne überhaupt zu merken, daß er sich eingeschenkt hatte. Er nahm wieder Platz und blickte auf die ungeöffneten Bücher. Über sich hörte er Grace hin und her gehen. Sie konnte keine Ruhe finden und konnte jetzt selbst die ganz gewöhnlichen Aufgaben als Haushälterin nicht erfüllen – und war doch so stolz auf diese Position, genau wie er.
Seine eine Hand, mit der er immer noch so viel leisten konnte, preßte sich fest um das Glas. Vor langer Zeit hatte er mal geglaubt, nicht mehr von Nutzen zu sein, Treibgut wie so mancher, den dieser scheinbar endlose Krieg an Land gespült hatte. Aber Grace hatte ihm durch all das Schlimme hindurchgeholfen. Jetzt erinnerte er sich an diesen Augenblick meistens in solchen Stunden des Zwielichts, wenn man sich die hohen Türme der Segel leichter vorstellen konnte, die Umrisse der französischen Schiffe, das betäubende Krachen und Brüllen der Breitseiten, als die beiden Flotten zur blutigen Umarmung aufeinanderstießen. Es schien damals den ganzen Tag zu dauern, bis es soweit war. In den Dienst gepreßte Männer wie er selber waren gezwungen, den ganzen Tag die Toppsegel des Feindes zu beobachten, die wie Fahnen aufstiegen und schließlich den ganzen Horizont füllten. Ein Offizier hatte später über diesen fürchteinflößenden Anblick gesagt, er lasse an die Ritter in ihren Rüstungen vor Agincourt denken.
Er hatte aber auch den ganzen Tag lang Richard Bolitho, den Kommandanten der Phalarope, gesehen, einer winzigen Fregatte im Vergleich zu den großen Linienschiffen. Er sprach seinen Männern Mut zu, forderte sie. Ja, Ferguson hatte, ehe es ihn selber erwischte, Bolitho bei einem sterbenden Seemann knien sehen, dessen Hand er hielt. Sein Gesicht an diesem schrecklichen Tag hatte er nicht vergessen und würde es auch nie vergessen können.
Und jetzt war er Inspektor dieses Gutes, des Hofes, der Häuschen und all der Menschen, die es zu einem Ort machten, den man liebt und an dem man gerne arbeitet. Viele von ihnen waren ehemalige Matrosen, die unter Sir Richard Bolitho auf vielen Schiffen und allen Teilen der Welt, in denen er seine Flagge zeigte, gedient hatten. Heute hatte er viele von ihnen in der Kirche gesehen, denn Sir Richard Bolitho war einer von ihnen und der berühmteste Sohn von Falmouth, Sohn eines Seemanns, aus Generationen von Marineoffizieren stammend. Sein Haus unterhalb von Pendennis Castle war Teil ihrer aller Geschichte.
Auf der anderen Seite des Hofs konnte er in einigen Zimmern Lichter erkennen, und er stellte sich die Porträts vor und auch das Bild, das Sir Richard als den jungen Kapitän zeigte, an den er sich als erstes erinnerte. Richards Frau Cheney hatte es in Auftrag gegeben, als er mit der Flotte auf See war. Bolitho hatte seine Frau nie wie dergesehen. Sie starb zusammen mit ihrem ungeborenen Kind, als ihre Kutsche ein Rad verloren hatte und umgekippt war. Ferguson hatte sie selber getragen und suchte noch Hilfe, als es schon zu spät war. Er lächelte traurig, als er daran dachte. Und damals auch schon nur mit einem Arm.
Die Kirche von St. Charles, dem Märtyrer, wo man sich an Tod und Leben aller Bolithos erinnerte, war bis auf den letzten Platz gefüllt mit Hausdienern, Hofarbeitern, Fremden und Freunden. Eng aneinander gedrückt erinnerten sie sich und beteten zusammen.
Er erlaubte sich, an den Kirchenstuhl der Familie in der Nähe der Kanzel zu denken. Richard Bolithos jüngere Schwester Nancy mußte selber noch mit dem Tod ihres eigenen Mannes klarkommen. Roxby, der »König von Cornwall«, war kein Mann, den man leicht vergaß. Neben ihr saß Catherine, Lady Somervell, groß und sehr gerade aufgerichtet, ganz in Schwarz gekleidet, ihr Gesicht hinter einem Schleier verborgen. Nur der Diamantanhänger auf ihrer Brust in Form eines offenen Fächers, den Bolitho ihr geschenkt hatte, verriet ihre Gefühle.
Und neben ihr sah man Adam Bolitho, sein Blick auf den Altar gerichtet mit hoch erhobenem Kinn. Kühn und entschlossen. Er glich Sir Richard in diesem Augenblick genau wie damals, als er nach seines Onkels Tod ins Haus gekommen war, Catherines Zeilen gelesen und sich den alten Säbel eingehenkt hatte: ganz der gefallene Marineoffizier, der hier in Falmouth aufgewachsen war.
Neben ihm saß ein zweiter Offizier, ein Leutnant, aber Ferguson hatte nur Adam Bolitho gesehen und die schöne Frau an dessen Seite.
Er wurde schmerzhaft an den Tag in derselben Kirche erinnert, als ein Erinnerungsgottesdienst abgehalten wurde, nachdem die Nachricht eingetroffen war, Sir Richard und seine Geliebte seien mit der Golden Plover vor Afrika untergegangen. Viele der jetzt Anwesenden waren damals auch hiergewesen, doch auch Bolithos Frau. Ferguson konnte sich noch an ihre entsetzten ungläubigen Blicke erinnern, als ein Offizier in die Kirche gestürzt war mit der Meldung, daß Bolitho und seine Begleiter noch lebten und entgegen allen Erwartungen gerettet worden waren. Als Lady Catherines Rolle beim Schiffbruch bekannt wurde, wie sie den Überlebenden im offenen Boot Mut machte und Hoffnung zusprach, da hatte sie aller Herzen gewonnen. Das schien den Skandal auszulöschen und die Erregung, mit der man sich bis dahin über ihre Verbindung zu Sir Richard ausgelassen hatte.
Allein oder zusammen – Ferguson sah sie wieder vor sich. Catherine auf dem Weg über den Klippen. Ihr offenes Haar wehte weit aus. Oder stehend an dem Steinhaufen, an dem er sie einst gesehen hatte, als beobachte sie ein Schiff, das näher kam. Sie hoffte vielleicht…
Jetzt gab es keine Hoffnung mehr. Ihr Mann, ihr Geliebter und der Held der Nation war auf See bestattet worden – in der Nähe der alten Hyperion, auf der so viele gefallen waren, Männer, die Ferguson nie vergessen würde. Es war das Schiff, auf das Adam als vierzehnjähriger Midshipman gekommen war. Nancy, Lady Roxby, würde sich daran auch erinnern. Für sie war Adam, der jetzt die Uniform eines Kapitäns trug, immer noch der Junge, der den langen Weg von Penzance hierhergekommen war – nach dem Tod seine Mutter. Er brachte nur einen Fetzen Papier mit, auf dem nichts als Bolitho stand. Und nun war er selber der letzte Bolitho.
Ferguson wußte, daß es sehr bald bedeutendere Erinnerungsgottesdienste geben würde, zuerst in Plymouth und dann in der Westminster Abtei. Er fragte sich, ob Lady Catherine nach London gehen würde unter die neugierigen Augen und spitzen Zungen derer, die sich das Maul zerrissen über ihre Beziehungen zum Helden der Nation.
Im Hof hörte er Schritte und riet, es müßte der junge Matthew sein, der erfahrenste Kutscher, der seine Runde machte und nach den Pferden schaute. Bosun, sein Hund, trottete sicher wieder schnaufend hinter ihm her. Der Hund war etwas taub, seine Sehfähigkeit ließ nach, aber kein Fremder würde je an ihm vorbeikommen, ohne daß er ihn heiser anbellte.
Auch Matthew war in der Kirche gewesen. Er hieß immer noch der »junge Matthew«, obwohl er längst verheiratet war. Auch er gehörte zur Familie, zur kleinen Mannschaft, wie Sir Richard sie getauft hatte.
Auf See bestattet. Das war sicher das beste. Keine Nachwirkungen, keine falschen Trauerbezeugungen. Oder doch?
Matthew mußte an das Tableau an der Kirchenwand unter der Büste von Kapitän Julius Bolitho denken, der 1664 in der Schlacht gefallen war.
»Die Geister der Väterwerden aus jeder Woge aufsteigen,denn das Deck war ihr Ruhmesplatz,der Ozean ist nur ihr Grab.«
Das sagte alles, ganz besonders denen, die sich in der alten Kirche in diesem Ort der Seefahrer versammelt hatten, die königliche Marine, die Küstenwache, Fischer und Seeleute von Postschiffen und Handelsschiffen, die mit jeder Tide das ganze Jahr über ausliefen. Die See war ihr Leben. Aber auch ihr Feind. Das hatte er ganz deutlich gespürt, als in der Kirche mächtig das Lied »The Sailors Hymn« erklang.
Er hatte den Knall der einzigen Kanone gehört, wie schon den Salut vor dem Beginn des Gottesdienstes. Adam hatte sich umgedreht und seinen Ersten Offizier angesehen. Die Leute hatten den Weg freigemacht, damit die Familie hinausgehen konnte. Dabei hatte Lady Catherine kurz Fergusons Arm berührt. Er hatte gesehen, daß der Schleier ihr am Gesicht klebte.
Wieder trat er ans Fenster, die Lichter brannten noch. Er würde ein Mädchen hinüberschicken, die sie löschen würde, falls Grace zu bewegt war, es selber zu tun.
Wieder dachte er an den Untergang der Golden Plover. Adam war hier erschienen, als gerade Vizeadmiral Keens junge Frau Zenoria hiergewesen war. Auch Keen war damals auf der Golden Plover gefahren.
Zenoria aus dem Dorf Zenor. Er wußte, daß Allday irgend etwas zwischen den beiden vermutete, und er selber hatte sich auch gefragt, was in jener Nacht wohl geschehen war. Die Frau hatte später durch einen Unfall ihr Kind verloren, Keens Sohn, und hatte sich an der berüchtigten Klippe, dem Trystrans Leap, zu Tode gestürzt. Er selber hatte zusammen mit Lady Catherine den kleinen, zerschmetterten Leib nach oben getragen.
Adam Bolitho hatte sich sicher verändert. War er gereift? Er dachte darüber nach. Nein, die Veränderung reichte tiefer.
Etwas, das Allday immer gesagt hatte, fiel ihm wieder ein, wie der Epitaph in der Kirche: Sie sahen so richtig aus – zusammen.
Kapitän Adam Bolitho saß in einem der hochlehnigen Stühle vor dem offenen Feuer und hörte den Wind gelegentlich stöhnen. Die Windstärke nahm zu, kam aus Südost. Morgen müßten alle ihren Kopf beisammenhalten, wenn die Unrivalled auslief.
Er ruckte in seinem Stuhl, der mit einem zweiten zu den ältesten Möbeln im Haus gehörte. Er war von den dunklen Fenstern weg gewendet, weg von der See, und er schaute auf das Glas Brandy neben sich auf dem Tisch und sah im Licht der Kerzen, die diesen Raum zum Leben brachten, die Gemälde unbekannter Schiffe und vergessener Schlachten. Wie viele Bolithos haben wohl hier gesessen, fragte er sich, ohne zu wissen, was hinter dem Horizont liegt oder ob sie je zurückkehren würden. Sein Onkel mußte an dem Tag, als er sein Haus verließ und sich auf dem Flaggschiff einschiffte, das auch gedacht haben. Er hatte Catherine dort zurücklassen müssen, wo es jetzt nur dunkel war, bis auf das Licht bei Ferguson. Es würde weiter leuchten, bis im alten Haus jeder zu Bett gegangen war.
Leutnant Galbraiths Wunsch, in der Kirche dabeizusein, hatte ihn überrascht. Soweit Adam wußte, hatte er Richard Bolitho nie getroffen. Doch auf der Unrivalled hatte man gespürt, daß etwas fehlte, etwas, das sie verband.
Er fragte sich, ob Catherine wohl schlafen könne. Er hatte sie gebeten, hierzubleiben, aber sie hatte darauf bestanden, Nancy in ihr Haus auf dem benachbarten Gut zu begleiten.
Er hatte auf die Treppe gesehen, auf der sie sich im Stehen verabschiedeten. Ohne den Schleier sah sie bedrückt und müde aus. Und schön.
»Das wäre kein guter Anfang für dich, Adam. Wenn wir zusammen hierblieben, würde es Gerüchte geben. Die möchte ich dir ersparen.« Sie hatte das so entschlossen gesagt, daß er ihren Schmerz spürte, ihr Leid, das sie in der Kirche und hinterher niemandem zeigen wollte. Auch sie hatte sich in diesem Raum umgeblickt und sich erinnert. »Du hast ein neues Schiff, Adam, also muß dies der neue Anfang für dich sein. Ich werde mich um die Dinge hier in Falmouth kümmern. Das Gut istjetzt deins. Deins mit allen Rechten.« Damit hatte sie betont, was sie längst gewußt hatte.
Abrupt trat er jetzt an die große Familienbibel auf ihrem angestammten Platz auf dem Tisch, die die Geschichte einer Familie von Seefahrern enthielt, eine Ehrenliste. Er hatte sie öfter angesehen.
Mit großer Achtung schlug er die Seite auf und meinte, die Gesichter würden ihn beobachten, die Porträts hinter ihm und an der Treppe. Einen besonderen Eintrag gab es in der bekannten, geschwungenen Handschrift, die er so gut kannte und die er liebte – aus Briefen seines Onkels, aus verschiedenen Logbucheintragungen und aus Meldungen, als er unter Sir Richard als junger Offizier gedient hatte.
Vielleicht macht Catherine sich Sorgen über seine Rechte und sein Erbe. Das Datum der Eintragung war das, an dem sein Nachname Pascoe in Bolitho geändert worden war. Sein Onkel schrieb damals in die Bibel: Zur Erinnerung an meinen Bruder Hugh, Adams Vater, einst Leutnant in Seiner Britannischen Majestät Marine, der am 7 ten Mai 1795 fiel.
Der Ruf der Pflicht war der Weg zum Ruhm.
Sein Vater, der dieser Familie Schande gebracht hatte und der ihn als illegitimen Sohn zurückgelassen hatte…
Adam klappte die Bibel zu und nahm eine brennende Kerze. Die Treppe knarrte, als er am Porträt von Kapitän James Bolitho vorbeiging, der in Indien einen Arm verloren hatte. Mein Großvater. Bryan Ferguson hatte ihm etwas gezeigt, das man nur von einer Stelle aus im richtigen Tageslicht entdecken konnte: Der Künstler hatte nach seiner Rückkehr den Arm mit einem leeren, aufgepinnten Ärmei übermalt.
Auch in der Nacht hatte die Treppe geknarrt, als Zenoria von oben gekommen war und ihn hier unten weinend vorgefunden hatte, weil er mit der Nachricht nicht fertig geworden war, daß sein Onkel, Catherine und Valentine Keen mit der Golden Plover untergegangen waren. Der Wahnsinn, der dann folgte. Die Liebe, die nicht sein durfte. All dies, so viel Leidenschaft und so viel Leid, war in diesem Haus unterhalb vom Pendennis Castle eingefangen. Er öffnete die Tür und zögerte, als beobachte ihn jemand. Als sei sie vielleicht immer noch da…
Er ging durch den Raum und öffnete die schweren Vorhänge. Der Mond schien jetzt, und er konnte Wolken vor ihm vorbeihuschen sehen wie zerfetzte Fahnen.
Er sah sich im Raum um, sah das Bett, sah im spielenden Licht der Kerze die beiden Porträts. Eins zeigte seinen Onkel als jungen Kapitän in dem überholten Uniformrock mit weißen Aufschlägen, ein Bild, das seine Frau Cheney so sehr liebte. Das andere zeigte auf der gleichen Wand Cheney. Catherine hatte es restaurieren lassen, nachdem Belinda es verschwinden lassen wollte.
Er hielt die Kerze dichter an das dritte Porträt, das Catherine ihrem Richard nach dem Untergang der Golden Plover geschenkt hatte. Es zeigte sie in der Seemannskleidung, mit der sie sich bedeckt hatte, als sie mit den verzweifelten Überlebenden im gleichen Boot saß. »Die andere Catherine« hatte sie es betitelt, die Frau, die kaum jemand kannte, dachte er, außer dem Mann, den sie mehr als ihr Leben geliebt hatte. Catherine mußte hier gestanden haben, ehe sie das Haus mit Nancy verließ, denn hier duftete etwas nach Jasmin – wie ihre Haut, als sie ihn zum Abschied geküßt hatte und ihn festhielt, als wolle oder könne sie sich von ihm nicht trennen.
Er hatte ihre Hand an seine Lippen geführt, doch sie hatte den Kopf geschüttelt und ihm ins Gesicht gesehen, als fürchte sie, etwas zu verlieren. Er konnte sie immer noch fast körperlich spüren.
»Nein, Adam. Halt mich fest.« Sie hob das Kinn. »Küß mich!«
Er berührte das Bett, versuchte das Bild zu verdrängen. Küß mich. Waren sie jetzt beide so allein, daß sie Sicherheit bräuchten? War das der wahre Grund für Catherines Abschied an diesem furchtbaren Tag?
Er schloß die Tür hinter sich und ging die Treppe hinunter. Einige Kerzen waren verschwunden, andere waren so abgebrannt, daß sie kaum noch Licht gaben, aber die am Kamin waren erneuert worden. Eines der Hausmädchen mußte es erledigt haben. Er lächelte. In diesem Haus gab es keine Geheimnisse.
Er trank einen Schluck Brandy und fuhr mit den Fingern die Schnitzereien über dem Kaminsims entlang. Das Familienmotto, Für die Freiheit meines Landes, war durch viele Hände ganz glatt poliert worden. Von Männern, die das Haus nur verließen, Männern, die große Taten antrieben, Männern in Zweifel oder Angst.
Er setzte sich wieder.
Das Haus, der Ruf, den er zu pflegen hatte, die Leute, die sich auf ihn verließen – er würde Zeit brauchen, das Neue zu übernehmen oder auch nur zu verstehen.
Morgen würde er wieder Kapitän sein, das, was er immer sein wollte.
Er sah die Treppe empor und stellte sich Richard Bolitho vor, wie er hinabschritt für eine neue Aufgabe, um die Verantwortung zu übernehmen, die ihn eines Tages töten würde und ihn eines Tages auch getötet hatte.
Ich würde alles geben, deine Stimme wieder zu hören und deine Hand zu halten, Onkel.
Doch nur der Wind antwortete Adam.
Die beiden Reiter saßen ab und blieben stehen, durch Felsentrümmer etwas geschützt, hielten die Pferde am Zaumzeug und blickten über das schaumgekrönte Wasser der Bucht von Falmouth.
»Ob sie wohl kommt, Tom?«
Der ältere der beiden Küstenwächter zog sich den Hut tiefer in die Stirn. »Mister Ferguson glaubt’s jedenfalls. Wir sollten sie im Auge behalten, für alle Fälle.«
Der andere wollte reden. »Du kennst Mylady natürlich, Tom!«
»Wir haben ein-, zweimal ein paar Worte gewechselt.«
Er hätte gelächelt, wenn ihm das Herz nicht so schwer gewesen wäre. Sein junger Begleiter meinte es natürlich gut, und wenn er sich weiter an dieser Küste so bewährte, würde er es in ein paar Dienstjahren weit bringen. Lady Catherine Somervell kennen? Wie könnte er sie beschreiben? Selbst wenn er es wollte? Er sah das große unruhige Wasser, die Wogenkämme, die wie von einem Riesenkamm ausgerichtet wurden, und spürte den Wind, der hier seine Kraft erprobte.
Es war Mittag oder kurz davor. Als sie den Küstenpfad von der Stadt herauf geritten waren, hatte er kleine Gruppen von Leuten gesehen. Sie sahen aus, als seien sie aus alten Mythen aufgestiegen, die es hier in Cornwall in reicher Auswahl gab. Die Stadt und der Hafen lebten von der See, und die Leute hier hatten viel zu viele Söhne draußen verloren, um die Gefahren nicht zu beachten.
Wie sie beschreiben? Etwa von damals reden, als er versucht hatte, sie den leichten zerschmetterten Körper des Mädchens nicht sehen zu lassen, das durch einen Sprung von Tristram Leap Selbstmord begangen hatte? Er hatte gesehen, wie sie das Mädchen in den Armen hielt, das zerrissene und triefend nasse Kleid öffnete, um nach einer Narbe zu suchen, an der man sie identifizieren könnte. Denn das Gesicht war durch den Sturz und durch die See gänzlich zerstört worden. Das Mädchen hatte auf diesem kleinen, halbmondförmigen Stück Strand im ablaufenden Wasser gelegen, nachdem man den leblosen Körper durch die Brandung hereingeholt hatte. Das würde er nie vergessen – und er wollte es auch nicht.
Schließlich sagte er: »Eine schöne Dame.« Er erinnerte sich, was einer von Fergusons Freunden über sie gesagt hatte: »Die Frau eines Seemanns.«
Er war wie alle anderen in der Kirche gewesen und hatte sie dort stolz und aufrecht gesehen. Aber sie beschreiben?
»Hatte niemals zuviel zu tun und nahm sich nie so wichtig. Sie ließ dich immer spüren, daß du jemand bist. Sie ist anders als ein paar, die ich besser nicht nenne.«
Sein Begleiter sah ihn an und glaubte, ihn verstanden zu haben.
Dann sagte er: »Du hast recht, Tom. Da kommt sie.«
Tom nahm den Hut ab und beobachtete, wie die einsame Gestalt näher kam.
»Sag nichts. Heute nicht!«
Sie trug den alten, verschossenen Bootsmantel, den sie hier oben auf dem Klippenpfad oft benutzte. Ihr Haar war offen und wehte im Wind aus. Sie drehte sich um und sah auf die See hinaus, wie so oft bei solchen Spaziergängen. Von hier hatte man den besten Blick, sagten die Leute.
Beunruhigt meinte der jüngere der beiden Küstenwächter: »Du glaubst doch nicht etwa, daß sie…«
Tom wandte sich um, sein geschulter Blick kannte jede Bewegung und jede Stimmung der See in dieser Gegend.
»Nein!« Er sah die schönen Linien des Schiffes, das unter dem Pendennis Kap und der drohenden Burgruine gewendet hatte und sich jetzt hoch am Wind weit übergelehnt vorankämpfte und Kurs auf St. Anthony’s Head nahm. Es trug mehr Segel, als man bei diesem Wind erwartete, aber Tom wußte, was der Kommandant beabsichtigte. Er wollte vom Vorland und den schäumenden Riffen klarkommen und dann halsen, um mit dem Wind als Verbündetem das offene Wasser und die weite See zu gewinnen.
Ein knappes Manöver, aber hervorragend ausgeführt, vor allem, wenn es stimmte, was man hörte, daß die Unrivalled unterbesetzt war. Manche hätten es sicher tollkühn genannt. Tom erinnerte sich an den dunklen, energischen Kapitän, den er in der Kirche und auch sonst schon mal gesehen hatte. Er hatte beobachtet, wie weit der Mann es vom Midshipman bis zu diesem Augenblick gebracht hatte, sicher seiner bedeutendsten Aufgabe.
Er sah, wie die Frau den schäbigen Bootsmantel öffnete und unbewegt im keuchenden Wind stehenblieb, nicht in Schwarz, sondern in einem dunkelgrünen Kleid. Tom hatte sie hier schon früher gesehen, als sie auf ein anderes Schiff wartete. So daß der Ankommende sie entdecken, ihr Willkommen erahnen konnte.
Er sah, wie die Fregatte krängte, meinte das Quietschen der Blöcke zu hören, das Schlagen der Leinwand, als die Rahen herumgeholt wurden. Er hatte alles schon so oft gesehen. Er war ein einfacher Mann, der an dieser Küste seinen Dienst tat, im Krieg wie im Frieden.
Welches Schiff sah sie wohl jetzt gerade, fragte er sich. An welchen Augenblick dachte sie?
Catherine ging an den beiden Pferden vorbei, ohne etwas zu sagen.
Verlaß mich nicht.
II Kein Fremder mehr
Adam Bolitho legte eine Hand auf die Achterdeckreling und sah, wie der diesige Horizont kippte, als solle das ganze Schiff umgeworfen werden. Den größten Teil der Morgenwache hatten sie mit Segeldrill zugebracht, der wegen des böigen Windes noch ungemütlicher war als sonst. Er wehte exakt aus dem Norden und war stark genug, die Unrivalled, soweit zu krängen, bis die See gegen die geschlossenen Kanonenpforten rauschte und die Männer im Rigg und auf Deck durchnäßt wurden wie im tropischen Regen.
Vor drei Tagen war die Küste Cornwalls hinter dem Horizont versunken, und jeder Windhauch war gut genutzt worden.
Die meisten Männer verschwanden jetzt unter Deck. Die neuen an Bord, Leute vom Land, und andere, die sich noch nicht sicher genug fühlten, hielten sich an den Webleinen fest, wenn das Schiff sich nach Lee überlehnte und die See direkt unter ihnen zu sein schien. Selbst bei diesem Wind konnte man den Rum riechen, und Adam hatte bereits ein Fähnchen aus fettigem Rauch gesehen, der aus dem Schornstein der Kombüse stieg.
Er sah den Ersten Offizier an der Steuerbordleiter. Sein Gesicht verriet nichts.
»Das war besser, Mr. Galbraith.« Er meinte, Galbraiths Augen auf die Tasche wandern zu sehen, in der er seine alte Taschenuhr trug, und fragte sich, wie er sich wohl wieder als Leutnant fühlen würde, der Befehle nur auszuführen hatte, statt als Kommandant, der sie gab. »Lassen Sie die Wache nach unten wegtreten.«
Er hörte, wie die Matrosen ihre Stationen verließen, froh, daß man sie nicht weiter drangsalierte. Über ihrem Rum würden sie jetzt auf den Kapitän fluchen. Er wußte auch, daß der Master ihn beobachtete. Er stand wie immer neben dem Rudergänger, wenn das Schiff einen neuen Kurs lief oder durch den Wind ging.
Adam ging nach Luv hinüber, wischte sich Gischt aus dem Gesicht und stand schräg gegen das Deck geneigt, als die Segel sich wieder füllten und wie Brustpanzer standen. Die See war heute lebhaft und trug Schaumkronen, doch insgesamt ruhiger als in der Biskaya. Dank zuviel Gischt konnte er das Land nicht ausmachen, aber es war da, ein langer, purpurner Buckel wie eine Wolkenbank, vom Himmel gerutscht. Kap San Vincent. Und trotz des Drills und der vielen Kursänderungen: Um die Toppgasten und die neuen Männer einzuüben, war es ein exakter Landfall. Er kannte die Kalkulationen des Masters und seine täglichen Schätzungen der abgelaufenen Distanzen.
Joshua Cristies Gesicht war so wettergegerbt, daß er aussah wie der sprichwörtliche Wassermann, obwohl er erst zwischen vierzig und fünfzig Jahre alt war. Er hatte auf fast jeder Art von Schiffen gedient, vom Schoner bis zum Schiff der Zweiten Klasse, und er war seit über zehn Jahren als Master für die Navigation verantwortlich. Wenn die älteren Unteroffiziere das Rückgrat eines jeden Kriegsschiffes bildeten, dann war der Master so etwas wie sein Ruder. Die Unrivalled war glücklich, ihn zu haben.
Adam trat neben ihn und fragte: »Also morgen Gibraltar, oder?«
Cristie sah ihn unbewegt an. »Sehe kein Problem dabei, Sir.« Er war ein kurz angebundener, nüchterner Mann, der nie viele Worte machte.
Adam hatte bemerkt, daß Galbraith nach achtern gekommen und einen Midshipman mitgebracht hatte. Er prüfte sein Gedächtnis, richtig, das mußte Sandell sein.
Galbraith sagte: »Ich habe Sie beobachtet, Mr. Sandell. Ich habe Sie schon zweimal ermahnt. Disziplin ist eine Sache, Gewalt eine ganz andere!«
»Der Mann hat das mit Absicht getan, Sir. Er blieb zurück, damit wir die letzten wurden«, polterte der Midshipman los.
Üblicherweise zeigte Galbraith keine solche Erregung, vor allem dann nicht, wenn Wachgänger in der Nähe waren, die zuhören konnten. Es schien ihm Mühe zu machen, wieder ruhig zu werden.
»Ich weiß, daß Sie die Männer kontrollieren müssen, die Sie führen. Wenn Sie Offizier des Königs werden wollen, gehört das dazu. Inspirieren Sie sie, überreden Sie sie meinetwegen, aber mißbrauchen Sie sie nicht. Ich werde Sie daran nicht noch mal erinnern.«
Der Midshipman hob grüßend die Hand an den Hutrand und zog sich zurück. Adam sah nur flüchtig sein Profil. Galbraith hatte sich gerade einen Feind gemacht, wie es alle Ersten Offiziere überall taten.
Jetzt kam er das schräge Deck empor und sagte: »Ein Rohling. Nutzt das Tauende viel zu schnell. Ich weiß, daß der betreffende Mann die ganze Übung aufhielt, ich habe es selber gesehen. Doch es fehlen uns sechzig Männer, und manche von denen, die wir kürzlich übernommen haben, sind Tölpel. Aber wir müssen uns mehr Mühe geben.«
Adam war, als lichte sich der Nebel hinter dem Fernglas. Er erinnerte sich plötzlich, daß er kürzlich gehört hatte, man habe einen Midshipman an Land gesetzt, um ihn vor ein Kriegsgericht zu stellen, weil ein Seemann durch einen Unfall auf See ums Leben gekommen war. Die Sache wurde dann doch nicht verhandelt, man versetzte den Midshipman nur auf ein anderes Schiff. Er war der Sohn eines Admirals. Geschehen war das Ganze um die Zeit, als Galbraith das Kommando nicht bekam, das ihm versprochen worden war. Keiner konnte irgendeinen Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen herstellen, und es würde auch kaum einen interessieren – außer Galbraith. Nun war er hier als Stellvertreter des Kommandanten einer der mächtigsten Fregatten. Würde er damit zufrieden sein? Oder würde er jetzt zu sehr um seine weitere Laufbahn besorgt sein und nichts von dem Schwung zeigen, mit dem er einst sein eigenes Kommando bekommen wollte?
»Befehle, Sir?«
Adam blickte auf die nächsten Achtzehnpfünder. Auch so ein Unterschied. Die Bewaffnung der Unrivalled bestand hauptsächlich aus diesen Kanonen, und sie waren das größte Gewicht an Deck. Die Schiffbauer hatten darauf bestanden, daß die Kanonen, die üblicherweise neun Fuß lang waren, einen Fuß kürzer gegossen wurden, weil man damit etwas von dem Gewicht oben reduzieren konnte.
Eine Fregatte war nur so gut wie ihre Feuerkraft und ihre Beweglichkeit, und Adam war sehr wohl aufgefallen, daß die See bis fast an die Kanonendeckel an Lee schlug. In einem wütenden Gefecht Schiff gegen Schiff konnte sich kein Kommandant mehr auf die Überlegenheit verlassen, die ihm die bessere Position im Wind bot.
Er sagte: »Wir werden heute nachmittag die Backbord-Batterien exerzieren, Mr. Galbraith. Ich möchte, daß unsere Männer die Kanonen in- und auswendig kennen. Sie sagten, wir haben eine zu geringe Besatzung. Wenn wir die Batterien auf beiden Seiten gleichzeitig besetzen müssen, kriegen wir wirklich zu tun.« Er bemerkte ein leichtes Stirnrunzeln. »Gut, vielleicht müssen wir niemals kämpfen. Der Krieg ist vielleicht schon wieder vorbei, wer weiß.« Er berührte seinen Arm und spürte, wie der andere zuckte. »Aber wenn wir kämpfen müssen, dann lege ich Wert darauf, daß dieses Schiff gewinnt.«
Galbraith tippte an den Hut und verschwand und würde jetzt in der Messe einen Haufen Fragen und manches Murren zu hören bekommen.
Adam trat an die triefenden Finknetze und hielt sich gerade, als das Deck unter einer neuen Bö wieder stark krängte. Das Land war jetzt fast außer Sicht. Kap St. Vincent, Schauplatz einer der größten Seeschlachten! Nelson hatte sich einfach über die strengen Kampfinstruktionen hinweggesetzt und das spanische Flaggschiff Santissima Trinidad angegriffen, das mit einhundertdreißig Kanonen das größte Kriegsschiff der Welt war. Wie mein Onkel, dachte Adam. Sir Richard Bolitho hatte niemals zugelassen, daß die üblichen Regeln über das Führen von Gefechten und Schlachten seine Initiative einschränkten oder seinen persönlichen Mut. Irgendwie war es bedauerlich, daß die beiden Admiräle, die von denen, die sie führten, so bewundert und geliebt wurden, sich nie getroffen hatten.
Er wischte sich mit dem feuchten Taschentuch übers Gesicht, das nun ganz naß vom Schaum war. Es ähnelte dem Tuch, das er Catherine in der Kirche gereicht hatte, damit sie sich die Tränen hinter dem Schleier trocknen konnte. Auch Galbraith hatte das bemerkt…
Ärgerlich schüttelte er sich und trat die Reling. Ein paar Männer waren mit Spleißen und Reparaturen beschäftigt. Auf jeder Fregatte mußten das Rigg und die Leinen ständig gewartet werden. Einige blickten auf und sofort zur Seite. Das also waren die Männer, mit denen aus einem Schiff etwas wurde – oder nicht. Er grinste ein bißchen grimmig. Oder aus seinem Kommandanten. Einige Männer kamen direkt von den Gerichtsschranken, waren Schuldner oder Diebe, Tyrannen oder Feiglinge. Ihre Alternativen hießen Verbannung und Strick. Er sah Schaum über das Vordeck rauschen, die Galionsfigur mußte jetzt wie eine Nymphe glänzen, die gerade aus der See aufgetaucht war. Die Unrivalled würde alle zusammenführen, aus ihnen eine Mannschaft, eine Gemeinschaft machen.
Welche Befehle würden auf sie in Gibraltar warten? Wieder nach England zurückzukehren? Oder umgeleitet zu werden zu einem anderen Geschwader in einem fernen Ozean? Wenn sich nichts geändert hatte, würde er noch nach Malta weitersegeln und zum neuen Geschwader unter der Flagge von Vizeadmiral Sir Graham Bethune stoßen. Bethune war mit dem Befehl gekommen, Sir Richard Bolitho abzulösen, aber das Schicksal hatte anders entschieden. Wenn nun Bethune gefallen und Sir Richard Bolitho zurückgekehrt wäre zu seiner Catherine, zu Kate?
Wie später Adam war Bethune früher einer von Bolithos Midshipmen auf seinem ersten Schiff, der kleinen Sparrow, gewesen. Auch Valentine Keen war noch Midshipman, als Richard Bolitho schon eine Fregatte führte. So viele Gesichter waren verschwunden. Wir wenig Beglückten, ein Kreis verschworener Brüder. Jetzt gab es nur noch wenige.
Er sah, wie zwei der jungen Herren über Deck marschierten und sich trotz krachender Leinwand und Seewasserduschen unterhielten, als kümmere sie auf der ganzen Welt nichts.
Diesmal hatte er nur fünf an Bord. Er müßte sie endlich kennenlernen. Galbraiths scharfe Bemerkung über Begeisterung und Führung galt ja in beide Richtungen, hatte immer nach oben und nach unten gegolten. Auf großen Schiffen, die ganze Horden von Midshipmen an Bord hatten, bestand immer die Gefahr, daß es zu Schikanen und Unterdrückung kam. Er hatte es am eigenen Leib erfahren, wie manches andere in seiner Laufbahn. Es hatte ihn gelehrt, sich zu wehren und für andere einzutreten, die das weniger gut als er konnten.
Heute würde sein Ruf, mit Pistole und Klinge hervorragend umzugehen, jedes Problem auslöschen, ehe es überhaupt entstand. Das war kein leichter Weg gewesen. Er hatte Zeit gebraucht, dererlei zu begreifen und damit fertig zu werden. Ein Lehrer hatte ihm an Land regelmäßig Fechtunterricht erteilt. Später hatte er dann im Umgang mit dem Säbel alle Feinheiten des Angreifens und der Verteidigung gelernt. Hatte er eigentlich nie wissen wollen, wie diese Stunden bezahlt wurden? Einmal hatte er im Nebenraum seinen Fechtlehrer im Bett mit seiner Mutter gehört. Und später andere Männer.
Jetzt war alles anders. Mochte man von seiner Mutter halten, was man wollte – doch keiner wagte mehr, in seiner Gegenwart ihren Namen zu beschmutzen. Nur die Erinnerung blieb wie eine nicht heilende Wunde.
Er beobachtete Fielding, den Midshipman der Wache, der gerade etwas auf seine Tafel schrieb, die Lippen konzentriert gespitzt. Der hatte ihn doch an jenem Morgen geweckt, als er keine Kraft hatte, sich aus dem Traum zu lösen!
Er mußte wieder an Catherine denken, ihren letzten verzweifelten Kuß, ehe sie das Haus verließ. Um meinen Ruf zu schützen. Aber gegen Träume konnte man sich nicht wehren. Und in solchen Träumen hatte sie ihn nie abgewehrt.
Hinter sich hörte er ein Hüsteln: Usher, der Sekretär, der mal Gehilfe des Zahlmeisters gewesen war, ein kleiner, nervöser Mann, der in einem Kriegsschiff so ganz fehl am Platze schien. O’Beirne, der grobschlächtige Arzt, hatte ihm anvertraut, daß der Mann starb, »jeden Tag ein bißchen« – in seinen Worten. Seine Lungen waren krank, was in diesen engen Schiffen häufig genug vorkam. Er mußte an den rundlichen Yovell denken, den Sekretär seines Onkels. Ein belesener Mann, den man nie ohne Bibel sah. Auch er mußte damals dabeigewesen sein… Er wischte die Erinnerung weg und drehte sich um.
»Ja, Usher?«
»Ich habe die Listen abgeschrieben, Sir, jede dreimal.« Er hielt es für nötig, ständig alle Einzelheiten seiner Arbeit zu nennen.
»Sehr gut. Ich werde sie abzeichnen, wenn ich gegessen habe.«
»An Deck! Segel an Steuerbord voraus!«
Alle sahen hoch. Die Stimme des Ausgucks war auf dieser Reise bisher selten zu hören gewesen.
Der Master drückte sich den Hut fester in die Stirn und sagte: »Soll ich noch einen Mann hochschicken, Sir?«
Adam sah ihn an. Cristie war ein Fachmann, sonst würde er nicht hier stehen. Die Bemerkung war also nicht zufällig. Und jetzt tauchte auch Wynter eilig aus dem Kartenhäuschen auf, der Dritte Offizier, der die Wache hatte. Zwiebackkrümel auf seinem Uniformrock verrieten, was er gerade getan hatte. Er war jung, hellwach und brachte viel zustande, doch wenn nötig, konnte er eine so leere Miene aufsetzen, daß niemand erkennen konnte, was er dachte. Für einen so jungen Offizier war das ungewöhnlich. Doch sein Vater war Parlamentsabgeordneter, und das mochte vieles erklären.
»Mr. Fielding, Ihr Glas. Ich werde selber aufentern«, sagte Adam. Er merkte, wie Cristie ihn schärfer ansah. »Ich werde nicht reffen. Noch nicht.« Er klemmte seinen Hut in den Niedergang und spürte auf der Stirn das nasse Haar. »Vielleicht ein Handelsschiff, das die Gesellschaft einer Fregatte sucht?« Er schüttelte den Kopf, als habe jemand eine Antwort gegeben. »Nein, wahrscheinlich nicht. Ich kenne ein paar Offiziere, die sich nicht scheuen würden, bei dem an Bord nach ein paar guten Leuten zu suchen, ganz gleich, wie die Instruktionen der Admiralität lauten mögen.«
Cristie zeigte ein seltenes Lächeln. Er mußte es wissen. Selbst Seeleute, die der offizielle Schutzbrief eigentlich vor den Wünschen einer ewig hungrigen Flotte bewahren sollte, waren gepreßt worden. Monate vergingen, ehe man so etwas entdeckte und etwas dagegen unternahm.
Cristie meinte: »Wenn der weiter in Luv bleibt, Sir, werden wir ihn nie einholen können!«
Adam sah in die gewaltigen Masten über sich. Aber warum? Wollte das andere Schiff etwas beweisen? Seine Kühnheit zum Beispiel?
Er hängte sich das große Teleskop über die Schulter und ging nach vorn an die Großrüsten. In den schwankenden Rahen würde der Ausguck wie ein Seevogel hocken, der sich um die Welt unter seinen baumelnden Beinen nicht kümmerte, weil sie ihm egal war.
Die anderen beobachteten ihn, und dann wollte Leutnant Wynter wissen: »Was liegt ihm im Magen, Mr. Cristie? Warum weiß er immer mehr als wir alle?«
»Dem Kapitän entgeht kaum was, Mr. Wynter.« Er deutete auf die Zwiebackkrümel. »Ihr kleines Vergnügen zum Beispiel auch nicht.«
Ein Matrose murmelte: »Da kommt der Erste, Sir!«
»Verdammt«, Wynter sah hinter dem schlanken Kapitän her und beugte sich hinten weit über das weiße Wasser, das hinter dem schmal gehaltenen Heck ablief. Er war zweiundzwanzig Jahre alt und erinnerte sich, wie man ihm gratulierte und ihn gleichzeitig beneidete, als er auf die Unrivalled