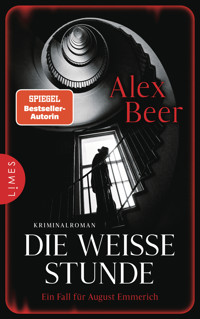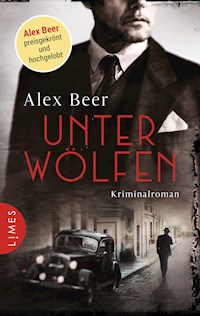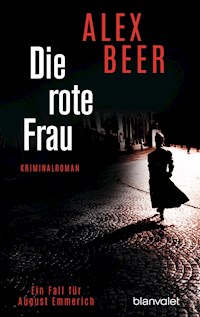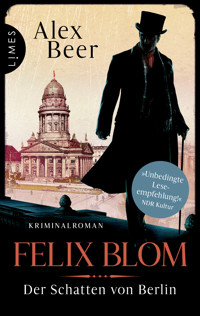
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Felix-Blom-Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein aufgebrochener Sarg. Ein mysteriöser Todesfall.
Ein brillanter Meisterdetektiv.
Der zweite Fall für den ehemaligen Gauner Felix Blom aus der Feder von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Alex Beer!
Berlin, 1879: Der ehemalige Gauner Felix Blom und seine Geschäftspartnerin Mathilde Voss stehen kurz vor dem Bankrott. Da kommt den beiden Detektiven ein lukrativer Auftrag sehr gelegen: Sie sollen herausfinden, wer in die Gruft eines kürzlich verstorbenen Archäologie-Professors eingedrungen ist. Der Sarg wurde aufgebrochen, jedoch nichts gestohlen. Kurz darauf wird ein Kleinganove brutal ermordet, und die Fälle scheinen miteinander verbunden zu sein. Die Spur führt ausgerechnet zu Bloms einstigem Mentor, dem gerissenen Gangsterboss Arthur Lugowski. Felix und Mathilde ahnen nicht, dass sie bald zwischen die Fronten rivalisierender Banden geraten und Blom den Fall nicht nur mit legalen Mitteln lösen kann …
Basierend auf einer wahren Begebenheit.
Lesen Sie auch die andern Bücher von Alex Beer!
Die Kriminalinspektor-Emmerich-Reihe:
Der zweite Reiter: Ein Fall für August Emmerich (Bd. 1)
Die rote Frau: Ein Fall für August Emmerich (Bd. 2)
Der dunkle Bote: Ein Fall für August Emmerich (Bd. 3)
Das schwarze Band: Ein Fall für August Emmerich (Bd. 4)
Der letzte Tod: Ein Fall für August Emmerich (Bd. 5)
Die Isaak-Rubinstein-Reihe:
Unter Wölfen (Bd. 1)
Unter Wölfen – Der verborgene Feind (Bd. 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Berlin, 1879: Der ehemalige Gauner Felix Blom und seine Geschäftspartnerin Mathilde Voss stehen kurz vor dem Bankrott. Da kommt den beiden Detektiven ein lukrativer Auftrag sehr gelegen: Sie sollen herausfinden, wer in die Gruft eines kürzlich verstorbenen Archäologie-Professors eingedrungen ist. Der Sarg wurde aufgebrochen, jedoch nichts gestohlen. Kurz darauf wird ein Kleinganove brutal ermordet, und die Fälle scheinen miteinander verbunden zu sein. Die Spur führt ausgerechnet zu Bloms einstigem Mentor, dem gerissenen Gangsterboss Arthur Lugowski. Felix und Mathilde ahnen nicht, dass sie bald zwischen die Fronten rivalisierender Banden geraten und Blom den Fall nicht nur mit legalen Mitteln lösen kann …
Die Autorin
Alex Beer, geboren in Bregenz, hat Archäologie studiert und lebt in Wien. Für ihre Kriminalromane wurde sie mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter der Leo-Perutz-Preis für Kriminalliteratur 2017 und 2019, der Krimi-Publikumspreis des Deutschen Buchhandels MIMI 2020, der Österreichische Krimipreis 2019 sowie der Fine Crime Award 2021. Zudem stand sie auf den Shortlists für den Friedrich Glauser Preis, den Viktor Crime Award und den Crime Cologne Award. Mit Felix Blom – einem ehemaligen Gauner, der im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts zum Detektiv wird – hat sie einen charmanten neuen Ermittler erschaffen, der die Krimifans begeistert.
Alex Beer
Felix Blom – Der Schatten von Berlin
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Alex Beer
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Kai Gathemann GbR.
© 2023 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Regine Weißbrod
Covergestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com(schab, bluepen, ilolab, Thomas Jablonski, Michal), Colin Thomas / bookcoversphotolibrary.com und World History Archive / Alamy Stock Photo
KW · Herstellung: DiMo
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30430-0V004
www.limes-verlag.de/
Aus der Berliner Gerichtszeitung vom 4. März 1879
Die auf dem St. Hedwigs-Kirchhofe befindliche Kapelle und die darunter gelegene Leichenhalle ist in der Nacht vom 28. Februar zum 1. März mittels Nachschlüssels, resp. Dietriche geöffnet, in der Kapelle das Tabernakel erbrochen und von einem in der Sakristei stehenden Kandelaber aus Zink ein Arm gewaltsam abgebrochen worden. Der Arm fand sich auf dem Altartisch vor. Ferner wurde das dort befindliche Erbbegräbnis* der Familie R. gleichfalls durch Nachschlüssel geöffnet, von dem darin freistehenden Sarge der Holzdeckel abgeschraubt und hinuntergeworfen und sodann am Kopfende der Leiche der Zinksarg, welcher sich in dem Holzsarg befand, so weit aufgeschnitten, dass man bequem mit der Hand in den Sarg hineingreifen konnte; die Leiche ist jedoch, wie am folgenden Morgen festgestellt wurde, unberührt geblieben, und aus dem Erbbegräbnis nichts gestohlen worden. Spuren, welche auf die Täter leiten, sind bis jetzt nicht bekannt geworden. Die etwa vorhandenen Fußspuren sind vom Schneefall verdeckt, und es lässt sich daher nicht einmal feststellen, von wo aus die Einbrecher in den Kirchhof eingedrungen sind.
* Familiengrab
1
Schneeflocken wirbelten wild tanzend durch die Luft und verpassten der Stadt einen feuchtkalten Anstrich. Mit hochgezogenen Schultern, die Hände tief in den Taschen seiner groben Wolljacke vergraben, stemmte sich Christian Kamerling dem Wind entgegen und eilte durch die Nacht.
Es war nicht sein erster Einbruch. Wie immer hatte er sich gut vorbereitet, dennoch war er dieses Mal nervös. Nervös und angespannt. Mit jedem Schritt ging sein Puls schneller. Die Kiste, die er aufbrechen musste, war eine besondere Herausforderung, und zwar nicht im guten Sinn.
Fröstelnd bog er in die Liesenstraße und blies warmen Atem in seine Fäuste. Je näher er dem Stadtrand kam, desto finsterer und einsamer wurde die Umgebung. Die Anzahl der Häuser, Zäune und Lichter nahm ab, und auch die der Menschen, zumindest die der lebenden.
Hier begann das Reich der Toten.
Als der Raum auf den innerstädtischen Friedhöfen knapp geworden war, hatten die Kirchengemeinden begonnen, ihre Verstorbenen vor den Toren der Stadt zu begraben.
Juden, Protestanten, Muslime … sie alle waren ihm einerlei. Aber Katholiken … Katholiken fand Kamerling zum Fürchten. Sie glaubten an den Teufel, verzehrten den Leib Christi und dekorierten ihre Kirchen mit den Bildern gefolterter Männer und Frauen. Und ausgerechnet einen solchen Katholiken musste er nun heimsuchen.
Beim Gottesacker der Pfarrei St. Hedwig angelangt, tastete Kamerling die massive Mauer ab, die das Gelände umschloss. »Komm schon«, murmelte er ungeduldig und nickte zufrieden, als seine Finger auf Hüfthöhe eine Lücke zwischen zwei Ziegelsteinen fanden. Er schob einen Fuß hinein, schwang seinen Seesack über die Schulter und zog sich hoch.
»Verdammt«, murrte er, als er sich an einer spitzen Kante das Hosenbein aufriss. Kamerling hatte nie verstanden, warum Friedhöfe umzäunt waren. Es war ja nicht so, als müsste man irgendjemanden daran hindern, von dort abzuhauen.
Auf der anderen Seite angelangt, kroch ihm beim Anblick der vielen Grabsteine und Kreuze, die sich in der Dunkelheit vor ihm ausbreiteten, ein Schauer über den Rücken. Erzählungen von Wiedergängern und Untoten fielen ihm ein. Ein leises Rascheln neben sich ließ Kamerling zusammenzucken. Er fuhr herum, doch es war nur der Wind gewesen, der mit den Zweigen eines Baums gespielt hatte. Mit wild pochendem Herzen huschte er den schneebedeckten Weg entlang durch die Stille. Nirgendwo flackerten Kerzen, und auch das schiefe kleine Haus des Totengräbers, das etwas abseits stand, wirkte verlassen. Entweder saß der Kerl in einer gemütlichen Gaststube und wärmte sich an heißem Grog und einem üppigen Busen, oder er schlief. Beide Optionen sollten ihm recht sein. Hauptsache, er blieb ungestört.
Kamerling eilte zur zentral gelegenen Friedhofskapelle, einem runden Backsteingebäude, an dessen Rückseite sich ein quadratischer Anbau befand. Dieser war sein eigentliches Ziel.
Vor der Eichenholztür hielt er inne und drehte sich um. Der Schneefall war inzwischen so dicht und stark, dass er seine Fußspuren innerhalb kürzester Zeit zudecken würde. »Gut so«, murmelte er.
Mit klammen Fingern schloss Kamerling die Pforte auf, trat ein und fand sich in einem kleinen Vorraum wieder, in dem es nach einem Gemisch aus Weihrauch, altem Holz und Kalkmörtel roch. Er klopfte sich den Schnee von der Schiebermütze, blies abermals Atem in seine Fäuste, zog anschließend eine Packung Schwefelhölzer aus dem Seesack und versuchte eines davon zu entfachen.
Als es ihm endlich gelang, zündete er die mitgebrachte Lampe an, hob sie in die Höhe und sah sich um. Dann suchte er in seiner Tasche nach einem weiteren Schlüssel. Es waren insgesamt drei an der Zahl, die er heute Nacht verwenden würde.
Er ignorierte die weiß getünchte, metallbeschlagene Tür, hinter der sich, wie er in Erfahrung gebracht hatte, die sogenannte Sakristei befand, und wandte sich einer unscheinbaren braunen Pforte zu, die tief in die dicke Steinmauer eingelassen war. Das, was sie verborgen hielt, war tausendmal wertvoller als die Schätze, die die Priester im Nebenraum horteten. Kamerling öffnete das Schloss und setzte einen Fuß auf die steinerne Wendeltreppe, die von hier in die Krypta führte. Die Flamme in seiner Laterne zeichnete groteske Schatten an die Wände. Obwohl er nicht gläubig war, bekreuzigte er sich. Dann stieg er langsam in die Tiefe.
Dort herrschte Grabesstille, im wahrsten Sinn des Wortes. Nur aus weiter Ferne ließ sich das Tosen des Windes erahnen. Und es war frostig. Die Kälte hier schien durchdringender zu sein als jene im Freien und kroch tiefer in die Knochen – bis ins Mark.
Kamerlings größtes Problem war jedoch nicht die Temperatur, es war die Räumlichkeit an sich. Eine Art Friedhof unter der Kapelle, der wohl unheimlichste Ort, den er sich auszumalen vermochte. Es fiel ihm schwer, nicht Reißaus zu nehmen.
»Alles wird gut«, murmelte er leise. Der Klang seiner Stimme beruhigte ihn, weswegen er weitersprach. »In wenigen Minuten ist die Sache wieder im Reinen.«
Sobald diese verfluchte Mission erfüllt war, würde er zum Spreewirt gehen, einen Platz vor dem Kamin suchen und sich ein paar Hochprozentige hinter die Binde kippen. Vor dem Feuer sitzend würde er sich an diesen Moment erinnern und lachen.
Er zog den letzten Schlüssel aus seiner Jackentasche und betrachtete ihn. Er war filigraner als die beiden zuvor. Ein besonderer Schlüssel für ein besonderes Schloss.
Leise seufzend musterte Kamerling die schmalen Türen, die sich rings um ihn herum befanden. Türen, hinter denen Grabkammern lagen. Er leuchtete die Metallschilder an, die Auskunft gaben, wer in der jeweiligen Gruft bestattet worden war, bis er jenes der Familie Rohland gefunden hatte.
Die Rohlands waren ein altes Kaufmannsgeschlecht, wie es im Buche stand: strebsam, reich und generös – besonders dann, wenn es ihnen einen Vorteil verschaffte. Sie hatten Geld für den Bau dieser Kapelle gestiftet und im Gegenzug die Erlaubnis erhalten, ihre Angehörigen in der Krypta zu bestatten. Wohlhabende Menschen wurden nicht draußen im Freien beerdigt, wo ihre Gräber Wind und Wetter ausgesetzt waren. Sie durften die ewige Ruhe gut geschützt im Trockenen verbringen.
Geld regierte die Welt – die der Lebenden und die der Toten. »Wahrscheinlich sogar das Jenseits«, murrte er, während er den Schlüssel in das Schloss steckte und umdrehte.
Mit leisem Knarren öffnete sich die Tür.
Alles in ihm sträubte sich dagegen, das dahinterliegende Gewölbe zu betreten. Seine Großmutter war überzeugt, dass Tote, deren Ruhe man störte, zu Wiedergängern wurden, die den ungebetenen Besucher verfolgen würden.
Bis in alle Ewigkeit.
Aber es musste sein. Er atmete tief ein und schritt in die Grabkammer. Dort roch es modrig und erdig mit einem Hauch von Schimmel. Er stellte seinen Seesack und die Lampe auf den Boden, zündete die Kerzen an, die in einer Halterung an der Wand steckten, und sah sich um.
Die Gruft war niedrig und eng, die Mauern bestanden aus grob behauenem Stein, der Boden aus gestampftem Lehm. Gegenüber der Tür hing ein mannshohes Kruzifix, darunter standen auf einer Art Podest fünf Eichensärge. Einer davon sah neuer und weniger verstaubt aus als die anderen. Auch war er der einzige, auf dem welke Lilien und ein Rosenkranz aus schwarzen Perlen lagen.
Kamerling entzifferte die Plakette, die darauf angebracht war: Eduard Rohland (* 1802 – † 1879).
Das war er. Der Mann, dessentwegen er gekommen war.
Plötzlich strich ihm ein kalter Lufthauch über die Wange, und er glaubte ein Geräusch hinter sich zu vernehmen. Er schnellte herum, hob die Laterne auf und hielt sie in die Höhe. Seine Hand bebte. Licht und Schatten erschufen Bewegungen, wo keine waren.
Oder etwa doch?
Obwohl es eiskalt war, begann Kamerling zu schwitzen.
»Ist da jemand?«, fragte er mit heiserer Stimme und lauschte.
Nichts.
Eilig zog er sein Werkzeug aus dem Seesack und legte es auf das Podest. Er musste sich beeilen, bevor seine Sinne ihm weitere Streiche spielten. So schnell es ihm mit seinen zitternden Händen möglich war, löste er die festsitzenden Schrauben aus dem Holzdeckel von Eduard Rohlands Sarg.
Mit angehaltenem Atem hob er ihn hoch, wobei er ihm aus den klammen Händen rutschte und mit einem ohrenbetäubenden Knall auf den Boden schlug. »Herr im Himmel«, entfuhr es ihm. Er fasste sich ans Herz, trat an die Tür und lauschte. Hatte jemand den Lärm gehört?
Offenbar nicht. Wer denn auch? Außer ihm war niemand hier – zumindest niemand mit einem Puls.
Kamerling ging zurück, schaute in den Sarg und stöhnte auf. »Verdammt«, fluchte er. Ihm blickte nämlich nicht Herr Rohland entgegen, sondern ein weiterer Sarg. Eine massive, mattgraue Kiste, die – wenn er sich nicht täuschte – aus Zink gefertigt war. Hektisch ließ er die Fingerspitzen über die raue Oberfläche gleiten und suchte verzweifelt nach einer Möglichkeit, das vermaledeite Ding aufzumachen. Gab es denn nirgendwo ein Schloss oder einen Riegel?
Nein, dieses Behältnis war nicht dafür gedacht, jemals wieder geöffnet zu werden.
Er nahm sein Werkzeug und machte sich am Kopfende des Zinksargs zu schaffen. Als Kamerling das widerspenstige Metall endlich durchdrungen hatte, strömte ihm ein süßlich fauliger Geruch entgegen, und er musste ein Würgen unterdrücken. Schnell wickelte er seinen Schal über Mund und Nase. Angewidert weitete er das Loch, bis es groß genug war, dann hielt er inne.
Er schloss die Augen und steckte langsam die Hand in die Öffnung. Darin ertastete er edlen Stoff, schob die Finger darunter, fühlte weiter und fand endlich, wonach er gesucht hatte.
Erleichterung durchfuhr ihn. Kamerling zog seinen Schatz aus dem Sarg, packte seine Sachen ein, nahm die Laterne und huschte aus der Grabkammer. Er konnte es nicht erwarten, diesem Ort zu entkommen. Den Korn beim Spreewirt hatte er sich wahrlich verdient.
So schnell es ihm bei den schlechten Lichtverhältnissen möglich war, durchquerte er die Krypta und setzte gerade einen Fuß auf die unterste Stufe der Treppe, als hinter ihm ein Geräusch erklang.
Wie angewurzelt blieb er stehen.
Großmutters Geschichte von den Untoten tauchte wieder in seinen Gedanken auf. Er wollte fliehen, davonrennen, so schnell ihn seine zitternden Beine trugen, doch er war starr vor Schreck. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Und höher. »Ist da jemand?«
»Aber ja«, sagte eine heisere Stimme. »Ich habe auf dich gewartet.«
Kamerling hielt den Atem an, drehte sich langsam um und starrte in die Dunkelheit.
»Gib ihn mir«, fackelte der ungebetene Gast, bei dem es sich um einen Mann aus Fleisch und Blut handelte, nicht lange herum.
»Verschwinde!« Kamerling ließ den Seesack von seiner Schulter gleiten, beugte sich darüber und tastete nach seinem Werkzeug.
Doch er war nicht schnell genug.
Der andere huschte flink und lautlos wie eine Raubkatze auf ihn zu. Als der Fremde endlich in den Lichtkegel der Laterne trat, konnte Kamerling erkennen, dass der Kerl einen massiven Kandelaber in der Hand hielt. Ehe er sichs versah, sauste der schwere Lüster auf ihn nieder.
Alles wurde schwarz.
2
Der Morgen war äußerst unwirtlich. Wieder einmal. Graupelkörner prasselten gegen die Fensterscheibe, Wind pfiff durch alle Ritzen, und der Himmel war mit dicken grauen Wolken verhangen. Dieser Winter war einer der längsten und härtesten, die Berlin in den letzten Jahrzehnten erlebt hatte. Seit Wochen herrschte heftiger Niederschlag, immer wieder peitschten orkanartige Windstürme durch die Stadt, und der Frost fraß sich gnadenlos durch das Mauerwerk.
»Wir brauchen mehr Feuerholz.« Felix Blom gähnte, rieb die Hände aneinander und schob ein paar Holzscheite in den gusseisernen Ofen, der im hinteren Teil der Detektei stand. Ein Anflug von Wärme breitete sich in dem kleinen Raum aus, begleitet von leisem Knistern und Knacken. Die Luft erfüllte sich mit dem Geruch von Rauch und Harz. »Außerdem benötigen wir neue Flugblätter und Visitenkarten. Das könnte mit dem Geld knapp werden.« Er strich seinen Gehrock glatt, schlang seinen Schal enger um den Hals und schritt in die Kammer, die an das Büro anschloss. »Verdammte Kälte«, murmelte er. »Heute Nacht sind mir die Haare am Kissen angefroren, und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal meine Zehen gespürt habe.«
Seine Geschäftspartnerin, Mathilde Voss, schenkte dem Gezeter keine Beachtung. Sie starrte in ein großes, mit Regenwasser gefülltes Gurkenglas, in dem sich ein Blutegel wand. »Er ist hektisch«, erklärte sie. »Und er schwimmt oben. Das bedeutet, noch mehr schlechtes Wetter.« Sie stellte das hausgemachte Barometer auf den Schreibtisch, bückte sich, hob einen Karton voller Stofffetzen auf und stellte ihn neben den kleinen Blutsauger.
»Ein Königreich für ein paar Sonnenstrahlen und eine Handvoll zahlungskräftiger Kunden.« Blom kratzte sich am Kinn. Dann füllte er missmutig Kaffeebohnen in eine hölzerne Mühle und hielt Mathilde die halbleere Blechdose vor die Nase. »Der Kaffee ist bald alle, genau wie das Holz, und gegen den hässlichen Wasserfleck an der Decke haben wir auch noch nichts unternommen.« Er setzte sich und murmelte irgendetwas Unverständliches in seinen Dreitagebart.
Mathilde wandte sich dem windschiefen Fensterrahmen zu. »Was ist los? Warum so miese Laune? Ist gestern Abend was passiert?« Mit stoischer Gelassenheit stopfte sie die Fetzen in Löcher und Ritzen, durch die eisige Luft drang. »Du warst doch in der Oper? Oder etwa nicht? Üblicherweise bist du danach immer ganz glückselig.«
Blom klemmte die Mühle zwischen seine Knie und begann ruckartig den Kaffee zu mahlen. »Ich habe die Schnauze voll davon, pleite zu sein, mich reinschummeln zu müssen und dann auf irgendeinem billigen Platz zu stehen. Gestern wurde La Traviata gegeben. Ich habe so gut wie nichts davon mitbekommen. Nicht nur dass ich kaum etwas gesehen habe, ich habe auch fast nichts gehört, weil die Leute neben mir ständig die Klappe offen hatten. Bei Addio del passato haben sie über die Kaninchenplage im Humboldthain geredet. Kannst du dir das vorstellen? Während auf der Bühne Violetta in den Armen ihres Liebsten stirbt, diskutieren diese Banausen über Karnickel.«
Mathilde zündete eine Kerze an und hielt die Flamme vor den Fensterrahmen, um herauszufinden, ob es noch immer hereinzog. »Wart nur ab, wenn das Geschäft endlich gut läuft, kannst du dir wieder Plätze in der Loge leisten. Und Champagner obendrauf.«
Die ehemalige Prostituierte und der einstige Meisterdieb hatten sich vor rund acht Monaten zusammengeschlossen und versuchten seither mehr schlecht als recht, mit einer Privatdetektei Geld zu verdienen.
»Dein Wort in Gottes Ohr.« Blom kontrollierte, ob die Bohnen bereits fein genug gemahlen waren. »Was steht heute auf dem Plan?« Er erhob sich und zückte ein rot-weiß kariertes Taschentuch. Dieses legte er über eine abgesplitterte Porzellankanne, formte mit den Fingern eine Mulde und schüttete das Kaffeepulver hinein.
Mathilde fröstelte und schlang ihren grob gestrickten violetten Wollschal eng um ihren Oberkörper. »So wie bereits gestern und vorgestern haben wir auch heute nicht viel zu tun, fürchte ich.« Sie blickte hinaus in den Hof, der mit einer dicken Schneeschicht bedeckt war. Der Hackklotz und der Brunnen glichen pudrigen Hügeln in einem Meer aus Weiß, das auch den Krempel, der sich in einer Ecke stapelte, unter sich begraben hatte. Dort, wo üblicherweise schmutziges Chaos herrschte, wirkte alles sauber und aufgeräumt. Eigentlich ein schöner Anblick, der – sollte der Blutegel recht behalten – noch einige Tage lang erhalten bleiben würde. Niemand ging bei diesem Wetter freiwillig vor die Tür.
»Was wissen wir über den entlaufenen Hund von Herrn Thiele?«, fragte Blom.
»Der ist von allein zurückgekommen.«
»Und was ist mit der Observierung des Grafen Hochmeister? Du weißt schon – wegen des angeblichen Techtelmechtels mit der Köchin.«
Mathilde seufzte. »Seine Gattin hat den Auftrag an Kühn und Zandelow vergeben.«
»Was? Wieso? Das darf ja wohl nicht wahr sein!« Blom öffnete das Fenster und schaufelte Schnee vom Sims in einen zerbeulten Kochtopf. »Ausgerechnet denen.« Er stellte den Pott auf den Ofen und sah zu, wie die weiße Pracht langsam schmolz. »Diese verdammten Kerle haben wahrscheinlich Lügengeschichten über uns in die Welt gesetzt, um uns den Auftrag abspenstig zu machen.«
Mathilde drehte sich zu ihm. »Ich fürchte, da waren keine unlauteren Mittel im Spiel. Ich denke, es war Kühn und Zandelows großes, warmes Büro in bester Lage mit seinen ledernen Fauteuils und Marmortischen, das die Frau Gräfin mehr überzeugt hat als unsere Referenzen.«
Blom ließ seinen Blick durch den kargen Raum schweifen. »Ich habe es so satt …«, setzte er an. Sein Lamento fand ein plötzliches Ende, als die Tür aufgerissen wurde.
Der Wind blies klirrend kalte Luft herein, eine dick vermummte Frau erschien in einer Wolke aus Schnee. Sie war in einen grauen Mantel aus grobem Wollstoff gehüllt und hatte einen abgenutzten schwarzen Hut auf dem Kopf. Auch die Schnürstiefel und fingerlosen Handschuhe, die sie trug, hatten zweifelsohne schon bessere Zeiten gesehen.
»Guten Morgen, Frau Brenke.« Mathilde lächelte ihr zu und deutete auf einen Sessel.
Die Frau schloss die knarrende Tür, knöpfte ihren Mantel auf und nahm den Hut ab. Ihr Gesicht war verhärmt und fahl, tiefe Falten hatten sich um ihren Mund und auf ihrer Stirn eingefurcht. Sie wirkte angespannt und nervös. »Haben Sie die Brosche gefunden?«, kam sie sofort auf den Punkt. Ihr Blick flog zwischen Blom und Mathilde hin und her.
»Das haben wir in der Tat.« Blom schob ein weiteres Holzscheit in den nimmersatten Ofen, stocherte mit dem Schürhaken in dem Feuer herum und nickte zufrieden, als der geschmolzene Schnee endlich zu kochen begann.
Frau Brenkes Gesicht erfüllte sich mit Leben. »Wo war sie denn?«
»Im Pfandleihhaus.«
»Im Pfandleihhaus?«, wiederholte Frau Brenke ungläubig und setzte sich.
»Ihre Dienstherrin scheint ein paar Probleme finanzieller Natur zu haben.« Mathilde nahm eine Zigarre aus einem kleinen Kistchen, das auf dem Schreibtisch stand, und zündete sie an. Bittersüßer Rauch erfüllte die Luft. »Probleme, die sie vor ihrem Gatten geheim halten möchte.«
Brenkes Augen weiteten sich. »Die Frau Baronin …«
»Die Frau Baronin ist offenbar nicht so edel und wohltätig, wie sie sich nach außen gibt.«
Frau Brenke wusste offenbar nicht, was sie erwidern sollte. »Sie selbst hat …?«, stammelte sie. »Sie hat ihre eigene Brosche versetzt? Und als ihr Mann …?«
»Als ihr Mann danach fragte, behauptete sie, das Schmuckstück sei gestohlen worden und hat Ihnen die Tat in die Schuhe geschoben.«
Frau Brenke schien fassungslos. »Wie? … Wie war es Ihnen möglich, das herauszufinden?«
»Die Antwort auf diese Frage ist recht simpel: Wir sind gut. Die besten.« Blom nahm den Topf vom Ofen und goss das heiße Wasser langsam über den gemahlenen Kaffee, wobei ein gluckerndes Geräusch zu hören war.
»Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten«, erklärte Mathilde. »Sie können zur Polizei gehen und die Geschichte zur Anzeige bringen …« Sie öffnete eine Schublade und zog einen Umschlag hervor. »Oder Sie konfrontieren die alte Hexe mit dem, was wir herausgefunden haben, und verlangen eine Entschuldigung und Ihre Stellung zurück.« Sie schob das Kuvert über den Tisch. »Darin finden Sie alle nötigen Beweise.«
Mit offenem Mund starrte Frau Brenke auf den Umschlag.
»Was auch immer Sie unternehmen …« Blom goss Kaffee ein. »Ihre Unschuld ist bewiesen, Ihr tadelloser Ruf wiederhergestellt.«
Frau Brenke lächelte und wirkte plötzlich um Jahre jünger. »Danke«, sagte sie mit belegter Stimme. »Vielen Dank.« Sie nahm die Beweismittel und erhob sich. »Ohne Sie wäre ich ruiniert gewesen. Ohne Ihre Hilfe hätten die Kinder …« Ihre Stimme brach. Sie griff in ihre Tasche und zog einen zerknitterten Fünfmarkschein und ein paar schmutzige Münzen daraus hervor. Das Geld legte sie auf den Tisch und blickte die beiden Detektive verlegen an. »Ich weiß, das ist zu wenig«, erklärte sie. »Aber ich habe im Moment nicht mehr. Die Kleinen brauchen dringend neue Schuhe und Fritz seine Medizin. Ich verspreche, ich begleiche den Rest meiner Schuld, sobald ich meine Stellung zurückbekommen habe und mein Mann wieder gesund ist.« Sie fasste sich mit der rechten Hand ans Herz. »Ich werde mir etwas einfallen lassen.«
»Schon gut.« Mathilde schob das Geld zurück.
Frau Brenke schien nicht zu verstehen.
»Der Winter wird sich noch länger nicht verabschieden.« Mathilde blickte zu dem Gurkenglas, in dem der Blutegel noch immer von schlechtem Wetter kündete. »Sehen Sie zu, dass Ihr Mann sich erholt und die Kinder etwas Warmes in den Magen bekommen.«
Frau Brenkes Augen glänzten feucht. »Sind Sie sicher?«
Blom starrte auf die halbleere Kaffeedose und die letzten Holzscheite. »Nun ja …«, setzte er an, doch Mathilde ließ ihn nicht ausreden.
»Ja, das sind wir.«
»Sie sind ein Segen«, sagte Frau Brenke mit tränenvoller Stimme. »Ohne Sie wäre ich verloren gewesen und mit mir Fritz und die Kleinen.«
»Vielleicht könnten Sie ja …«, setzte Blom an, doch Mathilde bedeutete ihm zu schweigen, indem sie unauffällig einen Finger auf die Lippen legte.
Sie führte Frau Brenke zur Tür. »Alles Gute.« Sie blickte ihr nach, bis die Frau im Schneegestöber verschwunden war.
»Was sollte das denn?«, fragte Blom, als Mathilde die Tür wieder geschlossen hatte. Er öffnete eine Schublade, kramte eine zerbeulte Blechkassette daraus hervor und blickte hinein. »Verdammt, Mathilde«, schimpfte er. »Wir haben gerade mal fünfzig Mark übrig. Wenn das so weitergeht, werden wir Holz aus dem Plänterwald holen, den Kaffee mit Wegwarte strecken und den Gürtel noch enger schnallen müssen.«
Mathilde rieb sich die Augen. »Frau Brenke hat fünf kleine Kinder, ihr Mann leidet an Tuberkulose. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihr etwas zu berechnen. Die arme Frau hat es schon schwer genug.«
Blom schaute nachdenklich und nickte schließlich. »Da magst du wohl recht haben.« Er zog seine Schnupftabakdose aus der Tasche, öffnete sie, überlegte es sich aber wieder anders und steckte sie zurück. »Sieht aus, als müssten wir unseren Tabak rationieren.« Er deutete auf das hölzerne Kistchen, in dem sich Mathildes geliebte Zigarren befanden.
Mathilde ließ die Schultern sinken. »Ich bringe es einfach nicht fertig, diesen armen Menschen ihr letztes Geld abzuknöpfen.«
»Ich verstehe dich ja, aber wenn wir im Schuldenturm landen, hat auch niemand was davon.«
»Das ist wohl wahr.« Mathilde strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr und setzte sich.
Blom nahm einen Schluck Kaffee und verbrannte sich die Zunge. »Verdammt!« Er schlug mit der Faust auf den Tisch und starrte ins Leere.
Mathilde sah ihn erschrocken an. »Tut mir leid, Felix. Wirklich. Nächstes Mal werde ich …«
»Schon gut.« Blom blickte auf und schaute sie an. »Es sind nicht nur die Detektei, die Oper und das Geld. In der Wohnung zieht es, ich habe schlecht geschlafen, bin komplett verspannt, und Auguste …«
»Auguste.« Mathilde rümpfte die Nase. »Daher weht also der Wind. Was ist es dieses Mal? Ist sie traurig, weil du nicht mit ihr zu Borchardt gehst? Oder enttäuscht, weil du sie nicht ins Theater begleitest?«
»Schlimmer.« Blom kaute auf seiner Unterlippe herum.
»Na, jetzt bin ich aber mal gespannt.«
»Ich hatte es so satt. Die Heimlichtuerei, das dumme Geschwätz der Leute, das Getuschel hinter unseren Rücken … Darum wollte ich Nägel mit Köpfen machen, wenn du verstehst.«
Mathilde schüttelte den Kopf.
»Ich wollte unsere Verbindung legitimieren, klare Verhältnisse schaffen. Also habe ich bei ihrem Vater um Augustes Hand angehalten.«
Mathilde, die wohl schon ahnte, wie die Sache ausgegangen war, seufzte. »Lass mich raten: Er war nicht sonderlich begeistert.«
»Er hat ihr untersagt, mich zu heiraten, und ihr sogar verboten, mich weiterhin zu sehen. Er meint, dass der Umgang mit mir ihren Ruf schädigt und dass unsere Verbindung ohnehin keine Zukunft hat, weil ich seiner Tochter kein standesgemäßes Leben bieten kann. Um uns zu trennen und jedweden Kontakt zwischen uns zu unterbinden, schickt er sie nach Wien, wo sie sich um ihre Tante kümmern soll.« Blom setzte sich aufrecht hin. »Und weißt du was? Ich verstehe ihn. Sieh mich doch nur an.« Er breitete die Arme aus. »Auguste ist im Grand Hotel aufgewachsen, inmitten gediegener Gesellschaft und aller Annehmlichkeiten, die man sich nur denken kann. Ich hingegen bin ein armer, abgetakelter Exhäftling und kann für keine Frau, geschweige denn für eine Familie sorgen. Wenn das so weitergeht, bin ich nicht mal mehr in der Lage, mich selbst zu ernähren.« Er starrte in den Kaffee, als könne er in dem tiefschwarzen Gebräu eine Lösung für seine Probleme finden. »Denkst du manchmal daran …« Er zögerte und schluckte. »Du weißt schon … Daran, wieder in dein altes Leben zurückzukehren?«
Mathilde riss die Augen auf. »Zurück in Madame Loulous Bordell? Auf gar keinen Fall!« Sie schauderte. »Allein bei dem Gedanken an manchen Freier wird mir ganz anders.« Sie wandte den Blick ab und sah aus dem Fenster. »Bestien«, murmelte sie.
»Aber du hattest Geld und ein komfortables Heim«, sinnierte Blom. »Du musstest dir keine Gedanken darüber machen, wie Essen auf den Tisch kommt, wie du deine Stube wärmst oder ob du dir Zigarren leisten kannst.«
Mathilde zuckte mit den Schultern. »Natürlich vermisse ich einiges, aber glaub mir: Kein Luxus auf der Welt kann Würde und Selbstbestimmtheit aufwiegen.« Sie hielt inne und legte den Kopf schief. »Warte mal. Du denkst doch wohl nicht etwa daran, in alte Gewohnheiten zu verfallen und wieder lange Finger zu machen?«
Blom kratzte sich am Kopf. »Nun«, druckste er herum. »Um ehrlich zu sein, manchmal schon.«
»Felix, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein, oder?«
»Manche Menschen schwimmen im Geld. Sie besitzen mehr, als sie in hundert Leben ausgeben könnten. Das sind Männer und Frauen, die nie für ihr Vermögen gearbeitet haben. Der Adel, der Klerus, die Kaufmannsdynastien«, begann er aufzuzählen. »Die haben nie einen Finger krumm gemacht, haben lediglich geerbt oder ihre Untergebenen ausgebeutet. Ich verstehe nicht, was so schlimm daran sein soll, ihnen ein bisschen was von ihrem Reichtum abzuknöpfen. Es ist ja nicht so, als würde ich arme Leute wie Frau Brenke ausnehmen.«
»Das Leben ist ungerecht.« Mathilde zuckte mit den Schultern. »Trotzdem können wir nicht einfach unsere eigenen Regeln aufstellen. Die Polente weiß, dass du der Schatten von Berlin warst. Wenn irgendwo ein gefinkelter Einbruch passiert, ist denen sofort klar, an welche Tür sie klopfen müssen.«
»Da hast du wohl recht.« Blom starrte auf seine Hände.
»Sag mal …« Mathilde kniff die Augen zusammen und musterte ihren Kompagnon. »Kann es sein, dass das Stehlen und das Einbrechen dir fehlen?«
Blom zog die Schultern hoch und betrachtete die Schnupftabakdose. »Jeder von uns hat seine Schwächen«, gab er sich zerknirscht. »Im Gegensatz zu anderen Lastern kostet das Stehlen aber nichts.«
»Das würde ich so nicht unterschreiben. Im schlimmsten Fall kostet es die Freiheit.«
Blom seufzte.
Mathilde tätschelte ihm die Hand. »Es wird sich schon alles finden. Wir sind noch immer irgendwie über die Runden gekommen. Und die Sache mit Auguste wird sich auch einrenken. Wirst schon sehen. Wahre Liebe kann auf Dauer nichts trennen.«
»Wollen wir es hof…« Bloms Worte wurden von einem hektischen Klopfen übertönt. Noch ehe er oder Mathilde reagieren konnten, wurde die Tür aufgerissen und die alte Frau Hinze streckte ihren Kopf herein. »Herr Voss!«, rief sie aufgebracht.
Mathilde rümpfte die Nase. »Wie oft soll ich Ihnen denn noch sagen, dass nicht er, sondern ich die Chefin …«
Die alte Frau ließ sie nicht ausreden. »Ham Se schon jehört? Es is furchtbar. Schrecklich. Een Skandal.« Sie deutete nach draußen.
»Was ist ein Skandal?« Blom stand auf, bat sie herein und schloss die Tür hinter ihr.
»Raus. Wir müssen raus«, erklärte sie, wobei sie so schnell sprach, dass sie sich beinahe verhaspelte. »Mit Sack und Pack. Wir ham bis zum Ende des Monats.«
»Haben Sie die Miete nicht bezahlen können?«, fragte Mathilde. »Da gibt es doch sicher eine Lösung.«
»Nee, Se vastehn det falsch.« Frau Hinze schnaufte. »Es jeht nicht um die Miete. Wir müssen alle raus. Alle Bewohner des Krögels. Ooch Sie.«
»Wir?«
Frau Hinze nickte. »Eben war een elejanter Schnösel im Haus. So’n eitler Fatzke. So’n Immobilienheini. Der Krögel … unser Krögel … soll abjerissen werden, plattjemacht, um Platz zu schaffen für nen schicken Neubau.«
Mathilde ließ sich auf den Sessel fallen und blies eine Locke aus ihrer Stirn. »Das können die nicht machen. Gegen so was muss es doch ein Gesetz geben.«
»Jesetze sind für reiche Leute. Nicht für solche wie unsereins.« Frau Hinze schnaubte. »Außerdem sajen die, es müsse sein. Det Wohnen hier sei jefährlich und jesundheitsjefährdend.« Sie blickte zwischen Blom und Mathilde hin und her. »Worauf warten Se? So tun Se doch wat!«
»Wir?« Blom runzelte die Stirn.
»Ja, jenau. Immerhin sind Se doch Herr Voss. Von der Detektei Voss.« Sie hielt Blom eines ihrer Flugblätter vor die Nase. »Wir lösen Probleme«, steht da. »Also machen Se ma. Lösen Se!«
Mathilde verdrehte die Augen. »Frau Hinze«, schimpfte sie. »Wie oft soll ich Ihnen denn noch sagen, dass er nicht Herr Voss ist.«
Doch die Alte hörte ihr nicht zu. Mit verkniffenen Zügen stapfte sie nach draußen und schlug die Tür hinter sich zu.
Blom und Mathilde schauten einander an. »Immer wenn man denkt, es könne nicht schlimmer werden«, sagte Blom, »haut einem das Schicksal noch eine rein.«
»Vielleicht hat Frau Hinze irgendetwas falsch verstanden«, versuchte Mathilde etwas Hoffnung zu verbreiten.
»Wie auch immer.« Blom gönnte sich nun doch eine Prise Schnupftabak. »Wir müssen uns etwas einfallen lassen.« Er seufzte, als er Mathildes kritischen Gesichtsausdruck sah. »Keine Sorge. Etwas Legales.«
3
Vor Kälte zitternd zündete er sich eine weitere Zigarette an, drückte sich tiefer in die Mauernische und trat ungeduldig von einem Bein aufs andere. Noch immer konnte er kaum glauben, was vor ein paar Stunden auf dem Friedhof von St. Hedwig geschehen war.
Sein Plan war einfach gewesen, denn einfache Pläne waren meist die besten. Schlicht und schnörkellos, ohne komplizierte Manöver und komplexe Abläufe, hatten seine Vorhaben stets reibungslos funktioniert. Zumindest bis heute. Denn dieses Mal hatten unvorhergesehene Umstände sein Unterfangen durchkreuzt, oder besser gesagt: Ein fieser kleiner Kerl hatte es getan.
Der Fremde war ihm zuvorgekommen, hatte Christian Kamerling niedergeschlagen und war mit der Beute abgehauen – und zwar direkt in ein stadtbekanntes Bordell namens Schwarzer Kater. Wie es schien, wollte der Fremde seinen Triumph feiern.
Unvermittelt musste er grinsen. Die gute Laune würde dem Kerl bald vergehen. Irgendwann musste er den Schwarzen Kater nämlich wieder verlassen und dann würde er ihn abpassen und sich das zurückholen, was er dringend brauchte. Er zog an seiner Zigarette und fixierte die Eingangstür. Noch einmal würde er sich die Beute nicht durch die Lappen gehen lassen.
Koste es, was es wolle.
Vorsichtig beugte er sich nach vorn und blickte in die lange schmale Gasse, die den ehrwürdigen und somit völlig unzutreffenden Namen Königsmauertrug. Alles war ruhig, mehr noch, wirkte wie ausgestorben, ganz anders als früher.
Noch vor wenigen Jahren war hier unglaublich viel los gewesen – und zwar zu jeder Tages-, Nacht- und Jahreszeit. Ob bei strömendem Regen oder strahlendem Sonnenschein, die Königsmauer war stets ein Garant für Trubel und Vergnügen gewesen. In mehr als der Hälfte der über fünfzig Häuser hatten sich Bordelle befunden, die restlichen Gebäude hatten verrufene Spelunken und wilde Spielhöllen beherbergt. Damals hatten üppige Kronleuchter hinter gestickten Gardinen und roten Vorhängen gefunkelt. Musik, Gelächter und das Klingen von Gläsern hatte aus den Etablissements getönt. Schöne Mädchen in durchsichtigen Kleidern hatten in den Türen gestanden und versucht, die vorbeigehenden Männer mit ihrer kessen Anmache zu bezirzen.
Heute war von dem einstigen Glanz kaum etwas übrig. Seitdem Hurenhäuser offiziell verboten waren, flankierten abgebröckelte Fassaden und blinde Fensterscheiben den Weg, der von Schlaglöchern übersät war, eines tiefer als das andere. Einzig der Schwarze Kater und das benachbarte Etablissement, das den passenden Namen Scharfes Eck trug, trotzten dem Niedergang des einst so schillernden Rotlichtviertels.
Er rauchte und lauerte, versuchte, die eisige Kälte zu ignorieren, und grübelte. Denn es gab da zwei Fragen, die ihn schwer beschäftigten: Woher wusste der Fremde von dem Schatz? Und woher wusste er von Kamerling?
***
Christian Kamerling fühlte sich noch immer benommen. Sein Kopf schmerzte, seine Schläfen pochten. Er fasste sich an die Stirn und tastete über die Schwellung, die sich dort gebildet hatte.
Bei dem Gedanken an das, was in der Krypta geschehen war, fröstelte er. Dieser fiese kleine Mistkerl hatte ihn niedergeschlagen, beraubt und dann einfach dort unten liegen gelassen. Das Schwein hatte wohl gedacht, er wäre über den Jordan gegangen, doch die Drecksau hatte die Rechnung ohne seinen Dickschädel gemacht. Er war nämlich schnell wieder zu sich gekommen und hatte sich an die Fersen des anderen geheftet. Fußabdrücke im frisch gefallenen Schnee hatten ihm den Weg in Richtung Königsmauer gewiesen. Dort hatten sie sich mit anderen vermischt, doch das war kein Problem. Es gab nur einen Grund, diese schmale, krumme Gasse zu betreten. Man wollte sich vergnügen – und das war derzeit nur in zwei Etablissements möglich.
Er hatte sich daher in einem leerstehenden Haus versteckt und beobachtete seither durch die schmutzige Fensterscheibe die Türen des Schwarzen Katers und des Scharfen Ecks. In einem der beiden Bordelle musste der Kerl stecken – und mit ihm die Beute.
Erneut fasste Kamerling sich an die Stirn. Woher wusste das Schwein von dem Schatz? Er rieb seine Augen und atmete schwer. Angst kroch in ihm hoch, denn es gab da noch etwas, das ihm Kopfzerbrechen bereitete: Vom Friedhof hatte eine weitere Spur fortgeführt.
Wem gehörte sie? War diese Person etwa auch hinter dem Schatz her? Und wenn ja, wo war dieser Mensch jetzt? Befand er sich vielleicht ganz in der Nähe?
***
Er hatte sich gerade eine weitere Zigarette angesteckt, als der Fremde mit einem selbstgefälligen Lächeln auf den schmalen Lippen aus dem Schwarzen Katertrat.
Genüsslich kratzte sich der Kerl im Schritt, gähnte ausgiebig und beobachtete die Atemwolke, die sich langsam in der klirrend kalten Luft auflöste.
Er fasste in seine Tasche, strich über den hölzernen Griff seines Messers und das kalte Metall des Schlagrings und setzte an, aus seinem Versteck zu treten. Vor lauter Schreck zuckte er zusammen, als auf der gegenüberliegenden Straßenseite schwungvoll ein Fenster geöffnet wurde.
Eine rotgelockte Schönheit streckte ihren Schopf hervor. »Komm bald wieder, mein Hübscher«, rief sie dem Fremden zu. »Du weißt schon, wie ich das meine.«
Da wurde auch im Haus daneben ein Fenster aufgerissen. »Abwechslung macht das Leben süß«, rief eine Brünette mit Zigarettenspitze zwischen den rosa leuchtenden Lippen. »Komm lieber zu mir, du Prachtkerl.« Sie beugte sich so weit nach vorn, dass er ihr dralles Dekolleté sehen konnte. »Am besten jetzt gleich. Eine schnelle Nummer vor dem Frühstück macht dich munter. Ich zeig dir mal, woher der Doppelte Rittmeister seinen Namen hat.«
Weitere Fenster öffneten sich, und verschiedene Frauen boten ihre Dienste an. Offensichtlich war es derzeit sogar den abgebrühtesten Nutten zu kalt, um draußen auf Freierfang zu gehen, weswegen sie versuchten, aus ihren warmen Zimmern heraus Kunden anzulocken.
»Entscheid dich schnell, bevor mir die Nippel abfrieren.«
Verschwindet, formten seine Lippen lautlos. Für das, was er vorhatte, konnte er keine Zeuginnen gebrauchen.
Der Fremde lachte. »Ich muss was Dringendes erledigen«, rief er den Frauen zu. »Aber ich komme in einer Stunde zurück. Dann werde ich euch allen einen Besuch abstatten, meine Täubchen.« Er warf ihnen Kusshände zu, drehte sich einmal um die eigene Achse und deutete eine Verbeugung an. »Macht euch bereit.«
Die Weibsbilder lachten und schlossen die Fenster, der Fremde schlug den Kragen seiner Jacke hoch und stapfte durch den frisch gefallenen Schnee.
Die Jagd konnte beginnen.
Er wartete kurz, stellte sicher, dass keine der Frauen mehr auf die Straße blickte, dann zog er sich den Schal über Mund und Nase und begann, dem Fremden zu folgen.
***
Die Uhr der nahe gelegenen Marienkirche schlug gerade neun Mal, als der Mistkerl, der ihn in der Krypta niedergeschlagen und ausgeraubt hatte, aus dem Schwarzen Kater trat. Er war es, ganz eindeutig. Das Schwein hatte nämlich ein Feuermal auf der Wange, das Christian Kamerling im Schein der Laterne kurz gesehen hatte. Der Kerl plänkelte mit den Huren herum, grinste schief und ging schließlich davon.
Kamerling wartete, gab ihm ein paar Meter Vorsprung und trat schließlich aus dem leer stehenden Haus. Der Himmel war von einem düsteren Grau, eiskalter Wind fegte durch die Gasse. Just in dem Augenblick, als er die Verfolgung aufnehmen wollte, löste sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein dunkler Schatten aus einer Toreinfahrt und heftete sich an die Fersen des vermaledeiten Räubers.
Die zweite Fußspur.
Ein weiterer Verfolger.
Wer waren die beiden Kerle? Worauf hatte er sich da nur eingelassen? Kamerling schauderte. Wie hatte die ganze Sache nur derart aus dem Ruder laufen können?
Er fröstelte, überlegte kurz, alles abzublasen, sah aber ein, dass das nicht möglich war. Nicht, wenn er noch länger in Berlin bleiben wollte.
***
Er schlich dem Fremden hinterher. Der ging schnellen Schrittes über den Alexanderplatz in Richtung Friedrichshain. Auch hier hatte das schlechte Wetter die Straßen geleert. Keine Huren, Bettler oder Tagediebe lungerten herum, nirgendwo promenierten Spaziergänger, und nicht ein einziger Drehorgelspieler wartete auf Publikum. Wer es sich erlauben konnte, blieb drinnen, in einer gemütlichen Stube, einem geheizten Bureau oder zumindest einem windgeschützten Unterschlupf. Hier draußen herrschten Zustände, bei denen man keinen Hund vor die Tür schickte.
Perfekte Gegebenheiten für sein Vorhaben. Denn ein zweites Mal durfte er nicht scheitern. Zu wichtig war sein Vorhaben, zu bedeutend seine Mission.
Der Wind frischte noch weiter auf, rauschte durch die Kolonnaden, die die Königstraße säumten, und heulte, wenn er auf die ionischen Doppelsäulen entlang des Wegs traf.
Der Fremde beschleunigte seine Schritte, eilte zu einem Bretterzaun, hinter dem eine Baustelle lag, und kletterte flink wie ein Wiesel darüber.
»Sehr gut«, murmelte er und folgte dem drahtigen kleinen Mann mit ein paar Metern Abstand. Das Labyrinth aus ungefähr zwei Meter hohen Mauern war der perfekte Ort, um den Mistkerl auszuschalten. Die Arbeiten waren durch das Wetter zum Erliegen gekommen, niemand würde hier sein, und selbst wenn sich irgendjemand, warum auch immer, hierherverirrte, boten die halbfertigen Wände einen optimalen Sichtschutz.
Er kontrollierte den Sitz seines Schals, folgte seinem Opfer hinein in den steinernen Wald und konnte sein Glück kaum fassen, als der Fremde direkt vor einer Mauer stehen blieb, ihm den Rücken zuwandte und an seinem Hosenschlitz herumnestelte. Leises Plätschern und ein erleichtertes »Ahhh« erklangen.
Er griff nach seinem Messer und schlich vorsichtig an den Mann heran. Behutsam setzte er einen Fuß vor den anderen, wobei trotz aller Vorsicht ein leises Knirschen ertönte.
»Was soll das?«, schimpfte der Fremde, ohne sich umzudrehen. »Kann man hier nicht mal mehr in Ruhe pissen?« Er knöpfte die Hose zu und fuhr herum.
Schweigend streckte er die Hand aus.
Der Kerl gab sich irritiert. »Mensch, was soll das? Was willst du von mir?« Er starrte ihm ins Gesicht und legte den Kopf schief.
Anstatt zu antworten, machte er einen weiteren Schritt auf den Fremden zu und präsentierte sein Messer. Schnee rieselte auf sie beide nieder. Aus der Ferne war ein Knacken zu vernehmen, gefolgt vom Heulen des Windes. »Gib ihn mir«, sagte er.
Der Fremde brauchte offenbar ein paar Augenblicke, bis er verstand. »Nur über meine Leiche«, murmelte er mit zusammengekniffenen Zähnen.
Er dachte kurz nach, wog das Für und Wider ab und rief sich in Erinnerung, was auf dem Spiel stand. »Das kannst du haben«, sagte er schließlich.
***
Mit einem unguten Gefühl im Bauch war Christian Kamerling den beiden Fremden hinterhergehastet. Er musste die Beute um jeden Preis wiederbeschaffen. Doch wie sollte er das anstellen? Ihm graute davor, Gewalt anzuwenden. Er war ein Dieb und Einbrecher, aber kein brutaler Schläger.
Kamerling war den zwei Männern bis zu einer Baustelle gefolgt. Vorsichtig war er über den Zaun geklettert, der das Gelände umgab, und den Fußspuren durch das steinerne Labyrinth hinterhergeschlichen.
»Nur über meine Leiche«, hörte er jetzt jemanden zischen und blieb stehen. Er erkannte die Stimme. Das war der Mann, der ihn überfallen hatte. Die beiden befanden sich offenbar nur wenige Meter vor ihm hinter einer Mauer.
Kamerling überlegte. Am besten, er wartete, bis sie sich gegenseitig windelweich prügelten, sodass er den Überraschungseffekt nutzen und als lachender Dritter aus der Sache herausgehen konnte. Behutsam machte er ein paar Schritte nach vorn, bis er an der Mauerkante angekommen war, und lauschte.
»Das kannst du haben«, sagte eine raue Stimme. Es folgten ein erstickter Schrei und ein leises Gurgeln.
Kamerlings Herz begann zu rasen, er wusste, dass gerade etwas Schreckliches passiert war, und ihm war auch klar, dass er sich so schnell wie möglich vom Acker machen sollte. Doch irgendeine selbstzerstörerische, völlig unvernünftige innere Stimme drängte ihn, einen Blick um die Ecke zu wagen.
Nur ganz kurz, nur um zu verstehen, was hier los war. Mit angehaltenem Atem schob er den Kopf nach vorn.
Er hatte mit vielem gerechnet, aber nicht mit solch einem verstörenden Anblick. Panisch drehte er sich um und rannte so schnell wie möglich davon.
4
Zum ersten Mal seit Tagen zeigte sich die Sonne, wenn auch nur schüchtern. Für ein paar Augenblicke drangen ihre schwachen Strahlen zwischen zwei Wolken hindurch und brachten den gefrorenen Bach, der zu seiner Rechten verlief, zum Glitzern.
Kommissar Heinrich Schlesinger konnte dieser Schönheit jedoch nicht viel abgewinnen. Er stakste durch knöcheltiefen Schnee, wobei feuchte Kälte seine Hosenbeine hochkroch. Auch seine ledernen Schnürschuhe wurden von Schritt zu Schritt nasser, während eisige Luft durch die groben Nähte seiner dünnen senfgelben Leinenjacke zog. Er war erst am Abend zuvor in Berlin angekommen und hatte noch keine Zeit gefunden, adäquate Kleidung zu besorgen. Es war Pech, gleich heute zu einem Außeneinsatz gerufen zu werden. Noch dazu auf freiem Feld.
Hätte der Kerl nicht in einer Gaststube ermordet werden können? Oder in einer windgeschützten Ecke irgendwo in der Innenstadt?
Schlesinger hatte vergessen, wie unwirtlich die deutschen Winter sein konnten. Dennoch ließ er sich nichts von seinem Ungemach anmerken. Jammern machte die Sache nicht besser, zudem wollte er an seinem ersten Tag bei der Berliner Polizei einen guten Eindruck hinterlassen. Ihm war bewusst, dass er es mit einem Haufen altgedienter Haudegen zu tun haben würde, einer eingeschworenen Mannschaft, die ihm – dem Neuen, dem Fremden – mit Misstrauen begegnen würde.
Der Skandal im vergangenen Jahr hatte ein schlechtes Licht auf die Kriminalabteilung geworfen, weswegen nach langem Hin und Her der Entschluss gefasst worden war, deren Leitung nicht intern nachzubesetzen, sondern jemanden von außerhalb anzuheuern. Einen unbestechlichen, unkorrumpierbaren Kämpfer. Jemanden, der sich nicht von Gefühlen leiten ließ.
Einen geborenen Häscher.