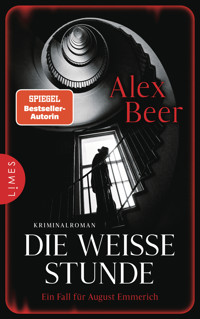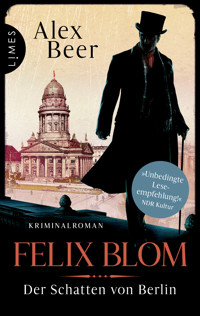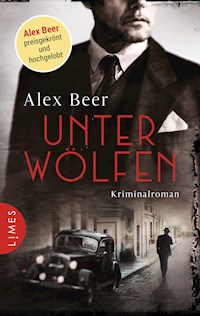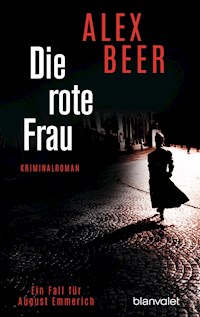9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kriminalinspektor-Emmerich-Reihe
- Sprache: Deutsch
Grausam zugerichtete Leichen, ein Mörder, der alte Verbrechen sühnt und ein Kommissar, für den es um alles geht …
Wien im November 1920: Ein unerwarteter Kälteeinbruch hat die Ernten vernichtet, jeder dritte Mann ist arbeitslos, und das organisierte Verbrechen hat Hochkonjunktur. Doch der Mordfall, der jetzt die Stadt erschüttert, übertrifft alles bislang Dagewesene: Ein Toter wird bizarr zugerichtet und von einer Eisschicht bedeckt aufgefunden. Kurz darauf taucht ein Bekennerschreiben auf. Kriminalinspektor August Emmerich und sein Assistent Ferdinand Winter ermitteln – und das ist nicht das einzige Rätsel, das sie zu lösen haben, denn noch haben sie Xaver Koch nicht aufgespürt, den Mann, der Emmerichs Lebensgefährtin entführt hat und der sich als gefährlicher Gegner entpuppt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch:
Wien im November 1920: Ein unerwarteter Kälteeinbruch hat die Ernten vernichtet, jeder dritte Mann ist arbeitslos, und das organisierte Verbrechen hat Hochkonjunktur. Doch der Mordfall, der jetzt die Stadt erschüttert, übertrifft alles bislang Dagewesene: Ein Toter wird bizarr zugerichtet und von einer Eisschicht bedeckt aufgefunden. Kurz darauf taucht ein Bekennerschreiben auf. Kriminalinspektor August Emmerich und sein Assistent Ferdinand Winter ermitteln – und das ist nicht das einzige Rätsel, das sie zu lösen haben, denn noch haben sie Xaver Koch nicht aufgespürt, den Mann, der Emmerichs Lebensgefährtin entführt hat und der sich als gefährlicher Gegner entpuppt …
Autorin:
Alex Beer, geboren in Bregenz, hat Archäologie studiert und lebt in Wien. Ihre spannende Krimi-Reihe um den Ermittler August Emmerich erhielt zahlreiche Shortlist-Nominierungen (u.a. für den Friedrich Glauser Preis, Viktor Crime Award, Crime Cologne Award) und wurde mit dem Leo-Perutz-Preis für Kriminalliteratur 2017 und 2019 sowie dem Krimi-Publikumspreis des Deutschen Buchhandels MIMI 2020 prämiert. Auch der Österreichische Krimipreis wurde der Autorin 2019 verliehen. Neben dem Wiener Kriminalinspektor hat Alex Beer mit Felix Blom eine weitere faszinierende Figur erschaffen, die im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhundert ermittelt und für den sie mit dem silbernen Homer 2023 und dem Berliner Krimifuchs 2024 ausgezeichnet wurde.
Mehr Informationen unter: www.alex-beer.com
Von Alex Beer bereits erschienen Der zweite Reiter Die rote Frau
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ALEX BEER
DERDUNKLEBOTE
Ein Fall für August Emmerich
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2019 by Alex Beer Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Kai Gathemann © 2019 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: Margit von Cossart Covergestaltung: www.buerosued.de Covermotive: Donald Jean/Arcangel Images KW · Herstellung: sam Satz und E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-641-23784-4 V007 www.limes-verlag.de
Sag mir, wie du dir den Teufel vorstellst, und ich sage dir, wer du bist.
Paul Carus
Sonntag,
31. Oktober 1920
1
Der Sensenmann ging um. Menschen, Traditionen, politische Systeme … Nichts und niemand war vor ihm sicher. Selbst Wien, die alte Kaiserresidenz, zählte zu seinen Opfern.
Die Todeszuckungen der sterbenden Stadt waren überall spürbar. So brannten die meisten Straßenlaternen im 6. Bezirk nicht, obwohl es längst dunkel war. Wie so viele andere Dinge waren sie Sparmaßnahmen oder Vandalismus anheimgefallen. Vielleicht auch einfach nur dem Zahn der Zeit. Es machte keinen Unterschied. Das Licht der wenigen intakten Lampen war jedenfalls so schwach, dass es den Dunst des Nebels kaum durchdrang.
Die Hände tief in den Manteltaschen vergraben, setzte er einen Fuß vor den anderen und wäre beinahe über einen zerlumpten Bettler gestolpert, der mitten auf dem Gehsteig seinen Rausch ausschlief.
»Wien, du elender Moloch«, murmelte er fröstelnd.
Tatsächlich schwebte seit Wochen eine dumpfe Unruhe über der Donaumetropole, und auch in dieser nasskalten Herbstnacht war das Brodeln spürbar. Etwas lag in der Luft.
Er konnte es nicht erwarten, diesen Ort endlich wieder zu verlassen. Die klaustrophobische Enge der Gassen schnürte ihm die Luft ab, der Dialekt schmerzte in seinen Ohren.
Nicht mehr lange, dachte er und seufzte, als er endlich vor dem Haus ankam, in dem er sich eingemietet hatte.
Als wäre er ein ordinärer Dienstbote, musste er das Gebäude durch den Gesindeeingang betreten, hinter dem ein unbeheizbares, heruntergekommenes Quartier auf ihn wartete. Leise stahl er sich durch den Flur und schlich in seine Kammer. Er hatte keine Lust auf seine beiden Mitbewohner, diese lästigen Kerle, die ständig versuchten, Konversation zu betreiben. Sie sollten nicht wissen, dass er wieder daheim war.
Er schloss die Tür hinter sich und tastete in seiner Hosentasche nach Streichhölzern. Fließendes Wasser und Elektrizität gab es nur im Herrenhaus. Die Bewohner des Dienstbotentraktes waren auf den Brunnen im Hof und Kerzen angewiesen.
Plötzlich hielt er inne und starrte in die Finsternis. Er war nicht allein. Noch jemand war im Raum. Obwohl die andere Person sich durch nichts bemerkbar machte, spürte er deren Anwesenheit, so wie es ein Beutetier tat, dem ein uralter Instinkt Gefahr signalisierte.
Schweigend stand er einfach nur da, nicht wissend, was er tun sollte. Zwar hatte er im Krieg gekämpft und dort dem Feind ins Auge geschaut, doch das hier war etwas anderes.
Sein Herz schlug ihm bis zum Hals, und sein Mund wurde trocken. »Was willst du?«, flüsterte er schließlich.
»Kannst du dir das nicht denken?«, hörte er eine zischende Stimme aus der Dunkelheit. »Ich bin gekommen, um deine Seele zu holen.«
Montag,
1. November 1920
2
Das Ende des Krieges hatte kein Ende der Not mit sich gebracht. Im Gegenteil. Die Siegermächte hatten das K.-u.-k.-Reich in sieben Nationen zerteilt und die Vielvölkermonarchie Österreich zu einem isolierten Kleinstaat gemacht, an dessen Lebensfähigkeit viele zweifelten. Zu Recht.
Die Zollgrenzen zu den neuen Nachbarländern erschwerten die dringend notwendigen Lebensmittellieferungen, enorme Reparationszahlungen mussten geleistet werden, und die Teuerung erklomm schwindelerregende Höhen. Staatskanzler Mayr musste sich mit dem Koalitionsbruch zwischen den Sozialdemokraten und den Christlichsozialen herumschlagen, die Fronten zwischen dem rechten und dem linken Lager verhärteten sich. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen würde.
Damit nicht genug war auch noch eine unerwartete Kältewelle über die Stadt hereingebrochen. Seit Tagen fegte ein sibirischer Steppenwind durch die Gassen und trieb haushohe Staubwolken vor sich her. Der Frost hatte die Kartoffelernte zunichtegemacht, was die ohnehin prekäre Versorgungslage noch weiter verschlimmerte. Hungertote würden auf der Tagesordnung stehen. Wieder einmal. Das Grauen des Winters hatte sich wie ein Leichentuch auf die Menschen gesenkt. Es sah nicht gut aus für die junge Republik.
Wenn er nicht bald ins Warme kam, sah es auch für die Gesundheit von August Emmerich, Kriminalinspektor in der Abteilung »Leib und Leben«, schlecht aus. »Verdammt«, fluchte er, als ihm eine eisige Windböe in die Kleider fuhr. Die angeblichen zehn Grad unter null fühlten sich weitaus kälter an.
Er dachte an die Soldaten, die aus den russischen Lagern zurückgekehrt waren, an ihre Erzählungen von Atem, der in der Lunge klirrte, und Spucke, die in der Luft erstarrte, und kam zu dem Schluss, dass es ihm nicht zustand zu klagen. Schweigend schlug er den Kragen seines Mantels hoch und sondierte die Lage. Wohin er auch blickte, ein Meer aus Schwarz. Schwarze Hüte, schwarze Schleier, schwarze Mäntel. Den einzigen Farbtupfer stellte die kupferne Kuppel der Luegerkirche dar, die sich schwach vor dem grauen Himmel abzeichnete. »Verdammt«, wiederholte Emmerich, wobei der Fluch dieses Mal nicht dem Wind galt, sondern Bruno Kopp, seinem Informanten, der ihn herbestellt hatte.
»An Allerheiligen pilgert halb Wien zum Zentralfriedhof«, hatte Kopp gesagt. »Alle Schichten, alle Professionen. Niemand wird sich was denken, wenn wir beide auch dort sind.«
Was war nur aus der guten alten Zeit geworden, als man seine Spitzel in dunklen Kaschemmen oder an finsteren Straßenecken traf? »Der alten Zeit«, korrigierte Emmerich sich selbst. Gut war sie noch nie gewesen.
»… dass heute die Toten von den blutgetränkten Karpaten, von den Vogesen, von den Kavernen des Karstes auferstehen, um Blutzeugen zu sein und die Heimat an ihre Pflicht zu erinnern …«, hielt ein Mitglied der Frontkämpfervereinigung eine flammende Rede vor dem Haupteingang des Friedhofs, und Emmerich beobachtete die Scharen von Menschen, die trotz des unwirtlichen Wetters auf den Gottesacker strömten. Der große Krieg war hungrig gewesen, und so gab es kaum eine Familie, die kein Grab zu besuchen hatte.
Gebeugte Greisinnen gingen an ihm vorbei, Kinder, die ihre Väter kaum gekannt hatten, schluchzende Frauen, deren Hoffnung auf ein stilles Glück irgendwo im Feindesland verscharrt worden war. Doch nicht nur Verwandte, auch ehemalige Soldaten waren gekommen, viele von ihnen Invalide − eine Armee aus Stümpfen und notdürftigen Prothesen.
Unwillkürlich fasste Emmerich an sein rechtes Knie, in dem seit der Schlacht von Vittorio Veneto ein Granatsplitter steckte. Inoperabel. Er humpelte und litt unter chronischen Schmerzen, doch im Vergleich mit vielen der Anwesenden war sein Gebrechen von der harmloseren Sorte.
Er mischte sich unter die Trauernden, ließ sich von der Prozession an den Aufbahrungshallen und den Arkaden vorbeitreiben. Während sich der Tross Meter für Meter voranschob, studierte Emmerich die Gesichter, die ihn umgaben, und fand in ihnen Resignation, verklärtes Sentiment oder neu erwachten Schmerz. Die Gräber weckten Erinnerungen. Ein paar gute und sehr viele schlechte. Er selbst schob alle Emotionen beiseite. Das Einzige, was ihn beschäftigte, war der Kerl, den er seit Monaten jagte.
Xaver Koch, der tot geglaubte Mann seiner geliebten Luise, hatte eines Tages einfach in der Tür gestanden, abgezehrt und eingefallen, ein Häuflein Elend, nicht mehr als ein fahler Schatten. Doch der Schein hatte getrogen. Die Kriegsgefangenschaft hatte ihn nicht gebrochen, sondern verroht, und noch bevor Emmerich Luise und die Kinder in Sicherheit hatte bringen können, war das Schwein mit ihnen verschwunden. Spurlos.
Seit über einem halben Jahr suchte er nun schon nach ihnen, hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, alle Mittel ausgeschöpft. Aber nie war er seinem Ziel so nah gewesen wie an diesem Tag.
Sein Puls beschleunigte sich, als er das Zentrum der Kriegsgräberanlage erreichte. An dieser Stelle wollte Kopp auf ihn warten, doch weit und breit war nichts von ihm zu sehen.
Ungeduldig trat Emmerich von einem Bein aufs andere und ließ dabei seinen Blick schweifen. Trostlosigkeit so weit das Auge reichte. Die Totenlichter hielten dem Wind nicht stand, und Blumenschmuck gab es keinen, da sämtliche Pflanzen dem Frost zum Opfer gefallen waren. Nur ein paar dürre Tannenzweige und vereinzelte Heidekrautsträußchen schmückten das halbkreisförmige Areal, auf dem mehr als fünfzehntausend Soldaten begraben lagen.
Die Zeit verstrich, irgendwann konnte Emmerich seine Füße nicht mehr spüren. »Tschuldigung«, sprach er eine Frau an, deren Gesicht von einem Kreppschleier verdeckt wurde. »Wissen Sie, wie spät es ist?«
Anstatt zu antworten, deutete sie auf die Turmuhr der Luegerkirche, die Viertel nach neun anzeigte.
Kopp sollte längst da sein.
Emmerich zündete sich eine Zigarette an und rotierte einmal um die eigene Achse. Wo steckte der Kerl bloß? Mehr und mehr wurde er von einem diffusen Unbehagen erfasst. Irgendetwas lag in der Luft, und das war nicht nur der Geruch nach Schnee. »Xaver Koch ist gefährlich. Verdammt gefährlich. An Ihrer Stelle würde ich ihm die Frau und die Kinder lassen. Legen Sie sich nicht mit so einem an«, hatte Kopp bei ihrem letzten Treffen gesagt, doch Emmerich war nicht darauf eingegangen, hatte die Warnung für einen Vorwand gehalten, um noch mehr Geld aus ihm herauszupressen.
Hätte er das Ganze ernst nehmen sollen?
Als ihn jemand von hinten an der Schulter packte, fiel ihm vor lauter Schreck die Zigarette aus dem Mund. Er fuhr herum.
»Verdammt, Ferdinand«, fluchte er, als er seinen Assistenten erkannte. »Musst du dich so anschleichen?«
»Tut mir leid.« Ferdinand Winter, ein schmaler Bursche, der stets nobel gekleidet war und im Gegensatz zu Emmerich über eine gute Kinderstube verfügte, bückte sich und hob die Zigarette auf. »Normalerweise sind Sie nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen.«
Emmerich wich seinem fragenden Blick aus, nahm die Zigarette und rauchte weiter. »Was machst du hier? Ich dachte, deine Familie läge in Gersthof begraben.«
»Das stimmt, aber ich bin nicht zur Andacht gekommen. Ich bin hier wegen der Arbeit. Es gibt eine Leiche, und Ihre Hauswirtin meinte, Sie wären auf dem Zentralfriedhof. War gar nicht einfach, Sie zwischen den vielen Leuten zu finden.«
Emmerich schnaubte. Das war mal wieder typisch. Kaum kümmerte er sich um eine persönliche Angelegenheit, schon wurde jemand ermordet.
»Um ehrlich zu sein, hätte ich Sie gar nicht so eingeschätzt.« Winter suchte nach dem passenden Wort. »So sentimental … so christlich.«
»Bin ich auch nicht.« Emmerich erwog, seinem Assistenten die Wahrheit anzuvertrauen, entschied sich aber dagegen. Er wollte Winter nicht in seine Privatfehde hineinziehen, wollte ihn nicht unnötig in Gefahr bringen. Er schaute sich noch einmal um. Der Wind löste Blätter aus den Baumkronen und trieb sie über das Gräberfeld, Krähen zogen am Himmel vorbei, ein Hauch von Weihrauch erfüllte die Atmosphäre. Bruno Kopp war nirgendwo zu sehen und würde wohl auch nicht mehr auftauchen. »Gehen wir.«
Mit starrem Blick und aufeinandergepressten Lippen marschierte Emmerich in Richtung Ausgang. Erst als ein Mann in einer abgetragenen K.-u.-k.-Uniform ihn anrempelte und ohne ein Wort des Bedauerns einfach weiterlief, machte er seiner Frustration Luft. Er schimpfte so derb, dass Winter rote Ohren bekam.
Warum war Kopp nicht gekommen? Gab es eine harmlose Erklärung, oder steckte mehr dahinter? Würde er sich wieder melden? Und wenn nicht, welche Möglichkeiten blieben ihm dann, um Luise und die Kinder wiederzufinden?
»Was weißt du über den Mord? Kennst du schon Details?«, versuchte er, seine Gedanken auf etwas weniger Schmerzvolles zu lenken.
»Nicht viel. Männliche Leiche im 6. Bezirk. Hofmühlgasse. Wurde heute früh von der Vermieterin gefunden. Offenbar ziemlich schlimm, das Ganze. Schlimmer als sonst.«
»Was soll das heißen? Schlimm? Blutiger als im Krieg und trauriger als hier kann es am Tatort wohl kaum sein.«
»Verschreien Sie’s nicht.« Winter schlang die Arme um seinen Oberkörper. »Der Wachmann, der als Erster am Tatort eingetroffen ist, war mit den Nerven angeblich ziemlich am Ende.« Er schauderte. »Da kommt was auf uns zu.«
3
Sie holperten in einer Kutsche über die Simmeringer Hauptstraße, die traurigste Straße Wiens. Sie entlangzufahren hieß, durch ein Memento mori zu reisen. Wohin man auch sah, fiel das Auge auf Dinge, die an das Unausweichliche erinnerten: Bestattungsinstitute, Steinmetze, Sargmacher … Betriebe, die genau wie er selbst und Winter so schnell nicht arbeitslos werden würden.
Schweigend starrten sie aus den Fenstern. Die Gebäude, die sie passierten, waren in der Nähe des Zentralfriedhofs noch klein gewesen und hatten weit auseinandergestanden, nun wurden sie immer höher und rückten näher aneinander, bis sie zu massiven Bauten anwuchsen, zwischen denen enge, mittelalterlich anmutende Gassen verliefen.
Emmerich scherte sich nicht um die Welt draußen, lieber dachte er an Luise, während Winter, der noch nicht lange mit Kapitalverbrechen zu tun hatte, sich wahrscheinlich schon gegen das wappnete, was gleich auf sie zukommen würde.
Erst als der Kutscher mit einem lauten »Da wär’n ma!« seine Pferde zum Stehen brachte, wurden sie aus ihren Gedanken gerissen. Emmerich richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf das Hier und Jetzt.
Trotz des unwirtlichen Wetters hatte sich bereits eine große Menschenmenge vor dem schmalen Haus eingefunden. Auch der Leichenwagen der Gerichtsmedizin war schon da. Nüchtern und geschäftsmäßig stand er zwischen den Gaffern, ein schwarzer Ruhepol inmitten einer Horde aufgeregter Männer und Frauen.
»Elendes Gesindel, neugieriges.« Emmerich riss die Tür auf und stieg aus.
»Was für ein Aufstand«, wunderte Winter sich. »Langsam sollten die Leute doch an den Tod gewöhnt sein.«
»Nichts lässt die eigenen Sorgen besser vergessen als das Unglück anderer.« Der Kutscher fasste sich an den Zylinder, schnalzte mit der Zunge und trabte davon.
»Oder aber es ist, wie ich schon gesagt habe«, murmelte Winter laut genug, dass Emmerich es hören konnte. »Ziemlich schlimm, das Ganze. Schlimmer als sonst.«
»Wir werden’s ja gleich sehen.« Emmerich zeigte dem Uniformierten, der den Eingang sicherte, seine Legitimation. »Leib und Leben«, sagte er knapp und betrachtete den Burschen.
Der war blass um die Nase, der Geruch von Erbrochenem umwehte ihn. »Sie werden schon erwartet.«
Emmerich drehte sich noch einmal um und ließ seinen Blick über die Schaulustigen wandern. Irgendetwas hatte seine Aufmerksamkeit geweckt. Irgendjemand. Doch je stärker er versuchte, das vage Gefühl auf den Punkt zu bringen, desto mehr entglitt es ihm. »Es wird einfacher mit der Zeit«, sagte er zu dem Wachmann, zündete sich eine Zigarette an und betrat das Haus.
»Wird es nicht«, flüsterte Winter und folgte seinem Vorgesetzten.
Der Eingangsbereich war menschenleer, gedämpftes Gemurmel drang aus allen Richtungen.
»Da sieh mal einer an.« Ein gedrungener Mann, der die kakaobraune Dienstkleidung des Sicherheitswachekorps trug, war am oberen Absatz einer Treppe erschienen und eilte nun zu ihnen herunter. Rüdiger Hörl. »Emmerich und Winter. Wie läuft’s bei ›Leib und Leben‹?«
»Das Gehalt ist mies, und die Kollegen nerven. Alles wie früher.« Emmerich grinste und schüttelte Hörl die Hand. In ihrer Zeit als Polizeiagenten hatten Winter und er mit dem Ordnungshüter zusammengearbeitet. »Was ist hier los?«
»Ihr seid hier, was wird’s wohl sein?«
Emmerich rollte mit den Augen. »Details«, forderte er.
Hörl zeigte auf die Zigarette, die in Emmerichs Mundwinkel hing, woraufhin dieser ihm eine Schachtel voller Selbstgedrehter reichte. Er roch daran. »Machorka-Tabak? Nicht Ihr Ernst!« Mit gerümpfter Nase nahm er einen der filterlosen Stumpen. »Die Bezahlung bei ›Leib und Leben‹ muss wirklich lausig sein.«
»Details«, wiederholte Emmerich.
»Gegen acht ging ein Anruf bei uns ein. Eine alte Frau stünde auf der Straße und schreie Zeter und Mordio.« Hörl zündete die Zigarette an und hustete. »Als würde man glühende Eisenspäne einatmen.«
Emmerich bedeutete ihm weiterzureden.
»Ich bin mit dem Grünschnabel hergefahren, wir haben sie ins Haus gebracht und ihr so lange Tee mit Rum eingeflößt, bis sie sich wieder beruhigt hatte. Ihr Name ist Cäcilie von Waldstein. Sie ist die Besitzerin des Hauses, Witwe, alleinstehend. Den Mann ans Alter verloren, einen Sohn an den Krieg, einen an die Spanische Grippe. Vermietet die ehemaligen Dienstbotenzimmer, um über die Runden zu kommen.« Hörl zog einen schmalen Notizblock aus seiner Gesäßtasche und blätterte nach hinten. »Kaspar Hofbauer, Ignaz Wagner, Arnulf Kainz.«
»Ich nehme an, das sind die Namen der Mieter«, warf Winter ein.
»Die Heiligen drei Könige sind’s jedenfalls nicht.« Mit angewidertem Gesicht nahm Hörl noch einen Zug. »Die Herren Wagner und Kainz sind heut in der Früh bei der alten Waldstein vorstellig geworden. Irgendwas sei mit dem Hofbauer, haben sie zu ihr gesagt. Sie solle nach dem Rechten sehen.«
»Und?«, hakte Emmerich nach, als Hörl nicht mehr weitersprach, sondern den Notizblock wegsteckte und sich Tabakbrösel von den Lippen klaubte.
»Na, was wohl? Sie hat’s gemacht und sie dabei gefunden, die Leich’. Ziemlich grauslige Angelegenheit.«
Langsam verlor Emmerich die Geduld. »Kann mir bitte endlich wer sagen, was genau passiert ist?«
»Um das herauszufinden, sind Sie hier.« Hörl zeigte auf die steile Holztreppe, die er zuvor heruntergekommen war. »Am besten, Sie schauen es sich selbst an. Ist schwer in Worte zu fassen.«
»Ich dachte, Sie waren im Krieg.«
»War ich auch. Marine. Matrose auf der SMS Prinz Eugen.«
»Dann haben Sie doch wohl so einiges gesehen.«
Hörl zuckte mit den Schultern. »Aber halt nicht so was.«
»Jetzt bin ich aber mal gespannt.« Emmerich stieg auf die erste Stufe, was mit seinem lädierten Knie kein einfaches Unterfangen war. Bereits nach wenigen Tritten schoss der altbekannte Schmerz durch sein Bein.
»Spurensicherung und Gerichtsmedizin sind auch schon oben«, rief Hörl. »Die Frau von Waldstein und ihre Mieter sitzen im Salon und warten auf Ihre Anweisungen.«
»Passt!«
Emmerich mühte sich weiter über die knarrende Treppe und betrachtete die Gemälde, die an den Wänden hingen – grimmig dreinblickende Männer in aristokratisch steifer Pose. Zumindest Frau von Waldsteins Ahnen zeigten sich ungerührt ob des Vorfalls.
Im zweiten Stock endete der Aufgang, und Emmerich schaute sich fragend um. Wo waren denn bloß alle? Normalerweise herrschte am Schauplatz eines Mordes reges Treiben, sodass man den Ort des Geschehens unmöglich verfehlen konnte.
»Ich glaube, wir müssen da durch.« Winter zeigte auf eine hölzerne Vertäfelung.
Emmerich runzelte die Stirn. »Durch die Wand?«
Winter drückte gegen ein Paneel, das sich daraufhin nach innen öffnete und laut quietschend den Blick auf einen düsteren Flur freigab. »Die Dienstbotenzimmer sind in vielen Herrenhäusern …«
»… von den ach so feinen Räumen der ach so feinen Leute separiert«, fiel Emmerich ihm ins Wort. »Damit die Hochwohlgeborenen nicht vom Anblick des arbeitenden Volkes belästigt werden.« Er spähte in den Durchgang. Eng und finster war es in der Welt hinter der Welt, die aus einem grob gezimmerten Dielenboden und fünf verzogenen Holztüren bestand – zwei zur Rechten, zwei zur Linken und eine direkt gegenüber. Der muffige Geruch von feuchtem Mauerwerk hing in der Luft, und er suchte vergeblich nach einem Lichtschalter. »Vorne hui, hinten pfui.« Seine Abscheu gegen die sogenannte bessere Gesellschaft kochte in ihm hoch.
»Ah, die Herren von ›Leib und Leben‹. Da sind Sie ja endlich.« Ein stattlicher Mann war in der hinteren rechten Tür erschienen. »Sie haben sich Zeit gelassen.« Kein Geringerer als Professor Dr. Alwin Hirschkron war mit der Leichenschau vor Ort betraut worden. Der Mittfünfziger war Ordinarius und Vorstand des Instituts für gerichtliche Medizin und zudem ein gefragter Gutachter.
Sie hatten den Besten geschickt.
»Ich hatte noch Verpflichtungen. Allerheiligen. Friedhof. Sie wissen schon …« Emmerich schüttelte Hirschkrons Hand. »Womit haben wir es zu tun?«
»Sehen Sie selbst.«
»Kann denn hier keiner mehr Klartext reden?« Emmerich schob sich an dem Gerichtsmediziner vorbei, blickte in die Kammer – und verstand.
»Herr im Himmel.« Winter hatte ihm über die Schulter geschaut. Er wich zurück, während Emmerich den letzten Zug von seiner Zigarette nahm und leise durch die Zähne pfiff.
Das Zimmer war maximal zehn Quadratmeter groß und wurde durch ein schmales Fenster mehr schlecht als recht mit Licht versorgt. Das bisschen reichte jedoch, um einen ersten Eindruck von dem zu vermitteln, was sich hier drinnen abgespielt haben musste: auf dem Boden, den Wänden und dem spärlichen Mobiliar − überall im Raum rotbraune Blutspritzer.
»Männliche Leiche, zwischen dreißig und vierzig«, sagte Hirschkron. »Laut der Vermieterin handelt es sich um einen gewissen Kaspar Hofbauer. Seine Ausweispapiere bestätigen ihre Angabe.«
Emmerich blickte sich um. Alles schien ordentlich und aufgeräumt. »Sieht nicht aus, als hätte es einen Kampf gegeben.«
»Wenn, dann keinen langen. Der Mörder muss diesen Hofbauer überrascht und mit einem gezielten Stich seine Karotis punktiert haben.« Hirschkron fasste an eine Stelle rechts von seinem Kehlkopf. »Die Halsschlagader steht unter hohem Druck, deshalb das viele Blut.«
Emmerich nickte und rieb seine Handflächen aneinander. »Verdammt, ist das kalt hier.« Er sah zu, wie sein Atem in der Luft kondensierte. »Frost und Tote, dafür hätte ich gleich auf dem Zentralfriedhof bleiben kön…« Er hielt mitten im Satz inne, als sein Blick auf die Leiche fiel, die im hinteren Teil des Zimmers auf einem schmalen Bett lag. Der nackte Mann starrte mit aufgerissenem Mund an die Decke, sein rechter Arm hing herunter, sein Körper wirkte sonderbar verrenkt. Doch nicht das war es, was Emmerichs Aufmerksamkeit geweckt hatte – es war die Tatsache, dass das Opfer glänzte, als wäre es mit einer schimmernden Lasur überzogen worden. »Was zur Hölle …«, murmelte er und trat näher.
»Immer wenn man glaubt, man hätte schon alles gesehen …« Hirschkron trat neben ihn.
»… dann lässt sich das Leben einen neuen perversen Spaß einfallen. Was ist das?« Er beugte sich über die Leiche. »Ist das etwa …?«
»Eis.«
Emmerich deutete auf den Füllfederhalter, der aus Hirschkrons Brusttasche lugte. Der Gerichtsmediziner reichte ihm das gute Stück, und Emmerich schlug damit sachte auf die Füße des Toten. Ein leises Klacken ertönte.
»Von allein ist das nicht entstanden, so viel steht fest«, erklärte Hirschkron. »Der Täter muss den Körper mit Wasser übergossen und dann das Fenster geöffnet haben. Die Kälte hat den Rest besorgt.« Er betrachtete die Leiche mit derselben Mischung aus Faszination und Befremden wie Emmerich es gerade getan hatte.
»Irgendeine Idee, was das zu bedeuten hat?«
»Vielleicht etwas Persönliches. Möglicherweise wollte der Täter aber auch nur den Zeitpunkt des Mordes verschleiern. Durch das Einfrieren ist es so gut wie unmöglich, den Eintritt des Todes zu bestimmen. Ich habe gefallene Soldaten in den Alpen gesehen, die lagen seit Jahren im Eis und wirkten, als wären sie gerade erst gestorben.«
Emmerich entgegnete nichts. Wortlos klopfte er die Leiche ab. Beine, Bauch, Brust. »Die Eisschicht geht nur bis zum Hal… Oh!« Er hatte ein Detail entdeckt, das sogar ihn kurz aus der Fassung brachte. Im weit aufgerissenen Mund des Opfers befand sich eine klaffende Wunde. »Wo …?« Er schaute sich um, musterte das Bett, das Nachttischkästchen und den fadenscheinigen Teppich, auf dem sie standen.
»Sie ist nicht hier.« Hirschkron hatte wohl seine Gedanken erraten. »Zumindest nicht in diesem Raum. Der Rest der Truppe durchsucht gerade das Haus. Es würde mich aber wundern, wenn sie etwas fänden.«
»Sie denken, der Mörder hat die Zunge mitgenommen? Als Trophäe?«
Hirschkron zuckte mit den Schultern. »Es ist Ihre Aufgabe, das herauszufinden. Ich muss mich zum Glück nur mit den Überresten des Opfers und nicht mit den Perversionen irgendeines Wahnsinnigen herumschlagen.«
»Glauben Sie, dass wir es damit zu tun haben? Mit einem Wahnsinnigen?«
Hirschkron zwirbelte seinen Schnurrbart. »Genug davon laufen herum. Seit dem Krieg ist die halbe Stadt voll mit Irren. Das viele Sterben, die große Not … das macht etwas mit den Leuten. Das schlägt nicht nur aufs Gemüt, sondern auch auf den Verstand.«
»Das Ganze wirkt doch aber eigentlich gut organisiert«, warf Winter ein, der noch immer auf dem Flur stand und durch die offene Tür den Ausführungen gefolgt war. »Der Mörder hat Hofbauer überrascht, ihn getötet und ist unbemerkt wieder verschwunden. So etwas bedarf Intelligenz und Planung.«
»Was auch immer dahintersteckt … sobald Sie es herausgefunden haben, seien Sie so gut und erhellen Sie mich. Es würde mich wirklich interessieren.« Hirschkron wandte sich zu Winter um. »Sind Sie so lieb und geben meinem Assistenten Bescheid, dass die Leiche bereit für den Abtransport ist?«
»Werden Sie ihn so durch die schmale Tür kriegen?« Emmerich deutete auf den Toten, dessen steif gefrorene Beine gespreizt waren.
»Die Männer von der Spurensicherung haben nachgemessen, es sollte knapp gehen. Zur Not müssen wir ihn seitwärtsdrehen oder – im schlimmsten Fall – die Extremitäten brechen.«
Winter zögerte nicht lange und eilte davon.
4
»Ich lasse das Opfer zum Auftauen in ein Wasserbad legen«, erklärte Hirschkron. »Am Nachmittag kann ich es dann obduzieren. Ich schätze, so gegen drei Uhr.«
»Wir werden da sein.«
Emmerich und Winter verließen den Dienstbotentrakt und folgten Wachtmeister Hörl in den Salon, wo die Hausherrin und ihre zwei verbliebenen Mieter bereits auf sie warteten.
Beim Anblick des Raumes verspürte Emmerich eine Mischung aus Mitleid und Genugtuung. Jetzt, da die Inflation das Barvermögen der ehemaligen Von und Zus in wertloses Papier verwandelte, mussten diese, genauso wie der Rest des Volks, andere Wege finden, um ihr Leben zu bestreiten. Überall in der Stadt sah man Trödler aus Palais und Herrschaftshäusern kommen, vollbepackt mit Teppichen, Geschirr und Möbeln. Schätze, die jahrhundertelang in den feinen Familien Österreich-Ungarns weitervererbt worden waren, wurden nun ins Ausland verscherbelt. Devisen füllten den Magen, Tradition tat das nicht.
Auch hier hatten die Aasgeier gewütet, das war nicht zu übersehen. Dunkle Flecken markierten jene Stellen, an denen früher Gemälde gehangen hatten, Abdrücke im Parkett erinnerten an längst verheizte Tische und Kredenzen. Die wenigen Einrichtungsgegenstände, die übrig geblieben waren, darunter ein Bild von Kaiser Franz Josef, wirkten verloren in dem großen Zimmer – genauso verloren wie ihre Besitzerin in der neuen Weltordnung.
Nostalgie hing in der Luft, die Sehnsucht nach vergangenen Tagen.
Cäcilie von Waldstein saß auf einer ausladenden Chaiselongue, in der einen Hand ein Taschentuch, in der anderen ein Fläschchen mit Riechsalz. Sie ließ ihren Blick zwischen den Anwesenden umherwandern und schien wenig erfreut darüber, dass der Pöbel sich in ihr Hoheitsgebiet verirrt hatte.
»Passen Sie gefälligst auf, das ist eine echte Comtoise«, rief sie, als ein Mann von der Spurensicherung eine vergoldete Standuhr anhob.
»Läuft eh nimmer«, murmelte der in seinen Bart.
»Hier drinnen steht die Zeit noch auf Monarchie«, fügte Hörl hinzu.
»Meine Herren«, grüßte Emmerich. »Frau Waldstein.«
»Von«, entgegnete sie und schenkte ihm einen pikierten Blick. Sein abgetragener Anzug, die schmutzigen Schuhe und sein ungekämmtes Haar ließen sie die Nase rümpfen.
»Wie Sie meinen, Frau Von.« Er verzichtete darauf, sie über das Adelsaufhebungsgesetz zu belehren, lehnte sich gegen eine Kommode und wandte seine Aufmerksamkeit den blassen Männern zu, die etwas abseits auf einer schmalen Bank saßen. »Ignaz Wagner? Arnulf Kainz?«
Die beiden nickten.
»Sie lebten Tür an Tür mit Herrn Hofbauer?«
»Ja. Er rechts, ich vis-à-vis«, sagte Kainz, ein magerer Kerl mit einem schmalen Oberlippenbart.
»Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen?«
Die beiden schauten sich an und zuckten mit den Schultern.
»Vor einer Woche? Vielleicht zwei?«
»Wir haben keinen Gemeinschaftsraum oder so was«, warf Wagner, ein untersetzter Mann mit schütterem Haar, ein. »Außerdem war Hofbauer einer, der gern für sich blieb. Von dem hat man nie was gesehen oder gehört.«
»Auch nicht, als er brutal ermordet wurde?«
Die beiden schüttelten wortlos den Kopf.
»Es muss passiert sein, während wir in der Uni waren, oder die Sache ist sehr leise vor sich gegangen«, fand Kainz als Erster seine Sprache wieder.
Emmerich zündete sich eine Zigarette an, legte den Kopf in den Nacken und paffte dicke blaugraue Rauchkringel in Richtung Decke. »Wie haben Sie gemerkt, dass bei ihm etwas nicht stimmt?«
»Haben Sie unsere Türen gesehen? Das Holz ist fürchterlich verzogen, überall sind Löcher und Ritzen. Aus dem Zimmer vom Hofbauer ist eiskalte Luft geströmt und hat alles noch ungemütlicher gemacht, als es eh schon ist. Es grenzt an ein Wunder, dass mir die Haare in der Nacht nicht am Kissen angefroren sind.« Wagner sah seine Vermieterin zornig an, was diese geflissentlich ignorierte. »Es war abgesperrt, und auf unser Klopfen und Rufen hat er nicht reagiert. Deshalb haben wir …« Er nickte in die Richtung Cäcilie von Waldsteins. »Sie hat einen Zweitschlüssel.«
»Wie schaut’s bei Ihnen aus, Frau Von?«, wandte Emmerich sich an die alte Dame. »Wann haben Sie Herrn Hofbauer das letzte Mal gesehen?«
»Vor ungefähr zwei Stunden«, sagte sie hörbar genervt.
»Lebend.« Emmerich schaute zu, wie seine Zigarettenasche auf das blank gewienerte Parkett fiel.
»Das war vor etwas mehr als sechs Monaten, als er hier eingezogen ist.«
»Wir Mieter haben im schönen, warmen Haupthaus nichts verloren«, erklärte Kainz. »Wir betreten unsere Zimmer über den Dienstboteneingang. Es gibt eine Treppe, die vom Hinterhof aus direkt nach oben führt.«
Emmerich nahm einen langen Zug. »Erzählen Sie mir mehr über Herrn Hofbauer.«
»Anständig hat er gewirkt. Gewählte Sprache, gute Manieren, gepflegtes Äußeres. So etwas ist heutzutage selten.« Die alte Frau warf ihm einen vielsagenden Blick zu.
»Hatte er Familie? Was war er von Beruf?«
»Ledig. Keine Kinder. Die Eltern verstorben. Von Beruf war er Versicherungsvertreter. Er war deshalb viel auf Reisen und nur sporadisch hier. Mehr weiß ich nicht.« Sie spielte an dem Riechsalzfläschchen herum, das sie noch immer in der Hand hielt. »Wenn ich das gewusst hätte …«, murmelte sie. »Dass der mir den Tod und den Plebs anschleppt … Nie und nimmer hätte ich ihn hier wohnen lassen.«
»Dem Plebs entkommt man in diesen Zeiten halt nicht«, sagte Hörl so laut, dass alle es hören konnten.
Emmerich unterdrückte ein Grinsen und wandte sich an Kainz und Wagner. »In der ganzen Zeit, in der Sie Zimmernachbarn waren, werden Sie doch wohl irgendetwas über Hofbauer erfahren haben. Denken Sie nach. Jedes Detail könnte von Bedeutung sein.«
»Hmmm …« Wagner strich über sein lichtes Haar, unter dem die glänzende Kopfhaut durchschimmerte. »Er war die meiste Zeit fort, und wenn er hier war, hatte ich immer das Gefühl, dass er mir aus dem Weg geht, dass er hinter seiner Tür wartet, bis ich aus dem Haus bin, um mir nicht im Flur zu begegnen …«
»Mir ging es genauso«, warf Kainz ein. »Letzten Monat hat er auf der Straße so getan, als würde er mich nicht kennen. Überhaupt hatte er etwas Sonderbares an sich, als wollte er etwas verbergen.«
»Sie haben nie wirklich mit ihm geredet«, fasste Emmerich zusammen.
»Das nennt man Privatsphäre«, warf die Vermieterin ein.
Emmerich lächelte schief und setzte an zu gehen, da sinnierte Kainz laut weiter.
»Jetzt, wo ich drüber nachdenke … Vielleicht hat er mich wirklich nicht erkannt. Er schien in Gedanken versunken, irgendwie gehetzt …«
Emmerich wartete, doch es kam nicht mehr. »Ich nehme an, Sie haben bereits alle Personalien aufgenommen und den Herrschaften erklärt, dass sie sich zu meiner Verfügung halten sollen«, wandte er sich an Hörl.
»Sowieso, bin ja kein Frischg’fangter.«
»Gut, dann sind wir hier fürs Erste fertig.« Emmerich nickte Winter zu.
In diesem Moment kam ein Mitglied der Spurensicherung auf sie zugeeilt. »Wir haben etwas gefunden«, rief der Mann und hielt einen schwarzen Ledermantel hoch. »Das könnte Sie interessieren.«
5
Die Bäume wogten im Wind, Blätter tanzten durch die Luft, und es roch nach Schnee. Wie gern wäre Luise in den Wald hinterm Haus gegangen, um Tannenzweige, Bucheckern und Moos zu sammeln. Daraus hätte sie einen Kranz flechten und anschließend zum Zentralfriedhof fahren können, wo ihre Eltern begraben lagen. Doch die würden dieses Jahr vergeblich warten. Niemand würde an ihrem geschmückten Grab stehen und um sie trauern. Kein Gesteck, keine Kerzen, keine Tränen.
Xaver hatte es verboten.
So wie Xaver alles verbot.
Nicht genug damit, dass er sie gegen ihren Willen an die äußerste Stadtgrenze verschleppt hatte, sie durfte das alte Fuhrwerkshaus nur verlassen, wenn er es erlaubte. Meistens unter Aufsicht, niemals gemeinsam mit den Kindern. Zu groß war seine Angst, dass sie ihn verlassen könnte.
Dabei ging es Xaver schon lange nicht mehr um sie. Seine Liebe hatte er in Russland gelassen, zusammen mit seiner Güte. Es ging nur noch um Stolz, um Besitz, um irgendeine fehlgeleitete Vorstellung von Männlichkeit. Er konnte es nicht ertragen, sie mit einem anderen zu wissen, am allerwenigsten mit August. Eher würde er sie umbringen. Sie – und wenn es sein musste, auch Emil, Ida und den kleinen Paul.
Er war nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Er hatte den Krieg mitgebracht.
Tränen verschleierten ihre Sicht und ließen die Landschaft hinter der Fensterscheibe verschwimmen. Mit einem Mal waren die Tannen nur noch schemenhafte Gebilde vor einem vernebelten Hintergrund.
Der freundliche Tischler, den sie damals geheiratet hatte, existierte nicht mehr. Der brutale Schwarzmarkthändler, der an seine Stelle getreten war, konnte ihren Anblick nicht ertragen. Sie sah es in seinen Augen, spürte es an seinen Schlägen. Der vermeintliche Ehebruch, den sie begangen hatte – er konnte ihn nicht vergessen.
Unzählige Male hatte sie ihm die Gefallenenmeldung gezeigt, in der sein Tod erklärt worden war. Sie hatte sich gerechtfertigt, ihn um Verzeihung gebeten, doch so etwas wie Absolution kannte er nicht. Für ihn war sie schuldig und hatte zu büßen. Immer häufiger, immer härter.
Wenn es so weiterging mit seinem Hass, würde sie den Frühling nicht mehr erleben.
Luise blickte wieder nach draußen, wo der Wald tobte, und dachte ans Sterben. Sie war gewappnet, hatte keine Angst. Der Tod war nicht mehr als ein Hauch, ein Flügelschlag – danach endlich Frieden.
Doch was würde aus den Kindern werden? Sie konnte erst gehen, wenn sie die drei in Sicherheit wusste.
Das Ende hatte noch zu warten.
Sie musste etwas unternehmen.
Doch was? Was konnte sie tun?
6
»Du Oasch, du depperter! Greif mi ned o!«
Im Vestibül des Polizeigebäudes schrie und fluchte ein junger Kerl so lautstark, dass es vermutlich bis in die oberen Stockwerke zu hören war. Obwohl er Handschellen trug und von drei breitschultrigen Wachmännern eskortiert wurde, schlug er um sich, teilte Tritte aus und fing schließlich hysterisch an zu lachen.
Während Winter konsterniert dreinschaute, schüttelte Emmerich den Kopf. »Verdammte Platten. Die elendige Brut wird langsam zu einem echten Problem.«
Tatsächlich hatte das Platten-Wesen beispiellose Ausmaße angenommen. Viele Eltern, besonders Kriegerwitwen, waren gezwungen, ihre Kinder sich selbst zu überlassen, weswegen diese – sei’s aus Langeweile, Hunger oder unter dem Einfluss schlechter Gesellschaft – früh auf den falschen Weg gerieten. Alkohol, Tabak und Glücksspiel nahmen den Platz ein, der eigentlich von Büchern und Schulheften besetzt sein sollte. Diebstahl, Schutzgelderpressung und Zuhälterei waren die nächsten Schritte in den kriminellen Karrieren der Jugendlichen, die sich häufig zu gefürchteten Banden zusammenrotteten – den sogenannten Platten.
»Noch Fetzer oder schon Randal?« Emmerich musterte den Burschen, der die typische Aufmachung der Gauner trug: eine auffällig gestreifte Krawatte, einen pelzbesetzten Mantelkragen und eine Kappe mit hochgebogenem Schirm. Das Haar, das darunter hervorlugte, war mit Schweinefett und Zuckerwasser in Form gebracht worden. Starr, wie aus Holz geschnitzt, bewegte sich die Tolle keinen Millimeter, ganz gleich, wie wild der Kerl seinen Kopf auch schüttelte.
»Randal«, erklärte einer der Uniformierten. Während die Mitglieder der Fetzer-Platten aus schulpflichtigen Jungen und Mädchen bestanden, die auf Auslagendiebstahl spezialisiert waren, richtete sich der Fokus der etwas älteren Randal-Platten auf Schutzgelderpressung und Zuhälterei. »Vermischt sich in letzter Zeit aber immer mehr«, fügte er hinzu. »Außerdem schließen sich wegen der hohen Arbeitslosigkeit immer mehr Erwachsene an. Tagelöhner, ehemalige Soldaten, Zuchthäusler … Das ganze Gesindel halt. Das ist Toni Lesch, der Anführer der Lesch-Platte. Treibt normalerweise in Margareten sein Unwesen. Wir haben ihn gerade drüben in der Leopoldstadt aufgegriffen. Dort hat er einen gegnerischen Plattinger halb totgeschlagen.«
»Wir werden Wien mit Angst und Schrecken überzieh’n.« Lesch rollte die Augen so weit nach oben, bis nur mehr das Weiße zu sehen war, und kicherte. Dabei wurde seine Stimme immer höher und höher, bis sie schließlich brach.
Emmerich trat neben ihn. »Du kannst dich so verrückt aufführen, wie du willst, du kommst trotzdem nicht nach Steinhof. Glaubst du, du wärst der Erste, der die glorreiche Idee hat, sich ins Narrenhaus einliefern zu lassen, weil man von dort besser abhauen kann?« Er wandte sich an die Uniformierten. »Ganz gleich, wie irr er sich anstellt, er kommt rüber in den Häfn. Wenn er dort weiter Ärger macht, dann steckt ihn in eine Zelle mit gegnerischen Platten-Brüdern.«
Der junge Mann fing erneut lauthals an zu lachen. »Ihr seid’s ja alle so deppert. Ihr Idioten habt keinen blassen Schimmer von nix.«
»Abführen. Schafft ihn mir aus den Augen.« Emmerich musste sich zusammenreißen, dem Kerl keine Kopfnuss zu verpassen.
»Keinen blassen Schimmer von nix? Was er damit wohl gemeint hat?«, fragte Winter, während sie über die Treppe in den ersten Stock stiegen, wo sich die Abteilung »Leib und Leben« befand.
Emmerich antwortete nicht. Gedankenverloren schaute er über die Balustrade nach unten, wo der noch immer tobende Gefangene abgeführt wurde.
»Keine Ahnung habt ihr«, rief dieser, als er Emmerichs Blick bemerkte. »Scheißkieberer, ihr werdet alle noch blöd schau’n.«
»Irgendetwas braut sich zusammen«, sagte Emmerich. »Irgendetwas tut sich in der Stadt, und es ist nichts Gutes.«
In der Abteilung »Leib und Leben« angelangt, eilten er und Winter durch einen langen Flur, der von dunkelbraunen Nussbaumholztüren gesäumt wurde. Ganz am Ende, in einer ehemaligen Besenkammer, befand sich ihr kleines Reich.
Doch bevor sie dort ankamen, trat Revierinspektor Peter Brühl aus seinem Amtszimmer. »Habe die Ehre.« Er stellte sich ihnen breitbeinig in den Weg und grinste.
Emmerich, der den miesen Paragrafenreiter nicht ausstehen konnte, grunzte etwas Unverständliches und versuchte, sich an ihm vorbeizudrängen.
»Schon gehört?«, ließ Brühl nicht locker. »Harbort geht in Pension, und Götz wechselt zum Erkennungsdienst.«
»Und?«
»Deren Büro wird frei.« Brühl strich mit der Hand über sein dichtes, schwarz glänzendes Haar, das seitlich gescheitelt und mit Pomade geglättet war. »Sie wissen schon, das mit dem dicken Teppich und der schalldichten Tür.«
Emmerich wusste ganz genau, um welches Büro es ging: um einen großen hellen Raum, der mit hochwertigem Mobiliar eingerichtet war. Ein Reich voller Komfort und Privilegien. »Und Sie wollen uns jetzt unter die Nase reiben, dass Sie es übernehmen werden.«
»Es wird darauf hinauslaufen. Der Chef gibt es dem Mann, der am Jahresende die beste Bilanz vorweisen kann. Und das werde auf jeden Fall ich sein.« Er zwinkerte, deutete eine Verneigung an und spazierte davon.
»He!«, rief Emmerich ihm hinterher. »So sicher ist das aber nicht. Ich liege fast gleichauf.«
»Noch«, rief Brühl in einem vielsagenden Ton über seine Schulter. »Aber nicht mehr lange! Mein neuer Assistent, Szepanek, leistet gute Arbeit, und mit zwei gesunden Beinen ist man doppelt so schnell wie mit nur einem.«
»Arschloch.« Nachdem sie ihr Kabuff betreten hatten, stellte Emmerich eine große Papiertüte auf den Tisch. »Kein Wunder, dass Brühl und Szepanek in der Statistik vor uns liegen. Die müssen ihre Fälle nicht in so einem winzigen Loch lösen.«
»Noch können wir die beiden überholen«, entgegnete Winter.
Emmerich nickte. »Gehen wir’s an.« Er zog den schwarzen Ledermantel aus der Tüte und breitete ihn vor sich aus.
»Vom Opfer?«
»Ja, der hing offenbar im Schrank. Den Kollegen von der Spurensicherung ist aufgefallen, dass er geraschelt hat.« Emmerich öffnete eine Schreibtischschublade, holte ein Messer heraus und trennte vorsichtig die Nähte auf.
»Zeitungspapier? Um bei der Kälte besser geschützt zu sein?« Winter nahm die Seiten, die Emmerich aus dem Futter gezogen hatte, und betrachtete sie.
»Das ist nur Füllmaterial.«
»Oh.« Winter machte große Augen, als Emmerich ihm Dollar und Lire unter die Nase hielt. »Glauben Sie, der Mörder hatte es darauf abgesehen?«
Emmerich schüttelte den Kopf. »Das Zimmer war überschaubar – fast so klein wie unseres hier. Der Täter hätte das Geld problemlos finden können. Dazu diese bizarre Inszenierung der Leiche. Nein … Ich bin sicher, dass es um etwas ganz anderes ging.«
»Schon eine Idee, was das gewesen sein könnte? Der Raum war sehr unpersönlich eingerichtet. Keine Fotos, keine Bücher … nichts, das irgendeinen Rückschluss auf Hofbauers Charakter oder sein Umfeld zulassen würde.«
Emmerich dachte an seine eigene Wohnsituation. »Manchmal ergibt sich das halt so«, sagte er, während er Banknote um Banknote ans Tageslicht beförderte. »Außerdem reichen diese Scheine, um sich ein ungefähres Bild von ihm zu machen. Dieser Kerl war kein Versicherungsvertreter. Er war ein Geldschmuggler. Das ist eine ganz eigene Sorte von Mensch. Seit der Kronenkurs so niedrig ist, floriert der illegale Handel mit ausländischer Währung. Diese Schweine schleppen Millionen von Valuten nach Österreich. Valuten, die immer kaufkräftiger werden und den hiesigen Markt endgültig ruinieren.«
»Sie glauben, jemand hielt ihn für einen schäbigen Kriegsgewinnler? Für einen von denen, die die Inflation noch weiter anheizen und sich am Elend der Bevölkerung bereichern?«
»Das, oder eine Fehde unter Konkurrenten ist eskaliert. Wie auch immer – wir sollten uns im Milieu umhören.« Das Büro war so winzig, dass Emmerich einfach nur den Arm auszustrecken brauchte, wenn er die Tür öffnen wollte. »Fräulein Grete«, rief er auf den Flur hinaus.
Kurz darauf steckte eine junge Frau ihren Kopf ins Zimmer. Ihr kinnlanges brünettes Haar war ordentlich onduliert, sie war dezent geschminkt. Wie immer, wenn sie in Winters Nähe kam, nahmen ihre Wangen einen zarten Rotton an.
»Kaffee?«, fragte sie und lächelte.
»Rufen Sie doch bitte die Abteilung für Wirtschaftskriminalität an. Finden Sie heraus, wer dort für den Valutaschmuggel zuständig ist, und stellen Sie den Herrn Kollegen dann zu mir durch. Und ja, Kaffee wäre fein.«
»Sie können Fräulein Grete nicht dauernd als Privatsekretärin missbrauchen. Sie ist Telefonistin«, warf Winter ein, als die junge Frau wieder verschwunden war. »Es ist nicht ihre Aufgabe, uns zu bedienen.«
»Glaub mir, ich tue ihr einen Gefallen. Sie freut sich über jeden Vorwand, bei uns reinzuschauen – und zwar nicht meinetwegen.«
Winter sah verschämt zur Seite. »Soll ich das Geld in die Asservatenkammer bringen?«
»Versuch nicht abzulenken. Außerdem glaubst du doch nicht etwa, dass es da lange bleiben würde. Wenn wir die Scheine dort deponieren, werden sie …«, Emmerich malte Gänsefüßchen in die Luft, »… verloren oder verlegt, so schnell kannst du gar nicht schauen.«
»Behalten können wir sie aber auch nicht.«
Emmerich zündete sich eine Zigarette an und dachte nach. »Wir verwahren das Geld fürs Erste hier im Büro. Danach schauen wir weiter.«
Winter riss das Fenster auf, eiskalte Luft strömte herein. »In der Asservatenkammer gehen doch nur Polizisten, Richter und Rechtsanwälte ein und aus.«
»Na und? Dank der schlechten Wirtschaftslage und der verfluchten Inflation geht es allen gleich schlecht. Weißt du eigentlich, wie hart das Leben für manche Leute ist? Besonders für die, die Kinder haben?« Unvermittelt musste er an Luise und die drei Kleinen denken. Sie waren eine Familie geworden. Ob sie wohl gesund waren? Genug zu essen hatten? »Erst gestern hab ich Zeitungsannoncen gelesen. Menschen, die ihren Nachwuchs aus eigener Kraft nicht mehr durchbringen können, suchen darin nach wohlhabenden Adoptiveltern.« Seine Augen wurden feucht. Schnell drehte er sich fort und schloss das Fenster wieder.
»Der Tabak, den Sie seit Neuestem rauchen, stinkt ganz schön.«
»Verstunken ist noch keiner, erfroren aber schon.«
Noch bevor Winter etwas entgegnen konnte, kam Fräulein Grete zurück. »Ich habe Herrn Seger von der Wirtschaftskriminalität in der Leitung. Ich stelle ihn gleich zu Ihnen durch.« Sie reichte den beiden je eine dampfende Tasse.
»Danke.« Emmerich nippte an seinem Kaffee, hielt inne und legte den Kopf schief. »Was wären wir nur ohne Sie, mein liebes Fräulein Grete«, sagte er schließlich. »Sie sind ein Engel.« Er lächelte, so freundlich er konnte, und kassierte dafür einen irritierten Blick von seinem Assistenten.
Fräulein Grete dagegen strahlte von Ohr zu Ohr, strich ihren Rock glatt und zupfte an ihrer Bluse. »Jederzeit gern.«
»Was war denn das?«, fragte Winter, nachdem sie wieder hinausgegangen war.
»Wir müssen den Wettstreit gegen Brühl gewinnen, und wenn wir die Hühnerarmee auf unserer Seite haben, ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil.«
»Die Hühnerarmee?«
»Du weißt schon … die Sekretärinnen und Telefonistinnen … die kennen sich untereinander, gehen am Abend gemeinsam aus, erzählen sich den neuesten Klatsch und Tratsch …«
Winter runzelte die Stirn.
»Unterschätze niemals die Macht einer Vorzimmerdame. Ab sofort werden wir …« Emmerich wurde vom Läuten des Telefons unterbrochen.
»Seger, Wirtschaftskriminalität. Sie wollten mit mir reden«, meldete sich der Kollege.
»So ist es. Ich brauche Informationen über einen Geldschmuggler. Kaspar Hofbauer. Sagt Ihnen der Name was?«
»Hofbauer? Nein. Muss einer von den kleinen Fischen sein. Von denen gibt es Hunderte, und jeden Tag kommen neue dazu.«
»Heute ist einer weggekommen.«
Es folgte Schweigen. Nur ein leises Rauschen war in der Leitung zu hören. »Kann nicht behaupten, dass mir das leidtut«, sagte Seger schließlich.
»So geht es wohl den meisten, trotzdem müssen wir herausfinden, wer’s war.« Emmerich beugte sich vor und hielt den Hörer so, dass Winter das Gespräch mitverfolgen konnte.
»Das wird nicht einfach. Viele Bürger haben eine verdammte Wut auf die elende Bagage. Die Kerle sind Schädlinge der schlimmsten Sorte. Aus purer Gier schleppen sie ausländische Werte in großen Summen ein und kurbeln dadurch die Inflation noch mehr an.« Segers Worte trieften nur so vor Zorn. »Es könnte jeder gewesen sein.«
»Verdammt«, murmelte Emmerich.
»Hören Sie sich in den Schieberkaffeehäusern um. Vielleicht weiß dort jemand etwas.«
»Schieberkaffeehäuser?«
»Sie sind nicht firm auf dem Gebiet, oder?«
»Erhellen Sie mich.«
»Wie bei allen Unternehmen gibt es eine klare Hierarchie. Ganz unten stehen die Schmuggler. Sie fahren regelmäßig ins Ausland, besorgen dort die Scheine und bringen sie über die Grenze. Die Mistkerle sind dabei äußerst erfinderisch, packen das Geld in Autoreifen, doppelte Kofferböden, hohle Spazierstöcke, in Brotlaibe und so weiter. Hier in Wien wird die Ware dann von Schiebern entgegengenommen, kumuliert und weitervertrieben.«
»Und diese Geschäfte tätigen sie im Kaffeehaus?«
»Ganz genau. Hocken im Warmen, fressen und saufen wie die Maden im Speck, und wir können nichts dagegen tun.«
»Weil?«
Seger lachte trocken. »Der Besitz von Valuten ist nicht strafbar, und den Handel können wir nur selten nachweisen. Und auch wenn …« Er schnaubte. »Meistens sind die Kerle in wenigen Stunden wieder auf freiem Fuß. Erstens ist das Gesetz zu milde, und zweitens können sie sich mit der vielen Kohle Bestechungsgelder und die teuersten Anwälte leisten.«
»Bei dem Mord könnte es sich demnach um einen Fall von Selbstjustiz handeln«, überlegte Emmerich laut.
»Genug erboste Leute gäbe es.«
»Was hieße, dass noch mehr Morde zu erwarten sind.«
»Das würde mich nicht überraschen und – unter uns gesagt – auch nicht stören, wenn es bloß was nutzen würde. Aber die Valutahändler sind wie die Hydra. Schlägt man einen Kopf ab, wachsen zwei nach.« Seger seufzte. »Wie auch immer. Sie brauchen die Adressen der Kaffeehäuser. Haben Sie was zu schreiben?«
Winter zückte einen Stift und ein Blatt Papier. »Geht schon.«
»Die Juden hocken im Café Adler, die anderen sind im Café Börse und im Café Residenz anzutreffen. Seit Kurzem hat sich auch das Café Salztorbrücke zu einem beliebten Umschlagplatz entwickelt. Ich an Ihrer Stelle würde dort schauen. Fragen Sie nach Ansgar Pavlovic. Er gilt in den Kreisen momentan als die Nummer 2. Aber erwarten Sie nicht zu viel. Pavlovic ist ein arroganter Hurensohn. Gut möglich, dass er Sie nicht mal mit dem Hintern anschaut.«
»Sie sagten Nummer 2. Wer ist die Nummer 1?«
»Das wissen wir nicht.« Seger seufzte erneut. »Und auch wenn wir’s wüssten – es würde keinen Unterschied machen. Der Kerl hat mehr Geld und Macht als der Staatskanzler. Den kriegen Sie nie dran.«
»Das werden wir sehen.« Emmerich drückte seine Zigarette im überquellenden Aschenbecher aus, bedankte sich und legte auf. »Das wird nicht einfach mit dem neuen Büro.« Er packte Hofbauers Mantel zurück in die Papiertüte und schloss das Geld in den Aktenschrank. »Auf geht’s!«
7
Das Café Salztorbrücke lag nur ein paar hundert Meter vom Polizeigebäude entfernt, und so gingen Emmerich und Winter zu Fuß den Donaukanal entlang. Beide stellten die Kragen ihrer Mäntel hoch und stemmten sich gegen den eisigen Wind, der ihnen von Osten her entgegenblies.
»Verdammte Schneckenfresser«, schimpfte Emmerich, als ein französisches Patrouillenboot an ihnen vorbeifuhr. »Die Alliierten kontrollieren uns, als ob wir Schwerverbrecher wären. So wird das nichts mit der Völkerfreundschaft.« Tatsächlich hatten die Siegermächte Truppen nach Österreich entsandt, um die Einhaltung des Friedensvertrags sicherzustellen. »Engländer, Amerikaner, Franzosen, Italiener … Mit denen hatten wir im Krieg schon genug Ärger. Wir brauchen nicht …«
»Eine Spende. Eine kleine Spende«, unterbrach ein verwahrloster Mann Emmerichs Litanei. Er saß nur wenige Meter von der Salztorbrücke entfernt auf dem Gehsteig. »Hab meine Beine fürs Vaterland geopfert.« Er präsentierte zwei schmutzige Stümpfe.
Winter kramte nach ein paar Münzen, Emmerich schenkte ihm eine Zigarette.
Augenblicklich erschienen noch mehr in Lumpen gehüllte Gestalten und drängten sich um die Kriminalbeamten. Die meisten von ihnen waren Invaliden mit eingefallenen Wangen und leeren Blicken.
»Ein Almosen, bitte ein Almosen«, flehten sie.
»Wo kommen die denn auf einmal her?« Winter war sichtlich erschrocken über die plötzliche Belagerung.
»Die wohnen unter der Brücke.« Emmerich verteilte seine Selbstgedrehten. »Von dort führen Kanalschächte stadteinwärts, in denen ist es halbwegs windgeschützt, und der feuchtwarme Dunst der Abwässer hält sie warm.«
»Wie schrecklich.« Winter drückte Münzen in ausgestreckte Hände, bis sein Portemonnaie leer war.
Als es nichts mehr zu verschenken gab, ließen die Elendsbrüder von ihnen ab, sodass sie die letzten paar Meter unbehelligt zurücklegen konnten.
Knisternde Luft schlug ihnen aus dem Lokal entgegen, Gemurmel erfüllte den Raum, dicke graublaue Rauchschwaden vernebelten die Sicht. Wiens Kaffeehäuser waren und blieben zeitlose Inseln der Heimeligkeit in einem Meer aus Chaos und Not.