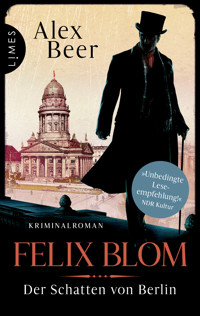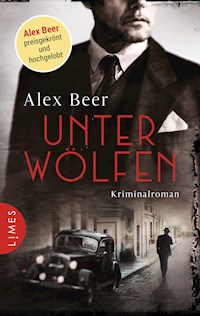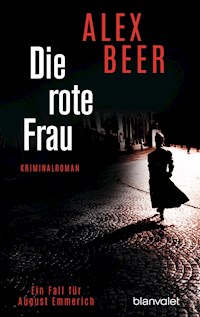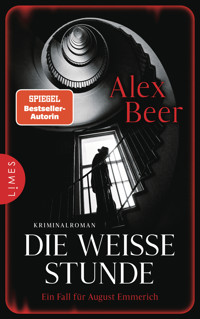
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kriminalinspektor-Emmerich-Reihe
- Sprache: Deutsch
Drei ungelöste Frauenmorde und ein Täter, der zurückgekehrt zu sein scheint …
Wien 1923. Die Stadt gleicht einem Pulverfass, die politischen Lager haben sich radikalisiert, die Hakenkreuzler sind auf dem Vormarsch. Mitten in dieser angespannten Situation geschieht ein aufsehenerregender Mord: Marita Hochmeister, eine stadtbekannte Gesellschaftsdame, wird brutal erschlagen in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Einen Tag später weist ein pensionierter Kriminalinspektor den Ermittler August Emmerich auf eine ungelöste Mordserie hin – damals, vor zehn Jahren, wurden drei Frauen auf ähnlich grausame Weise getötet wie das Opfer. Kann es sein, dass der Mörder zurückgekehrt ist? Und wenn ja, kann Emmerich ihn stellen, bevor er erneut zuschlägt?
»Für mich eine der tollsten Krimi-Kommissar-Figuren, die es überhaupt in den letzten Jahren gab. Deswegen: Die August-Emmerich-Reihe unbedingt lesen.« Stefan Keim, WDR 4
Verpassen Sie nicht die anderen historischen Kriminalromane von Erfolgsautorin Alex Beer!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Wien 1923. Die Stadt gleicht einem Pulverfass, die politischen Lager haben sich radikalisiert, die Hakenkreuzler sind auf dem Vormarsch. Mitten in dieser angespannten Situation geschieht ein aufsehenerregender Mord: Marita Hochmeister, eine stadtbekannte Gesellschaftsdame, wird brutal erschlagen in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Einen Tag später weist ein pensionierter Kriminalinspektor den Ermittler August Emmerich auf eine ungelöste Mordserie hin – damals, vor zehn Jahren, wurden drei Frauen auf ähnlich grausame Weise getötet wie das Opfer. Kann es sein, dass der Mörder zurückgekehrt ist? Und wenn ja, kann Emmerich ihn stellen, bevor er erneut zuschlägt?
Autorin
Alex Beer, geboren in Bregenz, hat Archäologie studiert und lebt in Wien. Ihre spannende Krimireihe um den Ermittler August Emmerich erhielt zahlreiche Shortlist-Nominierungen (u. a. für den Friedrich-Glauser-Preis, Viktor Crime Award, Crime Cologne Award) und wurde mit dem Leo-Perutz-Preis für Kriminalliteratur 2017 und 2019 sowie dem Krimi-Publikumspreis des Deutschen Buchhandels MIMI 2020 prämiert. Auch der Österreichische Krimipreis wurde der Autorin 2019 verliehen. Neben dem Wiener Kriminalinspektor hat Alex Beer mit Felix Blom eine weitere faszinierende Figur erschaffen, die im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhundert ermittelt und für den sie mit dem silbernen Homer 2023 ausgezeichnet wurde.
Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.instagram.com/alexbeerwriter
Von Alex Beer bereits erschienen:
Die Kriminalinspektor-Emmerich-Reihe:
Der zweite Reiter
Die rote Frau
Der dunkle Bote
Das schwarze Band
Der letzte Tod
Die Isaak-Rubinstein-Reihe:
Unter Wölfen
Unter Wölfen – Der verborgene Feind
Die Felix-Blom-Krimis:
Felix Blom – Der Häftling aus Moabit
Felix Blom – Der Schatten von Berlin
Alex Beer
Die weiße Stunde
Ein Fall für August Emmerich
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 by Alex Beer
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Kai Gatheman
Copyright © 2024 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Christiane Branscheid
Covermotiv und -gestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung eines Motivs von Linda Blazic-Mirosevic, Shutterstock.com
KW · Herstellung: DiMo
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30432-4V003
www.limes-verlag.de
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Sonntag, 8. April 1923
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Montag, 9. April 1923
12
13
14
15
Dienstag, 10. April 1923
16
17
18
19
20
21
22
23
Mittwoch, 11. April 1923
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Donnerstag, 12. April 1923
35
36
37
38
39
40
41
Freitag, 13. April 1923
42
43
Nachwort
Quellenangaben
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Newsletter-Anmeldung
»Der beste Prophet der Zukunft ist die Vergangenheit.«
Lord Byron
Sonntag, 8. April 1923
1
Der Tod wird auf schnellen Schwingen zu demjenigen kommen, der die Ruhe des Pharao stört. Dieser Satz wollte Marita Hochmeister bereits den ganzen Tag nicht aus dem Kopf gehen. Wie ein lästiger Ohrwurm hatte er sich in ihrem Hirn eingenistet, seit sie beim Frühstück einen Artikel über eine ägyptische Ausgrabung in der Illustrierten Kronen Zeitung gelesen hatte.
Nichts war imstande gewesen, die unheilvollen Worte aus ihren Gedanken zu tilgen. Nicht der Pianist in ihrem Stammcafé, der »Ausgerechnet Bananen« spielte. Nicht der Werkelmann an der Straßenecke vor ihrem Haus, der »O du lieber Augustin« zum Besten gab. Auch nicht ihre Freunde, die ihr zu Ehren aus vollen Kehlen ein bekanntes Geburtstagslied gesungen hatten.
Sie setzte sich an ihren Schminktisch, gähnte und starrte in den ovalen Spiegel. Eine schlanke Frau mit zerzaustem Haar blickte ihr entgegen, blass und müde.
Die ausgelassene Feier an diesem Abend und der darauffolgende Streit mit Joachim hatten Spuren hinterlassen.
Die vergangenen fünfunddreißig Jahre hatten Spuren hinterlassen.
Älter werden war nichts für schwache Gemüter.
Der Tod wird auf schnellen Schwingen zu demjenigen kommen, der die Ruhe des Pharao stört. Laut Kronen Zeitung hatte dieser Satz auf einer Tontafel gestanden, die in der Grabkammer des Tutanchamun gefunden worden war. Die Archäologen hatten den Fluch als Humbug abgetan, als den kläglichen Versuch ägyptischer Hohepriester, auf diese Weise Grabräuber abzuschrecken. Doch nun war Lord Carnarvon, der Finanzier der Ausgrabung, unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen.
Marita Hochmeister fröstelte, die Härchen in ihrem Nacken richteten sich auf. Ein unheilvolles Gefühl überkam sie. Plötzlich schien ihr, als wäre jemand mit ihr im Raum. Sie drehte sich um, ließ ihren Blick durch das Schlafzimmer wandern, doch da war niemand.
»Du Dummerchen«, sagte sie. »Du wirst doch wohl nicht wunderlich werden.« Obwohl sie bereits recht angeheitert war, spülte Hochmeister das Gefühl der Beklemmung mit einem weiteren Schluck Champagner hinunter. Sie trank direkt aus der Flasche und wischte sich anschließend mit dem Handrücken über die Lippen.
Genug von dem toten alten Lord und dem Fluch des Pharao. Es hatte gereicht, dass auf der Party alle Gäste davon geredet hatten, als gäbe es nichts Wichtigeres. Sie hatte ihren Geburtstag gefeiert und eine Mumie hatte ihr die Show gestohlen.
»Verdammter Tutanchidiot«, schimpfte sie leise und stellte die Flasche neben sich auf den Boden. Männer machten nichts als Ärger, selbst wenn sie seit ein paar Tausend Jahren tot waren.
Hochmeister dachte an Joachim, diesen elenden Kretin, kämmte ihr langes erdbeerblondes Haar und schmierte anschließend Gesicht und Dekolleté mit Crème Iris ein. »Die Lieblings-Toilette-Crème der feinen Damenwelt«, zitierte sie deren Werbeslogan.
Ach, wenn Mutter doch noch am Leben wäre. Sie würde vor Stolz platzen, in Anbetracht der Tatsache, dass ihre Tochter der Gosse entkommen war und sich vor Kurzem sogar eine herrliche Wohnung im Herzen der Stadt gekauft hatte.
Wie hieß es so schön? Der Arme wohnt in einem Zimmer, der Wohlhabende in fünf, der Reiche in zehn. Sie verfügte nun über ganze elf Räume – und zwar nicht irgendwo, sondern in der Beletage des berühmten Heinrichshofs, mit Blick auf den prunkvollen Ring, die Königin der Wiener Straßen.
Zufrieden mit sich selbst, stand Marita Hochmeister auf, löschte das Licht und ließ ihren Morgenmantel über die Schultern zu Boden gleiten. Nackt, wie Gott sie schuf, ging sie durch den silbernen Glanz des Mondscheins, der von draußen durch das Fenster fiel, und trat neben ihr Himmelbett, das mit kunstvollen Ornamenten verziert war. Sie ließ sich auf die Matratze fallen und zog die Decke bis unter die Nasenspitze. Die indische Seide, mit der sie bezogen war, fühlte sich angenehm weich an.
Marita Hochmeister schloss die Augen, doch obwohl sie todmüde war, wollte sich der Schlaf nicht einfinden.
Sonderbar. Üblicherweise döste sie, wenn sie ein paar Gläser zu viel gekippt hatte, innerhalb weniger Augenblicke weg. Aber nicht heute. Heute hielt sie irgendetwas wach.
Der Tod wird auf schnellen Schwingen zu demjenigen kommen, der die Ruhe des Pharao stört.
Sie starrte in die Düsternis, von draußen war Hufgeklapper zu hören sowie das Gegröle eines Betrunkenen und das leise Flüstern des Ostwinds. Alltägliche Geräusche, in denen plötzlich ein bedrohlicher Unterton mitschwang.
Irgendetwas stimmte nicht.
»Ist da jemand?« Hochmeister war überrascht, wie brüchig und verzagt ihre Stimme klang. »Joachim? Bist du es?«
Natürlich war er es nicht. Er hatte keinen Schlüssel. Niemand außer ihr und der Zugehfrau, die zweimal wöchentlich zum Putzen kam, besaß einen. Dies war ihr Reich, das sie mit niemandem teilte. Wer sollte also hier sein? Alle Gäste hatten die Festivität verlassen und auch Joachim war gegangen. Dennoch war ihr, als würde sie eine Art Präsenz spüren.
»Ist da jemand?«, rief Marita Hochmeister noch einmal und kam sich dabei fürchterlich einfältig vor.
Ihr Atem ging schneller, ihr Herz schlug bis zum Hals. Sie tastete nach den Streichhölzern, die neben ihr auf dem Nachtkästchen lagen, und zündete mit zitternden Händen eine Kerze an. Im flackernden Licht der kleinen Flamme sah sie sich um. Niemand war hier. Sie war allein. Was war heute nur los mit ihr? Leise seufzend ließ Marita Hochmeister die Zungenspitze über ihre Lippen gleiten. Diese fühlten sich trocken und spröde an, genau wie ihr Gaumen. Sie verspürte Durst und brauchte dringend einen Schluck Wasser. Bestimmt war auch noch ein Stück Geburtstagstorte übrig geblieben. Fett und Zucker waren schon immer das beste Heilmittel gegen Nervenflattern gewesen.
Marita Hochmeister schwang ihre Beine aus dem Bett und richtete sich auf.
Dann ging alles ganz schnell.
Etwas schoss unter dem Bett hervor und fasste nach ihr. Raue Finger, kräftig wie ein Schraubstock, umschlangen ihren Knöchel.
Hochmeister schrie auf.
Der Eindringling zerrte an ihrem Fuß, sie verlor die Balance, fiel nach vorn und schlug mit dem Gesicht auf die Dielen. Blut schoss ihr aus der Nase, ein metallischer Geschmack breitete sich in ihrem Mund aus, ein benommenes Gefühl in ihrem Kopf.
»Hilfe!«, ächzte sie, während sie mit dem freien Bein nach dem Angreifer trat. Sie versuchte, sich hochzustemmen, sich aus dem Griff zu winden, doch es wollte ihr nicht gelingen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, ihr Herz mit Panik. »Nehmen Sie, was Sie wollen«, wimmerte sie. »Ich habe Geld. Auf dem Schminktisch liegt ein Kuvert. Nehmen Sie es.«
Die Finger lösten sich von ihrem Knöchel. Sie hörte ein Knacken, gefolgt von einer Art Schleifen. Der Angreifer musste unter dem Bett hervorgekrochen sein.
Marita Hochmeister schaffte es, sich auf den Rücken zu drehen, stützte sich auf ihre Unterarme, schob sich nach hinten und tastete nach etwas, das sie als Waffe verwenden konnte. Doch alles, was sie zu fassen bekam, war ihr Morgenmantel.
Wohin hatte sie die verdammte Champagnerflasche gestellt?
Der Eindringling erhob sich, ein dunkler Umriss baute sich vor Marita Hochmeister auf und wirkte dabei riesengroß und mächtig. Der Schatten blickte schweigend auf sie hinab.
»Bitte! Bitte! Ich habe auch Schmuck«, flehte Hochmeister. »Und Aktien. Nehmen Sie. Nehmen Sie alles.«
Schweigend trat die Gestalt einen Schritt auf Hochmeister zu und hob einen Knüppel in die Höhe. »Es muss sein«, zischte eine heisere Stimme.
2
»Das hat mir gerade noch gefehlt.« Mit einem missmutigen Zug um den Mund blickte Kriminalinspektor August Emmerich nach oben. Dunkle Wolken hatten sich vor die schwache Sonne geschoben und ließen dicke Schneeflocken auf die Stadt fallen.
Was als blütenweiße Reinheit vom Himmel rieselte, verlor, sobald es den Boden erreichte, all seine Unschuld und verwandelte sich in grauen Matsch. Dieser erstickte das junge Gras und die zarten Knospen, die der Frühling in den vergangenen Tagen auf die Wiesen und die Äste der winterkahlen Bäume gezaubert hatte.
Emmerich zündete sich eine Zigarette an, nahm einen tiefen Zug und humpelte weiter, wobei er beinahe auf einer gefrorenen Pfütze ausgerutscht wäre. »Verdammte Schei…« Den Rest der Verwünschung schluckte er hinunter. Er hatte geschworen, unflätige Ausdrücke aus seinem Sprachschatz zu streichen, seit er letzte Woche in die Schule seines jüngsten Sohnes zitiert worden war, um sich dort eine Standpauke bezüglich seiner Ausdrucksweise anzuhören.
»Sie sind Pauls großes Vorbild«, hatte die Lehrerin mit erhobenem Zeigefinger erklärt. »Er ahmt Sie nach. Unter anderem, was die Wahl Ihrer Worte anbelangt.« Sie hatte die Hände in die knochigen Hüften gestemmt und Emmerich mit einem tadelnden Blick bedacht. »Der Kleine ist gerade mal sechs Jahre alt und flucht derber als ein betrunkener Lastenkutscher.«
Emmerich ermahnte sich zur Contenance und humpelte mit hochgestelltem Kragen stadtauswärts. Dabei passierte er abgewohnte Mietskasernen und Fabriken, aus deren Schloten beißender Rauch aufstieg, und ging an windschiefen Lagerhallen und zugemülltem Brachland vorüber. Je näher er dem Schönbrunner Schlosspark kam, desto mehr begann sich die Gegend zu verändern. Die Häuser wurden imposanter, die Gärten weitläufiger. Blank polierte Automobile parkten in großzügig angelegten Einfahrten, hell erleuchtete Fenster ließen glanzvolle Salons erahnen.
In diesem Viertel wirkte Emmerich mit seinen ausgetretenen Schnürschuhen und dem fadenscheinigen Mantel, der mehrfach geflickt und dessen Futter zum Schutz vor der Kälte mit Zeitungspapier ausgestopft war, wie ein Fremder. Ein Außenseiter, ein Eindringling, der hier nicht hergehörte. Dies war das Wien der reichen Leute. Das Wien der Spekulanten und Industriellen, der Bankiers und des ehemaligen Adels. Auf jeden Fall war es kein Ort für einen einfachen, abgebrannten Kriminalbeamten.
Er wischte sich Schneeflocken aus dem Gesicht und blieb vor einem hohen schmiedeeisernen Zaun stehen. Mit ungläubigem Staunen, das ihn täglich aufs Neue überkam, betrachtete er die Villa, die dahinter lag. Es handelte sich um ein Barockpalais mit aufwendig gestalteter Fassade, spitzen Giebeln und breiten Mansardenfenstern.
Emmerich nahm den letzten Zug von seiner Zigarette und zupfte sich einen Tabakkrümel von der Zunge. Er schnippte gerade den Stummel fort, als auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Fenster aufgerissen wurde.
Ein lautes Räuspern erklang und Emmerich wusste genau, was gleich folgen würde.
»Herr Emmerich!« Eine Frauenstimme spuckte den Namen mehr aus, als dass sie ihn rief.
Er biss die Zähne aufeinander und schlang seine Finger derart fest um den Knauf seines Spazierstocks, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Lange Zeit hatte er sich gegen den Einsatz einer Gehhilfe gewehrt, doch die Folgen seiner Kriegsverletzung zwangen ihn dazu.
»Ich weiß, Frau Herschmann«, rief er, ohne sich umzudrehen. »Der Verputz bröckelt, der wilde Wein wuchert. Das Haus ist ein Schandfleck für die Nachbarschaft.«
»Nicht nur das Haus«, rief sie. »Auch die Einfahrt und der Garten. Und die …«
»Die Bewohner«, vervollständigte er den Satz.
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Aber gemeint.«
Sie schnaubte, ging aber nicht weiter darauf ein. »Wann kümmern Sie sich endlich darum?«
»Sobald ich einen Goldesel habe.« Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, durchschritt Emmerich das herrschaftliche Tor, auf dem die Initialen A.v.B. prangten. Anselm von Breitenberg.
Jedes Mal, wenn er über die kiesbedeckte Auffahrt ging, die zu der Villa führte, überkam ihn ein eigenartiges Gefühl. Eine Mischung aus Verwunderung und Traurigkeit. Er konnte es noch immer nicht glauben. Das Gebäude, das inmitten einer großen Wiese stand, gehörte ihm. Ihm, dem Waisenjungen, dem Tagelöhner und Fußsoldaten, der sich mehr schlecht als recht durchs Leben gekämpft hatte, bevor er über verschlungene Wege bei der Polizei gelandet war.
Jahrelang hatte er nach seinen Eltern gesucht, und als es ihm endlich gelungen war, das Geheimnis seiner Herkunft zu lüften, hatte sich das Schicksal, dieser grausame Ränkespieler, wieder einmal einen Scherz mit ihm erlaubt.
Emmerich hatte seinen Vater gefunden, nur um ihn sofort wieder zu verlieren. Ihm war nichts geblieben, außer einer blassen Erinnerung sowie als Erbe ein mysteriöser Schlüssel und diese baufällige Villa, die ihm mittlerweile mehr Ärger als Freude bereitete.
Er öffnete die Haustür und betrat die Eingangshalle. Im ersten Moment wirkte alles elegant und durchaus luxuriös: Der Boden bestand aus fugenlos gegossenem Terrazzo, an der Decke hing ein riesiger Kronleuchter, eine elegant geschwungene Treppe führte in die oberen Stockwerke. Erst bei näherem Hinhören offenbarte sich der desolate Zustand des Hauses. Der Wind, der durch eine Vielzahl undichter Ritzen pfiff, brachte die schmutzigen Lusterkristalle zum Klimpern. Morsches Holz ächzte und knackte, und dann war da auch noch der Niederschlag, der durch das undichte Dach in verschiedene Eimer und Töpfe tropfte.
»Und?« Am oberen Ende der Treppe erschien eine groß gewachsene Schönheit, deren schwarzes Haar zu einem modernen Bubikopf geschnitten war. Irina Novotny, eine ehemalige Nackttänzerin, die seit dem Tod seiner geliebten Luise als Mitbewohnerin und Mutterersatz für Emmerichs drei Stiefkinder fungierte, kam herunter und sah ihn erwartungsvoll an.
Emmerich zog die Tür hinter sich zu, lehnte seinen Stock an die Wand und nahm seine Schiebermütze ab. »Wieder mal Fehlanzeige«, erklärte er. »Das beschi…« Er räusperte sich. »Das vermaledeite Ding hat zu keinem der Spinde im Ruderclub gepasst.« Er holte einen filigranen silbernen Schlüssel aus der Manteltasche und warf ihn ihr zu.
Geschickt fing Irina ihn auf. »Schon wieder eine Sackgasse.« Sie hielt den Schlüssel ins Licht, drehte und wendete ihn, wie sie es bereits zigmal getan hatte. »Wo gehörst du hin, du kleiner Schlingel?«
»Die Sache mit dem Erben hatte ich mir anders vorgestellt.« Emmerich trat ans Fenster und fuhr mit der Fingerspitze vorsichtig über einen Sprung in der Scheibe. »Anstelle von Reichtümern eine Bruchbude und einen Schlüssel, der nirgendwo passt.«
»Nun ja.« Irina zuckte mit den Schultern und sah sich um. »So wie deinem Vater erging es im Krieg vielen Adeligen. Sie haben schnell gemerkt, dass Lebensmittel und Medikamente wertvoller sind als Schmuck und Seide.«
Tatsächlich waren die Perserteppiche des Barons für Morphium draufgegangen, ein Großteil der Möbel für Brot und Fleisch. Manschettenknöpfe und Siegelringe waren gegen Kohlebriketts eingetauscht worden, und als der einstige Millionär nicht mehr in der Lage gewesen war, Löhne und Gehälter zu bezahlen, suchte selbst das treueste Personal nach und nach das Weite.
Emmerich blickte zu dem lebensgroßen Gemälde seines Vaters, das am oberen Ende der Treppe hing, und musterte dessen Züge. »So ein alter Kasten braucht Geld, um in Schuss gehalten zu werden«, murmelte er. »Und ich habe nicht annähernd genug. Unsere letzte Hoffnung ist der Schlüssel – oder besser gesagt, das, was sich möglicherweise hinter seinem Schloss verbirgt.«
Emmerich und Irina hatten bereits die ganze Villa auf den Kopf gestellt. Sie hatten sämtliche Banken, Bahnhöfe und Postämter aufgesucht und dort probiert, die Schließfächer zu öffnen. Vergebens.
»Wir sollten darüber nachdenken, das Haus zu verkaufen.« Emmerich durchquerte die Halle und öffnete eine schmale Doppelflügeltür. Dahinter lag das Zimmer, in dem früher das Personal gespeist hatte. Der Raum war klein und daher einfacher zu beheizen als die großen herrschaftlichen Salons. Im Kamin prasselte ein Feuer und verbreitete wohlige Wärme. Der Tisch war für das Frühstück gedeckt. Emmerich legte Holz nach und blickte hinaus in den Garten. »Das Grundstück ist einiges wert. Mit dem Geld könnten wir uns eine nette Wohnung nehmen.«
Irina, die ihm gefolgt war, trat neben ihn. »Das haben wir doch schon besprochen. Die Inflation würde den Verkaufserlös schneller auffressen, als du Wohnung buchstabieren kannst. Außerdem ist dieses Gebäude das Vermächtnis deines Vaters. Du hast so lange nach deinen Wurzeln gesucht.« Sie deutete um sich. »Und hier sind sie.«
»Desolat und heruntergekommen. Wie passend.« Emmerich zündete eine Zigarette an und rauchte gedankenverloren vor sich hin. »Ich denke, für die Kinder …«, setzte er an.
»Für die Kinder ist es hier genau richtig«, fiel ihm Irina ins Wort. »Die drei lieben den Garten und die Tatsache, dass sie so viel Platz und sogar eigene Zimmer haben. Die Sache mit dem undichten Dach und den kaputten Fenstern kriegen wir auch noch hin. Es wird uns schon was einfallen.« Sie stupste ihn mit dem Ellenbogen in die Seite. »Alles wird sich finden.«
»Und die Nachbarn?«
»Seit wann legst du Wert auf die Meinung dieses aristokratischen Gesindels?« Irina sah ihn fragend an. »Der August Emmerich, den ich kenne, würde drauf pfeifen und zudem noch Gerümpel im Vorgarten stapeln oder Laub verbrennen, um sie zu ärgern.«
»Ich dachte an Hühner.« Emmerich lächelte.
»Hühner?«
»Ich könnte einen kleinen Stall bauen und ein Gehege. Frau Herschmann wird es hassen und wir haben täglich frische Eier.«
Irina goss zwei Tassen Eichelkaffee ein. »Ich wusste, dass Verlass auf dich ist.«
Emmerich setzte sich an den Tisch, trank einen Schluck von der dunkelbraunen Brühe und verzog das Gesicht. »Vielleicht finden wir jemanden, der echten Bohnenkaffee gegen Eier eintauscht.«
»Das wäre wunderbar.« Verträumt starrte Irina ein Loch in die Luft. »Wir haben so viel Platz, dass wir auch noch Gemüsebeete anlegen könnten. Dazu ein paar Beerensträucher und einen Kräutergarten. Ich schau gleich mal nach, ob im Schuppen das nötige Werkzeug ist.«
»Mach das. Ich lege mich in der Zwischenzeit ein Weilchen aufs Ohr.«
Die Türglocke machte ihm einen Strich durch die Rechnung.
»Ich gehe schon«, sagte Irina.
»Wenn sich die verfluchte Herschmann wieder beschweren will, dann sag ihr, sie soll verdammt noch mal endlich Ruhe geben.«
Irina, die schon halb zur Tür hinaus war, kam zurück, streckte ihm die Hand entgegen und rieb Zeigefinger und Daumen aneinander.
Emmerich seufzte. »Sprache. Jaja, ich weiß.« Er zückte sein Portemonnaie, entnahm ihm einen Geldschein und reichte ihn ihr.
Irina holte eine Blechbüchse vom Kaminsims und legte das Geld hinein. »Die Schimpfwortdose ist bald voll.«
»Wir sollten das Geld ausgeben, bevor die Inflation es auffrisst. Kauf doch morgen die ersten Hühner damit.«
Es läutete ein zweites Mal.
»Die Kinder werden vor Freude in die Luft springen.« Irina verschwand nach draußen.
Kurz darauf kam sie zurück, gefolgt von einem attraktiven blonden Mann. Er war akkurat und sauber gekleidet, sein Haar gescheitelt und gekämmt und er roch nach einer Mischung aus Leder, Seife und Kölnischwasser.
»Ferdinand«, begrüßte Emmerich seinen Assistenten. »Das ist aber eine Überraschung. Was führt dich her? Schwarzbrot mit Margarine und Eichelkaffee sicher nicht.«
»Schön wär’s, aber …« Winter seufzte. »Es gibt Arbeit.«
3
»Arbeit? Und das am Sonntagmorgen!« Emmerich schob die Kaffeetasse von sich und stand auf.
Winter deutete auf den Schlüssel, den Irina auf den Esstisch gelegt hatte. »Schon wieder Fehlanzeige?«
»Leider«, sagte Emmerich. »Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.« Er hinkte in die Eingangshalle, zog seinen Mantel an und setzte seine Schiebermütze auf. Beide Kleidungsstücke waren noch immer kalt und feucht von seinem frühmorgendlichen Ausflug.
»Irgendwann werden Sie das passende Schloss schon noch finden«, gab sich Winter gewohnt optimistisch.
»Ich hege da langsam meine Zweifel. In den vergangenen Monaten habe ich so ziemlich jedes öffentlich zugängliche Schloss ausprobiert.« Emmerich schnappte sich seinen Stock, ging nach draußen und stellte den Kragen hoch. »Bleiben noch die Schubladen, Truhen und Tresore von privaten Leuten«, erklärte er. »Aber ich kann doch nicht einfach in fremde Häuser gehen und dort mein Glück versuchen.«
»Zutrauen würde ich es Ihnen.«
Noch immer fielen schwere Flocken aus dicken grauen Wolken und überzogen Wien mit einer feuchten Schicht aus Schneematsch.
Missmutig folgte Emmerich seinem Assistenten über die kiesbedeckte Auffahrt bis zur Straße, wo ein zerbeulter Fiat Torpedo stand, dessen Kotflügel mit Einschusslöchern übersät waren. Die Automobile der Wiener Polizei waren Relikte der k.u.k. Armee, in erster Linie Austro-Daimler, aber auch Wagen aus ehemaligen Beutebeständen, wie diese rostige italienische Konservendose, die Emmerich und Winter zugeteilt worden war.
Emmerich kletterte umständlich auf den Beifahrersitz, während Winter die Kurbel vorn am Kühlergrill betätigte. Als der Motor startete, ertönte lautes Knattern und das Gefährt begann heftig zu vibrieren.
»Der Fall …«, sagte Emmerich, nachdem Winter eingestiegen war. »Womit haben wir es zu tun?«
»Mit einer toten Frau im Heinrichshof. Sie wurde in ihrem Schlafzimmer ermordet. Recht brutal. Fräulein Grete meinte, die Haushaltshilfe, die sie gefunden hat, konnte vor lauter Schock kaum sprechen.« Winter bog auf die Ehrenfelsgasse ab und anschließend auf die Schönbrunner Straße. Von dort fuhr er in östlicher Richtung, vorbei am Hundsturmer, dem Spenger- und dem Franzenskino, bis zur barocken Karlskirche, deren Kuppel von zwei massiven, knapp fünfzig Meter hohen Säulen flankiert wurde, was ihr eine orientalische Anmutung verlieh.
Emmerich qualmte schweigend vor sich hin, während er nebenbei die handbetriebene Scheibensäuberungsvorrichtung betätigte. Im nächsten Moment kniff er die Augen zusammen und runzelte die Stirn. »Warte mal …« Er schnippte den Zigarettenstummel auf die Straße, wobei er nur knapp einen Kinderwagen verfehlte. »Fräulein Grete … Warst du etwa im Büro?«
Winter nickte und lenkte den Wagen auf die Ringstraße. Als eine Droschke ihnen den Weg abschnitt, hupte er. Das Geräusch klang blechern, weder die abgehalfterten Gäule noch der feiste Kutscher schenkten ihm Aufmerksamkeit.
»Heute ist Sonntag, Ferdinand. Wir haben zwar Bereitschaftsdienst, aber den kann man auch daheim absitzen, falls du das vergessen hast.«
»Es ist wegen Großmutter. Sie treibt mich noch in den Wahnsinn«, erklärte Winter. »Im Büro habe ich wenigstens meine Ruhe.«
»Verstehe.« Emmerich kannte die alte Frau Winter nur zu gut. »Womit quält sie dich dieses Mal?«
Winter zögerte. »Ach, vergessen Sie’s.« Er brachte das Automobil direkt gegenüber der Oper zum Stehen, wo sich der kostspieligste Privatbau befand, den Wien je gesehen hatte: der sogenannte Heinrichshof.
Das monumentale Gebäude besaß vier markante Ecktürme und glich eher einer Festung als einem Mietshaus. Vor sechzig Jahren war es im Auftrag des Ziegelindustriellen Heinrich Drasche als Domizil für feine Leute errichtet worden. Seither lebten hier Künstler, Bankiers und andere Neureiche in einhundert Wohnungen, die derart geräumig waren, dass der Prachtbau ganze acht Anschriften umfasste: Kärntner Straße 42, Elisabethstraße 2, 4 und 6, Opernring 1, 3 und 5 sowie Operngasse 3. Damit die Geldaristokratie für ihre täglichen Besorgungen keine weiten Strecken zurücklegen musste, hatte man im Erdgeschoss achtundvierzig Verkaufsgewölbe errichtet. Darin waren Lokale und Läden untergebracht, wie etwa das bekannte Café Heinrichshof, ein Juwelier, ein Feinkost- und ein Pelzwarengeschäft.
»Raus mit der Sprache«, ließ Emmerich die Sache nicht auf sich beruhen. »Was hat sich deine Großmutter dieses Mal einfallen lassen, um dir das Leben schwer zu machen?«
»Sie will mich unter die Haube bringen.« Winter stieg aus dem Wagen und schlug die Tür fester zu, als dies nötig gewesen wäre. »Sie bildet sich ein, ich bräuchte eine Ehefrau. Und Sie wissen ja, wie Großmutter ist. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, ist sie nicht mehr zu bremsen.«
Emmerich lachte derart heftig, dass er sich verschluckte und einen bösen Blick von seinem Assistenten kassierte. »Ich finde die Idee gar nicht mal so abwegig. Was gibt es Schöneres als die Liebe? Ich war im Leben nie glücklicher als während der Zeit mit Luise.« Bei der Erinnerung an sie schnürte sich Emmerichs Herz zusammen. Wie ein dunkler Nebel zog Trauer in ihm auf. Eilig quälte er sich aus dem Wagen, zündete eine Zigarette an und nahm einen tiefen Zug.
»Großmutter hält nichts von der Liebe«, erklärte Winter. »Sie behauptet, es handle sich dabei um eine sentimentale Verirrung, die früher oder später verfliegt. Darum will sie, dass ich rational und vernünftig denke, meine Gefühle im Zaum halte und eine gute Partie mache. Eine junge Dame aus der feinen Gesellschaft soll es sein, deren Familie blaues Blut und gute Umgangsformen vorweisen kann.«
»Hat deine Großmutter immer noch nicht eingesehen, dass die Aristokratie passé ist? Heutzutage regiert der Geldadel – und der hat weder das eine noch das andere.«
»Bevor sie irgendetwas einsieht, friert die Hölle zu.« Winter blinzelte eine Schneeflocke fort, die sich auf seinen Wimpern niedergelassen hatte. »Ich habe ihr gesagt, dass sie sich gefälligst nicht in meine privaten Angelegenheiten einmischen soll – und das mehr als einmal.«
»Lass mich raten: Sie hat deinen Wunsch ignoriert?«
»Natürlich hat sie das.« Winter zog die Schultern hoch und ließ sie wieder sinken. »Und damit nicht genug, hat sie doch tatsächlich hinter meinem Rücken ein Rendezvous organisiert. Heute Abend soll ich Charlotte Dietrichstein ins Sacher ausführen.«
»Es gibt Schlimmeres.«
»Charlotte Dietrichstein ist nicht mein Fall. Abgesehen davon will ich mich nicht auf Frauen, sondern auf die Arbeit konzentrieren. Apropos …« Winter zog einen Zettel aus seiner Manteltasche. »Mist«, murmelte er. »Hier steht nur Heinrichshof, aber nicht, welcher Eingang. Das Haus ist so riesig …«
»Wahrscheinlich müssen wir dort hin.« Emmerich deutete auf eine Stelle zehn Meter links von ihnen, wo sich mindestens fünfzig Leute versammelt hatten. Aufgeregtes Murmeln und leises Weinen waren zu hören sowie die Anweisungen eines sichtlich überforderten Wachmanns.
Die beiden Kriminalbeamten schritten auf die Menschentraube zu und drängten sich durch die gaffende Meute.
»Sie können hier nicht durch.« Der Wachmann, der breitbeinig vor der Tür stand, streckte seine Hand aus und schaute Emmerich böse an. Sein Gesicht war gerötet und trotz der Kälte standen Schweißperlen auf seiner Stirn. »Sensationslüsternes Pack«, zischte er.
Winter präsentierte dem Uniformierten den Bundesadler, der seine Dienstplakette zierte. »Leib und Leben«, erklärte er.
Der Wachmann zog die Augenbrauen hoch, trat zur Seite und schob die Tür einen Spaltbreit auf. »Schnell«, erklärte er. »Die sind wie die Hyänen. Der Plebs wird von Tod und Tragödien angezogen wie die Motten vom Licht.« Sein Blick richtete sich auf eine Frau, die einen Notizblock und einen Bleistift in die Höhe hielt, als handle es sich dabei um Schild und Schwert. »Und die Schmierfinken von der Journaille sind auch schon da.«
»Stimmt es?«, rief die Reporterin. »Wurde Frau Hochmeister wirklich ermordet?«
»Wie ist es passiert?«, fragte ein korpulenter Herr. »So sagen Sie doch schon!«
»Kann es sein, dass sich der Mörder noch im Gebäude versteckt?« Eine hagere alte Dame mit Hutschleier starrte die beiden Kriminalbeamten aus weit aufgerissenen wässrig blauen Augen an. »Sind wir in unseren Wohnungen sicher?«
»Wir verlangen Antworten!« Der beleibte Mann reckte die Faust in die Höhe. »Geben Sie uns Auskunft oder Sie hören von meinem Anwalt.«
»Tun Sie, was Sie nicht lassen können.« Emmerich ignorierte die Fragen und Forderungen. Stattdessen musterte er die Anwesenden. Besonders ein Mann stach ihm ins Auge. Er war groß gewachsen, ungefähr fünfzig Jahre alt, elegant gekleidet und hatte einen Schmiss auf der Wange, was ihm einen verwegenen Ausdruck verlieh. Sein Verhalten aber war alles andere als kühn. Im Gegensatz zu den anderen Schaulustigen hielt er sich bedeckt, drängte nicht nach vorn, und was Emmerich besonders auffiel: Er wich seinem Blick aus.
Ehe Emmerich ihn ansprechen konnte, schob sich ein schmieriger Kerl in sein Sichtfeld. Dessen Oberlippe zierte ein schmaler Bart, den Hut hatte er in den Nacken geschoben. »Ich bin von der Stunde. Können Sie uns schon Informationen über die Geschehnisse geben?«
»Kein Kommentar.« Emmerich schob den Reporter unsanft zur Seite und versuchte, den Mann auszumachen, den er gerade eben noch betrachtet hatte.
Doch er war verschwunden.
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, folgte Emmerich Winter ins Innere des Gebäudes.
Als die Eingangstür hinter ihnen ins Schloss gefallen war, sah er sich um und stieß einen leisen Pfiff aus. »So stelle ich mir Schloss Schönbrunn oder die Hofburg vor, aber kein Mietshaus.« Tatsächlich war das Foyer derart geräumig, dass man problemlos mit einem Pferdegespann darin hätte herumfahren können. Die Treppen, die sich zu beiden Seiten nach oben wanden, waren mit purpurrotem Teppich bespannt und wurden von Marmorsäulen flankiert. Funkelnde Kristallluster tauchten das Entree in warmes Licht. »Wer war diese Hochmeister? Wie konnte sie es sich leisten, hier zu wohnen? Und warum verursacht ihr Tod einen derartigen Rummel? Sollte ich die kennen?« Emmerich stieg langsam die Treppe nach oben, was ihm mit seinem lädierten Knie einige Mühe bereitete.
Winter folgte ihm. »Marita Hochmeister war eine illustre Erscheinung, über die in den Gesellschaftskolumnen oft berichtet wurde. Sie hat Matineen und Kammermusikabende veranstaltet und war mit vielen Prominenten auf Du und Du. Zum Beispiel mit Alma Mahler-Werfel«, begann er aufzuzählen, »Lina Loos, Berta Zuckerkandl, Camillo Castiglioni, Imre Békessy …«
»Kriegsgewinnlerin?«
»Nicht dass ich wüsste. Ich glaube, sie hat geerbt.«
»Dabei hatte sie wohl mehr Glück als ich.«
Im ersten Stock angelangt, deutete Winter auf eine offen stehende Tür, neben der ein junger Beamter Wache stand. »Besser schlecht geerbt als schlecht gestorben.«
»Wo du recht hast, hast du recht.« Emmerich nickte dem Mann zu und präsentierte seine Plakette. »Wir sind von Leib und Leben.«
Der Uniformierte stand stramm, seine Wangen röteten sich. »Conrad«, stellte er sich vor. »Inspektor Leo Conrad. Stets zu Ihren Diensten. Es ist mein großes Ziel, eines Tages in Ihre Fußstapfen zu treten.«
Emmerich rang sich ein Lächeln ab, stieg umständlich über einen Tatortkoffer, der den Weg versperrte, und sah sich um. »Scheint, als wurde hier ein rauschendes Fest gefeiert.« Auf der Anrichte und der Garderobe im Vorraum standen halb volle Cognacschwenker und Champagnergläser. Einige davon wiesen Abdrücke von Lippenstift in verschiedenen Rot- und Rosatönen auf. Der Boden im Flur war mit Konfetti übersät, von den Gemälden, die die Wände zierten, baumelten Luftschlangen. Der Geruch von kaltem Zigarrenrauch und abgestandenem Alkohol hing in der Luft, durchzogen vom Odeur des Todes. Dazu erklang das leise Schluchzen einer Frau.
Der Flur führte in einen großen Salon mit azurblauen Tapeten, der wohl das Zentrum der Wohnung darstellte. Die Einrichtung des Raums war eine Mischung aus rustikal und exotisch. Filigrane, reich verzierte Möbel im Empirestil standen zwischen einem ausladenden Sofa in opulentem Bordeauxrot, einem palmenartigen Gewächs und einem langen schnörkellosen Tisch. Auch hier waren überall Spuren der gestrigen Feier zu sehen: Aschenbecher voller Zigarren- und Zigarettenstummel, benutzte Gläser, Flaschen in allen Größen und Formen, Silberbesteck sowie jede Menge Teller, auf denen die Überreste von Torte klebten.
Vor einem Gemälde, das über einer Kredenz mit Elfenbeinintarsien hing, blieb Emmerich stehen. Es stellte eine rothaarige Frau in einem goldenen Kleid dar, die den Betrachter mit einem angedeuteten Lächeln auf den Lippen streng und ebenso verführerisch anblickte. »Ist sie das?«
Winter nickte. »Ich denke schon.«
Emmerich trat nahe an das Bild heran und schnupperte. »Es wurde erst vor Kurzem gemalt«, erklärte er. »Man kann noch die Farbe riechen.« Vorsichtig fuhr er mit der Spitze seines Zeigefingers über die Leinwand, die mit den Initialen O. K. signiert war.
»Vielleicht ein Geburtstagsgeschenk?«, spekulierte Winter.
»Wir werden es herausfinden.« Emmerich wandte sich an Arnold Zech, den Leiter der Spurensicherung, der gerade den Salon betreten hatte. »Guten Morgen.«
»Von wegen gut. Das hier ist ein Albtraum. Das Opfer hat gestern seinen Geburtstag gefeiert, und zwar mit jeder Menge Gäste.« Zech deutete um sich. »Das ist der schlimmste Tatort, den ich seit Monaten untersuchen muss – und glaub mir, es waren viele.« Er raufte sich die Haare. »Diese Bude ist riesig und mit Fingerabdrücken, Tschickstummeln und ähnlichem Zeug übersät. Wenn kein Wunder geschieht, hocken meine Leute und ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hier.«
»Dann schlage ich vor, wir verlieren keine Zeit.« Emmerich klatschte in die Hände. »Wo ist das Opfer?«
»Im Schlafzimmer.« Zech deutete auf eine hohe Doppelflügeltür hinter Winter. »Ich komm gleich zu euch. Ich hole nur schnell meine Sachen.«
Emmerich drehte sich zu seinem Assistenten. »Was ist?«, fragte er, als er dessen entgeisterten Blick bemerkte.
»Zech hat recht«, flüsterte Winter, der die Tür geöffnet hatte. »Das ist wirklich ein Albtraum – und zwar nicht nur spurensicherungstechnisch.« Er sah seinen Vorgesetzten mit großen Augen an. »Es ist schlimm.«
»Das ist ein Tatort, was hast du erwart…« Emmerich hielt inne. »Ach du Scheiße!«
Die Einrichtung des Schlafzimmers bestand aus einem Toilettentisch, auf dem ein geblümtes Porzellanlavoir stand, einem überdimensionalen Himmelbett sowie einem ovalen Barockspiegel, dessen Rahmen von zwei goldenen Engeln gehalten wurde. Sämtliche Möbel waren, genauso wie die Fensterwand und der Boden, mit rotbraunen Sprenkeln überzogen. Der metallene Geruch von Blut war derart präsent, dass sich Emmerich unwillkürlich in die Schlacht von Vittorio Veneto zurückversetzt fühlte, wo neben ihm Männer von Granaten zerfetzt worden waren und er nahezu knietief in den Eingeweiden seiner Kameraden gestanden hatte.
»Sie müssen die Inspektoren Emmerich und Winter sein«, holte ihn eine tiefe sonore Stimme zurück ins Hier und Jetzt. »Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Ich habe schon viel von Ihnen gehört.«
Emmerich betrachtete den blassen Mann, der mitten im Zimmer stand und dessen Äußeres rein gar nicht zu seiner Stimme passte. Er war klein und schmal, trug eine zierliche Drahtbrille und wirkte auf den ersten Blick eher wie ein Internatsschüler als jemand, der etwas an einem Tatort zu suchen hatte. »Wir von Ihnen leider noch gar nichts.« Emmerich deutete auf den weißen Kittel, den der Mann trug, und den Wattebausch in dessen Hand. »Sie sehen nach Gerichtsmedizin aus.«
»Klug gefolgert.«
»Wo steckt denn Professor Hirschkron?«
»Auf dem Kongress für Innere Medizin. Ich habe die Ehre, ihn so lange vertreten zu dürfen.« Der blasse Mann streckte Emmerich seine feingliedrige Hand entgegen. »Gestatten, Doktor Elkan. Robert Elkan.«
Nachdem die Formalitäten erledigt waren, trat Elkan zur Seite und gab den Blick auf eine geblümte Steppdecke frei, die auf dem Boden lag. Darunter zeichnete sich ein menschlicher Körper ab.
»Haben Sie sie zugedeckt?«
»Das Opfer wurde so aufgefunden. Ich habe kurz druntergeschaut und dann beschlossen, alles so zu lassen, bis Sie eintreffen.«
»Gut gemacht«, sagte Emmerich. »Lassen Sie uns beginnen.«
Elkan rückte seine Brille zurecht. »Ich muss Sie warnen. Es ist kein schöner Anblick.«
Winter schaute auf seine Füße, Emmerich nickte.
Der Gerichtsmediziner schlug die Decke beiseite.
Das Bild, das sich ihnen bot, ließ selbst den abgebrühten Emmerich schlucken. Vor ihnen lag eine nackte, blutverschmierte Frauenleiche mit verrenkten Gliedern, so als hätte man die Fäden einer Marionette durchtrennt und die Puppe einfach fallen lassen. Das Schlimmste war aber ihr Gesicht, das bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert war.
Winter schnappte nach Luft und wandte sich ab. »Ich …« Er überlegte und deutete nach draußen. »Vorhin habe ich jemanden weinen hören … Vielleicht sollte ich die Dame …«
»Es handelt sich um die Zugehfrau, die die Leiche gefunden hat«, erklärte Elkan. »Ich habe ihr ein Beruhigungsmittel verabreicht und sie gebeten, in der Küche auf weitere Anweisungen zu warten.«
»Dann werde ich mich mal um die Ärmste kümmern.«
Noch ehe Emmerich etwas entgegnen konnte, war sein Assistent verschwunden und er blieb allein mit der Toten und dem blassen Gerichtsmediziner zurück. Von draußen waren das Bimmeln einer Straßenbahn und das Hupen eines Wagens zu hören. Der Wind pfiff durch eine schmale Ritze im Fensterrahmen und irgendwo klingelte ein Telefon. »Können Sie schon etwas Genaueres sagen?«, fragte er den Mediziner.
»Wie es scheint, wurde sie an Ort und Stelle ermordet.« Elkan zeigte auf die Blutlache, die sich rund um die zerschlagene Masse gebildet hatte, die noch vor einigen Stunden ein menschliches Antlitz gewesen war. »Der Täter muss ungefähr hier gestanden sein.« Er positionierte sich neben der Leiche, ungefähr auf der Höhe ihrer Taille. »Und er hat mindestens zwanzigmal auf sie eingeschlagen.«
»Tatwaffe?«
Elkan deutete an die Wand. »Beachten Sie den Verlauf der Blutstropfen«, wies er an. »Schläge verursachen meist ein stumpfes Trauma. Das ist nicht so, als würde man die Halsschlagader durchtrennen.«
»Kurz gesagt, es spritzt nicht.«
»Ganz genau. Diese Muster sind entstanden, als der Täter mit der bluttriefenden Waffe wieder und wieder ausgeholt hat. Sehen Sie: Die Spuren reichen bis über den oberen Fensterrand.«
»Was schließen Sie daraus?«
»Dass es sich um einen länglichen Gegenstand gehandelt haben muss. Näher kann ich es derzeit leider nicht eingrenzen. Vom Zaunpflock bis zum Spazierstock, Schürhaken oder Nudelholz ist alles möglich. Sollten Sie etwas finden, kann ich gerne einen Abgleich machen. Bis dahin müssen wir spekulieren.«
Emmerich wandte sich an Zech, der gerade den Raum betreten hatte. »Habt ihr …«
»… die Tatwaffe gefunden? Leider nicht. Scheint, als hätte sie der Mörder mitgenommen.«
»Mist.« Emmerich starrte auf die Tote. »Handelt es sich zweifellos um Frau Hochmeister?«
Elkan nickte. »Die Haare und der Körperbau passen. Zudem hat die Haushälterin von einem Muttermal am Handgelenk berichtet. Dadurch konnten wir sie einwandfrei identifizieren.«
»Unzählige Verunreinigungen und von der Tatwaffe weit und breit keine Spur.« Emmerich trat ans Fenster und blickte hinaus. Die Aussicht war trotz des trüben Wetters herrlich: Direkt gegenüber erstrahlte die prächtig geschmückte Fassade der Oper mit ihren Renaissancebögen und wehenden Fahnen. Davor verlief die breite, kastaniengesäumte Ringstraße, auf der sich Menschen mit bunten Regenschirmen, fluffigen Pelzhauben und aufwendig gestalteten Hutkreationen tummelten.
»Ringstraßenkorso«, murrte Zech, der sich neben ihn gestellt hatte. Damit meinte er die Promenade der besseren Gesellschaft, die jeden Sonntagvormittag zwischen dem Schwarzenbergplatz und dem Beginn der Kärntnerstraße abgehalten wurde. »Dass es dieses Schaulaufen noch immer gibt.«
Emmerich ließ seinen Blick zurück zu dem Leichnam wandern. »Gut möglich, dass sie geplant hatte, auch daran teilzunehmen, aber anstatt da draußen durch den Schnee zu flanieren, liegt sie nun hier. Was hat die Frau nur getan, um so zu enden?«
»Das werden Sie hoffentlich bald herausfinden.« Elkan zückte eine Pinzette. »Ich werde eine schnelle oberflächliche Begutachtung in situ vornehmen und anschließend den Abtransport der Leiche veranlassen. Im Institut werde ich genauere Untersuchungen anstellen. Danach kann ich Ihnen hoffentlich mehr Erkenntnisse präsentieren.«
»Das wäre äußerst hilfreich. Wir kommen später vorbei.«
»Ich werde dem Fall oberste Priorität einräumen. Geben Sie mir etwa eine Stunde.«
Emmerich verabschiedete sich, ging zurück in den Salon und von dort durch eine andere Tür in die Küche. Winter saß auf einem Schemel und tätschelte die Hand einer älteren Dame. Diese hatte ihr graues Haar im Nacken zusammengeknotet, trug eine weiße Schürze über einem einfachen Kleid aus brauner Wolle und tupfte sich mit einem Spitzentuch die vom Weinen verquollenen Augen ab.
Als er seinen Vorgesetzten sah, stand Winter auf und machte einen Schritt auf ihn zu. »Frau Künzelmann sollte sich nicht noch mehr aufregen«, flüsterte er. »Ich denke, sie hat mir alles gesagt, was sie weiß.«
Emmerich verstand den Wink mit dem Zaunpfahl und ging, gefolgt von seinem Assistenten, zurück in den Salon. »Was hat sie berichtet?«
»Gestern Abend hat Marita Hochmeister ihren fünfunddreißigsten Geburtstag gefeiert, wobei böse Zungen behaupten, sie habe ein paar Jahre weggeschummelt.«
Emmerich zündete sich eine Zigarette an und zeigte auf ein vollgeschriebenes Blatt Papier, das Winter in der Hand hielt. »Was ist das?«
»Das sind die Namen der Gäste.«
Emmerich pfiff durch die Zähne. »Das sind noch mehr, als ich befürchtet habe.«
»Frau Künzelmann und ein paar Aushilfskräfte haben sich während des Fests um die Garderobe und alles Weitere gekümmert«, fuhr Winter fort. »Sie haben Champagner kredenzt und Torte.«
»Waren sie bis ganz zum Schluss hier?«
Winter schüttelte den Kopf. »Sie sind gegen zehn Uhr gegangen. Frau Künzelmann ist heute wiedergekommen, um aufzuräumen. Dabei fand sie die Leiche. Offenbar stand die Tür zum Schlafzimmer offen und da hat sie das Blut gesehen.«
Emmerich rauchte schweigend vor sich hin. »Hat sie irgendetwas angefasst?«
»Sie sagt, sie hat den Raum betreten, unter die Decke geschaut und sofort die Polizei gerufen.«
»Es war also nicht Frau Künzelmann, die die Tote zugedeckt hat?«
»Nein, das muss der Mörder gewesen sein.«
»Interessant. Der Täter hat Frau Hochmeister also erst erschlagen und anschließend die Decke über sie gebreitet. Wozu wohl?« Emmerich rieb sein Kinn, das von einem grau melierten Stoppelbart geziert wurde. »Wie sieht es mit ihren Wertsachen aus? Fehlt etwas?«
»Auf den ersten Blick scheint laut Frau Künzelmann alles da zu sein. Zech und seine Leute haben außerdem ein Briefkuvert voller Scheine auf dem Schminktisch gefunden.«
»Also kein Raubmord.« Emmerich atmete aus und blickte dem blaugrauen Rauch nach, der langsam in Richtung Zimmerdecke stieg. »Gab es Einbruchspuren?«
»Die Wohnungstür samt Schloss war intakt, die Fenster geschlossen«, erklärte Winter. »Es herrschte natürlich Chaos in der Wohnung, aber soweit Frau Künzelmann es beurteilen kann, stammt es von der Feier.«
»Wie sieht es mit einem Herrn Hochmeister aus?«
»Sie war ledig.«
»Vielleicht ein eifersüchtiger Liebhaber?«, spekulierte Emmerich. »Die Tat war brutal. Das deutet darauf hin, dass Emotionen im Spiel waren.«
»Frau Künzelmann wusste von keinen speziellen Männerbekanntschaften.«
»Würdest du mit der Haushälterin über deine amourösen Verwicklungen sprechen?«
Winter wurde rot. »Wahrscheinlich nicht.«
Emmerich kratzte sich am Kopf. »Natürlich gibt es noch jede Menge anderer Motive.« Er starrte auf die Gästeliste. »Wir müssen herausfinden, wer die Feier als Letztes verlassen hat. Es war anscheinend viel Alkohol im Spiel. Der verstärkt Gefühle und senkt die Hemmschwelle.«
»Wie wollen wir vorgehen?« Winter deutete auf die vielen Namen auf dem Blatt. »Sollen wir die alle aufsuchen? Oder im Büro antanzen lassen?«
»Ich denke, es reicht fürs Erste, wenn wir sie anrufen. Das sind höchstwahrscheinlich reiche Leute. Von denen hat sicher jeder einen Anschluss.« Emmerich grübelte. »Wie heißt noch mal der eifrige junge Beamte, der die Eingangstür bewacht hat?«
»Leo Conrad.«
»Genau. Er soll die Nummern heraussuchen und mit dem Telefonieren beginnen. Sag ihm, er muss herausfinden, ob es Streit gab oder sonst irgendwelche Vorfälle. Und er soll eruieren, ob Gerüchte im Umlauf sind und wer am längsten …«
»Gut, dass ihr noch hier seid!«, unterbrach Arnold Zech. Mit einem triumphalen Grinsen im Gesicht überreichte er Emmerich eine Krawattennadel. »Die hat sich im Laken verfangen.«
Emmerich hielt das filigrane Schmuckstück ins Licht und betrachtete es. Es war aus Gold gefertigt und am oberen Ende mit einer Art Sonne verziert, in deren Zentrum ein Rubin strahlte.
»Es war also ein Mann im Schlafzimmer«, folgerte Winter. »Scheint, als hätten wir es doch mit einem Verbrechen aus Leidenschaft zu tun.«
Emmerich nickte. »Die Nadel wirkt teuer«, erklärte er. »Das ist keine Massenware. Es sollte ein Leichtes sein, herauszufinden, wem sie gehört.«
Winter lächelte. »Wenn wir Glück haben, können wir morgen bei der Montagskonferenz mit einem gelösten Fall auftrumpfen.«
Emmerich steckte die Krawattennadel ein. »Dein Wort in Gottes Ohr.«
Nachdem sie Conrad instruiert hatten, traten Emmerich und Winter hinaus ins Freie, wo es mittlerweile aufgehört hatte, zu schneien. Sie gingen zu ihrem Wagen.
»Bevor ich es vergesse …« Winter streckte seine Hand aus. »Sie schulden mir tausend Kronen.«
Emmerich sah seinen Assistenten an, als hätte dieser den Verstand verloren. »Wofür?«
»Für das Sch-Wort. Drinnen am Tatort, als Sie die Leiche gesehen haben.«
»Dir entgeht wohl gar nichts.« Emmerich verdrehte die Augen. »Das war eine Ausnahmesituation.«
»Tausend Kronen für die Schimpfwortkasse«, blieb Winter stur. »Ich musste Ihnen schwören, streng zu sein.«
Emmerich grummelte etwas Unverständliches und zückte seine Brieftasche. »Warum tausend?«, fragte er. »Vorgestern waren es noch achthundert.«
»Inflation«, sagte Winter und startete den Wagen.
»Sch…«, sagte Emmerich. »Schon gut.«
4
Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus.
Ihn, der entbrannt den Achaiern
unnennbaren Jammer erregte,
und viel tapfere Seelen der Heldensöhne zum Aïs sendete.
Ich bin Achilleus.
Ich bin der Zorn.
Es ist später Vormittag und ich bin wie immer völlig übernächtigt. Bleischwere Müdigkeit ist mittlerweile meine ständige Begleiterin. Denn jede Nacht, das ist so sicher wie das Amen im Gebet, reißt meine Rage mich zwischen drei und vier Uhr aus dem Schlaf.
Manche bezeichnen diese Zeit als die Stunde des Wolfs. Ich nenne sie die weiße Stunde.
Es ist der Moment, in dem meine Wut am heißesten kocht. Gleißend durchfährt sie meinen Körper von den Zehenspitzen bis zum Haaransatz und bringt alles, was gut und richtig in mir ist, zum Verglühen.
Sie frisst die Gnade aus meinem Herzen, die Milde aus meinem Bauch und den Frohsinn aus meinem Kopf.
Die Fassade, die ich während des Tages aufrechterhalte, wird niedergerissen. Die schreckliche Wahrheit dahinter entblößt.
Jedes Mal aufs Neue kämpfe ich gegen die weiße Glut.
Jedes Mal aufs Neue verliere ich die Schlacht.
Alles, was bleibt, sind Dunkelheit und Leere.
Zwar bin ich in der vergangenen Nacht meinem Ziel, die weiße Stunde zu bezwingen, einen Schritt näher gekommen, doch noch immer wandle ich, dem Achilleus gleich, durch den Hades. Eine leere Hülle, ein Schatten.
Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus.
Singe den Zorn, o Göttin, von mir.
5
Die Wolkendecke war aufgerissen und die ersten Sonnenstrahlen mogelten sich durch das trübe Grau. Das Einzige, was sich kaum geändert hatte, war die unwirtliche Temperatur.