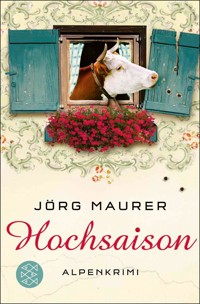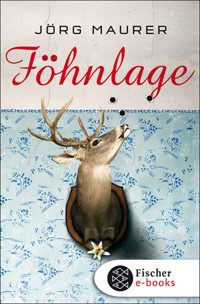8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Jennerwein ermittelt
- Sprache: Deutsch
Am Abgrund macht der Tod den ersten Schritt. Kult-Ermittler Hubertus Jennerwein löst seinen persönlichsten Fall: Der sechste Alpenkrimi von Bestseller-Autor Jörg Maurer Geiselnahme auf einem Gipfel über dem idyllischen alpenländischen Kurort! Ein maskierter Mann bringt brutal eine Wandergruppe in seine Gewalt. Er stößt Drohungen aus, verlangt nach Informationen. Kurz danach stürzt eine Geisel den Abgrund hinunter. Als Kommissar Jennerwein alarmiert wird, merkt er schockiert, dass er alle Opfer persönlich kennt – aus der Schulzeit. Kennt er womöglich auch den Mörder? Hat der Fall etwas mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun? Während sein Team grantige Geocacher jagt, macht das Bestatterehepaar a.D. Grasegger in Grabgruften und Grundbüchern eine brisante Entdeckung. Jetzt muss Jennerwein alles anzweifeln, woran er felsenfest geglaubt hat … »Auf höchstem Alpen-Niveau. Ein Glück für die deutsche Unterhaltungsliteratur.« Deutschlandfunk »Zu Recht mit Kultstatus behaftet. Kommissar Jennerwein auf dem Bestsellergipfel.« Westdeutsche Allgemeine »Da schreibt einer, der weiß, was er tut. Sehr unterhaltsam.« Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Jörg Maurer
Felsenfest
Alpenkrimi
FISCHER E-Books
Erfahren Sie mehr unter: www.fischerverlage.de
Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Text und Bildern, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen.
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Inhalt
Vorwurf des Autors
Um die Frage gleich von vornherein zu beantworten: Die Personen der Handlung sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Meine ehemaligen Klassenkameraden haben nicht für diesen Roman Pate gestanden. Ich selbst hatte eine glückliche Schulzeit, meine Mitschüler waren durchaus nicht so garstig und hinterhältig, wie sie hier in diesem Buch dargestellt werden, die Bosheit und Gemeinheit dieser Figuren ist dem Genre des Kriminalromans geschuldet.
Es war nun ein naheliegender Gedanke für mich, einige dieser netten Weggefährten von damals zu bitten, ein Vorwort zu diesem Roman zu schreiben. Ich liebe Vorworte. Sie sind ein kleiner Gruß aus der Küche, ein Amuse-Gueule, ein Magentratzerl, wie man hierzulande sagt. Schade, dass diese Tradition etwas aus der Mode gekommen ist. Ich formulierte also eine höfliche Bitte, suchte in den entsprechenden Internetdiensten nach den in alle Welt versprengten Absolventen meiner damaligen Abiturklasse und beschickte sie per E-Mail. Ich bekam absonderliche Rückantworten, alle waren negativ und beleidigend, manche sogar schroff aggressiv und drohend. Hatten mich meine Erinnerungen an die vielen netten Menschen so getrogen? Mein ehemaliger Freund F. schrieb, er wäre enttäuscht von mir. Für die mühevollen Hilfestellungen, die er mir damals in Mathematik gegeben habe, hätte ich mich wenigstens einmal bedanken können. Ein anderer Freund, H.A., warf mir vor, dass ich nichts, aber auch gar nichts, was er mir seinerzeit geliehen habe, jemals zurückgegeben hätte: Radiergummis, Fahrradklingeln, Bücher, Fitnessgeräte, Wohnungsschlüssel … Nach und nach trudelten Mails aus aller Welt ein, mit immer schlimmeren und groteskeren Unterstellungen. Gut, manches entsprach den Tatsachen: Ich ging mein Bücherregal durch, und in vielen Büchern fand ich das Exlibris mit den Buchstaben H.A. Aber trotzdem. An manches konnte ich mich beim besten Willen nicht erinnern.
Wie sich dann herausstellte, war der Grund für diese Lawine von Anschuldigungen meine erste Mail. Die Funktion Autovervollständigen hatte das Wort ›Vorwort‹ zu dem (zugegebenermaßen häufigeren) Wort ›Vorwurf‹ korrigiert. Vorworte sind ja tatsächlich etwas aus der Mode gekommen, wer kennt so etwas schon noch. Ich jedoch bemerkte die Korrektur nicht. (Und seien Sie ehrlich: Sie haben es bei der Überschrift zu diesem Kapitel auch nicht bemerkt. Sie haben vielleicht gestutzt, mehr nicht.) Wie auch immer, diese Mail war für alle meine Klassenkameraden willkommener Anlass, endlich das loszuwerden, was schon seit Jahren und Jahrzehnten in ihnen köchelte und brodelte.
Menschliche Abgründe taten sich auf. Eine der Mitschülerinnen war Staatsanwältin geworden, sie verwendete natürlich das entsprechende bedrohliche Briefpapier – wenn man ein solches Schreiben bekommt, zittert einem automatisch die Hand. Ein anderer verstieg sich zur Bezichtigung der Körperverletzung: Ich hätte ihn damals beim Fußballspielen absichtlich gefoult, und das nur, um statt seiner in die Schulauswahl zu kommen. Heute noch würde er, der eigentlich Balletttänzer hätte werden wollen, lahmen und hinken und zum Gespött der Leute werden. Ein dritter, schon immer mit der Aura des Geheimnisvollen behaftet, schrieb kurz zurück: »Da fragst du noch?«
So wurde die nette Klasse, die ich in Erinnerung hatte, zu einem wüsten Haufen nachtragender Verbalinjuriker. Wie viel schmutzige Wäsche wurde da gewaschen! Die lieben und hilfsbereiten Menschen waren zu grässlichen Monstern verkommen, die nun nichts mehr hielt. Ich wurde beschimpft, bedroht, tätlich angegriffen. Seitdem stehe ich unter Polizeischutz.
Aber es gibt keinen Schaden, der nicht einen Nutzen hätte, so sagt jedenfalls der Volksmund. Die netten Klassenkameraden von damals waren jetzt, nach ihrer Verwandlung, endlich dazu geeignet, Vorlagen für die vielen fiesen Figuren abzugeben, die man in einem Kriminalroman braucht. Und um die Frage nochmals zu beantworten: Ja, ich habe meine Abiturklasse als Vorbild genommen und sie eins zu eins ins Buch übertragen. Ich kann also mit Fug und Recht behaupten: Die Handlung ist frei erfunden, die handelnden Personen aber sind bis ins kleinste Detail real.
Doch ich muss schließen. Mein Aufenthaltsort ist vermutlich aufgeflogen. Draußen im Vorgarten höre ich sonderbar knirschende Geräusche. Man flüstert, man entsichert Pistolen, man pocht an die Tür. Es bleibt mir nur noch die Flucht durch den Lüftungsschacht. Und alles nur wegen dieser verdammten Autovervollständigungsfunktion, die keine Vorworte kennt.
Die Absolventen des Abiturjahrgangs 82/83 (und was aus ihnen geworden ist)
DR. JUR. BEPPO PRALLINGER
Oberregierungsrat
im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen
»Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten?«
J.W. von Goethe (übrigens auch ein Jurist)
»Wenn ich es bedenke, so muss ich sagen, dass mir meine Erziehung in mancher Richtung sehr geschadet hat.«
Franz Kafka (und noch ein Jurist)
Liebe Absolventen des Abiturjahrgangs 82/83, mit diesen kleinen literarischen Lesefrüchten möchte ich mich bei Euch ganz herzlich dafür bedanken, dass Ihr mich wieder eingeladen habt zum diesjährigen Klassentreffen! Aber selbstverständlich wird der Prallinger kommen! Der Prallinger hat sich die vier Tage schon freigehalten! Wie schön wird es sein, Euch alle wiederzusehen, Ihr Asse in Mathematik, Ihr Cracks in Deutsch, Ihr Koryphäen in Physik! Ihr habt es ja, wenn ich mir Eure Lebensläufe so anschaue, alle zu etwas gebracht – ich hingegen bin nur ein unscheinbarer Oberregierungsrat im Ministerium geworden, mit einem grauen Büro, einem Anspruch auf zwei Topfpflanzen und einigen kleineren, nicht sehr aufregenden Aufgabenbereichen. Nicht einmal eine Sekretärin habe ich. Aber ich bin’s zufrieden. Ein jeder dient unserem schönen Freistaat, wo er kann. Ich habe mein Auskommen. Wie sagt schon der Dichter:
»Armut ist ohne Zweifel das Schrecklichste. Mir dürft’ einer zehn Millionen herlegen und sagen, ich soll arm sein dafür, ich nehmet’s nicht.«
Johann Nestroy (auch der hat Jura studiert!)
Ich bin gesund, ich habe viel Zeit für meine Familie, kann mich inzwischen auch an zwei Enkelkinderchen erfreuen, mit denen ich oft im Garten spiele. Sie heißen Aleksander (ja, so schreibt man das heutzutage!) und Lisa, und ich werde Bilder mitbringen, falls jemand einen Blick auf die übernächste Generation werfen will. Und Vorsicht! Ich werde auch meinen Fotoapparat mitbringen!
Ich hoffe, dass von unseren alten, braven Lehrern nicht schon wieder welche weggestorben sind, aber so ist nun einmal der Lauf der Welt. Lebt unser Mathelehrer Schirmer noch – der die Schultheatergruppe Die Rampensäue geleitet hat? Shakespeares Romeo und Julia – so lustig habe ich die Balkonszene nie mehr danach gesehen! Es war die Nachtigall, und nicht die Lerche … Oder Musiklehrer Lorenzer mit seinem ewigen Tristanakkord?
»Und Dideldumdei und Schnedderedeng!
Der Lärm lockt aus den Tiefen
Die Ungetüme der Wasserwelt,
Die dort blödsinnig schliefen.«
Heinrich Heine (auch der war Jurist!)
Wie auch immer – der Prallinger Beppo freut sich jedenfalls schon wahnsinnig, und der Prallinger ist gespannt, was der eine oder andere von Euch lieben Mitschülern zu erzählen hat.
Euer – ja, wer schon? – Beppo Prallinger (Jurist)
1
Die silberglänzenden Kalksteinspitzen stachen wie Dolche in die klare Bergluft. Einige winzige Wolken scheuerten sich an ihnen und lösten sich in blauen Himmel auf. Die Augustsonne brannte unbarmherzig ins Tal. Doch oben auf einem der glitzernden Gipfel, in knapp zweitausend Meter Höhe, rupfte ein eisiger Wind an den ergrauten Haaren der kleinen, verstörten Schar von Bergwanderern, die mit gesenkten Köpfen am Boden hockten. Nur eine Gestalt saß hoch aufgerichtet auf einem Felsen. Der Mann trug eine graue Windjacke, sein Kopf war verhüllt von einer Skimütze mit Sehschlitzen und einer herausgeschnittenen Aussparung für den Mund. Er hatte gerade ein paar Worte in ein Megaphon gefaucht, die groben, militärisch kurzen Kommandos schienen noch in der Luft zu hängen. Die Wanderer waren starr vor Angst, niemand bewegte sich. Das weitläufige Gipfelplateau bot ihnen ausreichend Platz zum Sitzen, aber nur wenige Meter entfernt gähnte der Abgrund. Das machte die Situation noch bedrohlicher. Die Windböen ebbten langsam ab. Der Mann ließ das Megaphon sinken. Einige Mutige riskierten einen Blick. Unvermittelt riss sich der Megaphonmann die Sturmmaske vom Kopf. Viele der Wanderer schrien auf. Sie glaubten zu wissen, was es bedeutete, wenn ein Geiselnehmer sein Inkognito aufgab. Doch zu ihrer aller Überraschung erschien keine kantige Verbrechervisage, sondern ein längliches, glattes Gesicht mit einer sauber geschnittenen Pagenfrisur. Es war das Gesicht einer jungen Frau. Ihre Lippen waren grellrot geschminkt, die Frisur saß fest wie Stahlbeton, ihre Miene veränderte sich keinen Millimeter. Sie drehte die starre Fratze langsam herum und ließ ihren Cyberblick in kleinen ruckartigen Bewegungen über die Wanderer schweifen. Die mechanische Künstlichkeit, die maschinenhafte Präzision der Kopfdrehung verschlug allen den Atem. Mancher begriff erst nach und nach, dass die Gestalt eine Kapuzenmaske aus Kunststoff trug. Auf dem Schoß der schrecklichen Maskenfrau lag eine kompakte Maschinenpistole. Das schwarze, ölig glitzernde Auge der Laufmündung schien alle böse und unheilverkündend anzuglotzen.
Die Geisel, die der Frau am nächsten saß, trug eine verwitterte Joppe und eine abgetragene Kniebundhose. Aus dem braungebrannten Gesicht leuchteten helle, bewegliche Augen. Der graue Bart wirkte frisch gestutzt, der Mann war rundherum eine sympathische Erscheinung. Jetzt war er starr vor Entsetzen. Die anderen Teilnehmer der Wanderung befanden sich hinter ihm, fünf Meter vor ihm hatte sich die maskierte Gestalt auf den Felsen gesetzt. Der Bärtige war immer noch fassungslos, wie das hatte passieren können. Am Anfang hatte er den Tumult und das wilde Gekreische gar nicht so richtig ernst genommen. Doch jetzt saß da einer auf dem Stein und bedrohte sie mit einer echten Waffe. Wie um Gottes willen hatte das geschehen können? Der Bärtige versuchte, seine Gedanken zu sammeln. Er war sich sicher: Die bewaffnete Gestalt dort auf dem Felsbrocken war ein Mann. Die Körperhaltung und auch der Gang deuteten darauf hin. Es war ein Mann, der eine Frauenmaske trug. Genauer gesagt, eine Lady-Gaga-Maske aus dem Faschingsbedarf, was der Gestalt noch einen Tick mehr absurde Gefährlichkeit gab. Denn die Waffe auf Lady Gagas Schoß war kein Karnevalsrequisit. Das konnte der Bärtige erkennen. Er war beim Bund gewesen. Er konnte die zweieinhalb Kilo schwere russische Bison PP-19 von einer wesentlich leichteren Nachbildung durchaus unterscheiden.
»Man kann es daran erkennen, wie die Waffe gehalten wird«, hatte ihnen ihr Ausbilder bei der Bundeswehr erklärt. Ein paar heftige Windstöße fegten über den Gipfel, der Kidnapper wartete sie regungslos ab und führte das Megaphon langsam zur Mundöffnung der Maske. Der Bärtige schloss die Augen und lauschte angestrengt, ob er die Stimme erkannte. Fehlanzeige. Man konnte die Stimme auf diese Weise nicht identifizieren. Panik stieg in ihm auf. Es war doch so ein lustiger Ausflug gewesen. Und dann hatte er solch eine grauenvolle Wendung genommen.
»Ich weiß, dass ihr euch jetzt fragt, wer ich bin. Und ob ihr diese Stimme schon mal gehört habt!«, tönte es wie zum Hohn aus dem Megaphon. »Ihr werdet es nicht herausfinden, strengt euch also gar nicht erst an. Haltet euch an das, was ich gesagt habe: Alle gucken nach vorne. Niemand nimmt Kontakt zum anderen auf. Ihr bleibt einfach so sitzen, wie ihr jetzt sitzt, und wartet auf weitere Anweisungen. Wenn jemand aus der Reihe tanzt, dann spricht Lady Gaga Nummer zwo.«
Er hob die Bison in die Höhe und schwenkte sie über die Sitzenden, die sich instinktiv duckten. Manche schrien wimmernd auf.
»Für diejenigen unter euch, die keine Ahnung von Waffen haben: Das da in meiner Hand ist eine russische Bison PP-10-9!«
Er sprach die Waffenbezeichnung langsam und drohend aus. Pe! Pe! Zehn! Neun! Jede Silbe ein Pistolenknall.
»Sechshundert Schuss in der Minute sind kein Problem für sie. Und das reicht für alle hier.«
Der Geiselnehmer erhob sich von seinem Stein, stapfte zum Gipfelkreuz, öffnete den hölzernen Aufbewahrungskasten für das Gipfelbuch, nahm einen Stapel Masken heraus und hielt sie in die Höhe.
»Jeder von euch streift sich jetzt so ein Ding über. Und ich sag es nochmals: Niemand von euch spricht. Niemand macht Zeichen. Niemand sieht sich um. Niemand macht irgendetwas.«
Er sprang vom Felsen, ging ein paar Schritte in Richtung der Geiseln und warf jedem von ihnen eine Maske vor die Füße. Der Bärtige wunderte sich. Warum legte der Gangster solchen Wert darauf, dass sie sich nicht ansahen? Er spähte nach hinten. Dort saßen zwei seiner Freunde, die sich gerade in Lady-Gaga-Doubles verwandelten. Wo war der Gangster hergekommen? Hatte er sie hier oben erwartet? Hatte er sich auf dem letzten Wegstück, das kurvig und unübersichtlich war, unter sie gemischt? Oder – und jetzt erschrak er zutiefst – war er womöglich die ganze Zeit dabei gewesen, und war er infolgedessen einer von ihnen?
»Und nun zum Sinn dieser Veranstaltung. Ich habe vor, mich mit einem von euch – sagen wir – auszusprechen. Dieser eine weiß das wahrscheinlich auch schon, und er weiß, um was es geht. Die anderen haben nichts zu befürchten. In ein paar Stunden werden alle wieder frei sein. Bis dahin geben wir alle zusammen ein köstliches Bild ab!«
Der Gangster lachte hämisch.
»Wenn ich mir das so anschaue, verwandeln wir uns gerade in eine lustige Wandergruppe, bestehend aus lauter Lady Gagas, die sich gemeinsam einen originellen Spruch fürs Gipfelbuch ausdenken.«
Wieder schlug er ein hölzernes, fieses Lachen an, doch er beherrschte sich sofort wieder. Die Menschen, die am Boden kauerten, rührten sich nicht. Auch der Graubärtige mit der abgewetzten Kniebundhose wagte kaum, zu atmen. Geschweige denn, sich nochmals nach den anderen umzusehen. Beim Abmarsch vor zwei Stunden waren sie eine fröhliche Ausflüglertruppe von vierzehn Leuten gewesen. Während der Wanderung waren andere Bergsteiger zu ihnen aufgeschlossen, hatten sich unter sie gemischt, hatten sich bei Weggabelungen wieder von ihnen getrennt. Oben auf dem Gipfelplateau war dann alles so furchtbar schnell gegangen.
Der Bärtige drehte den Kopf unmerklich nach hinten. Der Kidnapper war immer noch dabei, den korrekten Sitz der Lady-Gaga-Fratzen zu überprüfen. Als er in eine andere Richtung schaute, zerrte der Bärtige an seiner Fessel. Keine Chance, sie zu lösen. Eine Art Zelthering war in die Erde eingeschlagen, der dicke, silberne Haken trug oben einen stabilen Ring. Diese Haken waren schon in der Erde verankert gewesen, als sie alle den Gipfel erreicht hatten. Sie hatten die kleinen silbernen Dinger nicht bemerkt. Sie waren atemlos und erschöpft hier oben angekommen, sie hatten ihre Rucksäcke wohlig stöhnend abgestreift und sich sofort in der moosigen weichen Mulde in der Mitte des Gipfelplateaus niedergelassen, vor dem Gipfelkreuz und dem großen Stein. Einige hatten sich auf den Rücken gelegt und die Augen geschlossen, um sich die Höhensonne auf die Nase brennen zu lassen. Manche hatten sich eine Zigarette angesteckt – und die anderen wedelten gespielt angeekelt mit den Händen. Siegfried Schäfer, der hochaufgeschossene Oberforstrat, hatte noch einen kleinen Vortrag über die Vegetation hier oben gehalten. Uta Eidenschink, die sangesfreudige Rothaarige, hatte ein Wanderlied geschmettert, ein paar andere hatten eingestimmt. Plötzlich, aus heiterem Himmel, völlig unerwartet, war eine maskierte Gestalt in ihrer Mitte gestanden. Kein Mensch hatte gesehen, woher sie gekommen war. Die Gestalt hatte einen kleinen Trichter in der Hand gehalten, ein Kindermegaphon aus dem Spielzeugladen, hatte etwas von Überraschung! Überraschung! gerufen, hatte jedem die Hand nach unten geführt – und innerhalb von wenigen Sekunden hing das gute Dutzend Wanderer mit Handschellen an den Ringen, die bis dahin unbemerkt geblieben waren. Sie hatten sich vermutlich deshalb so leicht überrumpeln lassen, weil keiner mit solch einer Aktion gerechnet hatte. Im Gegenteil, sie hatten es für einen Scherz gehalten, für einen spielerischen Programmpunkt der Wanderung. Einige hatten lachend protestiert und spaßhaft neckisch gemurrt. Ein paar hatten flotte Sprüche parat:
»Gibts denn jetzt beim Bergsteigen auch schon Bondage?«
Andere dachten wohl an den Hobbyzauberer mit dem Spitznamen ›Houdini‹, der mit ihnen gegangen war und der ein paar Zauberkunststücke draufhatte, die er bei jeder Gelegenheit zum Besten gab. Zersägte Jungfrau, Kaninchen aus dem Hut, das Übliche – und heute eben eine Gruppenfesselung auf fast zweitausend Meter Höhe. Das wäre gar nicht so unwahrscheinlich gewesen.
»Houdini lässt grüßen!«, hatte einer noch gerufen, daraufhin gab es Gelächter. Doch dann fielen die ersten Schläge. Die letzten drei, vier Fixierungen geschahen alles andere als freiwillig, der Geiselgangster half mit Fußtritten, Stößen und derben Ohrfeigen nach. Und spätestens jetzt hatte jeder begriffen: Das war kein lustiger Programmpunkt der Erlebniswanderung. Das war bitterer Ernst.
Der Bärtige betrachtete die Handschellen genauer. Es schienen keine blechernen Faschingshandschellen zu sein, es waren schwere eiserne Dinger, vielleicht sogar aus alten Polizeibeständen. Ihm fiel ein, dass es auch SM-Shops gab, in denen man stabile Handschellen kaufen konnte. Er ruckelte abermals an seiner Fesselung. Es mussten Zeltheringe sein, die sich im Boden verhakten, dann auseinanderspreizten wie Hohlraumdübel. Vielleicht waren sie sogar einbetoniert. Vorsichtig griff er mit der freien Hand unter die Maske. Mit den Fingerkuppen ertastete er Hautabschürfungen, an einer Stelle blutete er. Zudem hatte er einen ziemlich schmerzhaften Fußtritt abbekommen, als er sich als Letzter dagegen gewehrt hatte, die Handschellen anzulegen. Als er den Stiefel im Gesicht gespürt hatte, war er nach hinten gekippt. Noch jetzt klang ihm die Drohung im Ohr, ein gezischtes Mach jetzt! Sonst knallts! Und dann war da ein Wort gefallen, das er nicht verstanden hatte, so etwas Ähnliches wie Depesche. Er konnte die Stimme niemandem zuordnen. Keinem aus seiner Wandergruppe.
Wieder durchbrach das scharfe Gequäke des kleinen Kindermegaphons die Stille.
»Ihr greift jetzt mit der freien Hand in eure Tasche oder in euren Rucksack, holt euer Handy heraus und haltet es in die Höhe. Keine Tricks, dann passiert euch nichts. Wer ein Tablet dabeihat, ein Notebook, einen Krankenhauspiepser oder irgendeinen anderen Kommunikationsscheiß, der holt das ebenfalls heraus.«
Alle durchsuchten ihre Rucksäcke. Der Bärtige überlegte fieberhaft. Er trug das Smartphone seiner Tochter in der Brusttasche. Er hatte es der Dauersimserin heute Morgen beim Frühstück aus Spaß weggenommen und vergessen, es ihr wiederzugeben. Das Telefon von Mona steckte in einer trendigen, knallfarbigen, selbstgehäkelten Handysocke mit einem aufgestickten Geh ran! Ich bin’s! Sein eigenes, schick gestyltes, aber äußerlich leicht ramponiertes iPhone steckte in der Hosentasche. Sein Plan war, das bunte Handy herzugeben und das andere zu behalten. Sehr, sehr langsam griff er mit der freien Hand in die Tasche und zog das graphitschwarze Trendyhandy heraus. Er schob es unauffällig unter seinen Oberschenkel. Das Sockenhandy hielt er hoch. Der Kidnapper ging von einem zum anderen und sammelte die Geräte ein, auch das seiner Tochter. Geschafft. Es verschwand mit den anderen in einem leeren Stoffsack. Der Typ hatte aber auch alles vorbereitet! Der Bärtige legte seine Hand – unauffällig, wie er meinte – neben seinen Oberschenkel und überlegte. Die Notruftaste war zu riskant: Ihm selbst war es nicht möglich zu sprechen, und er durfte es nicht riskieren, dass der Wahnsinnige die Stimme am anderen Ende der Leitung hören konnte. Er musste eine SMS absetzen, und er wusste auch schon, an wen. Die Telefonnummer war, wie alle Nummern, die er nicht ständig brauchte, im Adressbuch auf der Homepage seines Providers gespeichert. Er musste ins Internet. Hoffentlich gab es hier ausreichend Empfang. Er drückte die Taste und wartete auf eine Gelegenheit, sein Adressbuch zu öffnen.
Die Gelegenheit kam schneller als erwartet. Aus der hintersten Reihe der Geiseln ertönte plötzlich ein Schrei, ein Hilferuf, nichts Gellendes, eher ein heiseres Ächzen. Der Maskierte befahl Schweigen, doch das hysterische Wehklagen hörte nicht auf. Er schwenkte die Waffe über dem Kopf und ging nach hinten, knapp an dem graubärtigen Mann vorbei. Er sah sich immer wieder um, aber er war abgelenkt. Der Bärtige hatte ein paar Sekunden Zeit, die SMS abzusetzen. Der Gangster schrie die gefesselte, wimmernde Person brutal an, sich gefälligst zusammenzureißen. Jetzt schleppte er sie offenbar ein Stück weit von der Gruppe weg und fixierte sie wohl dort am Boden. War denn das gesamte Plateau mit Fesselringen übersät? Er kam wieder nach vorn. Der Bärtige drückte auf Senden. Gerade noch rechtzeitig. Ein Schatten fiel auf ihn. Schnell schob er das iPhone wieder unter den Oberschenkel. Er hatte keine Zeit mehr, das Mobiltelefon auszuschalten. Der Maskierte schwenkte die Maschinenpistole zornig in seine Richtung. Und dann schoss er.
2
Drunten im Tal war es so ferienheiß und schwül, wie es nur in einem Freibad im August heiß sein kann. Tom (persönliches Profil: sonnengebräunt, muskulös, jung) hielt den farbigen Beachvolleyball in Kopfhöhe. Seine nackten Zehen krallten sich in den feinen, wüstenglühenden Sand, er warf den Ball hoch in die Luft. Als er ihm in die Höhe nachblickte, prasselte der Himmel pflaumenblau auf ihn herab. Tom musste blinzeln. Aus Richtung des Schwimmbeckens hörte er nasses Kinderquieken, das mehrfach aufstob und grell und salvenartig platschend im Wasser versickerte. Ein Bademeister (persönliches Profil: Kampftaucher, AC/DC-Fan) lief am glitschigen Beckenrand entlang, Tom hörte bis hierher das Nnpf, Nnpf seiner Plastiklatschen.
Tom ließ den Ball auf den Boden tropfen, bückte sich und griff ihn wieder auf. Acht Sekunden konnte man sich laut Regelwerk für eine Volleyballangabe Zeit lassen. Acht volle Sekunden. In dieser Zeitspanne soll auch das Universum entstanden sein, vom Urknall ab gerechnet. Acht Sekunden dauerte ein Sprung von der Klippe von La Quebrada in Acapulco. Nach acht Sekunden entfaltete Zyankali seine endgültige Wirkung. Acht Sekunden schienen eine richtig lässige Zeitspanne zu sein. Toms Mannschaftskameraden, die Gegner, auch die reichlich anwesenden Zuschauer wussten, dass von diesem einen Schlag eine ganze Menge abhing, dass hier auf dem glühenden Feinsandplatz eine schwerwiegende Entscheidung anstand. Auch die zufällig vorbeischlendernden Badegäste spürten es. Einer twitterte eine Nachricht an seine sechshundert Follower: Haha! Hulk schlägt grade im Centre Court auf. Bin im Loisachbad. Immer mehr Neugierige blieben stehen. Wenn Tom diesen Service versemmelte, dann waren nicht nur Punkt, Satz und Spiel verloren, sondern auch die Ehre der Apple-Benutzer. Denn heute spielten die Mac-User (Profil: stylisch, smart, designorientiert) gegen die PCler (Profil: übelst mainstreamig, old-fashioned, Tag und Nacht am Neustarten). Sie rangen jetzt schon zwei Stunden um den Sieg, hatten in der kühlen Morgenluft begonnen und sich Satz für Satz in die stetig anschwellende Vormittagshitze hineingebaggert und -geschmettert. In wenigen Augenblicken würde das sandige Gerangel zu Ende sein. Tom hatte vor, die Zeitspanne von acht Sekunden voll auszuschöpfen, um die öden Windows-User auf der anderen Seite des Netzes so richtig zu zermürben. Grundkurs Psychologie. Erneut hob er den Ball in Kopfhöhe. Und wieder eine ferne Kaskade von schrillem Kinderlachen, vermischt mit dem sturen Nnpf, Nnpf des Badeschlapfenmeisters. Noch sechs Sekunden. Tom war ein Crack. Er war der Beste hier auf dem Beachcourt. Seine muskulöse Erscheinung hatte er zusätzlich durch enganliegende Biker-Shorts unterstrichen. Er wusste, wie er posieren musste, um den vorderen Sägezahnmuskel (›musculus serratus anterior‹, auch ›The Great Pretender‹ genannt) dermaßen aus dem Brustkorb hervortreten zu lassen, dass zu dem unglaublichen Hulk oder den kampfbereiten Lieutenants aus den Ego-Shooter-Spielen nicht mehr viel fehlte. Tom ließ den Ball auf den Fingerkuppen kreisen. Dann umschloss er ihn mit der Hand, und die Kugel verschwand fast darin.
»Samba, samba!«, rief ein glühender Verehrer des großen iSteve. Er formte mit beiden Händen über dem Kopf den bekannten Apfel.
»Rumba, rumba!«, echote der Chor der Getreuen. Die Wörter samba (= geil) und rumba (= saugeil) hatten sich dieses Wochenende zu Modewörtern entwickelt, wie üblich wusste wieder einmal keiner, warum eigentlich. Tom hatte die These aufgestellt, dass die geflügelten Krafttanzausdrücke aus den Hüftschwüngen von Jeanette (persönliches Profil: 90–60–90) entstanden seien, die jeden Donnerstag bei einer Zumba-Fitness-Party ein paar Gramm abnahm. Die Steigerung von samba und rumba, das Nonplusultra, der krönende Abschluss war dann tango. Samba! --- Rumba! --- Tango!!! So klangen die Anfeuerungsschreie bei den drei Ballannahmen. Und bei tango wurde schließlich geschmettert.
Noch fünf Sekunden. Der Schiri führte die Pfeife schon mal vorsichtshalber zum Mund. Schiri war natürlich Bastian Eidenschink (persönliches Profil: ehemaliger Klassensprecher). Niemand hatte ihn je Volleyball spielen sehen. Es gibt so Typen, die immer nur Schiedsrichter sind. Beruflich werden sie Mediatoren, Tierpsychologen oder Blechschadenschätzer für Versicherungen. Angefangen haben sie als Klassensprecher. Bastian Eidenschink war so einer. Noch vier Sekunden. Jetzt atmete er tief und demonstrativ ein und steckte die Pfeife in den Mund. Er verdrehte die Augen und machte ein ungeduldiges Zeichen mit der Hand. Tom warf den Ball hoch. Ein langgezogenes --- ssssssssssamba! --- ließ das Freibad erzittern. Drei Sekunden. Noch hatte er keine Ahnung, wie er den Ball schlagen würde. Er wollte sich erst im letzten Moment entscheiden. Es gab viele Möglichkeiten, einen Service ins jenseitige Lager zu senden: die aus dem Sprung geschlagene Peitsche. Die gemeinst und übelst angeschnittene Giftbanane. Die gelüpfte Samba-Splitterbombe. Natürlich gab es noch weitaus mehr Möglichkeiten, den Aufschlag zu versaubeuteln. Tom, der Volleyballfreak, wusste, dass die in dieser Sportart weltweit führenden Chinesen coole Namen für solche Rohrkrepierer hatten: Tschan-tschu, die allzu weit hüpfende Kröte (= Ausball). Lei-sun, der müde Tiger (= Netzroller). Loa-ying, der kurzsichtige Adler (= Übertreten). Noch zwei Sekunden. Draußen am Spielfeldrand lümmelte Mona (persönliches Profil: Bikini, Bikini), die sicherlich ebenfalls gerne mitgespielt hätte, doch Mona trug den Arm in Gips. Gartenunfall. Pech für sie, schade für alle, denn sie wäre eine der besten Spielerinnen hier auf dem Platz gewesen. Tom hatte ein Auge auf sie geworfen. Er hatte ihren Beziehungsstatus auf Facebook gecheckt: Wieder solo – schade aber auch. Ganz klare Sache: Er wollte angeben mit dem Schlag. Einen tödlich angeschnittenen Smash zwischen die beiden ungelenken Flaschen dort drüben auf den Positionen drei und vier? Noch eine Sekunde. Auch Mona war jetzt aufgesprungen. Sie hob unbeholfen und katzenpfötchenhaft ihren Gipsarm und winkte ihm zu. Tom spannte die Muskeln und wuchs über sich hinaus. Er war bereit, zuzuschlagen. Er schmetterte. Er feuerte. Er drückte ab. Er spannte sich wie ein Flitzebogen und entlud seine ganze verdammte Hulk-Kraft darin. Er hörte kein Nnpf, Nnpf mehr und kein Kinderkreischen. Er hörte nur noch das --- rrrrrrrrumba! --- der außer Rand und Band geratenen Schlachtenbummler. Aus den Augenwinkeln sah er einen winkenden Gipsarm. Mona war wieder solo. Super. Die Hand von Tom schmatzte an den Ball, und wie ein Überschalltorpedo zischte die Kunstlederkugel davon, mit leichter Anfangssteigung in Richtung der gegnerischen Position fünf. Das Geschoss hatte eine ideale ballistische Flugbahn angenommen. Das Geschrei der Schlachtenbummler war jetzt ohrenbetäubend. Die Granate überquerte das Netz. Zunächst, im ersten fiesen Impuls, hatte Tom vorgehabt, die unbewegliche Tessy Meyer anzuspielen (Profil: Flaschenhalsbrille, Einserabitur, Wahlfach Altjapanisch), aber dann war sein Blick auf Steve gefallen. Steve Beissle auf Position fünf hatte seelenruhig sein Handy aus der Tasche gezogen, er setzte wohl gerade seinen Status neu: Am Beachen. Tom hat Service, diese Flasche. Steve (Profil: Physikgenie) beherrschte das einhändige Eintippen, auch das blinde einhändige Eintippen, auch das blinde einhändige Eintippen und dazu mit jemandem seelenruhig über Relativitätstheorie sprechen. Als Tom Steve sah, drehte er sich von Tessy Meyer weg und zielte auf ihn. Er wollte ihm das verdammte Handy aus der Hand schießen, dass es in die Stratosphäre spritzte. Und jetzt gab es helle Aufregung bei den Windows-Langweilern: Der Ball senkte sich raketenschnell auf Steve. Steve jedoch hatte die Ruhe weg. Er ließ die Hand mit dem Handy einfach sinken, mit der anderen Hand parierte er Toms Kracher, er parierte elegant und schaffte es sogar, den Ball locker zu Franziska zu spielen, die sauber an Josch weitergab. Josch sprang hoch, er schraubte sich aus dem Sand wie kochendes Wasser aus einem Geysir, er setzte zu einem kettensägenmäßigen Schmetterschlag an, und er schlug in Richtung Tom. Nicht direkt in Richtung Tom, er spielte einen Meter rechts neben Tom. Er wollte ihn dort im Niemandsland versenken. Tom setzte zum Hechtbagger an. Er spurtete los und flog. Er flog unendlich lange. Er stieg auf wie ein kühner Albatros, wie Conandree, der gleitende Dampfhammer aus dem Ego-Shooter-Spiel. In der Luft liegend sah er, dass Mona ihm einarmig zujubelte. Er riss die Augen weit auf. Hinter dem Spielfeld war eine Banderole aufgespannt: HERZLICH WILLKOMMEN ZUM KLASSENTREFFEN! Wenn er sich noch ein bisschen mehr reckte, konnte er den Ball vielleicht erreichen. Vielleicht.
3
»Ein Jegliches hat seine Zeit«, so heißt es in Prediger 3.1, »und alles hat seine Stunde: geboren werden und sterben, pflanzen und ausrotten, würgen und heilen, brechen und bauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, schweigen und reden …«
Die meisten Bibelfreunde steigen spätestens hier aus. Sie lesen nicht weiter, sie überfliegen die herrlichen Dualismen. Wird schon recht sein, meinen sie, alles hat eben seine Zeit – so rum und auch andersrum gesehen. Deswegen bleibt die zentrale Stelle meistens unbeachtet, wird auch oft sehr undeutlich mit »herzen und klagen« übersetzt, wo doch eine treffliche kraftvoll-bayrische Übertragung wäre: Auch schmusen und granteln hat seine Zeit. Und genauso hat es der große Deggendorfer Bibelübersetzer, der Hilfspfarrer Alois Grundlmayr, formuliert. Die Übersetzung wurde von der Amtskirche leider niemals anerkannt. Sehr schade.
Für den Gemüsemann am Marktstand war es heute an der Zeit zu granteln. Es war so ein Tag. Er hatte keinen Grund dazu, das Wetter war schön, der Himmel blitzblau, die Geschäfte an diesem Markttag liefen hervorragend, der Blumenkohl lag prall und rösch im Korb, er hatte keine komplizierten Kunden gehabt, keine Taschendiebe, Mundräuber, Wechselgeldwoller oder Pastinakenkritiker. Trotzdem schnauzte er den Mann, der sich über den Blumenkohlkopf beugte, heftig an:
»Pratzen weg, gelln S’. Anglangt is kafft.«
(In etwa: Finger weg, das gilt auch für Sie. Die Berührung der Ware bedeutet Kaufentscheidung.)
Der Angesprochene, Kriminalhauptkommissar Hubertus Jennerwein, zog die Hand zurück. Er wusste um die bayrische Befindlichkeit des Grantelns. Er wusste, dass es in solch einem Fall sinnlos war, zu diskutieren. Noch hatte er gar nichts berührt, er hatte es auch nicht vorgehabt. Er steckte die Hände in die Hosentaschen und schwieg freundlich.
»Was is’ jetzad?«, wurde er angeblafft. »Kaffassas dann?«
Das bayrische Grantigsein ist zu unterscheiden von ähnlich misslichen Befindlichkeiten anderer Volksstämme. Der Grant des Österreichers etwa, der mit dem bayrischen Grant oft in einen Topf geworfen wird, ist morbide, todesverliebt und jenseitig. Dieser Grant hat die Farbe des Verzweifelten. Zornrot werden die Grantler in Wien, diesen Donauraunzern und Wienerwaldmoserern schwillt der Kamm, und nicht selten fliegt über ihnen schon der große schwarze Vogel Tod. Aber auch beim überseeischen Blues, der mit dem Granteln oft verglichen wird, geht es um etwas grundsätzlich anderes. Für den Blues gibt es nämlich immer handfeste Gründe: tagelanger Regen down in Tennessee, ein böses Erwachen mit Kopfweh, der letzte Tropfen Whiskey, eine unerklärliche Schusswunde – solche fatalen Dinge behandelt der Blues, und der Schmerz wird immer schön eingepresst zwischen Tonika und Subdominante. Der Bayer braucht für seinen Fünfseenblues solche profanen Gründe nicht. Er beherrscht die Kunst zu klagen, ohne zu leiden. Zum föhngestützten Alpin-Grant hat er nicht einmal ein Instrument nötig. Er grantelt sozusagen freihändig und auswendig. In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder die ostwestfälische Schwermut und Nachdenklichkeit bemüht. Oder die russische Seele, die man angeblich aus den Liedern der Wolgaschiffer heraushören soll. Oder die französische Tristesse, die es bei Sartre und Camus sogar zu philosophischem Ansehen gebracht hat. All das kann niemals an die spontane Gefühlsregung eines alpenländischen Grantlers herankommen.
»Und? Nehmen S’ jetzt den Blumenkohl?«, fauchte der Gemüsehändler.
Jennerwein schüttelte den Kopf. Er sah sich um. Hinter ihm hatte sich eine kleine Schlange gebildet.
»Nein«, sagte er zu dem grantigen Tandler, »ich wollte nur schauen, was Sie da Schönes haben.«
»So, schauen wollten S’. Aha. Ja, dann schaun S’ halt, in Gottes Namen.«
»Wie viel kostet denn ein Kopf?«
»Warum wollen Sie das jetzt wissen? Wenn Sie doch bloß schauen wollen?« Der Gemüsehändler stutzte. »Aber Sie kommen mir bekannt vor!«
»Meinen Sie?«
»Sie waren schon öfters da.«
»Das kann durchaus sein.«
Jennerwein machte einem anderen, kauffreudigeren Kunden Platz. Er trat einen Schritt zurück, warf noch einen letzten Blick auf die bunten Gemüsearrangements, wandte sich dann zum Weitergehen. Er liebte den Markt. Er liebte es, herumzuschlendern, prall wuchernde Viktualien zu vergleichen und all die Verkaufstaktiken der Händler und Kaufgewohnheiten der Kunden zu studieren. Er konnte sich hier wunderbar entspannen. Wenn es an seinem Arbeitsplatz schnell gehen musste mit der Entspannung, dann spreizte er Daumen und Mittelfinger und massierte sich damit die Schläfen. Aber bei einem Spaziergang auf dem Wochenmarkt ging es auch ohne solche Hilfsmittel.
Kriminalhauptkommissar Hubertus Jennerwein hatte heute Bereitschaftsdienst. Bereitschaftsdienst war praktisch gleichbedeutend mit: freier Tag. Nur im äußersten Notfall, zum Beispiel wenn sich die Sonne zu einem roten Riesen ausdehnte und die Bayrische Polizei über geeignete Gegenmaßnahmen beraten müsste, dann würde auch der Bereitschaftsdienst hinzugezogen werden. In so einem Fall würde sein Mobilfunkgerät klingeln, das er in der Jackentasche trug. Wenn es nicht klingelte, würde es ploddernd vibrieren, und eine geheime Zahlenchiffre würde ihm gesimst werden, eine Abkürzung, wie sie auch im Polizeifunk verwendet wurde. Er hatte die einzelnen Nummern im Kopf. Er war kein Gedächtniskünstler. Er wusste die Nummern aus einem ganz bestimmten Grund auswendig.
017 Bombendrohung 021 Banküberfall 025 Zechprellerei
035 Verfolgung 039 Totschlag 045 Sprengstoffanschlag
048 Selbsttötung 049 Schwertransport 057 Ausbruch
073 Einschleicher 080 Falschgeld 084 Flugzeugabsturz
088 Gasgeruch 090 Gefangenentransport 091 Geisteskranker
094 Grober Unfug 107 Leiche 111 Munitionsfund
112 Notlandung 115 Raub 118 Ruhestörung
Doch sein Mobilfunkgerät klingelte nicht. Es hüpfte und plodderte auch nicht. Gutgelaunt schlenderte Jennerwein über den geschäftigen Markt des Kurortes. Es war erst früher Vormittag, doch um jeden Stand hatten sich schon kleine Gruppen von Interessierten gebildet. So ein Wochenmarkt ist auf der ganzen Welt gleich. Ganz am Anfang, in bester 1a-Lage, befindet sich immer ein Gemüsehändler. Im Kurort ist es der schon geschilderte Grantler. In Bayern gilt nämlich die Regel: Der grantigste Tandler macht das Rennen. Merkwürdigerweise wird er als der Seriöseste empfunden. Dann, nach einigen Antipasti-Angeboten, kommt ein weiterer Gemüsestand. Der Besitzer ist das genaue Gegenteil des Grantlers, es ist vielmehr ein rechter Quirlherum und Schreihals, der dich sofort duzt und dir einen Kohlrabi oder eine Mango aufgeschnittenerweise in den Mund steckt. Oder es zumindest versucht: Da, probier! Saugut! Nach drei weiteren Schritten steht man am Stand des gelangweilten, fast melancholisch dreinschauenden Honigverkäufers. Der blickt über die Kunden hinweg in die Ferne, als hätte er gerade ein paar Rainer-Maria-Rilke-Gedichte gelesen und verstanden. Es folgen: die Bude des Tirolers mit seinen tausend Schinken – der meist verwaiste Wachskerzenstand – das duftende Reich des folkloristisch gekleideten Gewürzweiberls – der erste Würstlstand. Dann kommt der dritte Gemüsestand, der ist so richtig demetrig bio, dementsprechend teuer, allerdings bestückt mit zwei jungen Verkaufskanonen, die das wieder wettmachen. Manches Blättchen Gemüse ist so horrend hochpreisig, dass die Kreditangebote der Sparkasse dahinter durchaus ihren Sinn haben. Trotzdem: Dieser dritte Gemüsestand ist eine Armutsfalle. Daran reiht sich – im Kurort genauso wie in Kiel oder Kaiserslautern – der Allgäuer Käsemann, ein grober Klotz, der das Publikum mit derben Zoten lockt – nix Rainer Maria Rilke, sondern naheliegende Wortspiele mit Eiern, Käse, Euter, Kuh, Stier, Hahn und der ganzen übrigen Bauernhoferotik. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen hat der wüste Allgäuer Zulauf von feinen Damen und der Intelligenzija des Kurorts. Der kunstsinnige Professor Schreyögg fragt nach Roquefort – er wird ausgelacht und bekommt Emmentaler aus Hindelang. Die zerbrechlich wirkende Baronin Brede von Hoffstaetter fragt nach einem milden Dessertkäse, der bei ihrer wöchentlich stattfindenden Séance die geschmackvolle Überleitung zum Geistersehen bilden soll –
»Do dädi an Schmierkäs empfähla«, allgäuerte der hagebuchene Hindelanger. »Der weckt Tote auf.«[1]
Nach der Bude des handfesten Käsemannes kommt die rosenwangige Biometzgerin, dann der hübsche Florist inmitten seiner phantasievollen Gebinde, und zum Schluss der Würschtlmo, der es versteht, seine Würschtl mit einem derartig positiven Mythos zu versehen, dass die Schlange oft bis zum Ortsausgang reicht, was den anderen Würschtlmo’s ein Rätsel ist.
Jennerwein bückte sich, um seine Schnürsenkel zu binden. Sein Blick fiel auf ein kleines Elektrohäuschen, das mit zweitklassigen Graffiti beschmiert war. Zweitklassig deshalb, weil sich der Kommissar ein wenig mit dieser Art der Malerei auskannte. Das Gekritzel dort auf dem Elektrohäuschen war nichts im Vergleich zu den Kunstwerken, die man oft auf dem Bahnhofsgelände sah: kühne Schriften und geheimnisvolle Zeichen der trotzigen Reviermarkierung. Jennerwein hatte vor vielen Jahren, als er noch im Streifendienst arbeitete, einen vermummten Writer festnehmen müssen, der gerade bei der Arbeit gewesen war. Nachts hatte er ihn erwischt, und es sah fast ein bisschen so aus, als wollte er sich erwischen lassen. Der Ober-Skiller mit dem Künstlernamen Mungo bezeichnete seinen Style als krypto. Jennerwein hatte es damals beim Platzverweis belassen, denn er fand, dass die Graffiti von Mungo das Schönste in dieser öden Straße waren. Das jetzige Piece hingegen war nichts weiter als der dilettantische Versuch einer Reviermarkierung. Trotzdem betrachtete er die Zeichnung genauer. Irgendetwas daran machte ihn stutzig. Er beugte sich vor, um sie genauer anzusehen.
Jennerwein erschrak, als er eine Hand auf der Schulter spürte.
»Sie sind es doch, oder?«
Schade, er hätte die Graffiti gerne intensiver studiert. Damals, vor Jahren, war er kurz davor gewesen, den Sprayer Mungo zu fragen, ob er ihm nicht bei sich zu Hause eine Wand in seinem verschlungenen Wildstyle verschönern könne. Er hatte es dann doch gelassen. Später hatte er ihn angerufen, doch Mungo war mittlerweile kein illegaler Inside-Bomber mehr, sondern Artdirector einer geleckten Werbeagentur mit Isarblick. Enttäuschend. Jennerwein erhob sich und reckte seine verspannten Glieder.
»Ja, freilich sind Sies!«
Die Frau war eine Einheimische, das sah er gleich an der Gewandung. Echte handgeschnitzte Hirschhornknöpfe auf einer dunkelgrünen Lederjoppe. Aus der Einkaufstasche lugten Salatköpfe in verschiedenen Farben. Dazwischen versteckte sich ein Pekinese.
»Herr Kommissar – ich bin eine große Bewunderin von Ihnen. Das wollte ich Ihnen bloß einmal persönlich sagen.«
Weitere Passanten blieben stehen und flüsterten sich zu.
»Wer ist denn das?«
»Der Jennerwein!«
»Wer? Wo? Der unscheinbare Typ? Das glaube ich nicht.«
»Den habe ich mir ganz anders vorgestellt.«
»Jetzt, wo ich ihn so sehe – der hat Ähnlichkeit mit diesem britischen Schauspieler – wo einem auch immer der Name nicht einfällt.«
»Jaja, der Schauspieler, der in dem einen Film da mitgespielt hat – Fünf Todesfälle und keine Spur von Hochzeit oder so ähnlich.«
Einer zückte seine Digitalkamera.
»Darf ich?«
»Ich kann es Ihnen nicht verbieten«, erwiderte Jennerwein höflich. Nach kurzer Zeit stand er inmitten eines kleinen Blitzlichtgewitters. Der Skispringer, der sich drüben am Fischstand nach dem kalorienärmsten Seebewohner erkundigte, schaute neidisch und sehnsüchtig herüber. Ein kleines Mädchen holte ihr Poesiealbum aus ihrer buntbestickten Umhängetasche.
»Schreiben Sie mir was rein, Herr Kommissar?«
»Was soll ich denn reinschreiben?«
»Eine Widmung, wissen Sie. Einen Spruch von einem Polizisten.«
»Gut. Hast du was zum Schreiben da?«
Das Mädchen gab ihm einen Stift.
»Aber bitte nicht so was Langweiliges. Nicht so was wie Ich bin ein kleines Mäuschen mit einem Blumensträußchen, ich mache einen Knicks, und weiter weiß ich nix. Das habe ich jetzt schon fünfmal drinstehen. Ich will was, was nur für mich ist!«
Jennerwein lächelte. Er dachte kurz nach. Dann schrieb er:
Ich bin ein Cop, ein alter,
mit ’ner zerkratzten Walther,
doch wenn dir was passiert –
weiß ich: sie funktioniert.
HUBERTUS JENNERWEIN
»Finde ich lustig«, sagte das Mädchen. »Aber da stimmt doch was nicht. Das weiß doch jedes Kind: Die Dienstwaffe der bayrischen Polizei ist die Heckler & Koch P7 und nicht die Walther.«
»Ja klar. Aber das reimt sich ja nicht.«
»Sie erschießen aber doch wohl keine Tiere mit der Pistole?«, fragte das kleine Mädchen besorgt.
»Natürlich nicht«, sagte Jennerwein.
Und jetzt surrte und blubberte sein Mobiltelefon in der Brusttasche. Jennerwein entschuldigte sich bei dem Mädchen und nahm das Gerät aus der Jacke. Eine SMS. Er konnte sie im gleißenden Sonnenlicht nicht sofort erkennen. Er drehte das Display hin und her.
hu!239b.gu
Er versuchte, den Absender zu identifizieren. Eine fünfstellige Nummer, die ihm nichts sagte. Das war keine Nachricht von der Dienststelle, so viel war sicher. Mit dem Zeichensalat selbst konnte er auch nicht viel anfangen. Es gab nicht viele Leute, die seine Mobilnummer hatten. Vielleicht hat sich jemand vertippt, dachte Jennerwein. Er steckte das Gerät wieder ein.
4
Der Schuss peitschte in Richtung des Bärtigen. Die Kugel riss den Stein, auf dem er sich mit der freien Hand eben noch aufgestützt hatte, vollständig weg. Alle Geiseln schrien auf. Irgendwo murmelte jemand leise, und man konnte nur einzelne Wortfetzen verstehen, die sich aus dem Gemurmel lösten. Die Frau flüsterte ein verzweifeltes Gebet. Der Gangster mit der Lady-Gaga-Maske hob das Megaphon.
»Ihr seht, das sind keine Platzpatronen. Es ist eine Warnung für euch alle, keinen Unsinn zu machen.«
Der bitter-metallische Geruch von Pulverdampf lag in der Luft. Der Schuss und das splitternde, keckernde Bersten des Kalksteins schienen noch nachzuhallen in den sonst so friedlichen Höhen. Der Geiselnehmer holte ein Fernglas aus seinem Rucksack und suchte damit die umliegenden Berge ab. Er drehte sich um die eigene Achse und beobachtete den wolkenlosen Himmel. Dann nahm er die PP-19 und sicherte sie. Das macht der nicht zum ersten Mal, fuhr es dem Bärtigen durch den Kopf. Sowas lernt man nicht in einem Volkshochschulkurs. Der hat eine militärische Ausbildung hinter sich.
»Und nun zu dir, mein Freund.«
Der Geiselnehmer kam direkt auf den Bärtigen zu. Dessen erster Impuls war, sein Mobiltelefon mit der freien Hand über die Felskante in die Tiefe zu werfen. Der Typ sollte wenigstens nicht erfahren, an wen er gesimst hatte. Aber er zögerte. Das graphit-schwarze Gerät war immer noch unter dem Oberschenkel verborgen. Eine heiße Angstwelle lief durch seinen Körper. Aber vielleicht hatte es der Gangster gar nicht bemerkt, vielleicht wollte er ganz etwas anderes mit Und nun zu dir, mein Freund! sagen. Er ließ das Handy stecken, wo es war, doch im nächsten Augenblick wusste er, dass der Geiselnehmer sehr wohl etwas bemerkt hatte. Obwohl er jetzt direkt vor ihm stand, brüllte er ihn mit dem Megaphon an.
»Unser Freund hier vorne ist wohl ein ganz Schlauer!«
Der Gangster stellte sich breitbeinig hin und stieß ihn mit dem Pistolengriff schmerzhaft vor die Brust, so dass er fast umkippte. Dann griff der Megaphonmann unter das Bein des Bärtigen und holte das Handy hervor. Er hielt es hoch.
»Alle mal hersehen, was ich da Feines gefunden habe!«
Die Geiseln stöhnten auf. Es klang fast nach einem abgesprochenen, lange eingeübten Theaterseufzer. Doch es war der Ausdruck echter Angst. Da hatte sich einer vorgewagt. Da hatte einer etwas unternommen in der schier aussichtslosen Situation. Aber gleichzeitig hatte da einer gegen die Regeln verstoßen. Es war wie damals in der Schule. Gegen den Lehrer aufzumucken war zwar gut, aber es brachte die ganze Klasse in Gefahr. Alte Erinnerungen stiegen auf. Alte Erinnerungen an die Schule sind selten positiv. Meist blubbern nur die übelriechenden und peinlichen Blasen aus dem Froschtümpel des Vergessens: miese Lehrer, ungelüftete Klassenzimmer, eine ungerechte Fünf minus, Angst vorm Durchfallen, Füller vergessen, Klassenkeile. All das stieg jetzt in dem Bärtigen auf und gab dem scharfen Geruch der Angst noch zusätzlich etwas Ranziges. Vermutlich empfanden das die anderen Opfer auch so.
Der Mann mit der Maschinenpistole beugte sich nach hinten, als ob er das Handy über den Rand der Klippe werfen wollte. Dann hielt er mitten in der Bewegung inne. Ihm schien etwas eingefallen zu sein. Er tippte mit einem Finger auf das Display. Erst jetzt fiel es auf, dass er hautfarbene Einmalhandschuhe trug. Der schien an wirklich alles gedacht zu haben. Ein Profi. Nachdem er gesehen hatte, was er sehen wollte, steckte er das Gerät in seine Windjacke.
Der Bärtige sah es an den Schultern, an der ganzen Körperhaltung. Dieser Mensch zitterte vor Wut. Er war stinksauer darüber, dass er ausgetrickst werden sollte.
»Falls noch jemandem etwas in der Art einfallen sollte, seht her, was mit ihm geschieht.«
Er packte die Maschinenpistole am Lauf. Doch er hatte nicht vor, zu schießen. Er hatte vor, zuzuschlagen. Und er schlug zu. Mit aller Kraft. Er zielte auf die ungefesselte Hand des Bärtigen, mit der dieser sich am Boden aufgestützt hatte. Er konnte sie nicht mehr rechtzeitig wegziehen. Das schwere Gerät traf ihn mit voller Wucht. Der Schmerz fuhr ihm dermaßen in den Körper, dass er unbeherrscht und kreischend aufschrie. Er blickte auf die Hand. Der Daumen stand in unnatürlichem Winkel ab. Er zitterte am ganzen Körper, ohne dass er etwas dagegen unternehmen konnte. Seine Hand war vollständig zertrümmert. Er war unfähig, sich zu bewegen. Der Schmerz schwoll an und nahm ihm fast den Atem. Der Gangster hob die Pistole nochmals hoch, als wollte er erneut zustoßen. Er beließ es bei der Drohung.
»So wird es jedem ergehen, der sich nicht an die Anweisungen hält.«
Er setzte sich wieder auf den erhöhten Stein. Niemand wagte hinzusehen. Keiner wollte den Blick des brutalen Typen auf sich lenken. Es herrschte atemlose Stille, selbst das flehentliche Gebet der Frau dort hinten war verstummt. Der Maskenmann holte das Mobiltelefon des Bärtigen aus seiner Tasche. Er tippte eine Weile darauf herum und las. Der Bärtige wusste, was er da las. Es war seine eingetippte Nachricht von vorher, sein improvisierter Hilferuf. Wenigstens musste dem Geiselnehmer jetzt klar sein, dass die Nachricht nicht an eine Notrufnummer gegangen war. Der Bärtige schöpfte ein klein wenig Hoffnung. Vielleicht verstand ja der Empfänger seine Botschaft. Und vielleicht konnte sie der Geiselnehmer nicht entschlüsseln.
5
»Ein reichlich merkwürdiger Ort für eine informelle Besprechung ist das schon!«, sagte Rechtsanwalt Nettelbeck. »Restaurant Bergpanorama! Sie haben mich um Diskretion gebeten, aber hier bei diesem Gewusel –«
Dr. Herbert Nettelbeck entsprach der Vorstellung des klassischen Rechtsanwalts: Maßanzug, Krawatte, graumeliertes Haar, randlose Brille und Aktenkoffer aus Leder, aus dessen Außenfach die ›Neue Juristische Wochenschrift‹ herausspitzte. Er wandte den Blick von seinen beiden Klienten ab und sah sich auf der Terrasse um. Er rümpfte die Nase. Das war keine angemessene Umgebung für ihn. Das war kein Ort, an dem Diskretion und Verschwiegenheit zu Hause waren. Auch seine beiden Klienten bildeten einen schroffen Gegensatz zu dem noblen Rechtsanwalt. Sie machten einen überaus lockeren, gutgelaunten Eindruck. Sie trugen wie viele Einheimische legere Tracht, sie saßen gemütlich da, sie strahlten die Ruhe der Alteingesessenen aus.
»Ich finde, das ist genau das Richtige für unsere Besprechung«, sagte der Mann in Bundhose und Strickjanker. »Das ist ein richtiges Touristenlokal. Keine Einheimischen, keine Bekannten. Hier können wir alles in Ruhe besprechen, Herr Advokat.«
Die Terrasse vor dem Ausflugslokal Bergpanorama war in diesen späten Morgenstunden schon gut gefüllt mit Touristen aller Nationalitäten. Der Name Bergpanorama entsprach allerdings nicht mehr ganz den Tatsachen, rundherum war im Lauf der Zeit ein Wildwuchs von mörderschicken Seniorenresidenzen, Wellnessoasen und Zweitwohnungsbunkern entstanden. Die Architekten hatten den Blick auf den Berg schwer verwellnesst. Doch die Innenarchitekten hatten gute Arbeit geleistet: Gaststube und Terrasse waren gemütlich bis konspirativ verwinkelt, es gab viele Erkerchen und Nischen, und am verschwiegensten Ecktisch der Veranda saßen die drei Geheimbündler: auf der einen Seite das ehemalige Bestattungsunternehmerehepaar Grasegger, Inhaber eines inzwischen ruhenden Familienbetriebs (gegr. 1848), ihnen gegenüber Rechtsanwalt Dr. Herbert Nettelbeck, Spezialist für Verwaltungsrecht, Politisches und Internationales Recht. Sie rückten enger zusammen und beugten die Köpfe vor.
»Was haben Sie herausgefunden, Herr Rechtsanwalt?«, begann Ursel Grasegger.
»Einiges«, antwortete Nettelbeck verschwörerisch.
Alle drei hatten nicht bemerkt, dass auf der anderen Seite der Terrasse, zwischen all den Touristen und Auswärtigen, doch ein Einheimischer saß. Er kannte die Graseggers gut, er kannte auch Nettelbeck. Er machte sich seinen Reim darauf. Er schoss ein Handyfoto von dem Trio. Dann erhob er sich, verschwand hinter einer Ecke und wählte die Nummer der örtlichen Zeitung.
»Wenn ich Sie recht verstanden habe, fassen Sie ins Auge, politisch aktiv zu werden?«, sagte Nettelbeck und holte ein paar Schriftstücke aus seiner Aktentasche. Er legte sie vorsichtig vor sich auf den Tisch. Doch jetzt kam die Kellnerin im rostgrünen Dirndl.
»Weißwürstl! Frische Weißwürstl!«, rief sie freudestrahlend und in bestem sächsischen Zungenschlag und schraubte drei wuchtige Porzellanschüsseln auf den Tisch.
»Wenn jemand schon Weißwürst-l sagt, dann langts mir schon«, murmelte Ignaz.
»Dann lassen Sie sich die Würstl mal schmecken!«, dresdelte die Rostgrüne und verschwand. Nettelbeck hatte seine Akten rechtzeitig zurückgezogen. Er warf einen vorsichtigen Blick in seine Schüssel. Die Würste drehten sich im heißen Wasser wie Holzstämme im Sägewerkssee. »Darf ich Sie fragen, wie Ihre Bewährungsauflagen lauten?«
Ignaz verschränkte die Hände gemütlich vor dem Bauch. Solange das noch möglich ist, hatte Ursel einmal gesagt, solange du mit den Armen da noch rumkommst, brauchen wir mit keiner Trennkostdiät anzufangen.
»Einmal in der Woche im Polizeirevier melden«, sagte Ignaz. »Bis vor kurzem mussten wir noch täglich antreten.«
»Und weiter?«
»Keine unangemeldeten Reisen ins Ausland.«
»Dachte ich mir schon.«
»Lebenslanges Berufsverbot als Bestatter. Diese Auflage ist besonders hart.«
»Normal.«
»Einzug des aus strafrechtlichen Tatbeständen erwirtschafteten Vermögens.«
»Sonst nichts?«
»Reicht das nicht?«, sagte Ursel und begann, die weichen Länglichkeiten des Morgens kunstgerecht zu zerlegen.
»A-ha, sonst nichts«, sagte Nettelbeck mit Nachdruck. »Zum Beispiel keine Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Das wollte ich bloß wissen. Und das ist gut. Da haben Sie ja richtiges Glück gehabt. In vielen Fällen kommt es zu einer Aberkennung, einer sogenannten ›Abjudikation‹ derselben, in diesem Fall hätten Sie dann kein passives Wahlrecht mehr. Und wenn ich einmal ganz offen sprechen darf: Das hätte mich bei Ihren weitreichenden Aktivitäten auch nicht gewundert. Gewinnbringende Zusammenarbeit mit der italienischen Mafia, hundertdreißig Doppelbestattungen im Kurort, mehrfache Fluchthilfe, Vereitelung von Strafverfolgung – um nur einige Straftaten zu nennen. Wer war eigentlich Ihr Richter?«
»Ein gewisser Bockmayr.«
»Bocki!? Bocki Bockmayr! Bocki, das Wüstenkamel! Ja, so was! Der ist mit mir in der Schützenbruderschaft. Dann ist mir alles klar. Ja, wenns weiter nichts ist, dann spricht kaum etwas dagegen, gewisse politische Ämter zu bekleiden.«
»Nur gewisse politische Ämter?«, fragte Ignaz zurück. »Nicht alle?«
»Wie meinen Sie das?«
Ursel schaltete sich ein.
»Also nicht nur Gemeinderat, sondern auch Bürgermeister, Mitglied des Landtags, des Bundestags, Minister, Kanzler – alles eben.«
»Sie wollen wohl hoch hinaus!«
»Ich meine ja nur theoretisch«, sagte Ursel und nahm sich einen Löffel süßen Weißwurstsenf aus dem kleinen Schälchen. »Aber wenn man jetzt zum Beispiel Justizminister werden würde, dann könnte man doch sich selbst –«
»Nein, das kann man nicht«, unterbrach Nettelbeck lächelnd. »Ich weiß, worauf Sie hinauswollen. Nach deutschem Recht geht das nicht. Aber in Amerika, da gab es mal so etwas. Irgendwann in den Dreißigern des vorigen Jahrhunderts. Prohibition, Weltwirtschaftskrise, Filme in Schwarzweiß, Sie wissen schon. Robert Tate hieß der Mann. Er saß im Knast wegen fünffachen Mordes, wartete auf seine Hinrichtung. Seine Sympathiewerte in der Bevölkerung waren jedoch groß. So ließ er sich also für die Demokraten aufstellen. Sein Plan war natürlich, Gouverneur seines Bundesstaates zu werden und sich schließlich selbst zu begnadigen. Rein theoretisch wäre das auch möglich gewesen. Er schaffte es aber bloß bis zum zweiten Bürgermeister von Oaktown City. Er leistete gute Arbeit aus der Zelle heraus. Oaktown blühte unter ihm geradezu auf. Er wurde aber dann schließlich doch hingerichtet. Der Gouverneur des Bundesstaates witterte Konkurrenz – Sie verstehen.«
»Die Welt ist schlecht«, seufzte Ignaz.
»Aber er hat doch Immunität genossen, dieser Robert Tate«, hakte Ursel nach.
»Nein, für einen Lokalpolitiker gilt das eben nicht. Auch bei uns in Deutschland nicht.«
»Auch für einen Bürgermeister nicht?«
»Nein. Immunität von Abgeordneten gilt nur –«
Nettelbeck hielt nun ein Referat über die Geschichte der Immunität von Julius Cäsar bis Silvio Berlusconi. Ursel und Ignaz hatten inzwischen die Weißwürste mit dem speziellen Kreuzschnitt freigelegt, enthäutet und zum Verzehr geeignet auf dem Teller arrangiert. Sie bissen erwartungsvoll hinein.
»Der Metzger Moll macht bessere«, sagte Ignaz.
»Da hast du recht«, nickte Ursel.
»Den Bürgermeisterposten können Sie in Ihrer Lage natürlich schon bekleiden«, sagte Nettelbeck. »Auch mit einer Bewährungsstrafe. Wer von Ihnen will sich denn aufstellen lassen?«
»Deswegen wollen wir ja mit Ihnen sprechen«, sagte Ursel. »Wir haben vor, das Amt zusammen zu bekleiden und auszuüben.«
»Zusammen? Beide zusammen?«
»Wir wollen als Ehepaar Bürgermeister werden.«
Jetzt nahm sich Nettelbeck ebenfalls eine Weißwurst aus der Terrine. Er legte sie auf den Teller und schnitt mit dem Messer ein dünnes Mäusescheibchen herunter. Er betrachtete es misstrauisch.
»Das scheint mir nicht möglich zu sein.«
»Aber grade bei uns in Bayern, wo die Familie und die Ehe so hochgehalten werden, wo es urbayrische Traditionen rund um die Liebesehe und die gezielte Verheiratung gibt, da müsste man das doch machen können. Es schadet ja auch niemandem.«
»So etwas hat es noch nie gegeben«, sagte Nettelbeck. »Meines Wissens jedenfalls nicht. Aber ich kann ja mal in den Archiven wühlen. Wenn Sie darauf bestehen.«
»Essen Sie doch was, Herr Doktor«, sagte Ursel.
»Ich schätze die Chancen, ehrlich gesagt, gering ein.«
»Gerade letztens hat einer zu uns gesagt, wir und die Simpsons wären noch die einzigen intakten Familien weit und breit. Da muss doch was gehen.«
Nettelbeck schüttelte den Kopf.
»Haben Sie sich schon mit Ihren Parteifreunden darüber beraten?«
»Wir haben keine Parteifreunde. Wir sind in keiner Partei. Eine Partei hätte auch nicht viel Freude mit uns. Wir lassen uns einfach als Bürgermeisterehepaar aufstellen.«
Nettelbeck schüttelte den Kopf.
»Ja, warum denn nicht!«, sagte Ignaz. »Hausmeisterehepaare gibt es doch auch. Solche Stellen werden sogar öffentlich ausgeschrieben. Warum soll es dann keine Bürgermeisterehepaare geben?«
Die Graseggers aßen langsam und genüsslich, Nettelbeck blätterte in einem juristischen Kompendium.
»Sie könnten natürlich eines machen«, sagte er. »Sie könnten nach ähnlichen Fällen suchen. Ich gebe Ihnen die Adresse vom Bundesamt für Gemeindewesen. Die helfen Ihnen in der Sache weiter. Wenn wir genügend gleichgelagerte Vorgänge hätten, wäre es theoretisch möglich, ein Bürgerbegehren einzuleiten. Über diesen Umweg könnte es gelingen.«
»Wollen Sie nicht auch einmal von der Weißwurst probieren, Herr Doktor?«, fragte Ignaz. »Sie wird sonst kalt.«
»Suchen Sie ruhig auch nach älteren Fällen einer Doppelanstellung«, sagte Nettelbeck.
»Wie alt?«
»Blättern Sie in Kirchenbüchern, studieren Sie Gemeindearchive, historische Festschriften, so etwas in der Art. Bayrische Richter stehen darauf, wenn man ihnen mit Traditionen und vergilbten Handschriften kommt.«
»Das mache ich gern«, sagte Ursel. »Endlich kann ich meiner Liebe zur bayrischen Geschichte nachgehen.«
Ursel untertrieb hier. Sie war viel mehr als eine Liebhaberin. Sie war eine ausgezeichnete Kennerin der bayrischen Geschichte, von den Agilolfingern bis zum ›Kini‹ Ludwig II.
»Die Würste sind sicher vom Kallinger«, sagte Ignaz. »Sie sind eine Idee zu stark gewürzt. Nur eine Idee, aber man schmeckts raus.«
»Die besten Weißwürste«, warf Ursel ein, »hat immer noch der alte Hölleisen in seinem Kessel schwimmen gehabt!«
»Da hast du recht. Aber sein Filius wollte ja unbedingt zur Polizei – da wars aus mit der Metzgerei Hölleisen.«
Nettelbeck probierte ein zweites Scheibchen Weißwurst.
»Es ist ja sehr ehrenvoll, dass Sie mich konsultiert haben«, sagte er. »Aber haben Sie denn in Italien keinen Rechtsanwalt bekommen? Einen italienischen Dottore. Also, Sie wissen schon –«
Nettelbeck kam ins Stottern.
»Sie meinen einen Mafiaanwalt? Das wollten Sie doch sagen, oder?«
»Nein, so weit wäre ich nie gegangen. Das waren Ihre Worte.«
»Was sollen wir mit einem sizilianischen Winkeladvokaten anfangen, wenn wir uns zu einem oberbayrischen Bürgermeisterehepaar aufstellen lassen wollen?«
»Nun ja –«