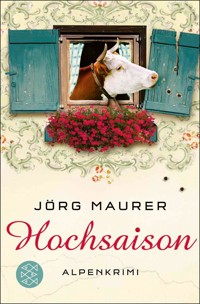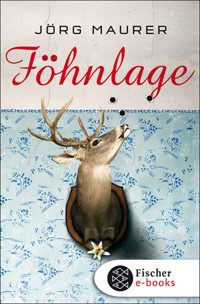8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Jennerwein ermittelt
- Sprache: Deutsch
In bester Lage wohnt der Tod: der neunte Alpenkrimi von Bestsellerautor Jörg Maurer ist Kommissar Jennerweins aufwühlendster Fall Böllerschüsse und Blaskapelle am Friedhof des idyllisch gelegenen Kurorts: Eine schöne Beerdigung, sagen alle, die danach ins Wirtshaus gehen. Nur schade, dass Kommissar Jennerwein gleich wieder weg musste, aber wegen dieses G7-Gipfels im Kurort sind alle Ordnungskräfte im Sondereinsatz. Dabei verliert gerade ein Mörder zwischen Polizeiabsperrungen und Anti-Gipfel-Demonstranten sein Opfer aus den Augen, ein schicksalhafter Schuss fällt, und das Bestatterehepaar a.D. Grasegger findet Verdächtiges auf dem Friedhof. Bei seinen Ermittlungen entdeckt Kommissar Jennerwein, dass nichts von Dauer ist – nicht einmal die Totenruhe…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Jörg Maurer
Im Grab schaust du nach oben
Alpenkrimi
Über dieses Buch
Ein buchstäblich tiefschürfender Fall für Kommissar Jennerwein
Dem Verstorbenen hätte die Beerdigung mit Schützensalut und Werdenfelser Trachtenkapelle sicher gut gefallen, sagen die Hinterbliebenen beim Leichenschmaus im Wirtshaus. Nur schade, dass Kommissar Jennerwein gleich wieder gehen musste, aber wegen dieses Groß-Gipfels im Kurort sind alle Ordnungskräfte im Sondereinsatz. Dabei verliert gerade ein Mörder zwischen Polizeiabsperrungen und Anti-Gipfel-Demonstranten sein Opfer aus den Augen, ein schicksalhafter Schuss fällt, und das Bestatterehepaar a.D. Grasegger findet Verdächtiges auf dem Friedhof. Bei seinen Ermittlungen entdeckt Kommissar Jennerwein, dass nichts von Dauer ist – nicht einmal die Totenruhe…
Weitere Titel von Jörg Maurer:
›Föhnlage‹, ›Hochsaison‹, ›Niedertracht‹, ›Oberwasser‹, ›Unterholz‹, ›Felsenfest‹, ›Der Tod greift nicht daneben‹, ›Schwindelfrei ist nur der Tod‹ sowie ›Bayern für die Hosentasche: Was Reiseführer verschweigen‹
Die Webseite des Autors: www.joergmaurer.de
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jörg Maurer stammt aus Garmisch-Partenkirchen. Er studierte Germanistik, Anglistik, Theaterwissenschaften und Philosophie und wurde als Autor und Kabarettist mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Kabarettpreis der Stadt München, dem Agatha-Christie-Krimi-Preis, dem Ernst-Hoferichter-Preis, dem Publikumskrimipreis MIMI und dem Radio-Bremen-Krimipreis.
Inhalt
Die harten Fakten
Erster Teil Die Wut
1 Der Weg
2 Der Schuss
3 Das Camp
4 Das Grab
5 Der Schreck
6 Der Kranz
7 Der Hit
8 Das Zelt
9 Die Leich’
Zweiter Teil Der Zorn
10 Der Chef
11 Der Wurf
12 Der Typ
13 Der Schock
14 Die Trance
15 Der Bruch
16 Der Schmerz
17 Die Rast
18 Der Hengst
19 Der Gang
20 Der Rausch
21 Das Cape
22 Der Russ
23 Das Blut
24 Die Frau
25 Der Plan
26 Der Gruß
27 Der Biss
28 Die Schrift
29 Der Schock
30 Auszüge aus dem Bayerischen Beamtenrecht
31 Der Abt
32 Das Lied
33 Der Block
34 Der Schutz
35 Der Berg
36 Der Club
37 Die Nacht
38 Das Ziel
39 Der Koch
40 Der Coup
41 Der Kick
42 Türenschlagen. Eine Brandrede
43 Der Trosch
44 Der Fund
45 Der Pfusch
Dritter Teil Der Schlag
46 Die Vier
47 Das Stück
48 Der Tipp
49 Das Haar
50 Eine kurze Geschichte des Zorns
51 Die Spur
52 Der Tee
53 Die Hatz
54 Der Hoosh
55 Die Tat
56 Das Hirn
57 The Help
58 Der Jazz
59 Der Kreis
60 Die Alm
61 Fußreflexzonen
62 Der Fund II
63 Die Fahrt
64 Der Busch
65 Der Blitz
66 Der Bus
67 Der Fuchs
68 Das Shi
69 Die News
70 Der Bluff
71 Das Harz
72 Der Brief
73 Die List
74 Die Flucht
75 Der Sarg
Der Dank
Die harten Fakten
Jäger, Soldaten, Mörder, Metzger und Auftragskiller reden vom waidgerechten, finalen oder terminalen Schuss, der die Eigenschaften der Schnelligkeit, Endgültigkeit und Schmerzlosigkeit in sich vereinigen soll. Schon Diana, die altrömische Göttin der Jagd, hatte den Wahlspruch Rapidus – Subitus – Mellitus auf ihren Bogen geschnitzt: schnell, unerwartet und honigsüß soll das Wild niedersinken. Eine alte Streitfrage ist allerdings, ob dabei der Kopf- oder der Blattschuss anzuwenden ist, um alle drei Effekte auch sicher zu gewährleisten. Die romantischeren unter den Schützen, die Soldaten und Jäger, zielen aufs Herz, die anderen auf die Schläfe, genau zwischen Schläfenbein und Ohr. Hierbei wird die Oberkieferarterie zerfetzt, die sich unter dem Schläfenbein verbirgt. Das führt zur augenblicklichen Bewusstlosigkeit, der Tod tritt Sekundenbruchteile später ein. Wenn nicht, dann unterbricht das Geschoss auf jeden Fall die dahinterliegenden, blutversorgenden Arterienverzweigungen. Und wenn auch das aus irgendeinem Grund missglücken sollte (Aber wie sollte es? Die Kugel müsste plötzlich eine Kurve fliegen!), dann ist die Läsion des angrenzenden Großhirnbereichs mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich. Wer daran interessiert ist, dass sein Opfer rasch, lautlos und gestisch unauffällig zu Boden sinkt, weiß das.
Das Spurensichererteam, das beim G7-Gipfel um die Leiche des Opfers versammelt war, hatte deshalb überhaupt keine Zweifel, dass die Tat nicht von einem spontanen Aktionisten aus dem Schwarzen Block, sondern von einem zielsicheren, gutausgebildeten Heckenschützen begangen worden war. Er hatte die optimale Position der Zielperson abgewartet, ehe er abdrückte. Gerade bei einer solchen politischen Großveranstaltung und den damit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen war das der größte anzunehmende Unfall. Wie hatte das nur geschehen können? Beim jährlich stattfindenden G7-Gipfel treffen sich bekanntlich die mächtigsten Staatenlenker der Welt. An einem sonnigen, aber gewitterträchtigen Juniwochenende war es wieder einmal so weit gewesen, auf Schloss Elmau, einem abgehobenen Luxury Spa & Cultural Hideaway Hotel nicht weit oberhalb des Werdenfelser Landes. Abgesehen von einigen regierungsnahen Organen hatte auch diese Veranstaltung keine gute Presse und einen noch schlechteren Ruf in der Öffentlichkeit. Das Treffen sei ein nicht mehr zeitgemäßes Ritual ohne konkrete Ergebnisse, blinder Hoch-Aktionismus, eine überteuerte Machtdemonstration von Polizei und Politik, eine schändliche Präsentation westlicher Dekadenz, eine gewaltige Verschwendung von Steuergeldern. Derartige Pauschalurteile sind schon deshalb zu kurz gegriffen, weil es durchaus Personenkreise gibt, die aus solchen Veranstaltungen großen Nutzen ziehen können. Viele Menschen hatten gerade wegen der massiven Zusammenballung von Ordnungskräften Gelegenheit, alte Rechnungen zu begleichen und neue Konzepte außerhalb der Legalität auszuprobieren. In diesem Buch wird ein besonders perfider Plan geschildert, der im Schatten des großen Gipfels gereift und im Auge des polizeilichen Orkans gediehen ist.
Die kleine, umgebaute Pistole hob sich Millimeter für Millimeter. Ein Blick auf den Entfernungsmesser: Die Zielperson war knapp achtzig Meter entfernt, sie stand seitlich, also ideal. Das Fadenkreuz fixierte deren Schläfenbein, die Stelle knapp neben dem Ohr. Der Abzugshebel gab kein Geräusch von sich. Der Schalldämpfer aus Titan mit dem speziellen Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium verwandelte das Explosionsgeräusch des Geschosses in ein kaum hörbares Rrrrfffffftsch! Es hätte auch ein mäßig aufgeregt schnatternder Eichelhäher sein können. Das Opfer sackte augenblicklich und ohne einen Laut von sich zu geben zusammen.
Doch der Reihe nach.
Erster TeilDie Wut
Montag, 8. Juni
1Der Weg
Bei meiner Beerdigung wünsche ich mir auf dem Weg zum Grab den altbewährten Trauermarsch, auf dem Rückweg aber das Lied ›Purple Rain‹ von Prince. Das örtliche Blasorchester soll beide Stücke schön langsam und gschmackig spielen, nicht zu krachert.
Immer trifft es die Besten. Gerade mal Anfang vierzig war er geworden, der Hansi. Sein Sarg glitt durch die verwinkelten Kieswege des Friedhofs, und die zwölfköpfige Gruftcombo blies den Trauermarsch im gewünschten Tempo: schön langsam und gschmackig, nicht zu krachert. Gerade schwang sich die erste Klarinette zu einem Triller auf, der nach Vogelgezwitscher und süßem Sommerlärm, fast nach Freibad und Erdbeereis klang. Viele der Besucher hoben unwillkürlich den Kopf, suchten den Sinn des Lebens im blassblauen Luftgewölbe dort oben und vergaßen kurz den beklagenswerten Anlass. Das Messing der blankgewienerten Posaunenzüge blinkte verwegen fröhlich im Sonnenschein, die Musiker schnitten das angestrengt-grimmige Gesicht, das Bläser immer zeigen, wenn sie versuchen, besonders seelenvoll zu spielen. Dirk hatte heute Dienst als zweiter Trompeter. Er setzte sein Instrument kurz ab und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Dabei bewegte er die Lippen zu einem unhörbaren Fluch. Vermaledeiter Job, verdammte Plackerei. Bis sechs Uhr früh hatte er in einem Salsaclub die Backgroundtrompete geblasen, die halbe Karibik hing ihm noch in den Ohren. Hätte einer von den Beerdigungsgästen genauer hingehört, wäre ihm das Schräge und Übernächtige, das Karibische und Rumbakubanische in der zweiten Trompetenstimme sehr wohl aufgefallen. Doch niemand bemerkte etwas.
Dirk hatte den Verstorbenen nicht persönlich gekannt, doch er wusste, dass der Hansi ein ehrenwerter Bürger gewesen war, fest verwurzelt im Kurort, den Traditionen verpflichtet, ein Vorbild für alle. Dazu war der Hansi Mitglied in unüberschaubar vielen Vereinen gewesen. Deshalb auch der Massenandrang auf dem Viersternefriedhof. Gut zweihundert Leute waren zur Beerdigung gekommen, den Vereinsfahnen und Zunftflaggen nach zu urteilen, musste mindestens ein Bürgermeister, Landrat oder Minister gestorben sein. Viele der Trauergäste hätten diese Alternativen ohnehin bevorzugt. Eines war jedenfalls sicher: Der Hansi war einer von den Guten gewesen. Einer von denen, die etwas geleistet hatten für die Gemeinde.
Dirk konzentrierte sich wieder auf die Musik. Gleich kam eine Stelle im Trauermarsch, die superpianissimo gespielt werden musste. Dirk zwang das alte Kasernenhof- und Toten-Aufweck-Instrument, gefühlvoll zu winseln und leise zu klagen. Die Trompete schnurrte wie ein Kätzchen. Wegen der ruhigen Stelle waren viele Schluchzer und Schnäuzer aus dem Trauerzug zu vernehmen.
»So ein guter Mensch!«, hörte man die Weibrechtsberger Gundi sagen. »Und so ein überraschender Tod.«
»Wie ist es denn eigentlich passiert?«, fragte die Hofer Uschi neugierig.
»Ja, weißt du denn das nicht? Der Schlag hat ihn troffen. Seinen Onkel, seine Mutter, seine Großmutter und etliche andere von den Ropfmartls hats auch schon so erwischt.«
»Seine Mutter und seine Großmutter auch. Schau, schau.«
Das Schlagerl, die Apoplexie war ein böses Familienerbstück der Ropfmartls. Immer wieder riss es einen von ihnen dadurch aus dem Leben. Ropfmartl war der Hausname der Sippe. Schon den ersten, namensgebenden Martl hatte der Schlag getroffen, genau am Montag, den 23. August 1802, wie es in der Familienchronik hieß.
Zehn Meter vor Dirk schwebte der Sarg. Vier stämmige Burschen von der Schuhmacherinnung hatten ihn geschultert, auf ihren schräg geschnittenen Lederschürzen prangte das Zunftwappen, an ihren Gürteln hingen Schusterhammer und Schusterbeil. Schon der erste Ropfmartl war Pantinenmacher gewesen, und die Familie hatte im Lauf der Zeit ein florierendes Geschäft aufgebaut. Die Burschen bogen jetzt ab, Dirk hatte dadurch einen guten Blick auf die engsten Verwandten, die direkt hinter dem Sarg her schritten. Er kannte die meisten von ihnen vom Sehen, von Hochzeiten und vom Fasching. Eine Frau in Schwarz fiel ihm besonders auf. Sie war klein und schmächtig, mit gespannten, leicht hochgezogenen Schultern, den Blick zum Boden gesenkt, eher trotzig als traurig. Sie hielt Distanz zu den anderen, dirigierte dabei zwei schlaksige Jugendliche vor sich her. In einigem Abstand neben ihr schritt eine große, muskulöse Frau mit kantigem Gesichtsausdruck. Ab und zu wandte sie sich prüfend und besorgt um, es schien, als ob sie dafür verantwortlich war, dass alles mit rechten Dingen zuging. Sie war eine entfernte Cousine des Verstorbenen, hatte die Beerdigung organisiert und mit den Musikern das Finanzielle geregelt. Bei ihrem vollen Namen nannte sie eigentlich niemand, sie hieß bei allen nur die Bas’, und man musste das -a- lang, dunkel und bedeutungsvoll aussprechen, nur dann war sie zufrieden. Sie hatte jedem der Musiker zusätzlich zur Gage noch einen Extrazwanziger in die Hand gedrückt – lumpen ließen sich die Ropfmartls wirklich nicht. Den beiden so unterschiedlichen Frauen folgten weitere Verwandte, allesamt schwarzgekleidet, die Männer mit dem Hut in der Hand, die Frauen mit einem Blumenbouquet. Die letzten Töne des Trauermarschs versickerten, die Musiker setzten ihre Instrumente ab.
»Ich seh nichts!«, schrie die Hofer Uschi aus einer der hinteren Reihen.
»Beim Tod musst du auch nichts sehen«, erwiderte die Weibrechtsberger Gundi.
Es bildete sich ein kleiner Rückstau, denn der Zirbelholzsarg und die nachströmenden Verwandten waren am Grab angekommen. Jeder versuchte, einen Platz zu ergattern, von dem er gut und bequem aufs Grab sehen konnte. Die Schusterburschen stellten den Sarg auf das Grabgerüst, herbeieilende Friedhofshelfer bedeckten ihn mit den bereitliegenden Kränzen, routiniert, aber doch mit der gebotenen nachdenklichen Pietät. Unter dem Sarg klaffte bereits das geräumige Erdloch, das Vorzimmer zur Unterwelt – vielleicht antichambrierte der Hansi gerade bei Hades, dem Herrscher des Totenreichs. Die kleine, zierliche Frau und die größere, muskulöse schienen um den ersten Platz vor dem Sarg zu rangeln, es konnte aber auch eine Täuschung sein, denn das Erdreich um die ausgehobene Stelle war locker und feucht, vielleicht waren die beiden nur ins Straucheln gekommen. Direkt vor dem Grab hatte sich eine kleine Pfütze gebildet, manche gingen vorsichtig außen herum, andere sprangen darüber, hineingetreten war noch niemand. Der spiegelglatte Wasserfleck lag so zentral da, als hätte er eine wichtige Funktion bei dieser Beerdigung. Endlich hatten alle ihren Platz gefunden, es kehrte langsam Ruhe ein. Dirk nahm den Hut ab. Ein Kommandoruf ertönte in der Ferne, dem ein mächtiger Böllerschuss folgte, das feierliche Echo rollte langsam und majestätisch aus. Jeder erwartete nun den zweiten Schuss, stattdessen durchschnitt ein helles, durchdringendes Motorengeräusch die andächtige Stille. Das Geräusch kam von oben. Es kam immer näher. Einige hoben erst beunruhigt, dann erschrocken den Kopf, blinzelten in die Sonne und duckten sich instinktiv.
2Der Schuss
Am Grab selbst wünsche ich mir einen Salut von Böllerschüssen. Es muss siebenmal anständig krachen, wenn der Sarg mit mir hinunterfährt. Bis hinauf auf die Kramerspitze soll man es hören. Und jeder der Gebirgsschützen soll einen Extrazwanziger dafür kriegen.
Was zum Teufel war das gewesen? Der Pilot des Air-Force-Hubschraubers V-22 Osprey fluchte laut in seine Sauerstoffmaske hinein. Dabei ließ er den Motor aufjaulen und flog eine enge Kurve nach unten. Er zog das digitale Sichtgerät zu sich her, scrollte und versuchte herauszufinden, woher die Explosion gekommen war. Am Rande eines Friedhofs machte er ein Objekt aus, von dem dünner Rauch aufstieg. Was war das? Wurde da unten geschossen? Doch nicht etwa auf ihn? Der Pilot zog die Maschine wieder hoch über die Wolken. Es gab klare Vorschriften für solch einen Fall. Leitstelle kontaktieren, Koordinaten durchgeben, nach der weiteren Vorgehensweise fragen. Die Antwort kam prompt.
»Auf dem Friedhof? Das sind sieben genehmigte Salutschüsse. Aus historischen Waffen.«
»Und warum weiß ich nichts davon?«
Mussten die verdammten Seppels ausgerechnet jetzt …
Für die Bas’ war es gar nicht so leicht gewesen, beim Ordnungsamt eine Genehmigung für das Böllerschießen zu bekommen. Klar war der Hansi fast so etwas wie ein Ehrenbürger gewesen, ein notabler Spross einer alteingesessenen Familie, außerdem Mitglied des Gebirgsschützenvereins, und in den wurden sicherlich nur die Rührigsten und Unbeflecktesten aufgenommen. Der Schützenverein hatte eine eigene Salutschützen-Abteilung, die Ehrenformation, die für derlei Gelegenheiten routiniert und zuverlässig zur Verfügung stand, an Fronleichnam, bei Hochzeiten, an Heiligabend, zur Sonnwendfeier, bei der Beerdigung von Veteranen, und bei vielen weiteren Anlässen. Gegen eine amtliche Erlaubnis sprach allerdings, dass der Kurort in diesen Tagen das lange vorbereitete Gipfel- und Elefantentreffen ausrichtete, G9, G8, G7 – kein Mensch wusste das so genau. Aber es herrschte ein gigantischer Auftrieb an Security, Polizei und Militär.
»Einen Ehrensalut für den Ropfmartl Hansi? Was soll denn das!«, hatte der zuständige Leiter des Ordnungsamtes die Bas’ angebellt. »Ausgerechnet jetzt? Weißt du nicht, was im Ort los ist?«
»Er hat es sich nicht aussuchen können, wann er stirbt«, hatte die Bas’ zurückgebellt. An ihr war es hängengeblieben, die vielen Wünsche des Hansi, die Beerdigung betreffend, zu erfüllen. Sie zeigte dem Leiter des Ordnungsamtes die entsprechende Stelle in seiner mehrseitigen Verfügung, dem Kodizill. So wurde das Begleitschreiben zum Testament genannt, das die Bestattung und die außererbschaftlichen Dinge des Verblichenen regelte. Solch ein Schreiben zu erstellen ging auf eine alte Familientradition der Ropfmartls zurück.
»Geht es nicht lautlos?«
»Lautlose Böllerschüsse – spinnst du? Ich habe nachgeschlagen. Gekrönten Häuptern stehen hundertdrei Schüsse zu. Hohen Militärs zweiundzwanzig. Einem Bischof immerhin noch achtzehn. Stell dir vor, wenn so ein Kaliber gestorben wäre! Aber sieben mickrige Böllerschüsse für den Hansi, das müsste doch ein Klacks für dich sein.«
Der Leiter des Ordnungsamtes seufzte. Seit einem Jahr tobten die Vorbereitungen zum Gipfel. Er hatte genug Ärger am Hals. Ein Ehrensalut hatte ihm gerade noch gefehlt. Er zögerte mit der Antwort, wollte auch schon zu einem gewissen amtlich-ablehnenden Kopfschütteln ansetzen, da murmelte die Bas’ wie nebenbei:
»Ich kann es natürlich auch an die Presse geben.«
»Was an die Presse geben?«
»Dass das Treffen jetzt zu allem Überfluss auch noch uralte Bräuche behindert. Dass man den letzten Willen von ehrbaren Bürgern nicht mehr respektiert. Dass so ein Gipfel wirklich alle echten, gewachsenen Traditionen niederbügelt. Das wird die Stimmung im Ort noch mehr aufheizen.«
»Du drohst mir?«
Die Bas’ nickte fröhlich.
Alle mehr oder weniger am Gipfel beteiligten Seiten hatten etwas daran auszusetzen. Das Lamento darüber war fast zur lieben Gewohnheit im Kurort geworden. Die einheimische Bevölkerung sah keinen rechten Vorteil eines Zusammentreffens von Politikern an einem solch schlecht zu sichernden Ort. Die Kurgäste fühlten sich gestört. Oder blieben gleich ganz weg. Die Taxifahrer jammerten über ausbleibende Kundschaft: Kein Demonstrant fuhr mit dem Taxi zur Demo, und die Bonzen hatten ihre eigenen Chauffeure. Die Globalisierungsgegner protestierten ohnehin gegen das Spektakel, im Kurort oder wo auch immer. Die Polizei wiederum hielt es für ausgesprochen riskant, ein Riesenaufgebot von Beamten von anderen Orten abzuziehen, die dann dort fehlten. Die Politiker klagten über die enormen Kosten, schoben die Schuld auf die Gipfelgegner, die die Sicherheitsanstrengungen immer weiter in die Höhe trieben. Die Security wies auf das absurd hohe Gefährdungspotential hin, das mit dem Auftauchen von sieben oder acht oder neun Staatschefs und ihrem Tross einherging. Überall wurde geklagt, ernsthafter Widerstand aus dem bürgerlichen Lager hatte sich jedoch nirgends geregt. Es war wie bei den Etiketten, die auf den Äpfeln klebten. Man ärgerte sich, aber die freche Selbstverständlichkeit, mit der das Obst verunstaltet wurde, führte zur protestlosen Resignation. Im Fall der Böllerschüsse hatte es schließlich dann doch eine Sondergenehmigung gegeben, ausgestellt nicht nur vom Ordnungsamt, sondern unterschrieben und gesichtet von mehreren in- und ausländischen Kontrollstellen, darunter dem Sicherheitschef der Amerikaner, dem kanadischen Militärattaché und dem japanischen Koordinator für Sicherheitsfragen. Die einheimischen Bräuche wollte schließlich niemand behindern. Und ein Seppel mit Lederhose, Schnauzbart und Rebhuhnfeder auf dem Hut würde sich schon nicht als Randalierer entpuppen.
Als der erste Böllerschuss verklungen war, schaute die Trauergemeinde weiterhin hinauf zu dem Hubschrauber mit den zwei Rotoren, der jetzt erstaunlich rasch an Höhe gewann und schließlich ganz vom satten Blau verschluckt wurde.
»Solche Maschinen wenn wir hätten!«, sagte ein Bergwachtler zum anderen.
»Einen V-22er Osprey?«
»Der braucht vom Boden aus nicht mehr als sieben Sekunden, bis man ihn mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennt.«
»Ja, das wärs! Von null auf unsichtbar in einem Blinzeln.«
»Am Ende ist sogar Mr President an Bord.«
»Und was täte der da bei uns?«
»Vielleicht hat er sich eine Zweitwohnung im Kurort ausgesucht.«
»Ja, und für später einen Grabplatz auf unserem Viersternefriedhof.«
Der Kaplan gab nun den Schustergesellen ein Zeichen, den Sarg hochzuheben. Zweihundert Meter vom Grab entfernt, außer Sichtweite, stand das kleine Häuflein der Gebirgsschützen in prächtiger, bunter Montur, jawohl: Montur, denn den unbändigen Zorn eines Gebirgsschützen lenkt der auf sich, der bei seinem Aufzug von Uniform, Tracht, Kluft oder gar nur Bekleidung redet. In der Hauptmanns-Montur stand also der Gebirgsschützenhauptmann Hackl, und die sieben Schützen knieten vor ihren historischen Böllerkanonen. Der Hansi hatte das so gewollt. Keine schlichten Hinterlader, sondern richtige gusseiserne Kanonen auf Holzrädern, mit zusätzlich aufgepflanzten Schalltrichtern. Sechs der Schützen warteten, bis sie an die Reihe zum Abfeuern kamen. Hauptmann Hackl hielt den Kommandodegen gesenkt. Verstohlen blickte er auf die Uhr. Kurz nach vier, alles wie abgesprochen. Der erste Salutschuss war schon einmal gut über die Bühne gegangen. Wenn nur nicht der blöde Hubschrauber dazwischengekommen wäre. Geplant war ein sogenanntes Lauffeuer, dabei zündete jeder der Schützen erst dann, wenn das Echo des Vorgängerschusses verklungen war. Jetzt die zweite Detonation. Die wuchtige Felsenwand der Kramerspitze nahm sie majestätisch auf und warf sie mit huldvoller Behäbigkeit zurück. Dann der dritte Schuss. Die Menge der Trauernden, die sich um das Grab gesammelt hatte, ergriff ein warmer, wohliger Schauer, selbst eingefleischte Antimilitaristen standen innerlich stramm, blickten mit durchgedrücktem Hohlkreuz auf den Sarg mit den Kränzen, von denen bunte Schleifen hingen: Ein letzter Gruß vom Trachtenverein. Vom Tennisclub. Von der Blaskapelle. Von deinen Kegelbrüdern. Von den Saunafreunden.
»So, so, von den Saunafreunden!«, raunte die Hofer Uschi anzüglich. »Da schau her.«
Der vierte Schuss. Scheinbar noch wuchtiger und bedeutender als die vorigen. Nur Memmen hielten sich die Ohren zu, diesem Zapfenstreich wollte man sich schon genussvoll aussetzen. Fünfter Schuss. Die Bas’ kontrollierte bei der Gelegenheit noch einmal, ob die Kränze vollständig auf das Sarggerüst geladen worden waren. Alles perfekt.
Der Schützenhauptmann hob sich natürlich mit einer prächtigeren Aufmachung von den gemeinen Kanonieren ab, er trug die Haupt- und Staatsmontur mit spitzzulaufender Mütze, die mit einer blutroten Kordel geschmückt war. Die Weste schillerte in allen Regenbogenfarben, und um die Hüften schlenkerte ein Charivari, das bei den Schützen natürlich auch nicht so hieß, sondern G’häng. Die bunte Pracht stand im Gegensatz zu der schlichten Uniform von Master Sergeant Rob Sneider, einem hohen Verbindungsoffizier der US Army, der momentan nicht verbergen konnte, dass er reichlich unterfordert war von dem langweiligen Job, tumbe Trachtler und ihre historischen Waffen zu beaufsichtigen. Gerade bekam Sneider über Funk die Anfrage eines Hubschrauberpiloten rein, was denn das für ein Geböller sei.
»War so ausgemacht«, gab Sneider lässig zurück, »Sieben Schüsse Punkt 4:00 p.m. Eine Beerdigung. Steht das nicht auf Ihrem Tagesplan?«
»Habe nichts davon mitbekommen.«
»Na, toll.«
Sneider legte auf. Die Koordination zwischen Sicherheitskräften und Militär war traditionell schlecht. Sneider hatte mittags die historischen Böllerkanonen begutachtet und für harmlos befunden. Keine atomaren Lenkraketen drin, die auf den Präsidenten zielen konnten, dafür viel Schwarzpulver, das einen Höllenlärm machte, wenn man es abbrannte. Lediglich die Amerikaner hatten inspiziert, die französische Delegation hatte verzichtet, Japan als Nicht-Atomwaffen-Land war gar nicht eingeladen worden. Die Kanadier hatten sich auf die Amis verlassen, die Briten hatten nur gelacht und die Angelegenheit mit den sieben Feuerwerkskrachern ohne Inspektion gegengezeichnet. Sneider fragte sich, was er hier tat. Historische Böllerkanonen. Kinderspielzeug. Kostümierte Seppeldeppen.
Der sechste Schuss klang in den Ohren der Trauergemeinde noch einen Zacken würdevoller, erhabener und historischer. Das Echo von den Kramerwänden waberte stark nach, der Friedhofsboden schien zu beben, die Pfütze vor dem Grab zitterte und warf die Sonnenstrahlen scharf blitzend zurück. Hauptmann Hackl strich zufrieden seinen Schnurrbart glatt. Die versammelte Trauergemeinde stand ruhig und ergriffen da. Kaum jemandem fiel die kleine Unregelmäßigkeit auf. Selbst die Bas’ hätte gar nichts mitbekommen, wenn nicht die Heinlinger Resel ihr ins Ohr geflüstert hätte:
»Sechs Schüsse.«
»Was?«
»Es waren bloß sechs Schüsse. Hat er sich nicht sieben gewünscht, der Hansi?«
Die Bas’ zuckte die Schultern. Dann eben bloß sechs Schüsse. Auch die Trauergemeinde, die hauptsächlich aus Zivilisten bestand und deshalb ungeübt im Heraushören von fehlenden Schüssen war, bekam von der ganzen Aufregung nichts mit. Sechs Knaller, sieben Knaller, einerlei.
Umso mehr schwitzte Hauptmann Hackl. Sein Gesicht war rot vor Scham und Wut, der gezwirbelte Bart vibrierte gefährlich. Warum zündete die siebte Kanone nicht? Ausgerechnet jetzt, unter den Augen einer Supermacht? Sneider grinste transkontinental überheblich und tippte etwas in sein Smartphone. Der namenlose arme Schütze Nummer sieben wiederum konnte nicht mehr tun als die vermutlich schadhafte Zündplatte zu verfluchen. Oder das nasse Pulver. Noch nie in der Geschichte des Vereins war so etwas passiert. Zwar war es beim Salutschießen immer wieder mal zu Unfällen gekommen. Dem Kanonier Gschnaider hatte es vor Jahren in Bad Tölz die Hand weggerissen, dem Degglinger Max in Mühldorf ein Auge, die vielen Schützenfinger gar nicht mitgezählt, die bei diversen Ehrensalven auf der Strecke geblieben waren. Die historischen Paradewaffen waren eben nicht mit den aktuellen Sicherheitsstandards ausgerüstet, das war ja schließlich das Historische daran. Aber was jetzt gerade geschah, nämlich nichts, das hatte es noch nie gegeben.
»Wir brauchen sieben Schuss«, sagte Sneider in die ungemütliche Stille hinein. »Nur dann ist die Security zufrieden. Los, machen Sie! Die Jungs zählen mit, die haken das ab. Sie könnten ja meinen, dass mit dem siebten Schuss später irgendein Unfug getrieben wird.«
Alle starrten auf die Kanone. Keiner trat näher. Ganz im Gegenteil. Die Ehrenmusketiere wichen zurück. Es war wie mit der Schlusspointe bei einer Hochzeitsrede: Wenn sie nicht zündete, gab es keinen Plan B.
»Was sollen wir jetzt tun?«, fragte Hackl gehetzt und atemlos.
»Die Kanone muss kontrolliert gesprengt werden«, stellte Rob Sneider fest.
Hackl fiel in sich zusammen. Der Master Sergeant ließ sich mit dem Minenräumkommando verbinden. Dann mit den internationalen Verbindungsoffizieren und dem Geheimdienstkoordinator der Militärpolizei. Schließlich hatte er es geschafft, die Meldung über den fehlenden Schuss an alle protokollarisch vorgeschriebenen Sicherheitsstellen abzusetzen. Trotz der zur Schau getragenen Coolness war Sneider hochnervös. Er hoffte inständig, dass er niemanden vergessen hatte. Denn wenn doch …
… dann saß jetzt irgendwo ein unerfahrener Abhörspezialist in einem verbeulten Umzugswagen, der zwar den fehlenden Knaller mitbekommen hatte, nicht aber die Entwarnung; der daraufhin eine Lawine lostrat, die mit der Verlegung aller Atom-U-Boote ins Mittelmeer, dem Erstschlag, dem Zweitschlag und der vollständigen Vernichtung der menschlichen Zivilisation endete. Master Sergeant Sneider sah diesen Verursacher der Apokalypse förmlich vor sich sitzen: er war klein, verschwitzt und hatte sich am Morgen beim Rasieren geschnitten. Sneider lief puterrot an und schnappte nach Luft …
Sein Mobiltelefon klingelte. Ein Beamter aus dem Pentagon war dran. Alarmstufe wieder auf null. Alles im grünen Bereich.
3Das Camp
Am nördlichen Ende des Kurorts, auf der grünen Wiese, hatten die Gipfelgegner ihr Camp aufgeschlagen. Buntfleckig lagen die vielen kleinen Zelte da, wie ein Haufen achtlos hingeworfener Bauklötzchen. Nach alldem, was Medien so gedruckt und gesendet hatten über die Globalisierungskritiker und ihre Schwarzen Blöcke, hätte man hier mehr Gefahr, Bedrohung und Vermummung erwartet, ein allgegenwärtiges fanatisches Glimmen in unbelehrbaren Revoluzzeraugen. Man hätte mit feige behelmten, schwarzledernen Bikern gerechnet, die mit aufheulenden Motoren einfuhren, grölende Radaubrüder, wie man sie von Fußballstadien kannte, oder vor Wut auf das Schweinesystem kochende Irre, die gefährlich blitzende, undefinierbare Gegenstände in der Hand hielten. Doch nichts von alledem war hier zu sehen. Zumindest momentan nicht. Ganz im Gegenteil: Es fehlte nicht viel zu einem ländlichen Open-Air-Festival, zu einem alplerischen Outdoor-Event, gesponsert von BMW oder Spatenbräu. Barfüßige junge Leute schleppten Wasserkanister durch die Gegend, diskutierende Grüppchen standen lachend und rauchend zusammen. Am Imbisszelt war am meisten los, es trug ein Schild mit der Aufschrift Ohne Mampf kein Kampf, und es gab hauptsächlich Handfestes wie Leberkäsesemmeln, gestiftet von der örtlichen Metzgerei Kallinger. Allerdings mit der Bitte um Diskretion:
»Ja, machts nur was gegen die Großkopferten da droben, aber sagts net, dass der Leberkas von uns is.«
Androgyne Gestalten tanzten einsame, sonnenzugewandte Tänze, im Hintergrund war die passende Musik dazu zu hören. Sie quoll aus einem nicht sehr leistungsstarken Ghettoblaster, der auf einem wackligen Klappstuhl stand. Ein Mann in Shorts und Badelatschen hatte sein Fernglas auf die Spitzen des Karwendelgebirges gerichtet. Ein anderer stieß ihn an.
»Toller Ausblick, gell?«
»Wie? Nein, ich such die Drohnen!«
Vor ihrem quietschvioletten, einschläfrigen Zelt saß die Bloggerin Nina2 im Schneidersitz, konzentriert über ihr Notebook gebeugt. Ihre langen schwarzen Haare quollen aus der Kapuze. Sie tippte wild und leidenschaftlich, ihre Gedanken waren schneller als ihre Finger.
Nina2 | Globoblog Mo, 8. Juni 15:30
Im Camp. Vor dem Eingang ein Plakat: Kein Gott, kein Staat, kein Kalifat. <grins> Daneben der handgeschriebene Zettel: Presse, Bullen, Weißwurstscheiben – müssen leider draußenbleiben. <verwundertamKopfkratz> Aber das mit dem Draußenbleiben scheint zu funktionieren. Keine Kameras, keine Fotoapparate, jedenfalls nicht auf den ersten Blick …
»Kennen wir uns nicht vom Gipfel in Deauville? Deauville nullelf? Oder von Brüssel nullvierzehn?«
Nina2 schüttelte den Kopf ohne aufzublicken. Sie tippte weiter. Wenn man einen Blog schrieb wie sie, dann war es ganz wichtig, alle Eindrücke aus diesem verschlafenen Kurort sofort zu posten. Das wirkte einfach am authentischsten.
»Oder von Heiligendamm nullsieben? Nein, für Heiligendamm bist du noch zu jung.«
»Ja, ja«, murmelte Nina2. »Von irgendwoher werden wir uns schon kennen.«
Der junge Mann hielt ihr eine offene Weinflasche entgegen und schüttelte sie. Es sollte einladend wirken. Nina2 warf einen kurzen Blick auf das Etikett. Supermarktplörre, allerunterste Schublade. Aber was konnte man hier anderes erwarten.
»Willste nen Schluck?«
Die Jesusgestalt mit Vollbart und weißwollener Tunika ließ nicht locker. Nina2 versuchte einzuschätzen, aus welcher politischen Fraktion er kam. Wahrscheinlich aus einer harmlosen. Trotzdem nahm sie ihr Smartphone und schoss unauffällig ein Foto. Der neutestamentarische Rotweinfreak zuckte die Schultern und trollte sich wieder.
Nina2 | Globoblog Mo, 8. Juni 15:35
Nach vier Tagen hier im Alpenland verdichtet sich der Eindruck: tiefste Provinz, politisches Entwicklungsgebiet. <Seufz> Die Locals stehen bei der Demo am Straßenrand und glotzen auf die Transparente. Sie halten Julian Assange wahrscheinlich für einen englischen Modedesigner. Auffällig: Die Fenster der Geschäfte sind kaum verbarrikadiert. Die scheinen sich nicht so recht zu fürchten. Witzig: Ausgerechnet der allerabgewrackteste und miefigste Laden, ein Matratzengeschäft, in das sowieso keiner je einen Stein schmeißen würde, war voll mit Bauholz verschalt. <eineDoseMitleidaufmach:Pfsch!> Das Camp füllt sich langsam wieder. Keine wirklich gewaltbereiten Aktivisten hier. Kann ja noch werden. <Augenbrauenbesorgthochzieh> Die meisten der Camper kommen aus elitären Verhältnissen, haben noch nie in ihrem Leben was gearbeitet, suchen einfach nur den Kick. Ja, Leute: So bewegt man nichts.
In einiger Entfernung von Nina2 erhob sich ein zaundürrer Jüngling, um das Wort zu ergreifen. Er hielt eine kleine Spontanrede, ohne Mikro, ohne Termin, einfach so. Einige der Herumlaufenden blieben stehen, manche setzten sich, es bildete sich ein Kreis um ihn. Er stellte sich als Bobo vor. Bobo trug ein Piratentuch, er hatte dadurch etwas von einem abgemagerten Seeräuber. Sein Adamsapfel sprang beim Reden deutlich auf und ab, er sprach von der Utopie der herrschaftsfreien Zukunft. Ohne Punkt und Komma. Nina2 schoss auch von ihm ein Foto.
Nina2 | Globoblog Mo, 8. Juni 15:40
Dieser Bobo ist wohl neu in der Antigloboszene, inhaltlich kaum einer Richtung zuzuordnen, am ehesten noch den Links-Identitären, die ganz Europa zerschlagen wollen in winzige Regionen, alle nicht größer als das Werdenfelser Land. <grins, hüstel> Send in the clowns?/??// Nö, die sind doch schon längst da, die Clowns! Bobo ist jedenfalls rhetorisch begabt, bei seinem mitreißenden Redeschwall fliegen einem die Ohren weg, und das kann man nicht von jedem hier behaupten. Wer mir unter den Zuhörern noch aufgefallen ist: Bindu, ein streitsüchtiger Chaot von der Vegan-Truppe, dann Alexa, ehemalige Attac-Mitarbeiterin, diese Sportsfreunde waren ihr aber zu wischiwaschi. Ferner Mungo, der zündet gerne mal was an, Aschentonnen zum Beispiel, er weiß auch, wie man Mollis und Nebelkerzen baut. Gibt dazu sogar Kurse hier im Camp. Dann noch der Empört-Euch!-Wotan: Ein Radikalintellektueller mit Muttersprache Fachchinesisch, macht einen auf Stéphane Hessel und Jean Ziegler gleichzeitig. Sieht das Ganze hier eher als Hauptseminar Soziologie. Schließlich die historische Abteilung: Ein paar stramme DKPler – ja, es gibt sie noch, auch ohne Artenschutz. //sarkasmus off/Wo ist eigentlich Ronny, der Totalverweigerer und Solokämpfer?
Nina2 blickte vom Notebook auf. Ein gleißender Sonnenstrahl brach durch die Wolken und schüttete sein Junifeuer über dem Karwendelgebirge aus. Mit Ronny hatte sie noch ein Hühnchen zu rupfen. Der bullige, gedrungene Typ, der etwas Wikingerhaftes an sich hatte, war eigentlich ein liebenswerter Einzelgänger ohne großen theoretischen Hintergrund. Ein Totalverweigerer. Im französischen Deauville nullelf waren sie das erste Mal aufeinandergetroffen, dann auf jedem Gipfel. Am Freitag waren sie fast gleichzeitig im Camp angekommen und hatten ihre Zelte aufgebaut. Am Samstag hatte sie vor der Mittagsdemo kurz mit ihm gesprochen, seitdem hatte sie ihn nicht mehr gesehen. Vielleicht war er im Ort nicht durch die Kontrollen gekommen und saß irgendwo fest.
Nina2 | Globoblog Mo, 8. Juni 15:45
Es wimmelt hier von Anarchisten. Habe vorhin einen blöden Slogan gehört: Machtlosigkeit an die Macht. <grübel, kopfschüttel> Demzufolge steht die Queen von England dem Anarchismus gar nicht so fern. Niemand bestimmt über sie, und sie hat eigentlich auch keinen Einfluss auf irgendjemanden oder irgendetwas …
Hinter einem der Zelte, unbeachtet von den übrigen Campbewohnern, luden zwei unauffällige Typen mit schwarzen Wollkappen mattglitzernde Pflastersteine aus einem verbeulten Kleintransporter, um sie in ihre Rucksäcke zu füllen. Die schwarzglänzenden, unregelmäßig geformten Würfel klickten hart gegeneinander. Einer schob die Mütze etwas hoch, um sich den Schweiß abzuwischen.
»Das müsste fürs Erste genügen«, zischte er. Ein fettes Grinsen erschien auf seinem Gesicht.
»Beeil dich«, trieb ihn der andere an. »Die Demo beginnt in einer Stunde.«
4Das Grab
Ferner will ich, dass keiner an meinem Grab mehr als drei Minuten redet. Und vor allem keinen Schmarrn. Das ist überhaupt mein größter Wunsch: kein Schmarrn am Grab.
Auf ein dezentes Handzeichen von Kaplan Müller-Zygmunt eilten die beiden Ministranten herbei und schwenkten ihre versilberten Weihrauchfässchen. In kleinen, locker zusammenhängenden Schwaden schien sich die Seele Hansis zum Himmel zu erheben, willenlos gab sie den leichten, spielerischen Windstößen nach und löste sich schließlich in nichts und niemand auf. Der Kaplan war in ein stummes Gebet versunken, er bewegte nicht einmal die Lippen. Er hatte sich entschieden, die drei Minuten für eine Art Schweigezeremoniell zu nutzen. Das passte gut. Schweigen war schon immer eine mächtige Waffe in der Hand der katholischen Kirche gewesen.
»Was sagt er?«, rief die Weibrechtsberger Gundi in die Stille hinein.
»Eben nix!«, gab die Hofer Uschi ebenso lautstark zurück. Die Kanonenschläge hatten die Ohren der beiden Ratschkathln fast vollständig ertauben lassen.
»Wie bitte? Das ist ja ein sauberer Pfarrer, der nix sagt! Für was zahlen wir eigentlich Kirchensteuer?«
Alle lächelten über die kleine Ruhestörung. Aber im Prinzip waren sie dem Kaplan dankbar. Nach der wuchtigen Kanonendonnerei war die bewusst zelebrierte Stille eine Erholung. Hut ab vor der Bas’. Das Einzige, was man jetzt hören konnte, war das Klimpern der Weihrauchfässchenketten. Die Ministranten strahlten. Sie warfen sich verstohlene Blicke zu. Das war zwar etwas unpassend für eine Beerdigung, aber sie freuten sich halt tierisch auf die versprochenen Extrazwanziger.
Die drei Oberreiter-Kinder wurden von ihrer Mutter nach vorne geführt, dann nacheinander auf den leeren Friedhofswagen gehoben. Die Hälse der Trauergäste reckten sich. Auf ein Zeichen der Mutter krähten die Mädchen mit ihren messerscharfen Kinderstimmen los, das Ergebnis war niederschmetternd schön.
♫ Staad, staad, dass di net draht.
Hats uns erst gestern draht, drahts uns heit aa …
In Dirk regte sich ein Gefühl der Eifersucht. Als Profimusiker übst du dir einen Wolf und feilst stundenlang und tagelang am richtigen Ton, und dann kommen drei Kindergartenknirpse und stehlen dir die Schau mit links. Alte Künstlerweisheit: Neben Kindern und Tieren kannst du nur verlieren. Vor allem gegen Kinder hast du keine Chance. Dirk wandte sich kopfschüttelnd ab. Die Oberreiter-Dirndln stellten sich in Position. Sie verstanden zwar den Ernst einer Beerdigung nicht, sangen aber dafür mit Inbrunst, immer und immer wieder dieselbe Strophe:
♫ Staad, staad, dass di net draht.
Hats uns erst gestern draht, drahts uns heit aa …
Zwanzig Meter vom Grab entfernt, in der letzten Reihe, stand Kriminalhauptkommissar Hubertus Jennerwein. Seine Gedanken waren ganz beim Verstorbenen. Erinnerungen an längst vergangene Tage mit ihm tauchten auf. Doch als ihn der Gesang der drei Minisirenen erreicht hatte, brachte ihn das scharfe, zirpende Quietschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Er massierte die Schläfen mit Daumen und Mittelfinger. Ansonsten eine unauffällige Erscheinung, war diese Geste das einzig Extravagante an ihm. Schließlich verstummte der Gesang. Jennerwein hatte den Ropfmartl Hansi gut gekannt. Er war ein angenehmer Mensch gewesen, etwas eigensinnig, manchmal sicherlich auch ein wenig schwer von Begriff – Jennerwein verbot sich diesen Gedanken. Über die Toten nichts außer Gutes. Ein fleißiger Mensch war der Hansi gewesen, beruflich durchaus erfolgreich, mit großen Plänen für die Zukunft. Aber er hatte auch überraschende Seiten gezeigt. Jennerwein fiel ein, wie er ihn einmal mit einem Päckchen Marihuana erwischt hatte, das für mehrere Abiturfahrten gereicht hätte. Eigentlich wäre Jennerwein als Polizeibeamter verpflichtet gewesen, die Sache weiterzuverfolgen. Aber beim Hansi? Er hatte lange im Zwiespalt mit sich gelegen. Doch schließlich hatte sich doch alles aufgeklärt und zum Guten gewendet. Der Hansi konnte mit einem gestempelten amtlichen Schreiben von der Bundesopiumstelle aufwarten, darin hieß es, dass er den Stoff ganz legal besitzen und konsumieren durfte. Aus medizinischen Gründen, es gab ein ärztliches Attest. Doch was in diesem ärztlichen Attest gestanden hatte, war eigentlich noch viel schlimmer als die paar Deka Gras, die Jennerwein bei ihm gefunden hatte.
Jennerwein wandte den Kopf zu Maria Schmalfuß, die wenige Schritte von ihm entfernt stand und sich gerade verstohlen eine Träne abtupfte. Ihre Blicke trafen sich, beide schämten sich ihrer Bewegtheit jedoch nicht, sondern lächelten sich zu. Auch die Polizeipsychologin hatte den Verstorbenen gut gekannt. Sie fand es beschämend, dass nur solch eine spärliche Abordnung von Polizisten zu seiner Beerdigung gekommen war. Auch daran war der verfluchte Gipfel schuld. Alle verfügbaren Polizeibeamten aus der näheren Umgebung waren, ob sie wollten oder nicht, für alles Mögliche eingeteilt worden: Durchführung von Festnahmen, Personalkontrollen, Beobachtung des Zeltlagers der Demonstranten und vieles andere mehr. Maria sollte Eskalationsstufen prognostizieren, Gewaltprävention leisten, psychologische Beratung anbieten. Viel war bisher allerdings nicht zu beobachten, zu leisten und anzubieten gewesen. Die Fronten waren klar und starr. Oben auf dem Berg tagten die guten, staatstragenden Elefantenmenschen, unten im Demonstrantenlager debattierten die edlen Revolutionswütigen. Auf einen Gipfelgegner kamen fünf Polizisten, auf einen Politiker fünfzehnhundert Sicherheitsleute. Maria sah sich um und ließ den Blick über die Trauergemeinde schweifen. Dann hielt sie inne. Irgendetwas stimmte hier nicht.
Nach Beendigung ihrer Gesangseinlage vollführten die drei Oberreiter-Schwestern einen guteinstudierten Knicks. Die Sonne huschte kurz hinter einen Wolkenschleier, die blassen Reststrahlen tauchten den Friedhof in ein unwirkliches, schauderhaft jenseitiges Licht. Sofort waren alle Gedanken wieder beim Ropfmartl Hansi. Viel zu früh bist du gegangen stand auf einer Kranzschleife. Die kleine, schmächtige Frau mit den hochgezogenen Schultern stierte auf die Schrift. Dann lachte sie bitter auf. Von wegen, murmelte sie halblaut. Ihre schwarzen Gedanken konnte sie einfach nicht loswerden. Sie stand etwas abseits, zwischen ihr und dem Rest der Verwandtschaft tat sich eine Kluft auf, nicht nur im übertragenen Sinn.
»Wer ist denn das?«, fragte die Weibrechtsberger Gundi und deutete mit dem Kopf in Richtung der einsamen Frau.
»Das ist die Sabine«, antwortete die Hofer Uschi.
»Die Sabine?« Die Weibrechtsberger Gundi sprach den Namen aus, als wäre es ein glitschiger, toter Fisch. »Die hätte ich jetzt gar nicht erkannt, so ganz in Schwarz. Von der hört man ja so einiges!«
»Was will man machen«, erwiderte die Hofer Uschi. »Sie ist – oder vielmehr sie war nun mal die Frau vom Hansi.«
Ein paar Meter von der Witwe entfernt standen ihre zwei Buben. Beide hielten die Hände locker nach unten gefaltet, etwa in Höhe des Gürtels. Sie schienen den Blick andächtig auf die Daumenspitzen gesenkt zu haben. Manchmal bewegten sie den Kopf, als ob sie ihre Finger noch genauer betrachten wollten als sie das ohnehin schon taten. Sie bewegten die Lippen leicht, es schien, als würden sie ein leises Gebet sprechen. Dann fiel der Blick der Witwe auf die schlampig gefalteten Hände. Zornesröte erschien auf ihrem blassen Gesicht, mit schnellen Schritten war sie bei den Buben.
»Ihr spielt doch nicht etwa ein Videospiel?«, zischte sie. »Hier am Grab! Das darf doch nicht wahr sein.«
Die Jungen blickten sie erschrocken an. Der Größere und Ältere der beiden schüttelte trotzig den Kopf, der Jüngere gab ein verächtliches Geräusch von sich, schaute jedoch gleich drauf verängstigt drein. Die Mutter öffnete einem der Halbwüchsigen die Hand. Und jetzt konnten es alle sehen. Sie entwand dem Kleineren ein Smartphone.
»Hier auf dem Friedhof! Dass ihr euch nicht schämt!«
»Wir haben kein Videospiel gespielt«, maulte der Jüngere.
»Das ist doch ganz gleich, was ihr gespielt habt.«
»Wir haben gar nicht gespielt.«
Der Ältere schaltete sich ein.
»Wir machen Fotos vom Grab, nichts weiter.«
»Und die Reden wollen wir auch aufnehmen.«
Der Ältere hob sein Smartphone, so dass die Umstehenden auf das Display sehen konnten. Manche der Trauergäste lugten hin, sie konnten erkennen, dass der Junge gerade das Blumen- und Kranzgepränge fotografiert hatte.
»So ein Unsinn«, fauchte die Witwe wütend. »Bilder vom Grab! Reden aufnehmen!«
»Zur Erinnerung«, sagte der Jüngere leise.
»Wer ist denn das da hinten mit dem Fernglas?«, flüsterte die Hofer Uschi der Weibrechtsberger Gundi zu.
»Wer? Wen meinst du?«
»Na, der in dem dunkelgrünen Anorak.«
»Ach, jetzt seh ich ihn auch. Ich muss schon sagen: ein recht unpassender Aufzug für eine Beerdigung.«
»Kennen wir den?«
»Nein, nicht dass ich wüsste. Erst hab ich gedacht, dass es der Seyfried Günther ist, weißt schon, der Oberförster. Weil er gar so jägerisch angezogen ist.«
»Ist das überhaupt ein Mannsbild?«
»Sicher bin ich mir nicht. Es könnte auch eine Frau sein.«
»Aber wo schaut denn der hin mit dem Fernglas? Am Ende zu uns her!«
»Ich kanns nicht genau erkennen. Ich glaub, der schaut eher zum Grab hin.«
»Ein recht ein kurzsichtiger Trauergast.«
»Jedenfalls hab ich ihn noch nie gesehen«, flüsterte die Weibrechtsberger Gundi und drehte sich wieder um. »Das ist bestimmt kein Einheimischer.«
»Vielleicht ist er auf der falschen Beerdigung.«
»Oder auf dem falschen Friedhof.«
Die beiden Ratschkathln kicherten hinter vorgehaltener Hand.
5Der Schreck
Mit der Durchführung der Begräbnisfeierlichkeiten beauftrage ich meine Cousine, die Bas’, die schon so manche Leich hervorragend und stimmungsvoll organisiert hat. Traditionell bekommt sie als Ausrichterin der Leich keine Münz, ein herzliches Vergelts Gott muss also genügen.
Über zwanzig Redner waren angemeldet. Die Kürzung auf drei Minuten hatte sich herumgesprochen, jeder der Trauergäste war gespannt auf die auf den Punkt gebrachten Nachrufe. Ein kleiner, beleibter Mann löste sich aus der Menge. Er trat ans Mikrophon und versuchte, den Galgen zu verstellen. Er drehte an einer Schraube. Sein Gesichtsausdruck war bekümmert, seine Bewegungen fahrig. Hinten hing ihm ein weißer, schmutziger Hemdzipfel aus der Hose. Die Trauergäste warfen sich fragende Blicke zu. In einiger Entfernung, auf einer kleinen Anhöhe, stand das ehemalige Bestattungsunternehmerehepaar Ursel und Ignaz Grasegger und versuchte, durch die dazwischenstehenden Trauerweiden herauszufinden, was am Grab vor sich ging. Ursel stieß Ignaz an.
»Wer ist denn das jetzt? Ich habe meine Brille nicht dabei.«
»Keine Ahnung.«
Ignaz kannte wirklich jeden hier auf dem Friedhof, sei es über, sei es unter der Erde, aber diesen Mann hatte er noch nie gesehen. Momentan schien er jedenfalls große Schwierigkeiten mit dem Mikrophongalgen zu haben, der ihm immer wieder nach unten kippte.
»Komm, gehen wir näher hin.«
Die beiden Graseggers nahmen nicht aus beruflichen Gründen an dieser Beerdigung teil. Ihre Bewährungszeit war immer noch nicht abgelaufen, und eine der richterlichen Auflagen untersagte es ihnen, den Beruf des Bestatters auszuüben. Keine Verfügung hatte ihnen jedoch verboten, einem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Darüber hinaus interessierte es die beiden brennend, wie ihr Nachfolger, der Bestattungsunternehmer Gustav Ludolfi, der erst seit einem Monat im Geschäft war, das Begräbnis realisierte. Sie hatten seit ihrer Zwangspensionierung schon viele kommen und gehen sehen. Eines war sicher: Auch er arbeitete nicht zur Zufriedenheit des Ehepaars. Sie hatten an allen Ecken und Enden etwas auszusetzen. Die Bas’ hatte sicherlich ihr Möglichstes getan, aber dieser Ludolfi war ein Pfuscher. Ursel blieb stehen, kniff die Augen zusammen und fixierte den Mann am Mikrophon genauer. Er hatte den schwenkbaren Arm des Mikroständers endlich fixiert. Jetzt klopfte er ans Mikro, worauf ein schriller, beißender Pfeifton über den Friedhof fetzte. Die Hälfte der Friedhofsbesucher hielt sich die Ohren zu.
»Ts! Ts! Sprechprobe. Eins, zwei!«
Wieder eine Rückkopplung, noch stärker als die erste. Die erhaben-nachdenkliche Stimmung, sorgsam aufgebaut durch Böllerschüsse, Weihrauch und Kindergesang, war dahin. Sie war sozusagen beim Teufel.
»Jetzt fang einmal mit deiner Rede an!«, schrie eine Frau von ganz hinten. »Das ist ja nicht zum Aushalten!«
»Das ist gar kein Redner«, sagte Ignaz. »Das ist der Ludolfi selbst. Nicht einmal das Mikro kann er anständig einrichten.«
Bestattungsfachwirt Gustav Ludolfi kratzte sich fahrig am Kopf. Dann nickte er der Bas’ entschuldigend zu und wandte sich zum Gehen. Dabei trat er auf das lose hängende Kabel, worauf das Mikrophon schmatzend aus der Halterung sprang und auf den schmutzigen, vom Blumenwasser feuchten Erdboden fiel. Es rutschte über die Grabkante und kullerte, das Kabel hinter sich herziehend, ins offene Erdloch. Mit einem weithin vernehmbaren KA-WUMM! knallte das bis zum Anschlag aufgedrehte Mikro auf den Sargdeckel, blieb schließlich darauf liegen. Alle hielten den Atem an. Manche schlugen die Hände entsetzt vor den offenen Mund, die in den vordersten Reihen beugten sich vor, um einen ängstlichen Blick in die Grube zu werfen.
»Das ist kein gutes Zeichen!«, raunte die Hofer Uschi der Weibrechtsberger Gundi zu.
»Der Tote hat seine Ruhe scheinbar noch nicht gefunden«, flüsterte diese mit zitternder Stimme zurück.
»Wer weiß? Vielleicht will uns der Hansi noch etwas sagen?«
Gustav Ludolfi sah sich hilflos und schulterzuckend um. Dann packte er das Kabel mit beiden Händen, um das Mikro wieder aus dem Grab zu ziehen. Zunächst gelang das auch, wobei sich die Schleifgeräusche schauderhaft anhörten. Wenn Tote reden könnten, würde es genau so klingen. Dann musste die erschrockene Trauergemeinde mit ansehen, wie sich das Kabel plötzlich spannte. Der dicke Mann riss daran. Diejenigen, die etwas näher dran oder höher standen, bemerkten es: Das Mikro hatte sich in einer Halterung des Sargdeckels verfangen und drohte ihn zu lösen. Überall mischten sich leise, entsetzte Schreie in das GROAAR des am Holz kratzenden Mikros.
Unwillkürlich trat die Bas’ einen Schritt näher zum Grab. Dort war es nass und matschig. Die Bas’ schloss die Augen. Waren alle Mühen umsonst gewesen? Sollte sie hinunterspringen, das verklemmte Mikro lösen und schnell wieder hochklettern? Unmöglich. Ausgeschlossen. Das wäre skandalös. Das durfte nicht geschehen. Nicht das! Ein plötzliches Schwindelgefühl erfasste sie. Doch dann die Erleichterung: Das Kabel hatte sich gelöst und wurde nach oben gezogen. Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn. Das war gerade noch einmal gutgegangen.
Nachdem das aufgeregte Gemurmel der Menge verstummt war und sich alle wieder beruhigt hatten, trat der erste wirkliche Redner ans Mikrophon. Es war der Vorsitzende des Skiclubs, er hielt sich auch strikt an die drei Minuten. Er schilderte den Verstorbenen als fairen Sportsmann (0:50), geselligen Vereinskameraden (1:45) und schließlich als guten Verlierer (2:55). Auch den nächsten Rednern gelang die zeitliche Beschränkung. Ein vorbildlicher Bürger, wohltätiger Geist, ruheloser Kämpfer für die gerechte Sache. Ein treusorgender Sohn, umsichtiger Gerätewart, pflichtbewusster Kamerad.
»Hätten wir nicht auch was sagen sollen?«, fragte Maria Schmalfuß, die inzwischen zu Jennerwein getreten war. Der Kommissar schüttelte den Kopf.
»Ich bin kein großer Redner. Und ich hätte viel zu viel zu sagen.«
Maria nickte.
»Nein, wir machen es anders«, fuhr Jennerwein fort. »Wir setzen eine Anzeige in die Zeitung. Ganzseitig. Das wird ihm eher gerecht.«
»Ich hätte es trotzdem schön gefunden, wenn Sie geredet hätten, Hubertus.«
Der Verstorbene wurde noch immer in den höchsten Tönen gepriesen. Von den Schlaraffen, von der Freiwilligen Feuerwehr, vom Tennisclub –
»Das hab ich gar nicht gewusst, dass der Hansi Tennis gespielt hat«, raunte die Weibrechtsberger Gundi der Hofer Uschi zu.
»Ich schätze, es gibt da noch viel mehr Dinge, von denen wir nicht die geringste Ahnung haben.«
Die Bas’ atmete auf. Alles verlief wieder nach Plan. In der Roten Katz wartete schon ein Riesenkessel voller Weißwürste, dem traditionellen Essen bei einem Leichenschmaus. Auf den Wastl, den Wirt der Roten Katz, war Verlass. Auch er war ein entfernter Ropfmartl, und bei ihm würde es keine geplatzten Weißwürste geben. Es war jetzt eh schon genug schiefgegangen. Ein Mikro, das ins Grab fiel! Noch so ein Fehler durfte nicht passieren. Die Bas’ richtete ihren Blick auf die Kränze. Stand da auf einer Schleife etwa Sauhund?
6Der Kranz
Auf meinem Grabstein soll etwas Beziehungsreiches stehen, etwas, was mit dem Schusterhandwerk zu tun hat. Wie wäre es zum Beispiel mit: Der letzte Schuh hat keine Sohle.
»Grüß Gott, ich brauche noch einen Kranz für den Hansi.«
»Der Hansi! So früh, gell.«
»Und eine Schleife dazu, mit einer schönen Aufschrift.«
»Was darf es denn für eine Aufschrift sein?«
»Ja, ich weiß nicht – Was für Sprüche haben denn die anderen schon genommen?«
»Moment, ich seh mal nach. Aber die Liebe bleibt … ist weg. Alles hat seine Zeit … auch weg. As time goes by …
»Wer schreibt denn As time goes by auf den Kranz?«
»Der Krepflinger Alois. Er wollte zuerst Wo du jetzt bist, gibt es keinen Schmerz, aber das hat der Nussdorf Blasi schon gehabt, dann wollte er es nicht mehr. Die zwei sind schwer über Kreuz, wissen Sie. Seit Jahren schon …«
»Und nur Danke?«
»Nur Danke, das haben schon, warten Sie, fünf Leute genommen. Danke ohne alles, das geht immer als Erstes weg. Weil es auch am billigsten ist. Wir haben einmal eine Beerdigung gehabt, da war das Grab voll mit Danke-Schleifen.«
»Wahrscheinlich lauter Geizhälse.«
»Lauter enge Verwandte, ja. Ah, da habe ich was für Sie: Deine Spur wird ewig bleiben.«
»Deine Spur wird ewig bleiben? Ich weiß nicht so recht.«
»Das ist doch schön!«
»Nein, wenn ich mir das so vorstelle, mit der Spur. Dass da ewig eine Spur bleibt vom Hansi. Komisches Bild.«
»Das finde ich persönlich am besten: Ein Stern trägt jetzt deinen Namen.«
»Ein Stern trägt jetzt deinen Namen, da stellt sich doch jeder vor, dass es bald einen Stern gibt, der Ropfmartl heißt.«
»Ja, komische Sachen passieren schon manchmal. Einmal haben wir einen Lehrling gehabt, der hat gleich an seinem ersten Ausbildungstag eine Kranzschleifenaufschrift machen müssen. Und wissen Sie, was dann am Grab für ein Kranz gelegen hat?«
»Keine Ahnung.«
»Ein wunderbarer Lorbeerkranz, und auf der Schleife: Name, wir vergessen dich nicht! Verstehen Sie, der Lehrling hat den Namen nicht eingesetzt.«
»Ich versteh schon.«
»Oder soll es was Nachdenkliches sein: Du bist nicht gestorben, nur vorausgegangen – Wir kommen bald nach – Das Gröbste hast du hinter dir – Warum du? – Vor allem Warum du? wird gerne genommen.«
»Das ist mir ein bisschen zu kurz.«
»Wir haben natürlich auch ausführlichere Sachen. Literatur. Da, was von Rilke:
Dass wir erschraken, da du starbst, nein, dass
dein starker Tod uns dunkel unterbrach,
das Bisdahin abreißend vom Seither: –«
»Entschuldigens, mir eilt es ein bisschen.«
»– das geht uns an; das einzuordnen wird
die Arbeit sein, die wir mit allem tun.
Schön, gell?«
»Das versteht doch kein Mensch.«
»Das nicht, aber angeben kann man damit. Eine extrabreite Schleife, und dann nicht einfach Danke, sondern Rilke. Ist natürlich nicht ganz billig, aber das sieht dann auch jeder, dass es nicht ganz billig war –«
»Wissen Sie was, machen Sie mir eine Schleife mit Pfiadi Hansi.«
»Pfiadi Hansi. Wie Sie wollen.«
»Pfiadi Hansi, genau. Wie lange brauchen Sie denn dafür?«
»Bis übermorgen.«
»Aber die Beerdigung ist doch jetzt.«
»Das ist blöd. Warten Sie. Vor ein paar Monaten ist der Haslmeier gstorben, der Haslmeier Hansi