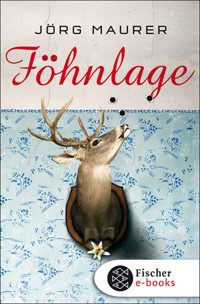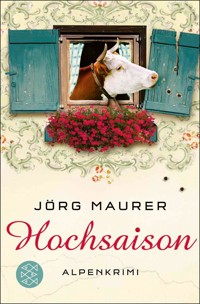
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Jennerwein ermittelt
- Sprache: Deutsch
Sterben, wo andere Urlaub machen Nach dem Bestseller ›Föhnlage‹ der zweite Alpenkrimi mit Kommissar Jennerwein. Beim Neujahrsspringen in einem alpenländischen Kurort stürzt ein Skispringer schwer – und das, wo Olympia-Funktionäre zur Vergabe zukünftiger Winterspiele zuschauen. Wurde der Springer etwa beschossen? Kommissar Jennerwein ermittelt bei Schützenvereinen und Olympia-Konkurrenten. Als ausgerechnet in einem Gipfelbuch per Bekennerbrief weitere Anschläge angedroht werden, kocht die Empörung im Ort hoch: Jennerwein muss den Täter fassen, sonst ist die Hochsaison in Gefahr…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Jörg Maurer
Hochsaison
Alpenkrimi
Roman
Fischer e-books
1
Sai|son [zɛˈzɔ̃, zɛˈzɔŋ] <französ.> »(günstige, geeignete) Jahreszeit«; Zeitabschnitt des Jahres, in dem bestimmte Vorhaben intensiver als sonst betrieben werden; vermutlich aus dem <latein.> satio = »Aussaat«, »Saatzeit«; nach G. Ruckdäschel aus dem <altgriech.> seēson, σέησov = »ernten, pflücken, ausnehmen, ausbeuten«; vergleiche auch <altfranz.> seyonn(e) = »Erntezeit« (aber auch, fig.: »jmd. das Geld aus der Tasche ziehen«); nach K. Hannemann und U. Lassedanz ein Lehnwort aus dem <altisländ.> (oiffe) seddan (hangör) = »Fremde kommen ins Dorf«; siehe auch K. Gröth: <chines.> (auch weibl. Vorname) Sesoan = etwa: »Reichtum zur rechten Zeit«; ungesichert dagegen F. Mackonsen, <sanskrit> dse-sunna = etwa: »(An)Schwellen des (Geld)Beutels« (Siehe auch Hoch|sai|son)
Lieber Herr Kommissar,
zunächst wünsche ich Ihnen einmal ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr! Sie werden überrascht sein, jetzt schon von mir zu hören und ein Bekennerschreiben zu bekommen, das diesen Namen eigentlich nicht verdient, weil es ja noch nichts zu bekennen gibt. Ja, Sie haben richtig gelesen: Die Tat ist noch gar nicht begangen, ich bereite das Delikt gerade vor. Das heißt: Ich überlege mir, gegen welches Gesetz ich denn nun verstoßen soll. Soll es eine »Straftat gegen die körperliche Unversehrtheit« werden? Eine »Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung«? Etwas Terroristisches? Reizen würde mich einiges, und ich habe auch schon eine Idee – aber lassen Sie sich überraschen, Herr Kommissar! Oh, Entschuldigung: Ich kenne Sie – Sie kennen mich hingegen nicht, ich darf mich deshalb vielleicht kurz vorstellen. Ich bin sechsunddreißig Jahre alt, männlich, schlank, mittelgroß, dunkelblond, Oberlippenbart, Sternzeichen Waage, meine Hobbys sind Reiten und Schach – das braucht natürlich alles nicht zu stimmen. Aber vielleicht doch.
Ich habe meine Hausaufgaben gemacht: Ich habe ein Päckchen Schreibmaschinenpapier gekauft, in einer anderen Stadt, schon vor längerer Zeit, ich habe nur ein Blatt daraus verwendet. Ich habe auf einem Flohmarkt eine alte Schreibmaschine erstanden, vielleicht im Ausland, vielleicht auch nicht. Ich habe beim Schreiben Handschuhe getragen, sogar Mundschutz und ein Haarnetz. Ich habe die vielen Entwürfe, die ich geschrieben habe, verbrannt. Viele Entwürfe deshalb, weil ich lange, wirklich sehr lange an meinem Schreibstil gefeilt habe. Der linguistische Profiler, der meine Sprache später untersucht, soll sich ruhig die Zähne daran ausbeißen. Er wird seinen Spaß haben. Ich war selbst lange genug bei der Polizei – auch dies muss wieder nicht stimmen. Aber das ist ja das Schöne an einem Bekennerbrief – es kann alles stimmen, muss aber nicht. Für heute ist es genug, Herr Kommissar, ich habe ja schließlich auch noch einen bürgerlichen Beruf. Sie hören sicherlich bald von mir, dann bin ich bestimmt auch schon ein Stück weiter.
Mit vielen Grüßen – Ihr (zukünftiger) Täter
2
Der Kameramann auf der Großen Olympiaschanze wusste gar nicht, wo er zuerst hinschwenken sollte, so babyaugenblau war der Himmel an diesem Neujahrstag, so dröhnend spannte er sich über das Werdenfelser Tal – so anzüglich glitzernd und dampfend buhlte jeder Einzelne der schneebedeckten Berge um die Aufmerksamkeit der sechsundzwanzigtausend Sportbegeisterten, die zum Neujahrsspringen gekommen waren. Unten im Loisachtal pflügte sich der namensgebende Fluss quer durch den Kurort – gerade eben noch war die Loisach als quicklebendiges Wildwasser über die nahe österreichische Grenze gepoltert, jetzt floss sie träge durch die leere Gemeinde – denn alle waren zur Schanze gepilgert: Adler gucken, Flugkurven bewundern, Deutschlanddaumen drücken. Eine Bombe hätte man werfen können im Ortskern, man hätte kaum jemanden getroffen.
Der Kameramann drehte sich nun um und schwenkte über den Hintergrund der Schanze, den dicht bewaldeten Gudiberg, an dessen Hang die beiden Sprungschanzen standen wie zwei vergessene Stöckelschuhe, aus denen gerade eine Riesin mit zwei unterschiedlich großen Füßen geschlüpft war. Gemessen am Alpenstandard war der Gudiberg natürlich nur ein Hügelchen, ein Dackelspaziergang – der gegenüberliegende Berg wiederum, auf den die Springer zuschossen, war schon eine Nummer felsiger: Die Kramerspitze schraubte sich da aus dem Schneemantel – ein frei stehender, knapper Zweitausender, quasi der Kilimandscharo des Werdenfelser Landes. Das Gipfelkreuz blinkte heute besonders frech von dort droben herunter, das ganze urtümliche Monstrum sah, mit ein bisschen Phantasie, wie ein schlafendes Nashorn aus, das zu wecken nicht ratsam war.
Die Wintersonne funkelte, kein Lüftchen regte sich hier oben auf dem Schanzenkopf. Das Wetterhoch Charlotte hatte den Himmel sorgfältig leergepustet, und der Föhn tat vielleicht noch ein Übriges, um die hingestreuten felsigen Schmuckstücke zum Greifen nah erscheinen zu lassen. Lange hielt der Kameramann auf die auffälligste Preziose in der Wettersteinkette, auf das markante Dreieck der Alpspitze, das etwas von einer Haifischrückenflosse hatte – das unvermeidliche Logo der ganzen Region. Das stramme Dreieck stellte für den wahren Bergfex wiederum nur einen Dackelspaziergang dar, klar. Aber vom Design her: Erste Sahne. Schließlich schwenkte der Kameramann noch hinüber zum Kleinen Waxenstein, dem unzugänglichen Kegelstumpf, der eigenbrötlerisch und trotzig nach vorn aus der Kulisse ragte. Abweisend war er wie ein nepalesischer Achttausender: Nur gucken, nicht raufsteigen! Trotzdem versuchten es jedes Jahr einige aufs Neue – und wurden zurückgeworfen ins herrliche Loisachtal.
Der Skispringer der dänischen Nationalmannschaft, der jetzt mit der Seilbahn die Große Olympiaschanze hinauffuhr, hatte momentan keinen Blick für all die Drei-Sterne-Sehenswürdigkeiten rundherum. Als er ausgestiegen war, schnaufte er ein paar Mal kräftig durch, als ob hier oben die Luft schon wesentlich dünner geworden wäre.
Der Stadionsprecher kündigte das Finalspringen an, und der Jubel der verkaterten Menge unten war gewaltig. Gerade vorhin noch hatte man Sekt gebechert, Blei gegossen, nach verlorenen Rindsfiletstückchen im Fonduetopf gefischt, gute Vorsätze gefasst, jetzt stand man drinnen in den Arealen A bis F und fror an allen frostschutzbedürftigen Körperteilen. Åge Sørensen war heute der einzige dänische Springer. In der Qualifikation hatte er sich einen der Lucky-Loser-Plätze erkämpft, und war, äußerst glücklich, gerade noch so hineingerutscht in das ehrenwerte Feld, in dem sich normalerweise nur die heiligen vier oder fünf Skisprungnationen tummelten – die erschreckend gut vorbereiteten Norweger beispielsweise, oder die unverschämt motivierten Finnen. Sørensen machte sich keinerlei Hoffnungen, ganz nach vorne auf einen Podestplatz zu kommen, er wusste, dass die Qualifikation für das Finale das Beste war, was er je erreichen würde – aber vielleicht gerade deshalb stieg er so gut gelaunt auf die Waage. Auf dem Rücken des Psycho-Wisch-Funktionärs hatte er mit seiner krakeligen Unterschrift gerade bestätigt, dass er sich freiwillig, bei klarem Verstand und ohne Zutun Dritter den Turm hinunterstürzen wollte. Er war nicht dem Erfolgsdruck der hochnervösen Hoffnungsträger ausgesetzt, die nach ihm springen würden. Åge hatte es bis hierher geschafft, und bei dem Gedanken daran kam ihm unter seiner Schutzbrille ein dickes dänisches Grinsen aus. Als die Kamera auf ihn hielt, zeigte er gar das Victory-Zeichen, beugte sich vor und grüßte seine Mutter im nordjütländischen Skagen.
Die ehrenamtlichen Helfer vor Ort hatten sich mächtig ins Zeug gelegt. Auf einem der Tischchen im Funktionsraum warteten isotonische Erfrischungsgetränke in allen Größen und Farben, dazwischen gab es regionale Schnittchen, dunkles Brot mit handgeschleuderter Bauernbutter und voralpenländischem Käse, liebevoll geschmiert von der Schwester der Frau des Neffen des Vorsitzenden des örtlichen Skiclubs. Wie furchtbar leicht wäre es, dachte Åge, auf eines dieser Butterbrote einen kleinen Muntermacher zu geben, eine Prise Epo etwa, eine Pipette voll Testosteron, oder ein Bröselchen AN1, um auf diese Weise die nachfolgenden Konkurrenten mal kurz in die Schlagzeilen zu bringen. Aber so etwas war vermutlich noch nie gemacht worden, zumindest beim Skispringen nicht. Bringt in dieser Disziplin ja auch gar nichts, wie die Verantwortlichen immer wieder beteuerten.
We are red, we are white, we are Danish dynamite!, glaubte Åge Sørensen von unten zu hören. War denn halb Dänemark da? Er stieg in den Schrägaufzug und fuhr die restlichen sechzig Meter hoch zum Schanzenkopf. Als er dort ins Freie trat, kam er sofort ins Visier der internationalen Kameras. Eine ferngesteuerte Linse schwenkte besonders dreist zu ihm herüber, und jetzt wurde er fast ein wenig übermütig: Er rieb sich den Bauch und formte mit den Lippen die Worte Rødgrød med fløde! in die Kamera. Das war seine Leib- und Magenspeise. Damit Mutter in Skagen schon mal Bescheid wusste.
Wenn er es schaffte, hier nur einigermaßen ordentlich herunterzukommen, dann gäbe ihm vielleicht sogar Königin Margrethe persönlich die Hand. Der letzte Däne, der im Skispringen etwas gerissen hatte, war Olaf Rye im Jahre 1808, und das war dann doch schon gut zweihundert Jahre her. Nicht dass ihm das mit der dänischen Königin persönlich etwas gegeben hätte, aber Mutter würde sich sicher darüber freuen. Er bekam nun das Zeichen, an den Start zu gehen. Am Absprungbalken klebte – ganz lieb! – ein Telegramm vom Skiclub Skagen: »viel glueck stop du packst sie alle stop«. Er rutschte in die Mitte des Balkens, dann stieß er sich ab. Rasch nahm er Fahrt auf und glitt im Winkel von 35 Grad nach unten. Steigender Puls, erhöhter Blutdruck, Adrenalin- und andere Ausschüttungen, Blutzuckererhöhung, das Übliche, um in die richtige Stimmung zu kommen. Es ging das Gerücht um, dass der Finne Leif Rautavaara einen iPod im Ohr stecken hatte, wenn er ins Tal rauschte. Ein paar Nationen hatten schon protestiert, es war ja schließlich auch eine Art Doping. In der Presse wurde daraufhin spekuliert, was sich Rautavaara in den paar Sekunden anhörte. Beethovens Fünfte (tatata-TAAA!!) würde von der Länge her passen, Rimski-Korsakows Hummelflug (brzldidlbrzldidlbrzl …) bildete die verbissene Energie des Springers am besten ab, und die Alpensinfonie von Richard Strauss (WROMM!!!BLOMM!!!FLOMM!!!) passte wie von selbst ins lieblich-wuchtige Voralpenland. Manche allerdings vermuteten, dass Rautavaara mit einem beziehungsreichen Song von Paul Simon (Slip slidin’ away …) nach unten ins Tal schoss.
Åge Sørensen schüttelte die ablenkenden Gedankenspiele ab. Er konzentrierte sich. Er bündelte alles auf den Absprung dort unten. Konzentration aufs Wesentliche, Tunneldenken. Gleich musste der tausendmal geübte Ablauf abgerufen werden, der auf die kleine Zehntelsekunde am Schanzentisch zuführte, die alles beim Skisprung ausmacht. Åges Blick verengte sich. Ganz von fern hörte er noch seinen Namen, dann das übliche anschwellende Ah und Oh der Menge. Sechsundzwanzigtausend Zuschauer reckten die Köpfe nach oben. Und auch die nordische Asengöttin Skaði (Kompetenzen: Jagd, Berge, Winter) saß auf seinen Schultern und breitete schon mal behutsam ihre Schwingen aus, um ihn auf seinem Weg in die Tiefe zu beflügeln.
Sein Absprung war hervorragend, wie aus dem Lehrbuch, und hoch erhob sich der dänische Ikarus ins Blaue. Seine Haltung war natürlich nicht zu vergleichen mit den ausgefeilten Kunstflügen der Happonens, Kankkonens oder Ahonens, aber er hielt sich, beschwingt durch die Göttin Skaði, ausgesprochen respektabel in der Luft. Sechsundzwanzigtausend Köpfe verfolgten die Sichelkurve, die zusammengestauchte y² = 2px-Parabel, den Ypsilon-quadrat-ist-gleich-zwei-p-x-Schlenzer. Jetzt aber, am obersten Punkt des Kegelschnitts, an dem Punkt, wo es höher nimmer geht, kam er ins Schlingern, der Däne, ins Trudeln, er legte sich seitlich wie ein Kajakfahrer in einer neuen Wasserströmung, das war keine gute Flugtechnik, das war gar keine Technik mehr, nein, das war ein Absturz. Er zog ein Bein leicht an und drehte sich seitlich um die eigene Achse, er flog mit dem Rücken voraus, er versuchte sich zu fangen, versuchte dem unvermeidlichen Höllensturz entgegenzusteuern, geriet aber immer mehr ins Rudern und Strampeln, und aus dem erschrockenen Raunen der Menge stachen schon einzelne spitze Schreie heraus.
Mancher unten in den Arealen A bis F hoffte, dass er sich wieder fing, der nordische Kämpfer, einziges Mitglied der dänischen Nationalmannschaft, dem man doch auch deswegen ein bisschen Sympathie entgegenbrachte. Mancher dachte, dass es vielleicht nur ein Spaß war, eine kleine Einlage, ein nordländischer Joke. Aber es war kein Spaß. Es war ein granatenmäßiger Sturz. Und jetzt kochte das Raunen und Schreien zu einem Kreischen hoch. Der Stadionsprecher, sonst auf alle Eventualitäten vorbereitet, schrie ins Mikro:
»Um Himmels –!«
Dann verstummte auch er. Der Däne flatterte kopfüber auf die schräge Landebahn, und bevor er aufschlug, wandten sich viele ab. Man glaubte das Knirschen der Knochen bis in die entferntesten Areale zu hören.
3
Unter denen, die sich nicht abwandten und ganz bewusst hinsahen, waren der frisch pensionierte Oberforstrat Willi Angerer, der Gemeinderat Toni Harrigl, der Sportpsychologe und Konfliktforscher Manfred Penck und, in der vollbesetzten VIP-Lounge mit guter Sicht auf die Ereignisse, der Geschäftsmann Kalim al-Hasid aus Dubai.
Kalim war vielleicht derjenige von den Genannten, der vom Skispringen im Allgemeinen und vom Skisprungzirkus im Besonderen am meisten verstand. Zwar war er ein waschechter Araber, großgeworden in den knochentrockenen Wüsteneien des Emirats Dubai, sozialisiert in Dubai City und später in vielen schneelosen Großstädten der Welt, doch er wusste alles über diese Sportart. Das Skispringen faszinierte ihn, weil es für ihn den puren Luxus symbolisierte. Der gewaltige Aufwand machte für ihn den Reiz des Skispringens aus. Da waren ein paar Auserwählte, die auf den teuersten Sportgeräten der Welt in den Abgrund rutschten. Und die Massen waren begeistert von dieser Disziplin, die angeblich einmal damit begonnen hatte, dass man über festgefrorene Misthaufen sprang. Er hatte gehört, dass es allein in Norwegen vierzehnhundert Skischanzen gäbe. In Dubai gab es noch keine – aber Kalim al-Hasid hatte vor, genau das zu ändern. Er plante, mitten in der glitzernden City eine Schanze zu bauen, die größte der Welt, die erste in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er würde sie in den Stadtteil Dschumaira setzen, erstmals würde ein Mensch damit mehr als dreihundert Meter fliegen können, später vielleicht sogar vier- oder fünfhundert Meter, es war ja alles eine Frage des Anlaufs. Die Springer würden unter rauschendem Applaus von zweihunderttausend Zuschauern direkt aufs Meer zuschweben und dort auf einer künstlichen Insel landen. Unmögliche Hirngespinste? Halluzinationen nach langen sattellosen Wüstenritten? Verrückte Pfeifchenträume aus Tausendundeiner Nacht? Keineswegs: Kalim al-Hasid hatte die Baugenehmigung dafür schon in der Tasche, auch der Baugrund war bereits so gut wie gekauft, und das amerikanische Architekturbüro Skidmore, Owings & Merrill würde es bauen, natürlich, wer sonst. Jetzt musste er nur noch Investoren finden, doch von denen dürfte es genug geben. Kalim al-Hasid war hier, um sich mit Jacques Rogge, dem IOC-Präsidenten, über das gewaltige Projekt zu unterhalten, gleich jetzt, nach dem Skispringen, im Hinterzimmer der Lounge, bei Weißbier und Thüringer Bratwürstchen, die der Belgier so liebte. Er wollte ihn auch schon ansprechen, doch Präsident Rogge hatte es nicht erwarten können – er war noch schnell hinausgegangen, um sich an einer der Imbissbuden eine dieser derben Thüringer Fettspritzknacker zu genehmigen –, denn hier in der spitzenköcheverseuchten VIP-Lounge schuhbeckelte es gewaltig, da gab es südfranzösische Delikatessen wie kuttelgekrösegefüllte Andouillettes, oder, ganz schlimm, panierte und flambierte Münchner Weißwürste. Gleichwohl – wenn Rogge gesättigt zurückkam, würde er ihm seine Pläne vorlegen. Die Olympischen Winterspiele 2022 in Dubai! Das klang doch nach was. Oder wenigstens 2026? Oder spätestens 2030? Kalim al-Hasid hoffte, dass Rogge diese hitzeschimmernden Traumgebilde in dickbalkige Zeitungsmeldungen verwandeln würde.
Doch jetzt war etwas passiert da draußen, und Kalim starrte entsetzt aus dem gepanzerten und verspiegelten Fenster der VIP-Lounge. Auch er hatte, arabische Contenance hin oder her, laut aufgeschrien, als der Däne am Scheitel der Flugparabel ins Rudern kam. Alle hier im Raum, die ganzen wichtigen Gestalten und ihre dazugehörigen Personenschützer, hatten von ihren Mobiltelefonen, Lachskanapees und Piña Coladas abgelassen und waren zum Fenster geeilt. Kaum jemand hatte dem Dänen vorher beim Springen zugesehen, beim Stürzen jedoch kamen sie alle zusammen, die Generalkonsule und Sauerkrautmillionäre, die Landesfürsten und Skibindungsfabrikantenwitwen. Alle unterbrachen sie ihre unaufschiebbaren Gespräche, denn sie waren größtenteils nicht aus sportlichem Interesse hier: Während Michael Uhrmann sich reckte, schlossen sie Verträge ab, während Martin Schmitt den Adler gab, stimmten sie Übernahmen zu, während Gregor Schlierenzauer halsbrecherisch landete, nickten sie Kommuniqués ab und schüttelten den Kopf, ob nicht der Artikel ix.f.22a doch … Aber jetzt war ein Aufschrei durch den Raum gegangen, und alle eilten panisch zum Fenster. Dort versuchte jeder, einen möglichst guten Platz zu ergattern. Viele hatten einen oder sogar mehrere Gorillas im Schlepptau, das Gedränge war dementsprechend groß.
Die hochkarätige, aufgeschreckte Meute drückte Kalim al-Hasid schmerzhaft an die Scheibe. Er blickte nach draußen und sah Jacques Rogge, wie er sich mit einem Würstchen in der Hand durch die Menschenmassen kämpfte. Kalim wandte sich um und suchte nach seinem Leibwächter Jusuf. Der schweigsame Marokkaner war ein Profi, er stand ganz in seiner Nähe, ein paar Meter von ihm entfernt, wie es sich gehörte – und das war beruhigend. Jusuf hatte sein Fernglas gezückt und blickte zur Schanze. Dort schlidderte Sørensen jetzt die Aufsprungbahn hinunter, der rechte Ski war ihm sofort weggeflogen und überschlug sich ein paar Mal, dann glitt das herrenlose Brettchen den Rest des Abhangs hinunter, frech fuhr es seinem Besitzer voraus und schoss durch die Absperrung mitten in die Zuschauermenge hinein, die sich kreischend öffnete, den Ski von Åge Sørensen verschlang und nicht wieder ausspuckte. Kalim ließ sich von seinem Leibwächter das Fernglas geben und verfolgte den Sturz des Dänen jetzt hautnah. Der linke Ski war noch an Åges Bein, aus irgendeinem Grund löste und löste sich die Sicherheitsbindung nicht. Sørensen überschlug sich mehrmals, wurde immer wieder hoch in die Luft geschleudert und landete abermals auf dem harten Steilhang. Nicht wenige der Zuschauer bekreuzigten sich jetzt schon. Kaum einer glaubte mehr, dass man so etwas überleben konnte. Erst in der Mitte des Auslaufbereichs kam der Däne zur Ruhe, und sternförmig liefen jetzt die Sanitäter auf ihn zu, Kalim zählte insgesamt acht Krankenbahren, die über den Schnee gerollt, gezogen und getragen wurden, bald nahm die Traube der rettenden Kräfte der gaffenden Menge dort unten die Sicht. Kalim gab Jusuf das Fernglas wieder zurück. Man konnte nur vermuten, dass da in der Mitte nicht viel mehr als eine Ansammlung dänischer Knochen lag.
Von der VIP-Lounge aus hatte man bessere Sicht als drunten beim zahlenden Publikum. Jusuf, der Marokkaner, ein ehemaliger Unteroffizier der Fremdenlegion, dem der Beruf des Bodyguards auf den Leib geschrieben war, zoomte sich mit dem Fernglas heran. Er konnte sehen, wie Sørensen der linke Ski ausgezogen wurde, wie sechs oder acht Arme beherzt unter ihn griffen, um ihn danach sanft auf eine Bahre zu legen. Das Klinikum war gleich um die Ecke, sogar in Sichtweite – ob aber das jetzt noch etwas nützte? Der Stadionsprecher plapperte weiter, dass die Rennleitung das Springen selbstverständlich abgebrochen hatte, dass man über den Gesundheitszustand des Gestürzten laufend informieren würde, dass der dänische Ministerpräsident schon angerufen hätte, und dass Jacques Rogge, der IOC-Präsident, gleich ans Mikrophon käme, um ein paar tröstliche Worte zu sprechen.
Nachdem der Krankenwagen weggefahren war, ließ Jusuf das Fernglas wieder sinken und entspannte sich. Er machte sich bewusst, dass es ein Unfall da draußen war, keine Bedrohung seines derzeitigen Objekts hier drinnen. Situationsanalyse: positiv. Entwarnung. Eine Alarmstufe zurück. Für die Sicherheit Kalim al-Hasids wurde er bezahlt, für sonst nichts. Er drehte sich vom Fenster weg und beobachtete die aufgeregte Meute der etwa hundert VIPs, die sich hier im Raum befanden. Jusuf kannte viele davon von anderen Gelegenheiten her, er kannte auch die dazugehörigen Leibwächter und ihre jeweiligen Fähigkeiten. Er war bezüglich der Sicherheit hier im Raum ganz beruhigt, es waren nur die Besten engagiert worden. Sein Blick wanderte zur Tür. Dort kämpfte sich Präsident Rogge gerade wieder herein, das Thüringer Wahrzeichen hielt er empor wie ein Staffelholz, vielleicht sogar wie die olympische Fackel selbst – bei Rogge sah es jedenfalls so aus. Obwohl sich ihm gerade das halbe bayrische Kabinett entgegenstemmte, kam der IOC-Präsident gut voran und gewann an Boden. Vielleicht lag es daran, dass er einmal Rugbyspieler gewesen war. Drinnen winkte ihm schon Kalim al-Hasid zu.
Der Kurort, der den unangenehmen Geschmack der Olympischen Winterspiele von 1936 loswerden wollte, bewarb sich, wieder einmal, um die Ausrichtung der Spiele im Jahr 2018. Eigentlich war München offizieller Bewerbungskandidat, aber dieses Vordrängeln der Landeshauptstadt beachteten viele Bewohner des Kurortes überhaupt nicht. Jedenfalls ging es um einiges, genauer gesagt, um viel, viel Geld. Deshalb waren der bayrische Ministerpräsident da, einige jeweils gegeneinander konkurrierende Brauereivorstände, Landmaschinen-, Auto- und Fleischfabrikanten, oberländische Kulturschaffende, alpennahe Mitglieder des bayrischen Landtags, aber auch internationale Größen wie etwa der hessische Innenminister. Einige Lokalpolitiker im Pflichtloden, zwei hohe Sportfunktionäre, Franz Beckenbauer (leibwächterlos, denn wer würde es wagen, dem Kaiser ein Leids zu tun!), ein androgyner Starfriseur, zwei Popgrößen und ein halbseidener Grundstücksmakler liefen nun hinaus, in den Vorraum oder gar ins ungeschützte Freie, um eine SMS abzusetzen, um zu telefonieren oder um den Chauffeur zu rufen. Ein paar andere kamen gerade wieder herein, so dass gegenläufige und unübersichtliche Bewegungen im Raum entstanden. Unübersichtliche Bewegungen sind Vorkommnisse, die der Spezies der Personenschützer normalerweise ein Graus sind. Doch Jusuf blieb cool, sein Blick wurde hart, er scannte den Raum. In einiger Entfernung drängten sich Jacques Rogge und der winkende Kalim al-Hasid aufeinander zu. Dort hinten stand ein Generalbundesanwalt (mit drei Leibwächtern), die Chefin eines weithin bekannten Zeitungsverlags (zwei Leibwächter), ein ehemaliger Berater eines ehemaligen Politikers (ein Leibwächter) und, wie gesagt, Beckenbauer, schutzlos, aber mit einer Zweihundert-Euro-Zigarre in der Hand. Und plötzlich erblickte Jusuf etwas sehr Eigenartiges.
Hinter Kalim al-Hasid hatte sich ein Mann geschoben, ein Mann im Skianorak mit SC-Riessersee-Aufdruck, so viel konnte er zwischen den drängelnden Leibern hindurch erkennen. Der Mann war eher schlank und zierlich. Er nestelte an seinem Skianorak herum und öffnete den Reißverschluss. Quer über die Brust lief ein Pistolenholster, leer, wie Jusuf sofort bemerkte. Das durfte doch nicht wahr sein! In der Hand hielt dieser Mann eine Handfeuerwaffe, aber hier konnte Jusuf eben nicht erkennen, um was für ein Fabrikat es sich handelte. Es hätte eine kleine Glock 17 sein können oder eine Heckler & Koch USP, Jusuf hätte nicht darauf wetten mögen. Auch eine Beretta der 80er-Serie oder sogar eine Walther PP mit Double-Action-Abzug hätte es sein können, alles wäre möglich gewesen, Jusuf konnte es in der Kürze der Zeit nicht ausmachen. Die Waffe zeigte nach unten, doch jetzt griff der Mann mit der anderen Hand an die Schulter Kalim al-Hasids und zerrte daran. Ob er ihn ansprach, konnte Jusuf nicht sehen, denn der Blick auf das Gesicht des bewaffneten Anorakträgers war ihm immer noch versperrt durch das Gedränge und Geschiebe im Raum. Was er aber jetzt sah, war, dass der Mann die Waffe so hob, dass sie auf Kalims Rücken zielte. Und jetzt reagierte Jusuf blitzschnell. Er zog seine Zenelli, eine Spezialanfertigung der Firma Carletto Inc. mit extrem schalldämpfendem Gehäuse, die beim Schießen wirklich nur einen winzigen Plop macht, ein Sssrit!, und da irgendein Anruf wie Legen Sie die Waffe weg! hier im lärmenden Getümmel sinnlos war, schoss Jusuf auf den Mann im Skianorak.
4
Man denkt immer, Journalisten sind Tag und Nacht damit beschäftigt, Fakten nachzujagen. Doch die Fakten sind ohnehin immer dieselben: Unfälle und Niederlagen, verknüpft mit Zahlen. Journalisten aber wollen mehr. Sie wollen Zusammenhänge, Hintergründe, Querverbindung, Wechselwirkungen. So war es auch im Kurort bei den versammelten internationalen Sportreportern. Åge Sørensen war noch nicht ganz fertig mit dem Stürzen, da fingen die Ersten schon an zu googeln, was das Zeug hielt: Wann der letzte Unfall geschehen war beim Skispringen, wann der erste, wie viele Unfälle es schon auf einer solchen K-125-Schanze wie dieser gegeben hatte, wie viele beim Neujahrsspringen. Wie viele Tote, der älteste Tote, der jüngste Tote, die erste tote außereuropäische Frau, und wie das Skispringen überhaupt dastand in puncto Gefährlichkeit, im Vergleich zu Sportarten wie Radrennen oder Eisstockschießen. So surften sie und telefonierten, fetzten die Ergebnisse in ihre Notebooks und bastelten an ihren Das-ist-genau-das-wovor-wir-immer-gewarnt-haben-Kommentaren.
Und in der Tat kann die Geschichte des Skispringens auch als die Geschichte seiner Stürze erzählt werden. Im Jahre 1808, als es in der norwegischen Region Telemark Mode geworden war, über zugeschneite Almhütten zu springen, lag der Weltrekord bei 9,5 (!) Metern, aufgestellt vom Dänen (!) Olaf Rye. Den ersten Toten gab es schon 1811: Der Kanadier Jean-Baptiste Garneau verunglückte in Brisebois bei Calgary beim Sprung über einen aufgeworfenen Schneehügel. Im Jahre 1830, als immer noch mit Skistöcken gesprungen wurde, rammte sich der Norweger Inger Faldbakken einen solchen in den Leib. Der Schweizer Romulus Winkli, der 1841 im walliserischen Täsch die erste Schweizer Schanze gebaut hatte, kam um, als er sie testen wollte. Der Franzose René Dupree brach sich 1842 in Chamonix das Genick, als er versuchte, nicht mit den Armen zu rudern, wie es damals üblich war, sondern einen neuen, windschlüpfrigeren Stil zu entwickeln und die Arme anzulegen, 1902 kam es im mittelfinnischen Jyväskylä bei einem Springen zu einer Massenschlägerei mit zwei Toten, im Jahre drauf brach die Unterkonstruktion der Skischanze im Steirischen Mürzzuschlag (ja, da wird auch skigesprungen!) zusammen – insgesamt waren hier vier Opfer zu beklagen, worauf der Konstrukteur, der Geheime Rat Oberingenieur Florian Plätschgeigl, der sich dafür verantwortlich fühlte, Selbstmord beging. 1911 (der Weltrekord stand inzwischen bei 41 Metern) stürzte der Amerikaner Gregory O’Connan schwer. Er nahm noch an der Siegerehrung teil, schleppte sich aufs Siegerpodest, brach aber nach der Nationalhymne tot zusammen – ein wahrhaft amerikanisches Schicksal. 1946 gab es einen skurrilen Unfall im schwedischen Sysslebäck, als der Springer Pär Hägg zwar gut landete, aber im Auslauf mit einem Zuschauer kollidierte, der lediglich zu seiner Familie auf der anderen Seite des Parcours wollte. Der Springer überlebte den Zusammenstoß, der Familienvater nicht.
»Skispringen ist halt nicht Halma.«
Mit diesem gut überlegten Aperçu war Sven Ottinger, Vorsitzender des Skiverbandes Oberbayern, bekannt geworden, den Spruch pflegte er bei jeder Gelegenheit zu bringen. Ottinger war der Einzige, der nach dem Unfall greifbar war, und so gab er das erste Interview zum Geschehen. Das Bonmot blieb auch diesmal nicht aus, und um die Peinlichkeit etwas abzumildern, setzte man auf die Bildwirkung der Großen Olympiaschanze, die sich im Hintergrund drohend nach oben reckte. Sonst ein Symbol des Fremdenverkehrs, war sie heute eher das Leitmotiv des Grauens. Die Kamera schwenkte hin und her.
»Herr Ottinger, ist es denn wirklich sinnvoll, solch kleine, unerfahrene Skinationen wie Dänemark mit ihren ungeübten Springern auf die Zuschauer loszulassen?«
»Das hätte einem großen Springer, einem Springer aus einer großen Sprungnation auch passieren können.«
Der Moderator konnte sich nicht verkneifen, die Tatsache zu erwähnen, dass Dänemark nur eine einzige Sprungschanze sein Eigen nenne, und die stünde auch noch in Grönland. Die Kamera schwenkte hinüber zum Klinikum und zoomte auf den Eingang. Da kam aber jetzt, eigentlich unpassend zur höheren Dramatik der Ereignisse, ein hustender Patient mit COPD im Endstadium heraus, um vor der Tür eine Rauchpause einzulegen. Das musste natürlich weggeschnitten werden.
Der Däne lag da drinnen, irgendwo auf einem Zimmer des Riesenkomplexes. So gut wie keine Informationen drangen nach außen, man wusste nur, dass noch Leben in ihm war. Die Krankenhausleitung hatte keine Drehgenehmigung erteilt, nicht einmal besuchen durfte man Sørensen, nur den dänischen Trainer Andersson ließ man hinein, wobei schon in der Vorberichterstattung die meisten Zeitungen das Wort »Trainer« gemeinerweise in Anführungszeichen gesetzt hatten. Dann hatte man doch noch einen Lokalprominenten vor die Linse bekommen. Es war Gemeinderat Toni Harrigl, zweiter Fraktionsvorsitzender seiner Partei, dritter Vorsitzender des örtlichen Hornschlittenvereins und beschäftigt in weiteren fünfzig anderen ehrenvollen Vereinigungen. Der Kameramann zoomte auf sein Gesicht, die Reporterin fuhr ihm mit dem Mikrophon an den Mund, als wollte sie ihm eine Magensonde legen.
»Ganz kurz nur«, sagte Harrigl und bereute, nicht die telegenere silberne Krawatte umgebunden zu haben. »Schreckliche Sache«, sagte er.
»Worauf führen Sie den Sturz zurück? Könnte es eine Windbö gewesen sein?«
Der Lokalpolitiker machte ein Gesicht, als wäre es eine unverschämte Unterstellung, in einem blitzsauberen Sportparadies wie diesem so etwas wie eine Windbö anzunehmen.
»Eine Windbö schließe ich aus, es war ein bedauerliches menschliches Versagen.«
»Der Ort hat sich bekanntlich für die Winterspiele 2018 beworben. Zieht er die Bewerbung nach diesem Unfall zurück?«
»Ich bitte Sie! Bei uns ist noch nie etwas passiert, unsere Sicherheitsstandards sind hoch, es war ein technischer Fehler des Springers, wie gesagt: bedauernswert, aber –«
Skispringen ist halt nicht Halma, lag ihm auf der Zunge. Aber dieser Spruch war schon vergeben. Er musste sich endlich einen eigenen claim überlegen.
»Wissen Sie, wie es dem Springer geht?«
»Den Umständen entsprechend gut. Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird er uns alle darüber informieren können, was wirklich geschehen ist«, sagte Harrigl ins Blaue hinein.
Åge konnte, zumindest vorläufig, kein Licht ins Dunkel bringen, er war nicht bei Bewusstsein. Ein blitzendes Röhrchen steckte in seinem Hals, er war tracheotomiert worden und blubberte vor sich hin. Er war kurz davor, Odin kennenzulernen, den Gott mit den zwei Raben auf der Schulter, der die Toten in Asgard empfängt. Åge sah den Führer des wütenden Heeres schon mit dem Speer winken.
Wo ist Thor?, wollte ihm Åge zurufen, doch die Stimme bröselte ihm weg. Ein schwitzender Oberarzt schüttelte den Kopf und murmelte das, was alle auf der Intensivstation dachten.
»Unglaublich. Dass dieser Mann überhaupt noch lebt!«
Die Aufzählung aller Befunde sprengte das Anmeldeblatt für die Notaufnahme des Krankenhauses. Allein die Liste der Frakturen schien die vollständige Liste aller menschlichen Knochen zu umfassen.
Der »Trainer« Andersson war der einzige Mensch ohne Äskulapstab, der hineindurfte, aber auch nicht ganz hinein, er bekam die Erlaubnis, durch eine Glasscheibe von außen in den OP-Raum der Intensivstation zu schauen. Doch er sah wenig von Åge, der noch vor einer Stunde Adler gewesen war und jetzt zerfleddert auf dem Tisch lag. Als ein dienstbarer Geist in Grünblau kurz wegging, um ein silbernes Nierenschälchen auszuleeren, fiel Anderssons Blick auf das freiliegende Bein Åges und den offenen Schienbeinbruch, bei dem der Knochen frei herausstand und mit einem Wattebausch saubergetupft wurde. Im Hintergrund stand eine riesenhafte Gestalt, ebenfalls in Grünblau, die ein neues Blatt in die Knochensäge einspannte.
5
Die ersten Gäste verließen die VIP-Lounge. Es war jetzt keine halbe Stunde her, dass Jusuf den Mann im Skianorak gesehen hatte. Das durfte doch nicht wahr sein: Er hatte auf jemanden geschossen, und dieser Jemand war spurlos verschwunden, nicht mehr aufzufinden, wie vom Erdboden verschluckt! So etwas hatte er noch nie erlebt. Er hatte auch noch nie von so etwas gehört. Er ging zu der Stelle, an der der Mann gestanden hatte. Wenn sich der Raum vollständig geleert hätte, würde er die Stelle unbeobachtet untersuchen. Er ließ die Ereignisse noch einmal Revue passieren, vielleicht hatte er etwas übersehen. Eine Pistole war in sein Gesichtsfeld gekommen, eine Pistole, die auf sein Objekt zielte, er hatte seine Zenelli gezogen und geschossen. Doch im Moment des Abdrückens, vielleicht auch erst eine Zehntelsekunde danach, war er von hinten gestoßen worden, unabsichtlich zwar, wie sich gleich danach herausstellte, aber doch so erheblich, dass er abgelenkt worden war. Ein übergewichtiger spanischer Bauunternehmer, der Rodríguez oder Gonzalez oder so ähnlich hieß, hatte sich, in jeder Hand ein Mobiltelefon, an ihm vorbeidrängen wollen. Jusuf hatte sich kurz umgedreht und erkannt, dass Gonzalez keine Bedrohung war. Der Spanier hatte so etwas wie ¡que te den por culo! gesagt, was wohl eine spanische Entschuldigung war. Wo war sein Objekt? Jusuf hatte einen besorgten Blick in Richtung Kalim al-Hasid geworfen, doch der stand schon bei Rogge, redete auf ihn ein und formte gerade mit beiden Händen eine Schanze, die bis aufs Meer hinausreichte – dort also war alles in bester Ordnung. Wo aber war der Mann im Skianorak geblieben? Der Angeschossene (oder, aus dessen Sicht, vielleicht auch glücklich Verfehlte) war von der Bildfläche verschwunden, hatte sich aufgelöst, so schnell, dass Jusuf kurz daran zweifelte, ob er die bedrohliche Szene wirklich beobachtet hatte. Das Tohuwabohu im Raum war noch stärker geworden, viele strömten hinaus, um die jetzt sicherlich zu erwartenden Interviews zu geben. Ein Kardinal in Zivilkleidung, Marianne und Michael in Strickjankern, der Landrat des Kreises, eine Olympiasiegerin im Biathlon, ein Fernsehkoch und der Ex-Drummer von den Guns N’ Roses – sie alle standen beieinander und diskutierten. Irgendwo hörte man auch den Satz »Skispringen ist halt nicht Halma«. Folglich war auch der Vorsitzende des Skiverbandes Oberbayern, Sven Ottinger, da. Oder einer, der noch keinen eigenen claim hatte.
Jusuf hatte seine kleine Zenelli wieder eingesteckt. Niemand im Raum schien bemerkt zu haben, dass er geschossen hatte, der Lärm der telefonierenden und sonst wie durcheinanderschreienden Hautevolee war ohrenbetäubend, und alle waren mit sich selbst beschäftigt gewesen. Sein Objekt lebte, dafür wurde Jusuf bezahlt und für nichts anderes. Trotzdem war er beunruhigt. Was hatte das zu bedeuten? Die ganze Szene hatte sich in der Nähe der Tür abgespielt, die nach draußen in den Vorraum führte. Die VIP-Lounge war im untersten Stockwerk des Schiedsrichterturms untergebracht, und kaum jemand wusste von diesem Raum. Der Schiedsrichterturm selbst stand unmittelbar neben der Schanze in Höhe der Aufsprungbahn, hier waren die Punktrichter in schier mittelalterlichen Verschlägen eingesperrt. Oben auf der Terrasse des Turms tummelten sich die wichtigen, aber doch nicht ultrawichtigen VIPs – denn Letztere fand man eben nur unten in der geheimnisvollen Lounge. Hier bewegten sich die richtig großen Tiere, die auch gar keinen besonderen Wert darauf legten, gesehen zu werden. Vom Vorraum führten drei Wege ins Freie. Es gab einen Weg zur Terrasse, einen hinunter zu den Tribünen und Würstelbuden, und einen dritten zum Anfahrtsweg für die Stretch-Limousinen und Bentleys. Alle drei Wege wurden äußerst streng bewacht, keine Chance, da ohne Aufsehen hinauszukommen. In jedem Fall musste die Flucht des Verletzten bemerkt worden sein. Es sei denn – er war gar nicht geflohen, er befand sich immer noch in der Nähe. Das war eine beunruhigende Vorstellung. Alarmstufe Orange.
Doch Jusuf schloss auch nicht aus, dass er den Mann überhaupt nicht getroffen hatte. Dass er durch den Rumpler des fetten Spaniers danebengeschossen hatte und der Mann im Anorak das im Getöse gar nicht mitbekommen hatte. Wenn es aber so war, musste die Kugel noch irgendwo herumliegen. Wenn er hingegen doch getroffen hatte, musste es Blutspuren geben. Vielleicht war der Mann in dem Skianorak mit dem SC-Riessersee-Aufdruck ja auch gar kein angreifender Eindringling, sondern VIP-Objekt oder auch – der größte anzunehmende Unfall – ein anderer Personenschützer. In beiden Fällen musste jemand auftauchen, der einen Verletzten zu beklagen hatte.
Langsam tröpfelten alle aus dem Saal. Die wenigen Verbleibenden waren so ins Gespräch vertieft, dass sie gar nichts um sich herum bemerkten. Ein hoher NATO-General und zwei Inderinnen (zumindest hatten die beiden kunstvoll bemalte Hände), der Landwirtschaftsminister von San Marino und ein alter Mann, den er nicht kannte. Und natürlich Kalim al-Hasid und Jacques Rogge, beide wohlauf. Jusuf ging ein paar Schritte auf die beiden zu.
»Alles in Ordnung?«, fragte er leise.
»Natürlich, alles o.k.«, antwortete Kalim zerstreut. Jusuf schlenderte scheinbar ziellos durch die VIP-Lounge, an den Wänden entlang, so, als ob er sich langweilen würde. Er blieb ab und zu stehen. Er prüfte jeden Quadratzentimeter auf Spuren eines Querschlägers. Er suchte, weiterschlendernd, den Boden nach dem Projektil ab. Nichts. Er bewegte sich abermals durch den Raum und erforschte die Wand noch genauer, Zentimeter für Zentimeter. Wieder nichts. Jusuf kam zu der Stelle, wo der Mann gestanden hatte. Er kniete sich hin, und tat so, als binde er sich die Schnürsenkel. Zentimeter für Zentimeter untersuchte er den Boden, fuhr auch da und dort mit den Fingern über den dicken Teppich. Es musste doch hier irgendwo Blutspuren geben! Er hatte natürlich nicht die Ermittlungs- und Untersuchungsmöglichkeiten der Polizei. Aber er musste einen Versuch machen. An einer Stelle stand der Teppich etwas hoch. Das Teppichstück war dunkel verfärbt, er wollte das zu Hause genauer untersuchen. Unauffällig nahm er sein Schweizer Taschenmesser heraus und schnitt ein kleines Stück ab. Besser als nichts. Er steckte es in die Tasche. Gerade wollte er noch ein zweites Stück Teppich herausschneiden, da fiel ein Schatten über seine Hand.
»Hallo, Jusuf!«
Verdammter Teppichfußboden. Lautlos war jemand herangeschlichen und hatte sich vor ihm aufgebaut. Jusuf richtete sich auf. Es war Charles Benetti, ehemaliger Leibwächter und Ausbilder, jetzt Inhaber einer florierenden Schule für Sicherheitspersonal, einen neuen Pass und eine wasserdichte Identität gab es gratis dazu. Was früher die Fremdenlegion geleistet hatte, das machte jetzt Benetti.
»Hallo, Charles.«
»Du bist bei Kalim al-Hasid?«
»So ist es.«
Benetti zu fragen, bei wem er war, erübrigte sich. Er hatte ein hochrangiges Objekt hier, das war sicher. Und er würde nicht sagen, wen er zu beschützen hatte.
»Verdammte Sache, das mit dem Sturz«, sagte Benetti.
»Das kannst du laut sagen. Ist dir hier irgendwas Besonderes aufgefallen? Was Außergewöhnliches? Was Verdächtiges?«
»Ich habe nichts bemerkt«, sagte Benetti lächelnd. Er machte eine kleine, diskrete Bewegung mit dem Kopf, hin zu den Füßen von Jusuf.
»Schuhe binden, wie?«, sagte er süffisant.
Jusuf brauchte nicht auf seine Schuhe zu sehen. Er trug heute Slippers.
6
»Ich werd euch ganz genau sagen, wie es passiert ist.«
Mit diesen Worten stellte Oberforstrat a.D. Willi Angerer sein imposant verpacktes Jagdgewehr in die Ecke des kleinen Cafés. Von der verwitterten Hülle aus dunklem Leder ging eine unbestimmte Melange aus Wald, Jagd und Brunft aus, doch niemand störte sich daran. Er setzte sich an eines der Tischchen. Die hip eingerichtete Bäckerei Krusti, zentral gelegen, zentraler ging es gar nicht mehr, bot nicht nur Aberhunderte von Semmelvariationen an (in dieser Woche neu: die Sex-and-the-Village-Laiberl), sondern war auch Treffpunkt all derer, die es wissen wollten. Die es nicht erst morgen in der Zeitung lesen wollten, sondern die es gleich und heute noch und brühwarm erfahren wollten. Es gab, einen Tag nach dem spektakulären Sturz des Dänen, nur ein einziges Thema, und das war das verpatzte Neujahrsspringen. Alle im Café hatten das Gespräch mitten im Satz abgebrochen und schauten jetzt hin zum Angerer. Alle hatten ihre Augenbrauen fragend hochgezogen, jeder wollte die Theorie des Försters hören, doch der Angerer biss zuerst einmal, quasi retardierend, in eine Mandelkleie-Dinkel-Semmel, um die Spannung zu erhöhen. Alle warteten, denn der Oberforstrat war ja gewissermaßen eine Respektsperson. Zusätzliche Kompetenz in dieser speziellen Angelegenheit gab ihm noch die Tatsache, dass er ehemaliger Skispringer war. Als junger Bursch, in den fünfziger Jahren, wäre er sogar fast einmal in die bundesdeutsche Nationalmannschaft berufen worden. Aber nur fast.
»Da sind wir aber alle gespannt, wie es wirklich passiert ist«, sagte der Gemeinderat Toni Harrigl, der im Schatten eines riesigen Gummibaums saß, der angeblich deswegen so gut geraten war, weil er täglich mit dem frischen Weißbier einer weithin bekannten (aber hier ungenannt bleibenden) Brauerei gegossen wurde. Harrigl und Angerer mochten sich normalerweise überhaupt nicht, der eine war für, der andere gegen den Fremdenverkehr – jetzt aber hörte der Gemeinderat dem Waidmann, wenn auch skeptisch, zu.
»Es war wie damals 1959 in Oberstdorf, beim Ausscheidungsspringen für Squaw Valley«, begann der Angerer, »ein Ami springt weg und liegt ungefähr so in der Luft –« Er hob die Arme und formte mit beiden Händen die Ski des Amerikaners, dabei kam ein windschiefes und zappeliges V heraus. Ein paar der Anwesenden grinsten schon. Die meisten von Angerers Skisprung-Anekdoten begannen nämlich 1959 in Oberstdorf.
»Jetzt verreißt es ihm den rechten Ski, dem Amerikaner, und –«
Er wurde mitten im Satz unterbrochen, denn die Tür flog auf und der Wind wehte einen seltenen (weil vielbeschäftigten) Gast herein, den Fischer Beppi, den bekannten Zitherkünstler, der mit verschiedenen Lauten der Begrüßung empfangen wurde: Hoi! Öha! Aha! Wos! Ja, du! Leck mi! Dem Fremden mögen diese Laute jetzt unverständlich und kryptisch (vielleicht sogar bedrohlich) vorkommen, doch in der Bäckerei Krusti trafen sie die Stimmung genau. Der Zither Beppi, wie er überall genannt wurde, war ein überaus kleines und verwachsenes Männchen, das seine zerkratzte Zither fast schützend vor sich hielt. Jetzt setzte er sich an den Tisch. Er war aber keineswegs gekommen, um in der Bäckerei Krusti ländliche und almerische Weisen aufzuspielen, er stellte sein Instrument vielmehr neben sich auf den Boden und bestellte einen Kaffee. Der Zither Beppi war natürlich ebenfalls im Skistadion gewesen, gestern, zur fraglichen Zeit, das war sozusagen sein Beruf, zur fraglichen Zeit mit der passenden Musik am richtigen Platz zu sein. Normalerweise spielte er in den touristischen Restaurants des Kurortes, dort unterhielt er die Fremden mit lokalem Liedgut und internationalen Schlagern, er zauberte bei Bedarf auch musikalische Abartigkeiten wie eine Zitherfassung von Highway to hell aus dem Ärmel. Am Neujahrstag hatte er sein Instrument in der geheimen VIP-Lounge des Skistadions aufgeschlagen, dort war er fest engagiert, seit Jahren schon, man konnte sich ein Neujahrsspringen ohne seine Zitheruntermalung gar nicht mehr vorstellen. Seine Gage war stattlich, aber dafür war er auch zum Schweigen verdonnert.
Er war bekannt und beliebt bei den Großen dieser Welt, und mancher Tycoon, Krösus und Alpha ließ sich mit ihm ablichten, als Maskottchen sozusagen. Der Zither Beppi behauptete, mit dem und dem per Du zu sein, aber so richtig zuverlässig waren seine Geschichten auch wieder nicht, viele der Erzählungen waren zusammengeschraubte oder ganz erfundene Erinnerungen eines hochmusikalischen und phantasievollen Hirns. Kamen noch ein paar Halbe Bier dazu, glitten seine Possen durchaus in den Bereich des Phantastischen. Sehr oft erzählte er die Geschichte, wie er dem Papst beim Neujahrsspringen Gstanzln vorgespielt hat, sozusagen von Beppi zu Beppi. Der Heilige Vater hätte ihn dann nach Rom eingeladen, und da wäre er auch hingefahren und hätte in den päpstlichen Lustgärten von Castel Gandolfo gewohnt.
»Ja und? Was hast du dann da gespielt?«
»Ja, was werd ich da gespielt haben: Highway to hell natürlich, und grad lustig war’s!«
Ganz von der Hand weisen konnte man die Geschichte nicht, denn der Zither Beppi war zur fraglichen Zeit tatsächlich eine Woche weg gewesen, aber andere sagten, er hätte in dieser Zeit in der Nähe von Lermoos einen Riesenfetzen Rausch ausgeschlafen.
Aber beim diesjährigen Neujahrsspringen war der Zither Beppi dabei gewesen, in der VIP-Lounge hatte er gezithert, aber diesmal eben nicht lange, dann war ja der Unfall passiert.
»Der Ministerpräsident ist da gewesen, der Beckenbauer, der Jacques Rogge, Marianne und Michael – alle halt. Auch ein paar, die ich jetzt nicht nennen kann.«
»Ach komm, sag einen!«
Doch der Zither Beppi hielt sich an die Vereinbarungen. Die Prominenten wären herumgelaufen wie verrückt, und er wäre höflich gebeten worden, sich draußen zur Verfügung zu halten.
»Rausgeschmissen werden sie dich halt haben!«, rief der Glasermeister Pröbstl, der immer zusammen mit seiner Gattin hierherkam. Die hakte nach:
»Und von dem Unfall selbst hast du nichts mitbekommen?«
Nein, das hätte er nicht, er hätte mit dem Rücken zum Fenster gesessen und gerade Schenkt man sich Rosen in Tirol gespielt, in A-Dur auch noch, was einige Konzentration verlangt, bei der Textstelle Mir winket neues Liebesglück! wäre der Unfall wohl passiert.
»Ich habe aber eine Vermutung«, sagte der kleine Zitherer. »Ich habe nämlich ein paar Gesprächsfetzen mitbekommen. Von einem Materialfehler war da die Rede und der falschen Legierung, und der Chef von der Skifirma, der dabeigestanden ist, ist ganz blass geworden und hat etwas von ausgerechnet jetzt … ausgerechnet vor dem Börsengang so ein Unfall gemurmelt.«
»Ich weiß eben nicht, ob Unfall der richtige Ausdruck ist«, mischte sich der Angerer Willi wieder ein. »Ich habe mir die Bilder im Fernsehen immer und immer wieder angeschaut. An einen Materialfehler glaube ich nicht. Ich weiß jetzt, wie es passiert ist.«
»Wie ist es dann passiert?«
»Am höchsten Punkt der Flugkurve reißt es ihm den rechten Ski ein bisschen weg –«
»War es vielleicht doch eine Windbö?«, unterbrach ihn der Penck Manfred, ein studierter Psychologe, der gerade eine Praxis für Mediation und Konfliktlösung im Kurort aufgemacht hatte, die angeblich total überlaufen war.
»Nein«, fuhr der Angerer fort, »der Ski hat sich so bewegt, als ob etwas hingeschlagen wäre, was man auf den Videos nicht sieht, weil es so klein ist.«
»Ein kleines Vogerl vielleicht?«, meinte einer.
»Wie damals in Oberstdorf, 1959?«, flüsterte ein anderer.
»Oder Squaw Valley, 1960?«, setzte ein Dritter drauf.
Einige kicherten. So ein Deppenhaufen, dachte der Angerer. Solche Banausen, solche blutigen Laien, die absolut keine Ahnung vom Skispringen haben, die sich vor Angst in die Hosen machen würden, wenn sie nur da oben stünden. Laut sagte er:
»Nein, ich hab da eine ganz andere Theorie.«
»Jetzt sind wir aber alle gespannt.«
»Es war ein Schuss. Der Sørensen ist beschossen worden.«
Erst war alles ruhig, ein paar schmunzelten, verstohlen, denn er war ja immerhin der Oberforstrat, dann aber prustete der eine oder andere los, schließlich gab es ein infernalisches Gelächter in der Bäckerei Krusti, das dazu führte, dass der Angerer, der Grünrock, der Jäger aus Kurpfalz, beleidigt aufstand, seine Zeche auf den Tisch warf, seine Gewehrhülle schulterte und hinausging, nicht ohne die Türe geräuschvoll zuzuschlagen. Nur der Mediator Manfred Penck, quasi ein gelernter Konfliktlöser, stand auf, um ihm nachzugehen und ihn zu beschwichtigen. Als er jedoch draußen auf der Straße stand, war der Angerer Willi schon außer Sichtweite. Der Psychologe legte den Kopf in den Nacken und sog die milde Winterluft ein.
Der Angerer Willi war immer noch wütend. Er ging zum örtlichen Polizeirevier und machte dort eine Aussage. Polizeiobermeister Johann Ostler hatte gerade Dienst, ein gemütlicher, aber gewissenhafter Beamter, dessen Familie schon seit der Römerzeit im Talkessel lebte. Ostler kannte jeden Stein im Ort. Er tippte die emotional aufgeladenen Spekulationen Angerers geduldig und seufzend in die Schreibmaschine (die EDV war schon wieder einmal kaputt), und genau diese Spekulationen lieferten am Morgen des übernächsten Tages die Schlagzeilen der Lokalblätter.
7
Die Frau mit dem Lederhut beugte sich vorsichtig über den Rand der Grasnarbe und wagte einen Blick nach unten in die gischtsprühende Klamm. Es war lediglich ein kleiner Schmelzbach, der in die Schlucht eingepfercht und dadurch monströs angeschwollen war und der sich jetzt aufspielte wie eine reißende Sturzflut, eine urgewaltige Kaskade vorzeitlicher Wasserverschwender. Zersplittertes Treibholz rumpelte durch den engen Wildparcours, staute sich da und dort mannshoch, um schließlich umso wütender wieder hinunterzubrechen in den alpinen Canyon. Gerade war wieder eine ausgewachsene Buche, die der Blitz gefällt und in die Klamm gestürzt hatte, an die Felswand gepfeffert worden, die Holzsplitter spritzten hinauf bis zu der Frau mit dem Lederhut. Wie sollte sie auf die andere Seite der Schlucht gelangen? Über den Abgrund zu springen war jedenfalls nicht möglich. Plötzlich legte sich eine Hand auf ihre Schulter, eine große, muskulöse Hand. Eine sehnige Hand, eine Hand, die zupacken konnte. Sie erschrak nicht, sie drehte sich ruhig um, sie kannte den Griff. Es war der Fallensteller, ein schweigsamer und bedächtiger Mann, der jetzt schon einige Stunden mit ihr unterwegs war und keine zwei Worte gesagt hatte. Er trug einen breiten Gürtel aus Kalbsleder, an dem der Lendenschurz und die zwei Beinröhren aus Schilfgras befestigt waren. Die Gefährten waren alle in dieser Art gekleidet, manche besaßen noch einen Umhang aus Pfeifengras als Regenschutz, manche eine Mütze aus Braunbärenfell.
Der Fallensteller hob die Hand und deutete stumm flussaufwärts. Dort oben, am Ufer, winkten und schrien die beiden anderen aus ihrer kleinen Gruppe: das Mädchen mit dem Schakalsgesicht und der Junge, der den Feuerschwamm trug. Sie deuteten aufgeregt auf ein zerfasertes Hanfseil, das mit plumpen Holzpflöcken über die Klamm gespannt war. Es war drei oder vier Gemsensprünge lang und sah nicht gerade vertrauenerweckend aus. Aber sie hatten keine andere Wahl. Sie alle mussten hinüber über die zornsprudelnde Schlucht, den wüsten Einriss in der Haut des lieblichen Voralpenlandes, hier auf dieser Seite waren sie nicht mehr sicher. Obwohl der Fallensteller ein großer und starker Kerl war, beugte er sich zögerlich über den Rand der Schlucht. Alle bemerkten, dass er zitterte. Jetzt umfasste er den groben Hanf, der mit dunkelrotem Harz getränkt war. Er schloss die Augen und murmelte ein Stoßgebet zu Bi-mora-boro, dem gütigen Gott und Nothelfer, der hinter der Sonne wohnte. Schließlich nahm der Fallensteller all seinen Mut zusammen und ließ sich bäuchlings auf die schwankende Brücke gleiten. Zehn feste Griffe, schon hatte er sich bis zur Mitte vorgearbeitet. Da und dort rissen bereits die ersten feinen Hanffasern, und auch der Pflock, über den die Schlaufe drüben am anderen Ufer geworfen worden war, neigte sich bedrohlich. Der Fallensteller war jetzt am Rand der Klamm angekommen, er griff mit der Hand nach einer frei hängenden Wurzel, die ihm stark genug schien, zog sich an ihr hoch, gewann Land und fiel erschöpft auf die nasskalte Erde. Hinter sich, drüben auf der anderen Seite, hörte er die freudigen Schreie der Gefährten.
Die Sonne ging auf, Eile war geboten. Bei Tag mussten sie drüben sein. Jetzt war der Junge, der den Feuerschwamm trug, an der Reihe. Er zurrte die Tasche fest, die er auf dem Rücken trug, und ging wortlos ans Steilufer. Er wählte eine andere Technik, klammerte sich von unten an das Seil und hangelte sich wie ein Affe vorwärts. Mit heiseren Schmatzern spritzte immer wieder Gischt hoch und benetzte seinen Umhang aus abwechselnd schwarz und weiß aneinandergenähten Biberfellen. Schließlich war auch er mitsamt seiner wertvollen Last drüben angelangt und ließ sich dort erschöpft auf die Erde fallen. Dann kam das Mädchen mit dem Schakalsgesicht. Wenn man sie necken wollte, brauchte man bloß den weinerlichen Singsang der Goldschakale nachzuahmen: Woiiiiiiii-kiki-woiiiiiiiiii-ki. Im Augenblick hatte niemand Sinn für solche Scherze, die Männer drüben mahnten zur Eile, das Mädchen wollte zum Seil greifen. Doch plötzlich hörte die Frau mit dem Lederhut hinter sich allzu bekanntes Gebrüll. Das Jagdgebrüll von Säbelzahntigern. Sie erstarrte. Sie wagte nicht, sich umzublicken.
8
Sozusagen zehntausend Jahre später, gar nicht so weit von der Höllentalklamm entfernt, fünf Speerwürfe vielleicht, las man in der Morgenzeitung die Schlagzeile
SCHÜSSE IM OLYMPIAORT!
Olympiade gefährdet?
Die Überschriften der anderen Blätter gingen in die gleiche Richtung: WILDWEST IN WERDENFELS (mit Fragezeichen), ZOFF IM ZUGSPITZDORF (mit zwei Rufzeichen), DÜSTERES DÄNENDRAMA (ohne alles). Es war ein herrlich klarer Wintermorgen, viele juckte es gleich nach dem Aufwachen in den Fingern, den Beruf des Schlossermeisters oder Oberstudienrats für Latein und Griechisch mal für ein paar Stunden ruhen zu lassen, sich die Bretter anzuschnallen und hineinzugleiten in die Loipen, die Pisten abwärtszuwedeln, rotbackig und modisch bebrillt, Tal um Tal zu durchmessen mit frischem Mute, schwer keuchend, doch glücklich, sich in die angeblich unberührte Natur zu schmiegen. Doch im schlossermeistrigen Fall musste das eiserne Grabkreuz für den alten Lackermeyer Korbinian geschmiedet werden, im anderen, oberstudienrätlichen casus paedagogi musste der Klasse 10 a des Gymnasiums das hexametrische Reimschema der Odyssee eingetrichtert werden, x̄ x x x̄ x x – Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes! – aber so ein Hexameter hat ja auch etwas vom Langlaufen.
So setzte sich der Großteil der Werdenfelser Bevölkerung kleinäugig und schlaftrunken an den Frühstückstisch, griff nach der Zeitung und las quellenlose Spekulationen wie diese, dass es womöglich die verirrte Gewehrkugel eines unachtsamen Jägers gewesen sein könnte, die den Dänen aus dem Rennen geworfen hatte. In einem Kommentar wurde sogar ein politischer Hintergrund angedeutet. Von der späten Rache eines Fundamentalisten an einem Vertreter des Landes der Karikaturenzeichner war da die Rede. Und viele schüttelten beim Frühstück besorgt den Kopf.
»Ein Attentat? Bei uns? Und ausgerechnet beim Neujahrsspringen! Das darf doch nicht wahr sein.«
Nur im Frühstücksraum der Pension Alpenrose, einer stattlichen Villa am Rande des Kurorts, wurden die Nachrichten schweigend aufgenommen. Die beiden unfrisierten Gestalten mit dem pechschwarzen Haar, die dort in einer Nische saßen und Eier köpften, waren unauffällig gekleidet, ihre asiatischen Wurzeln waren unübersehbar. Sie unterhielten sich leise, ein Sinologe hätte auf Südkantonesisch oder Nordkoreanisch getippt, ein Professor Higgins hätte zudem noch den kehligen Min-Yue-Dialekt herausgehört, den man in der Gegend um Chaoyang spricht. Die Frau warf jetzt die Zeitung auf den Tisch.
»Das hat uns gerade noch gefehlt«, zischte sie, doch man sah ihr die Verärgerung überhaupt nicht an. Man sah ihr auch nicht an, dass sie sich beherrschte.
»Was ist los?«, fragte der Mann.
»In der Zeitung wird schon spekuliert. Es gibt eine vage Vermutung, dass der dänische Skispringer beschossen worden sein könnte.«
Der Mann las den Artikel und sagte:
»Jetzt kommt wahrscheinlich irgendein Provinztölpel und ermittelt so lange, bis er was findet.«
»Auch dieses Problem werden wir lösen.«
»Das hoffe ich.«
Der Frühstücksraum füllte sich langsam mit den anderen Pensionsgästen, alle um die Sechzigsiebzigachtzig, angetan mit der neuesten Wintersportmode und bereit für Frischluft und Hüttengaudi. Die meisten waren paarweise da: Männe lud auf, Frauchen wählte den Tisch aus, im Radio dudelte etwas Oberkrainerisches dazu. Die Augen der beiden Chaoyanger leuchteten kohlschwarz, pechschwarz, ebenholzschwarz, Schweinfurter grünschwarz, vielleicht auch jadeschwarz, unergründlich fernöstlich eben.
Die Frau hieß Shan, was Lotusblüte bedeutete. Der Mann hieß Wong, was viel bedeuten konnte. Shan und Wong hatten sich, zusammen mit einem dritten Mann aus Chaoyang, vor ein paar Tagen hier eingemietet, weil sie in der Pension Alpenrose die geeignete Operationsbasis für ihre außergewöhnlichen Pläne gefunden hatten. Es war ein frei stehendes Gebäude, das auf einem kleinen Hügel etwas außerhalb des Kurortes lag. Der Zufahrtsweg war breit, ein zusätzlicher Weg führte um das Haus herum zum rückwärtigen Hof. Dort konnte man mit dem Auto parken und ins Haus gelangen, ohne dass man von der Straße und von den Fenstern und Balkonen des Hauses aus gesehen werden konnte. Vom Parkplatz ging noch ein zusätzlicher Fluchtweg ab, notfalls, quer durch die Wiese, hin zu einer anderen Straße. Auch mit dem Zimmer selbst konnten Shan und Wong mehr als zufrieden sein. Es lag im ersten Stock, hatte drei große Fenster, die einen Blick auf alle vorderen Zufahrts- und Zugangswege garantierten. Die Hausgäste waren württembergische Ministerialsekretäre und mecklenburgische Ex-Pastoren, sie schienen unbeweglich und schwerhörig, wohl nur interessiert an ihrem eigenen geregelten Tagesablauf, nicht an den irgendwie maoistisch aussehenden Feriengästen.
Die Direktrice der Pension Alpenrose, Frau Margarethe Schober, las an der Rezeption meist Heftchenromane mit Titeln wie Gefährliches Verlangen und Wilde Gier. Sie war wohl auch für die gewisse nachlässige Eleganz der Pension zuständig. Das Gästebuch und die Anmeldebögen wurden lax geführt, die Kontrolle der Personalausweise war nicht der Rede wert. Die Pension Alpenrose war ein Eldorado für jeden, der nicht ganz Koscheres im Sinn hatte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: