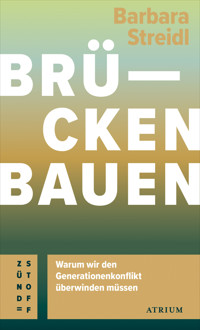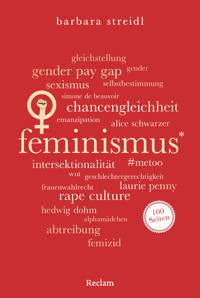
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Reclam 100 Seiten
- Sprache: Deutsch
Die Zukunft ist weiblich »Es genügt nicht, sich gegen die strukturelle Diskriminierung aufgrund von Geschlecht zu stemmen. Es gilt auch, Rassismus und die Benachteiligung aufgrund von sozialer Herkunft oder Alter mitzudenken.« Genderdebatten, #MeToo-Skandale und häusliche Gewalt bewegen die Gemüter – es ist Zeit für mehr Feminismus! Wie können wir in aller Vielfalt gleichberechtigt und sicher zusammenleben? Und was kann der Feminismus dazu beitragen? Barbara Streidl hat ihren Erfolgsband im Lichte aktueller Diskussionen komplett überarbeitet. Ein Buch für alle, die sich eine bessere Gesellschaft wünschen. Mit 4-farbigen Abbildungen und Infografiken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Barbara Streidl
Feminismus. 100 Seiten
Reclam
Für mehr Informationen zur 100-Seiten-Reihe:
www.reclam.de/100Seiten
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
6., komplett überarbeitete Auflage
2019, 2024, 2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung nach einem Konzept von zero-media.net
Infografik: annodare GmbH, Agentur für Marketing
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962376-4
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020541-9
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Zur Einstimmung
Gibt es ›den‹ Feminismus überhaupt?
Die Befreiung der Frau: von Louise Otto-Peters bis zum Zweiten Weltkrieg
Bis heute noch nicht abgeschlossen: die Befreiung der Frau
Gute gegen böse Feministinnen
Die ganze Welt ist feministisch
Zum Ausklang
Lektüretipps
Bildnachweis
Zur Autorin
Über dieses Buch
Leseprobe aus #MeToo. 100 Seiten
Zur Einstimmung
Auf den nächsten 100 Seiten geht es um das Thema Feminismus. Zu Beginn möchte ich Sie einladen, Ihre eigene Haltung kurz zu reflektieren, indem Sie Assoziationen wecken und an Personen oder Ereignisse denken, die Sie mit dem Thema verbinden. Es gibt kein Richtig oder Falsch bei den folgenden zehn Fragen, nur Sie und das, was Sie antworten.
Frage 1: Wann haben Sie zuletzt das Wort »Feminismus« gelesen – bevor Sie dieses Buch in die Hand genommen haben?
Frage 2: Hat der 8. März für Sie eine Bedeutung?
Frage 3: Als das Frauenwahlrecht 1918 in Deutschland eingeführt wurde, war das eine Errungenschaft der Frauenbewegung. Richtig?
Frage 4: Denken Sie an Ihre Mutter: Würden Sie sie als gleichberechtigt in der Beziehung zu Ihrem Vater bezeichnen?
Frage 5: Als Kanzlerin hat Angela Merkel die Bundesrepublik Deutschland sehr geprägt – auch als Frau?
Frage 6: Sind Sie der Meinung, eine Frauenquote sollte auch in privatwirtschaftlichen Unternehmen eingeführt werden?
Frage 7: Dürfen Feministinnen Lippenstift tragen?
Frage 8: Wer Gender Studies als Studienfach belegt, studiert Feminismus an der Uni – richtig?
Frage 9: Ist Alice Schwarzer für Sie ›die‹ deutsche Feministin?
Frage 10: Simone de Beauvoir sagte einmal, dass echte Gleichberechtigung in einem kapitalistischen System nicht möglich sei. Hat sie recht?
Gibt es ›den‹ Feminismus überhaupt?
Von Gleichheits-, Differenz- und Post-Feminismus sowie anderen Ideen, die gemeinsam eine Bewegung bilden
Nein. ›Den‹ Feminismus gibt es nicht.
Das wusste ich aber noch nicht, als ich mit Anfang 20 während meines Germanistikstudiums auf die sogenannte feministische Linguistik stieß. Dass die Grenzen meiner Sprache auch die Grenzen meiner Welt bedeuten, das hatte ich bereits bei Ludwig Wittgenstein gelesen. Dass die deutsche Sprache mich als Frau an vielen Stellen unsichtbar macht – etwa dann, wenn von »Studenten« die Rede ist, ich als »Studentin« aber auch gemeint bin – und dass damit nicht nur meine eigene Welt begrenzt wird, sondern auch die aller anderen, das leuchtete mir ein. Ich sprühte in großen schwarzen Lettern »Frau« an die Außenwand meiner Studentinnenwohnung und begann, mit Sprache zu experimentieren. Die »Krankenschwesterin« sorgte für Lacher in Uniseminaren und öffnete mir die Tür zu Grundsatzdiskussionen über Geschlechtergerechtigkeit.
Heute, rund 25 Jahre nach Abschluss meines Studiums, hänge ich immer noch am Sichtbarmachen von Frauen in der Sprache. Es geht mir längst auch um mehr, um Gleichstellung in der Gesellschaft, in der privaten wie politischen Debatte: Und die ist in Bewegung. Auf Veranstaltungen zu diesem Buch vergleiche ich den Feminismus gerne mit der Donau. »Iller, Lech, Isar und Inn fließen rechts zur Donau hin« – den Spruch kenne ich noch aus meiner Grundschulzeit. Wie die Donau ruht auch der große feministische Strom niemals, wie sie wird er gespeist von vielen Zuflüssen, von Ideen und Beobachtungen, politischen Ereignissen und mutigen Taten. Als ich dieses Buch für die Erstauflage 2019 schrieb, war die Welt eine andere als heute: Angela Merkel hat die politische Bühne nach 16 Jahren Kanzlerinnenschaft verlassen. Das feministische Mindset von Außenministerin Annalena Baerbock prägt die Politik der Folgekoalition, die sich um die Pandemie und deren Nachwehen ebenso wie um die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, den Klimawandel sowie den europaweiten Rechtsruck sorgt. Globale Themen, die einen langen Schatten werfen, bis hinein in den lokalen Denkraum, den ich für den Verein Frauenstudien München mit anderen auf Veranstaltungen und im Podcast Stadt, Land, Krise erschaffe. Sie werden sehen: Die feministische Debatte ist vielstimmig – und durchaus streitbar.
Es gibt und gab also immer schon viele unterschiedliche Feminismen – auf den folgenden Seiten bringe ich Ihnen einige davon näher. Dabei geht es in der Hauptsache um Deutschland ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich skizziere immer wieder Bücher, Ereignisse oder Biografien, auch von außerhalb des Landes. Einige Personen können Sie zum Teil mit exklusiven Zitaten etwas näher kennenlernen: Es sind Menschen, mit denen ich gemeinsam gearbeitet habe, deren Aktivismus ich schätze und die mich auf meinem feministischen Weg begleitet haben und begleiten.
Was ist unter »Feminismus« zu verstehen? Es gibt jede Menge Definitionen. Etwa diese aus dem dtv-Lexikon in 20 Bänden aus dem Jahr 1990, das mir meine Eltern zum Abitur schenkten, noch vor meinem feministischen Erwachen:
Richtung innerhalb der Frauenbewegung, die durch Zusammenschluss nur von Frauen (bei gleichzeitigem bewusstem Ausschluss der Männer) um Gleichberechtigung kämpft.
Ganz anders lautet die Definition der Schauspielerin Emma Watson von 2017:
Feminismus bedeutet, Frauen die Wahl zu lassen.
Klammer auf:
Watson ist Britin – sie sprach von choice, ein Wort, hinter dem sich mehrere Diskussionen verbergen. Im aktivistischen Kontext etwa bedeutet »Pro Choice«, dass Frauen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch haben sollen (seit vielen Jahrzehnten ein wichtiger Punkt auf der feministischen Agenda, siehe Seite 55, 63). Der sogenannte Choice Feminism dagegen bezieht sich auf eine Folge der Serie Sex and the City: In »Time and Punishment«, Staffel 4, Episode 7, beschließt Charlotte, einem Vorschlag ihres Mannes nachzugeben und künftig nur mehr Ehefrau und vielleicht bald auch Mutter zu sein, aber nicht mehr erwerbstätig. Gegen den Widerspruch ihrer Freundinnen sagt Charlotte: I choose my choice – »Ich wähle meine Wah«. Im »Choice-Feminismus« steht also das individuelle Wohlempfinden aufgrund eigener, freiheitlicher Entscheidungen im Vordergrund – was ein attraktives Verkaufsargument sein kann für luxuriöse Beautyprodukte, weiße Brautkleider oder Frauenzeitschriften voller Diättipps.
Klammer zu.
Watson fügte hinzu, dass sie nicht wisse, was ihre Brüste mit ihrem Feminismus zu tun hätten: Die Schauspielerin, die als Darstellerin in den Harry-Potter-Filmen bekannt wurde, erntete heftige Kritik, als sie in einer kunstvollen Fotostrecke im Magazin Vanity Fair eben ihre Brüste zeigte, wenig bedeckt durch eine Art Strick-Poncho. Wie könne sie so etwas machen, fragten viele. Schließlich stehe die Forderung, Frauen sollten nicht mehr auf ihre (makellosen, schlanken, weißen) Körper reduziert werden, ganz oben auf der feministischen Agenda. Emma Watson sagte abschließend:
Feminismus ist kein Stock, mit dem andere Frauen geschlagen werden. Es geht um Freiheit, um Befreiung und um Gleichheit.
Offensichtlich gibt es nicht nur viele Vorstellungen davon, was unter Feminismus verstanden wird, es kursieren auch viele Handlungsanweisungen dafür, wie sich eine Feministin (oder ein Feminist) zu verhalten habe. Dabei geht es um Taten, Worte und auch das Aussehen, die Lebensplanung, die Frage, ob eine heterosexuelle Partnerschaft, gar Ehe, möglich sei, ob Kinder »erlaubt« seien, eine Festanstellung oder eine Taxifahrt mit einem männlichen Fahrer. All diese Vorstellungen und Handlungsanweisungen sind häufig widersprüchlich – sie können das Leben eines Menschen sehr einschränken. Was erstaunlich ist, geht es bei den meisten feministischen Bestrebungen doch um Freiheit. Die US-amerikanische Journalistin Andi Zeisler hat ihren Umgang mit dem Diktum »Wie soll eine Feministin sein?« in Anlehnung an den Choice Feminism (siehe Seite 5) treffend zusammengefasst:
Nicht alles, was eine Feministin tut, ist eine feministische Tat.
Es gibt viele Filme, Romane, Sachbücher, Popsongs oder Kunstwerke, die eine feministische Intention erkennen lassen. In diesen Kästen werden Sie im Folgenden einige dieser Werke kennenlernen – aus Deutschland, aber auch aus den USA, aus Frankreich, Kanada, der Schweiz, aus Schweden, Großbritannien oder Nigeria.
Das wohl bekannteste Buch der feministischen Debatte ist Simone de Beauvoirs Das andere Geschlecht, geschrieben 1949. In diesem über 900 Seiten langen Essay untersucht de Beauvoir (1908–1986) die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es ist eines der Bücher, das wahrscheinlich nicht alle gelesen haben, die daraus zitieren; besonders häufig diesen Satz: »Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu.« De Beauvoir schreibt, dass eine Frau sich als Gegenstück zum vorherrschenden männlichen Prinzip diesem unterzuordnen habe und somit unfrei sei.
Die Philosophin und Autorin, die viele auch als die Partnerin von Jean-Paul Sartre kennen, hat sich dem Existentialismus verschrieben: Die Freiheit des bzw. der Einzelnen steht für sie im Vordergrund. Ihr Buch, das vor allem in der Zeit der zweiten Frauenbewegung (siehe Seite 51), also rund 20 Jahre nach seinem Erscheinen, viel diskutiert werden wird, ist ursprünglich nicht feministisch gemeint. Dennoch legt es den Grundstein zu vielen feministischen Debatten über Gleichstellung, Freiheit und die Frage, ob es Frauen überhaupt gibt: »Von allen wird einmütig anerkannt, dass es innerhalb der menschlichen Spezies ›Weibchen‹ gibt. Sie stellen heute wie ehedem etwa die Hälfte der Menschheit. Und doch sagt man uns, die Weiblichkeit sei ›in Gefahr‹, man ermahnt uns: ›Seid Frauen, bleibt Frauen, werdet Frauen.‹ Nicht jeder weibliche Mensch ist also zwangsläufig eine Frau …«
»Für mich ist sie ein großes Vorbild – und ihr Werk ist zu komplex, als dass es in eine Schublade passen würde«, sagt die Journalistin und Autorin Julia Korbik (* 1988) im Lila Podcast, den ich bis 2019 mit Susanne Klingner und Katrin Rönicke gemacht habe. Korbik hat sich mit mehreren Büchern tief in das Werk von Simone de Beauvoir gegraben:
»Der Feminismus von Simone de Beauvoir lässt sich am besten in ihren eigenen Worten zusammenfassen: ›Feminismus ist eine Art, individuell zu leben und kollektiv zu kämpfen.‹ Das heißt, beim Feminismus geht es um uns als Individuen, aber es geht auch um die anderen.« (Julia Korbik)
Zum Verhältnis von »ich« und »den anderen« gehört eine beliebte Verneinung, das »ich bin zwar keine Feministin, aber…«. Jahrelang verneinte Angela Merkel die »Feministin?«-Frage, bis zu einem Podium 2017 auf dem W20-Frauengipfel in Berlin. Dort fand die niederländische Königin Máxima eine Definition, der sich Merkel dann endlich anschließen konnte, wie sie auch später sagte. Für sie bedeutet Feminismus, »wenn ich dafür bin, dass Männer und Frauen die gleichen Lebenschancen haben«. Schon allein die binäre Aufteilung der Welt in Männer und Frauen macht diese Definition aber für viele angreifbar. Kann es überhaupt ein »wir« unter Feminist:innen geben? Wenn es überhaupt einen gemeinsamen Nenner gibt, dann war das für mich lange Zeit dieser: Niemand darf aufgrund seines Geschlechts diskriminiert werden. In dieser Hinsicht hat sich mein Fokus in den letzten Jahren geschärft, ich habe diese »klassische Position einer weißen Feministin« – ein Vorwurf, der mir nicht selten gemacht worden ist – verlassen. Heute gehe ich nicht mehr davon aus, Menschen wären ausschließlich aufgrund ihres Geschlechts von struktureller Unterdrückung betroffen.
Klammer auf:
Auf dem W20-Frauengipfel in Berlin meldete sich auch First Daughter Ivanka Trump auf die Frage, welche der auf dem Podium Anwesenden denn nun Feministinnen seien. Überraschung! Ihr Feminismus wurde nicht nur aufgrund der töchterlichen Bereitschaft, Donald Trump als »nie frauenfeindlich« zu verteidigen, zu Recht als Fake beschimpft: Die ehemalige Beraterin des Präsidenten der Vereinigten Staaten hält an einer kapitalistischen Lesart fest, und zwar am sogenannten »Lean-in-Feminismus«. Benannt wurde er nach Lean In: Frauen und der Wille zum Erfolg (2013), dem Bestseller von Sheryl Sandberg, jahrelang Geschäftsführerin von Meta Platforms (früher Facebook). Dieses Buch ist eine Art Karriereanleitung für Frauen. Mit Netzwerken, verlässlichen Partnern, mehr Frauen in Führungspositionen und einer bedingungslosen, nimmermüden Leistungsbereitschaft könnten es alle an die Spitze schaffen, verspricht die Autorin. Dass es auch Alleinerziehende gibt und nicht alle Frauen zur weißen Elite gehören, hatte Sandberg leider übersehen, wie sie später zugab.
Klammer zu.
»Bist du eine Feministin?« Eine Frage, in der vieles steckt: Vom Vorwurf über die Herabwürdigung bis hin zum Infragestellen der dafür notwendigen theoretischen Kompetenz ist eigentlich alles möglich. Auch die Hoffnung, eine Verbündete zu finden – oder eine Gegnerin.
Die »Feministin?«-Frage wird häufig gestellt – und auch von Männern beantwortet: This is what a feminist looks like – »so sieht ein Feminist aus«, sagte der frühere US-Präsident Barack Obama über sich selbst, räumte dann jedoch ein, in seinem Haushalt habe er keine andere Wahl gehabt. Manche grenzen sich in ihren Antworten ab: »Ich habe mich immer für feministische Theorie interessiert, aber wirklich überzeugt hat sie mich nie«, meinte die frühere Bundesfamilienministerin Kristina Schröder. Wieder andere vereinbaren das scheinbar Unvereinbare: »Ich trage Make-up – und bin Feministin!«, brüstet sich manche Beautybloggerin und widersetzt sich damit dem vermeintlichen Diktum, dass »die Emanzen« nur mit unrasierten Beinen und ungeschminkten Lippen »echt« seien.
Dass sich Feministinnen vor allem für die Belange und den Schutz von Frauen einsetzen (gemeint sind hier cis Frauen, also Personen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, und nicht etwa trans* Frauen), ist für viele ein weiteres Diktum, gegen das aufbegehrt wird. Die Schauspielerin Emma Watson (siehe Seite 5) etwa distanzierte sich von Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling, als diese mit transfeindlichen Äußerungen auffiel, beginnend mit ihrem Unverständnis für die Bezeichnung people who menstruate – »Personen, die menstruieren«: Eine solche Wortwahl mag dazu anregen, sich das Maul zu zerreißen – aber wichtiger ist es, das dahinter liegende Bedürfnis nach Inklusion zu verstehen: Nicht nur bei Geburt als Frau bezeichnete Menschen können ihre Tage haben.