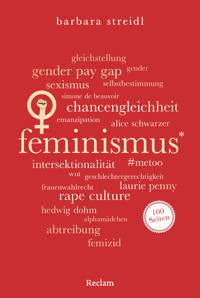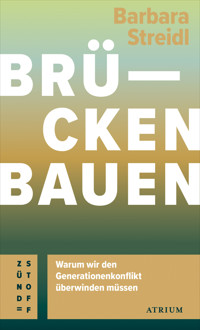
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Atrium Zündstoff
- Sprache: Deutsch
Gemeinsam in die Zukunft statt gegeneinander: ein klares Plädoyer für ein faires Miteinander der Generationen Generationenkonflikte gab es schon immer. Doch der derzeit vorherrschende ist geprägt von einem erheblichen Machtgefälle, während gleichzeitig ein enormer gesellschaftlicher Wandel gestemmt werden muss, wenn wir die Klimakatastrophe abwenden und unsere Zukunft bewahren wollen. Barbara Streidl zeigt, welche Kraft wir freisetzen können, wenn die Generationen ihre Differenzen überwinden und gemeinsam an einem Strang ziehen. Es wird deutlich, dass wir einen neuen Generationenvertrag benötigen, wenn wir die enormen Herausforderungen unserer Gegenwart meistern wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Barbara Streidl
Brücken bauen
Warum wir den Generationenkonflikt überwinden müssen
Copyright © 2024 Barbara Streidl
Originalausgabe
© Atrium AG, Zürich, 2024
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Annemike Werth, Hamburg
© Autorinnenfoto: Denise Stock
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-227-9
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
»Try to make more use of humility and curiosity – these attributes have a softening effect on our sometimes inflexible and isolating value systems. They allow us to remain true to our temporary selves but fluid and playful in our dealings with this strange and ever-changing world.«
»Probiere es mit mehr Demut und Neugier – diese Eigenschaften haben eine besänftigende Wirkung auf unser manchmal unflexibles und isolierendes Wertesystem. Sie erlauben uns, unserem temporären Selbst treu zu bleiben, aber beweglich und spielerisch zu sein im Umgang mit dieser seltsamen und sich ständig verändernden Welt.«
Nick Cave
EinleitungErst mal zuhören, bitte
Kurz bevor ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, ist meine Mutter in die Wohnung über mir gezogen. Mit 19 habe ich mein Elternhaus verlassen, mit 50 lebe ich wieder in einer häuslichen Gemeinschaft mit meiner Mutter – auch wenn wir uns Bad und Küche nicht wie früher teilen. Die Entscheidung dafür haben wir gemeinsam gefällt. Mein Mann und meine Söhne (geboren 2007 und 2011), die mit mir in der Wohnung im ersten Stock leben, hatten natürlich ein Mitspracherecht. Neben der Vernunft, die auf kürzere Wege, leichtere Absprachen, einen Ausweg aus der Alterseinsamkeit und vieles mehr setzt, stimmt heute auch mein Gefühl diesem Schritt zu.
Es ist schön, dass meine Mutter so nah ist. Nach einem anstrengenden Arbeitstag sitze ich gerne auf ihrem Sofa und plaudere mit ihr über die Wunderwelt der Häkelanleitungsvideos im Internet. Sie freut sich, täglich zu uns zum Mittagessen zu kommen, das meist mein Mann kocht, und hat immer einen neuen Zettel mit Fragen dabei: »Kennt ihr den Roman zum Film Die Caine war ihr Schicksal von Herman Wouk?« oder »Helft ihr mir, den Balkon winterfest zu machen?« Mein jüngerer Sohn hat das Lateinlernen in die Wohnung seiner Großmutter verlagert. Mein älterer Sohn hilft bei Computerproblemen und handwerklichen Aufgaben. Und ich versuche Antworten auf Fragen zu finden, recherchiere ärztliche Praxen in der Umgebung und versorge sie mindestens einmal pro Woche mit Spinatpfannkuchen.
Seit meine Mutter im selben Haus lebt wie ich, kann ich noch besser nachvollziehen, wie feindselig die Alltagswelt auf ältere Menschen wie sie wirkt: Termine in ärztlichen Praxen werden fast nur noch online vergeben. Bankfilialen sind rar, auch in der Großstadt. Wer noch die papierenen Überweisungsträger verwendet, muss diese zur Filiale bringen oder per Post schicken und für jeden Auftrag eine Gebühr zahlen. Selbst wenn es darum geht, einen Geschenkgutschein einzulösen, gibt es Stolperfallen: Onlineregistrierung, Zweifach-Authentifizierung, Codeeingaben und zwischendurch noch beweisen, dass man ein Mensch ist und Fahrräder, Brücken oder Zebrasteifen auf pixeligen Fotos markieren kann. Um schließlich einen Umzug zu stemmen – inklusive Ummeldung von Telefon-/Internetanschluss (Onlineformular plus Hotline mit erheblichen Wartezeiten), Besuch im Bürgerbüro (nur mit vorab online vereinbartem Termin) und Austausch mit dem Umzugsunternehmen –, braucht es wirklich einen eisernen Willen und viel Unterstützung. Die konnten wir Kinder und Enkel meiner Mutter geben. Sonst hätte sie es wohl nicht geschafft. Unsere smarte Welt ist nicht nur von Digital Natives[1] bevölkert, das wird mir in solchen Momenten immer wieder bewusst, sondern auch von analogen Alten.
Ob Digitalisierung oder Klimakrise, Pandemie, Bildung oder die Aufteilung von Ressourcen: Der enorme gesellschaftliche Wandel stellt uns vor gewaltige Herausforderungen, die für mehr Zündstoff zwischen den Generationen sorgen als je zuvor. Statt gemeinsam für die Zukunft und einen solidarischen Generationenvertrag zu kämpfen, wimmelt es in unserer Gesellschaft nur so von Vorwürfen zwischen Alt und Jung. Wir hören einander nicht zu, wir reden übereinander statt miteinander oder aneinander vorbei. Und so vertiefen sich die Gräben. Der Generationenkonflikt hat in unserem Krisenjahrzehnt eine neue Dimension angenommen. Es ist höchste Zeit, Brücken zu bauen und die dicken Bretter, die gebohrt werden müssen, gemeinsam zu bohren. Und zwar nicht nur für das Hier und Jetzt, sondern auch für das Morgen und Übermorgen, da die Jungen den Alten zahlenmäßig nicht ebenbürtig sind. Noch 1990 waren 13 Prozent der Einwohner:innen in Deutschland 67 Jahre alt oder älter. 2022 ist schon ein Fünftel in diesem Alter. Im selben Zeitraum ist der Anteil der Jüngeren, unter 20-Jährigen, gesunken: von 22 auf 19 Prozent.[2]
Dass sie weniger sind und mehr im Fokus der Gesamtgesellschaft stehen, das ist den meisten in der jüngeren Generation klar. Sie reagieren darauf, indem sie an vielen Stellen die Spielregeln verändern: Ein Bewusstsein für den Klimawandel ist für sie selbstverständlich und vielen auch bei der Partner:innenwahl wichtig.[3] Überhaupt möchten sich immer mehr Personen zwischen 18 und 24 Jahren nicht auf ein Geschlecht festlegen. Sie betrachten die Aufteilung unserer Welt in »Mann« und »Frau« kritisch und hinterfragen auch die damit einhergehenden Rollenzuschreibungen: Gründen zwei Männer eine Familie, ist nicht gleich klar, wer sich um die Kinder kümmert.[4] Daneben ist die Work-Life-Balance, also ein möglichst harmonisches Gleichgewicht zwischen Erwerbstätigkeit und Privatleben, mehr Mission als Modebegriff für die Jüngeren, was den Älteren häufig auf die Nerven geht.
Bestehendes nicht deswegen zu akzeptieren, weil es besteht: Das ist ein wichtiges Merkmal für jede junge Generation – ebenso wie die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Diese Bereitschaft wurde in der Coronazeit auf eine harte Probe gestellt. Schnell war beschlossen worden, dass die jungen Menschen zurückstecken müssen. Dass ihr Alltagsleben – um die Älteren, die Alten, die Hochbetagten und die Vorerkrankten zu schützen – am konsequentesten zum Stillstand gebracht werden muss. Die Folgen sind noch immer zu spüren.
Eng mit der Pandemie verbunden ist das Thema Bildung, weil in dieser Zeit die größten Schwachstellen des Systems sichtbar wurden: Die Digitalisierung war strukturell und flächendeckend verschlafen worden, Lehrkräfte fehlten oder befanden sich am Ende ihrer Kräfte. Wie unter einem Brennglas zeigte die Pandemie auch, dass race[5]und class[6] einen großen Einfluss auf die Bildungsbiografie haben: Chancengleichheit für alle Schüler:innen fehlt im Klassenzimmer und beim Lernen zu Hause. Dafür braucht es nachhaltige und kompetente Unterstützung vonseiten der Eltern. Die diese aber nicht immer leisten können – und so erben viele den Bildungsstatus ihrer Eltern. Ein Erbe, das teuer werden kann.
Teuer sind auch die Auswirkungen der Klimakatastrophe, die die heutige junge Generation zu erben droht. Mit einer Verfassungsbeschwerde sind zum Teil noch minderjährige Aktivist:innen 2020 nach Karlsruhe gezogen und haben in einem historischen Beschluss Recht bekommen: Nichts Geringeres als die Freiheit gilt es zu schützen! Denn wenn heute zu wenig für den Klimaschutz getan werde, würde das zu drastischen Maßnahmen in der Zukunft führen, so das Gericht.[7] Zuzulassen, dass unsere Freiheit heute die Freiheit von morgen stark einschränkt, das ist nach diesem Beschluss keine Option mehr für die Bundesregierung.
Schließlich geht es noch um die Frage nach dem Erbe, das eine Generation einer nachkommenden überlässt, auch hinsichtlich der gerechten Umverteilung von Besitz. Ähnlich wie im Bereich Bildung ist auch der Wohlstand einer Person stark mit race und class verbunden: Wer dort aufwächst, wo es etwas gibt, hat gute Chancen, davon etwas abzubekommen. Wer das nicht tut, geht leer aus. Somit bleiben die, die nicht erben, deren Eltern keine Häuser oder Unternehmen besitzen, außen vor.
Also: Stoff gibt es genug, um zu streiten. Aber die Voraussetzung für einen guten Streit ist die Bereitschaft, dem Gegenüber mit Respekt zu begegnen. Als Moderatorin von politischen Diskussionen habe ich zahlreiche Gespräche zum Thema Generationenkonflikt begleitet. Häufig sitzt da ein Forscher neben einer Politikerin; beide befinden sich in ihrer Lebensmitte und sind sich darüber einig, was junge Menschen wollen und sollen. Ich schätze ihre Expertise, bedauere dabei aber, dass diejenigen, um die es geht, keine Stimme haben, sondern pauschal eingeschätzt und beurteilt werden. Ja, es ist anstrengend und nicht selten kompliziert, alle an einen Tisch zu bringen und mit derselben Redezeit auszustatten. Aber für ein Miteinander auf Augenhöhe ist das unerlässlich. Nur, wenn die verschiedenen Generationen ihre Differenzen überwinden, können sie gemeinsam in die Zukunft gehen.
In diesem Buch finden Sie deshalb immer wieder Forderungen an Politik und Gesellschaft, die auf den Punkt bringen, was getan werden muss, um den Generationenkonflikt zu überwinden. Einige eignen sich dazu, auf T-Shirts gedruckt zu werden, mit anderen können Sie auf dem nächsten Generationentreffen oder Familienfest Position beziehen. Hier kommt die erste:
Wir müssen respektvoll miteinander umgehen.
Das ist die notwendige Voraussetzung, um Brücken bauen zu können. Brücken über den Graben zwischen Alt und Jung. Brücken, die die Generationen miteinander verbinden. Denn in diesem Krisenjahrzehnt brauchen wir auf Fragen wie diese Antworten, die wir nur gemeinsam finden können: Wo gehen die Jungen hin? Wo gehen wir Älteren hin? Und was wollen wir für die Jüngeren zurücklassen?
Wir müssen den Generationenvertrag neu verhandeln und dürfen uns nicht wegducken vor der Verantwortung für das, was von uns bleibt. Denn unser schönes und bequemes Hier und Jetzt bedeutet eben nicht, dass unsere Kinder und Enkelkinder auch oder noch ein gutes Leben führen können. In Sachen Bildung, faires Wirtschaften und Klimapolitik gibt es längst klare Forderungen, die Alt und Jung gemeinsam skandieren können. Verlassen wir endlich die Komfortzone und stellen uns auf die richtige Seite: die, wo gemeinsam für die Zukunft gekämpft wird.
Kapitel 1»Ok, Boomer« – Angebot zum Brückenbau
Babyboomer, Digital Natives, Gen Z: Diese Begriffe finden sich auch in der Generationenforschung, die abgesehen von populärwissenschaftlicher Auslegung und Volkes Mund nicht immer widerspruchsfrei ist. Ein tiefer Tauchgang in die Wissenschaften würde an dieser Stelle zu weit führen, aber einen kurzen Blick wollen wir wagen. Fangen wir mit Personen an, die alle zur selben Zeit geboren wurden. In der Forschung wird davon ausgegangen, dass diese Personen über ähnliche Erlebnisse und die Möglichkeiten, diese Erlebnisse zu verarbeiten, verbunden sind. Wenn diese Personengruppe dann eine ganz konkrete Erfahrung teilt, zum Beispiel die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, die Terroranschläge am 11. September 2001 oder eben die Coronakrise, dann entsteht eine noch stärkere Verbundenheit. Diese kann die eigene Weltanschauung beziehungsweise die sozialen oder politischen Sichtweisen verändern. Und das kann sich wiederum auf das künftige Denken und Handeln der Personengruppe auswirken.
In diesem Zusammenhang wird oftmals pauschal von einer »generationellen Prägung« gesprochen, also etwas, was eine komplette Personengruppe beziehungsweise eine ganze Generation betreffen kann. Ich glaube aber, dass es trotzdem sinnvoll ist, jeden einzelnen Fall genau zu betrachten. Ein Beispiel: Ein 18-Jähriger, der sich vegan ernährt, wird gern als »politisch« und »typisch für die Gen Z« gesehen. Sein Verzicht auf tierische Erzeugnisse kann aber auch von einer gesamtgesellschaftlichen Veränderung herrühren: dass vegane Lebensmittel für alle in jedem Supermarkt angeboten werden.
Die heute verbreitete Einteilung der Generationen weist jeder Gruppe eine Zeitspanne von rund 15 Jahren zu. In dieser Zeit, so kann die dahinterstehende wissenschaftliche Erklärung zusammengefasst werden, verändern sich die technischen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Bedingungen innerhalb einer Gesellschaft so sehr, dass sich das auch in bestimmter Weise auf die Personen auswirkt, die aufgrund eines ähnlichen Geburtszeitpunkts als Gruppe gelten.
Nehmen wir meine eigene Familie:
Meine Mutter, geboren 1936, zählt zur stillen Generation, zur »vergessenen Generation«[8] beziehungsweise zu den »Kriegskindern« oder den »Nachkriegseltern«. Gehorsamkeit, Disziplin und Anpassung gelten als typische Eigenschaften für diese zwischen 1935 und 1949 Geborenen. Die Zuschreibung, dass es Angehörigen dieser Generation schwerfällt, Speisen wegzuwerfen, kann ich bestätigen: Meine Mutter mag es nicht, etwas auf ihrem Teller zurückzulassen.
Mein Mann, Jahrgang 1967, mein Bruder und ich, geboren 1971 und 1972, gehören zur Generation X. Unser Heranwachsen fand statt, als das Wirtschaftswunder langsam an Strahlkraft verlor. Wir gingen von geringerer ökonomischer Sicherheit aus als noch die Generation davor, die Babyboomer, geboren zwischen 1950 und 1964, zu denen der ältere Bruder meines Mannes (geb. 1960) zählt.
Meine ältere Nichte (geb. 1988) und mein Neffe (geb. 1990) zählen zur Generation Y. Das sind die Digital Natives, die mit digitalen Technologien und dem Internet aufgewachsen sind, geboren zwischen 1980 und 1994. Viele sprechen auch von »Millennials« wegen der Nähe zur Jahrtausendwende beziehungsweise von der »Generation Praktikum«: Viele in dieser Generation haben eine Menge Praktika absolviert, bevor sie ihren Platz auf dem Arbeitsmarkt gefunden haben. Zum Slogan hat dieses Lebensgefühl das Magazin Neon gemacht, das sich an diese Gruppe der »irgendwie Zwanzigjährigen« richtete: »Eigentlich sollten wir erwachsen werden.«[9] Das Magazin wurde 2018 – nach 15 Jahren – eingestellt.
Meine jüngere Nichte (geb. 1999) und mein älterer Sohn (geb. 2007) sind Generation Z, wie die zwischen 1995 und 2010 Geborenen bezeichnet werden. Netzaffin, digitalkompetent, am Klimaschutz als auch am Mainstream orientiert, so lauten gängige Zuschreibungen für die Gen Z.
Mein jüngerer Sohn gehört zur Generation Alpha, wie die Jahrgänge ab 2010