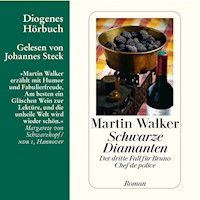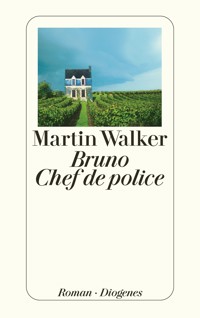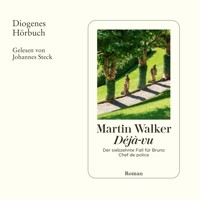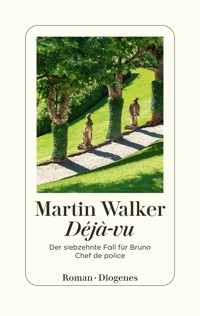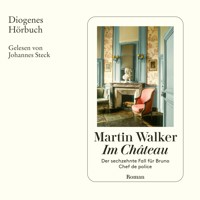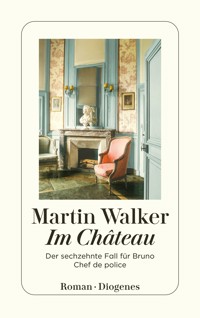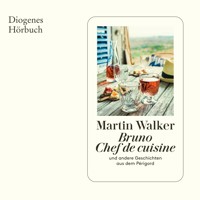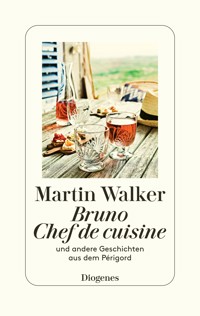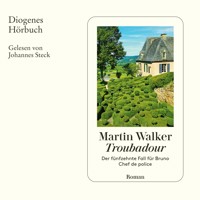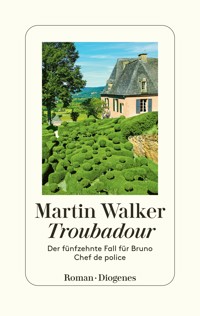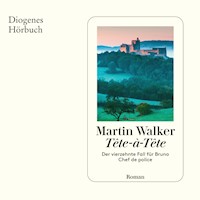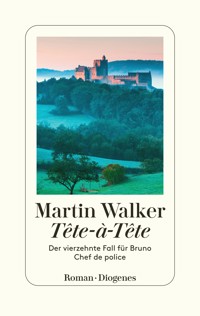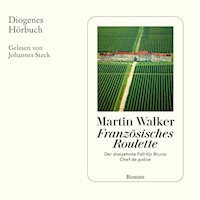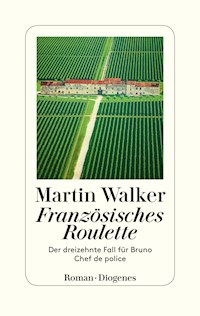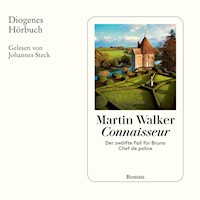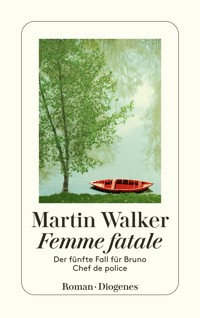
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bruno, Chef de police
- Sprache: Deutsch
Das Périgord ist ein Paradies für Schlemmer, Kanufahrer und Liebhaber des gemächlichen süßen Lebens. Doch im April, kurz vor Beginn der Touristensaison, stören ein höchst profitables Touristikprojekt, Satanisten und eine nackte Frauenleiche in einem Kahn die beschaulichen Ufer der Vézère. Und Bruno, den örtlichen Chef de police, stören zusätzlich höchst verwirrende Frühlingsgefühle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Martin Walker
Femme fatale
Der fünfte Fall für Bruno,Chef de police
Roman
Aus dem Englischen vonMichael Windgassen
Titel der 2012 bei Quercus, London,
erschienenen Originalausgabe: ›The Devil’s Cave‹
Copyright © 2012 by Walker &Watson, Ltd.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2013 im Diogenes Verlag
Covermotiv: Foto von Owen Franken (Ausschnitt)
Copyright © Owen Franken/Corbis/Dukas
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2019
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24293 5
ISBN eBook 978 3 257 60308 8
[5] Für Gabrielleund Michael
[7] 1
Bruno Courrèges, erster und einziger Polizist von Saint Denis, war selten glücklicher über sein Städtchen, als wenn er vom Portal der alten Steinkirche aus einer Probe des Kirchenchors zuhörte. Statt der schlichten weißen Chorhemden, die sie zur feierlichen Messe trugen, waren die Chormitglieder in Alltagskleidung erschienen, weil die Proben in der Regel abends nach der Arbeit stattfanden. Heute aber wurde zusätzlich am Vormittag geprobt, weil Pater Sentout den gewagten Vorschlag gemacht hatte, dass der Chor neben seinem üblichen Repertoire Bachs anspruchsvolle Matthäuspassion einstudieren sollte. Mit ihren Noten standen Bauern und Bäuerinnen neben Schullehrern und Büroangestellten, Kellnerinnen und Geschäftsleuten. Bruno erkannte alle, auch auf die Distanz, schon an ihrer Kleidung, und durch die vertrauten Choräle, die sie sangen, fühlte er sich in die Jahre im kirchlichen Waisenhaus zurückversetzt – die vielleicht einzige schöne Erinnerung, die er mit jener Zeit verband.
An diesem frühen Samstagmorgen zwei Wochen vor Ostern waren fast alle vierundzwanzig Chormitglieder versammelt. Die ersten Bankreihen der Kirche waren voller Mäntel und Einkaufskörbe, mit denen sie später auf den Markt gehen würden, der draußen auf der Straße gerade aufgebaut wurde. Eben erklangen die ersten Töne des Chorals »Sehet [8] ihn als wie ein Lamm«. Der Straßenlärm hinter Bruno schien abrupt zu verstummen, als Florence mit ihrem hellen Sopran einsetzte und damit das Kirchenschiff erfüllte. Bruno wusste, dass eigentlich zwei Chöre und zwei Orchester für eine Aufführung dieses Oratoriums nötig waren, doch musste Saint-Denis mit seiner verlässlichen Orgel und dem kleinen Grüppchen begeisterungsfähiger Sängerinnen und Sänger vorliebnehmen, allen voran Pater Sentout, dessen Liebe zur Chormusik nur noch von seiner Leidenschaft für Gaumenfreuden und die städtische Rugbymannschaft erreicht wurde. Damit, so dachte Bruno, eignete er sich wie kaum ein anderer zum Priester dieser kleinen Gemeinde im gastronomischen und sportlichen Herzland Frankreichs.
Hinter dem Hügelkamm im Osten von Saint-Denis ging eben die Sonne auf, schien durch die bunten Bleiglasfenster und warf blaue, goldene und rote Strahlen ins Kirchenschiff, in dem Pater Sentouts schwarze Soutane nun besonders hervorstach. Brunos Augen richteten sich jedoch unwillkürlich auf Florence, die zu ihrem weißen Kleid einen hellroten Schal trug. Mit hocherhobenem Kopf und ohne je in die Noten schauen zu müssen, sang sie ihr Solo, und ihr blondes Haar schimmerte im Sonnenlicht wie ein Heiligenschein.
Bruno beglückwünschte sich im Nachhinein, dass er ihr eine Anstellung als Naturkundelehrerin am hiesigen collège vermittelt hatte. Als Lehrerin hatte sie auch Anspruch auf eine von der Schule finanzierte Wohnung auf dem Schulgelände, die groß genug war für eine geschiedene junge Mutter mit zwei kleinen Kindern, Zwillingen. Florence war eine willkommene Bereicherung für Saint-Denis und vor [9] allem auch für den Chor, denn ohne sie hätte Pater Sentout wahrscheinlich nicht gewagt, die Matthäuspassion einzustudieren.
Erst jetzt schien Florence Bruno ganz hinten im Mittelgang zu bemerken. Sie lächelte und nickte ihm zu. Auch andere aus dem Chor hoben zum Gruß die Hand, doch Bruno, der plötzlich sein Handy am Gürtel vibrieren spürte, ging widerwillig nach draußen, um den Anruf anzunehmen.
»Bruno, ich bin’s, Marie.« Sie leitete das Hôtel de la Gare neben dem inzwischen verwaisten Bahnhof, denn die französische Eisenbahn hatte viele ländliche Strecken stillgelegt, um noch mehr Geld in ihre Hochgeschwindigkeitszüge investieren zu können. »Ich soll dir von Julien Devenon ausrichten, er habe eine nackte Frau in einem Boot den Fluss heruntertreiben sehen.«
Ihre Stimme klang genervt. Bruno dachte an Julien, der in einem kleinen Gehöft auf der anderen Flussseite wohnte und wahrscheinlich auf dem Weg in die Stadt wie schon sein Vater und seine Großväter die Abkürzung über die Eisenbahnbrücke und dann den Gleisen entlang zum Bahnhof genommen hatte. Der Chef de police schmunzelte bei der Vorstellung, wie dem Jungen, der gerade in die Pubertät kam, beim Anblick einer nackten Frau fast die Augen aus dem Kopf gefallen sein mussten. Eine nackte Frau zu dieser Jahreszeit war beunruhigend, denn so früh im April gingen trotz des schönen Frühlingswetters noch nicht einmal die holländischen, deutschen oder skandinavischen Touristen sonnenbaden, die sonst gewöhnlich bei der erstbesten Gelegenheit ihre Hüllen fallen ließen.
»Julien war auf dem Weg zum lycée in Périgueux und [10] wollte seinen Zug noch erreichen«, fügte Marie hinzu. Und dann, mit gesenkter Stimme: »Er glaubt, sie ist tot.«
»Steht Julien noch am Bahnhof?«, fragte Bruno, das Bild des Jungen vor Augen, wie er mit Feuereifer sein Rugbytraining durchführte.
»Nein, er ist schon im Zug. Aber er wollte unbedingt, dass ich dir Bescheid gebe. Er hätte dich auch selbst angerufen, aber sein Vater hat ihm das Handy abgenommen.«
Wahrscheinlich nicht ohne Grund, dachte Bruno.
»Wann genau hat er das Boot gesehen? Erst vor wenigen Minuten?«, fragte er und versuchte auszurechnen, wie lange es dauerte, bis ein treibendes Boot die große Steinbrücke von Saint-Denis erreicht haben würde, wo man es wohl am ehesten abfangen und ans Ufer ziehen konnte.
»Er ist von der Brücke direkt zu mir gerannt und gleich darauf in den Zug gesprungen. Ich habe sofort zum Hörer gegriffen. Das Ganze ist höchstens drei Minuten her.«
Bruno beendete das Gespräch und eilte die Rue de Paris entlang, vorbei an Marktständen und an Lieferwagen, die entladen wurden. Die ausgestreckten Hände und zum Küssen angebotenen Wangen ignorierte er diesmal. Er duckte sich rasch unter langen Stoffballen hindurch, wich Männern mit riesigen Käserädern auf den Köpfen aus und schlängelte sich zwischen Handkarren mit frischem Gemüse durch, während er über den Rathausvorplatz auf die Brücke zulief. Kaum hatte er sie erreicht, vibrierte wieder sein Handy, und diesmal war es Pierrot, der ihn sprechen wollte, ein passionierter Angler.
»Du glaubst nicht, was ich gerade auf dem Fluss gesehen habe«, begann er.
[11] »Eine tote Frau in einem Boot. Ich hab’s schon gehört. Wo bist du gerade?«
»Beim Campingplatz, gleich neben dem Kräutergarten am Steilufer. An der Flussbiegung stehen die Forellen und …«
»Wie schnell treibt das Boot?«, unterbrach Bruno.
»In fünf Minuten wird es an der Brücke sein, vielleicht auch ein bisschen später«, antwortete Pierrot. »Es ist einer dieser alten Flachbodenkähne, wie man sie nur noch selten sieht, und er ist voller Wasser. Die Frau liegt mit ausgebreiteten Armen splitterfasernackt auf dem Rücken. Ich glaube, sie ist tot.«
»Wir werden sehen. Danke, Pierrot«, sagte Bruno und klappte sein Handy zu. Vom Brückenkopf aus blickte er blinzelnd flussaufwärts über das in der Sonne glitzernde Wasser. Das Boot war nicht zu sehen. Er hatte also noch etwas Zeit und drückte die Kurzwahlnummer der Klinik, um mit Fabiola zu sprechen.
»Sie ist heute nicht da«, sagte Juliette vom Empfang. »Irgendein Privatpatient hat sie gerufen. Den Namen habe ich noch nie gehört. Ich verbinde Sie mit Doktor Gelletreau. Er hat Bereitschaft.«
»Nicht nötig«, entgegnete Bruno und eilte mit dem Handy am Ohr auf die Kirche zu, wieder im Zickzackkurs um die Händler herum, die weiter ihre Stände aufbauten. »Ich muss Schluss machen. Sagen Sie dem Doktor einfach, er soll zur Steinbrücke kommen. Es scheint, dass eine Leiche im Fluss treibt. Ich treffe ihn dort.«
Er brauchte Antoine mit seinem Kahn, und Antoine sang im Chor. Bruno schlüpfte durch die kleine Tür, die in das große, altertümliche Holztor eingeschnitten war, und staunte [12] nicht schlecht über den vollen Klang des Chors, dessen eine Hälfte »Sehet!« sang, worauf die andere fragte »Wen?«.
Unmittelbar bevor Florence zu ihrem Solo »O Lamm Gottes unschuldig« anheben konnte, trat Bruno nach vorn und tippte Pater Sentout auf die Schulter. Der Chorgesang verstummte abrupt, doch die Orgel spielte weiter. Pater Sentout öffnete die Augen und blinzelte verblüfft über Brunos Erscheinen.
»Tut mir leid, Vater, wir haben einen Notfall«, erklärte Bruno laut genug, um die Orgel zu übertönen. »Möglicherweise steht ein Menschenleben auf dem Spiel. Ich brauche ganz dringend Antoine.«
Mit einem letzten Seufzer aus ihren Pfeifen verstummte nun auch die Orgel.
»Sie wollen meinen Jesus?«, fragte der Priester irritiert.
Bruno schluckte und versuchte, sich auf die Frage einen Reim zu machen, aber dann fiel ihm ein, dass Antoine mit seinem prächtigen Bass den Jesus-Part sang.
»Auf dem Fluss treibt ein Kahn, mit einer vermutlich toten Person darin. Antoine muss mir helfen, sie zu bergen«, sagte Bruno und richtete seine Worte nicht nur an Pater Sentout, sondern an den ganzen Chor.
»Ich habe kein Kanu hier«, entgegnete Antoine. Er kam aus der Apsis und griff nach seiner Jacke, die auf der ersten Bank lag. Er war ein stämmiger Mann mit vom jahrelangen Rudern breiten und muskulösen Schultern. »Meine Kanus sind alle auf dem Campingplatz.«
»Ich brauche dich trotzdem«, sagte Bruno und führte ihn hinaus und durch das immer dichter werdende Gedränge auf dem Markt hinüber zum Fluss, gefolgt, wie er bemerkte, [13] von den meisten Chormitgliedern einschließlich Pater Sentouts.
Passanten und Händler wurden aufmerksam und schlossen sich ebenfalls dem Zug an, neugierig wie jede Menge, die ein Drama wittert. Sie alle stauten sich vor der Brücke, als Bruno und Antoine den fast gesunkenen Kahn entdeckten, der langsam kreisend von der Strömung herangetrieben wurde.
»Möglich, dass er von der Sandbank aufgehalten wird«, sagte Antoine. »Wenn nicht, müssen wir runter zum Campingplatz und ein Kanu zu Wasser lassen, um ihn rauszuziehen.«
»Könnte ich nicht in den Fluss waten und ihn abfangen?«, fragte Bruno.
»Lieber nicht«, antwortete Antoine und rechtfertigte damit nachträglich Brunos Entscheidung, die Chorprobe zu unterbrechen und ihn um Hilfe zu bitten. »Sieh mal da vorn, die Strömung unter dem ersten Brückenbogen. Da ist der Fluss am tiefsten. Du würdest bis zum Hals versinken oder noch weiter. Und dann hättest du keinen Halt mehr, um den Kahn ans Ufer zu ziehen.«
Immer mehr Leute liefen herbei und reckten die Hälse, um einen Blick auf den Kahn zu erhaschen, der langsam näher kam. Zwischen all den fuchtelnden Armen und Händen war auch die Kamera von Philippe Delaron zu sehen, dem Betreiber des Fotoladens, der nebenbei als Reporter für die Sud-Ouest arbeitete. Bruno stöhnte innerlich. Eine nackte Leiche in einem Boot war schlimm genug. Dass nun auch noch ein gruseliges Foto davon in der Zeitung erscheinen würde, wäre bestimmt nicht im Sinne des [14] Bürgermeisters, der sich um ein beschauliches Image seiner Stadt bemühte.
»Das ist ja ein Stechkahn«, sagte Antoine und klang überrascht. »Ich dachte, die gäbe es längst nicht mehr. Früher, vor der Eindämmung des Flusses, als noch jedes Frühjahr weite Uferteile überschwemmt wurden, hat man von solchen Kähnen aus Wasservögel gejagt.«
»Sollten wir jetzt nicht lieber zum Campingplatz fahren und ein Kanu holen?«, fragte Bruno, den es drängte, irgendetwas zu tun.
»Warten wir noch ein bisschen. Mal sehen, ob der Kahn die Brücke passiert«, erwiderte Antoine und steckte sich eine gelbe Zigarette an, eine Gitanes. Bruno hatte fast vergessen, dass die immer noch hergestellt wurden. »Wenn er untergeht, hat es keinen Sinn, und vielleicht bleibt er ja auch auf der Sandbank hängen. Anderenfalls hätte ich eine Idee. Komm mit!«
Antoine bahnte sich einen Weg durch die Menge. Mit Bruno im Schlepptau stieg er über die steilen schmalen Steinstufen von der Brücke hinab zum Anleger, wo das alljährliche Wettangeln stattfand. Drei Angler saßen dort auf ihren Klappstühlen. Sie starrten auf ihre Schwimmer und linsten gelegentlich zu ihren Nachbarn hinüber, um zu sehen, ob diese mehr Glück hatten. Der Menge auf der Brücke schien keiner von ihnen Beachtung zu schenken.
»Patrice, könntest du deine Schnur auf den Kahn auswerfen, der da angetrieben kommt, und versuchen, ihn an Land zu ziehen?«, fragte Antoine den ersten Angler.
Als Patrice sich halb zu ihnen umdrehte, hatte er einen verkniffenen Mund und nuschelte etwas Unverständliches.
[15] »Wie bitte?«, fragte Bruno.
Patrice öffnete den Mund und holte drei dicke, sich windende Maden hervor. Bruno wusste von dem Baron, mit dem er gelegentlich angeln ging, was es damit auf sich hatte. Früh am Morgen, wenn es noch kühl war, wurden Maden schnell träge. Fische aber ließen sich nur von denen anlocken, die am Haken kräftig zappelten. Um sie warm und lebendig zu halten, legten passionierte Angler sie unter die Zunge – für Bruno völlig undenkbar, weshalb aus ihm nie ein richtiger Angler werden würde.
»Dann geht mein Köder verloren, vermutlich auch der Haken mitsamt der Schnur«, entgegnete Patrice und legte die Maden zurück in die alte Tabaksdose, in der er seine restlichen Köder aufbewahrte. In die Sonne blinzelnd, setzte er nach einer kurzen Pause nach: »Was hast du überhaupt mit diesem Kahn zu schaffen, Bruno?«
»Es liegt eine Frauenleiche darin. Angeblich ist sie auch nackt«, antwortete Bruno. Patrice war ein kleiner, krummer Mann, seit vierzig Jahren mit einer sehr viel größeren Frau mit entsprechend lautem Stimmorgan verheiratet. Wahrscheinlich, dachte Bruno, erklärte das, warum Patrice einen Großteil seiner Zeit mit seiner Angel am Flussufer zubrachte.
»Ich würde es ja selbst versuchen, aber mit der Rute geht keiner so geschickt um wie du«, sagte Bruno. Während seiner Militärzeit hatte er gelernt, dass man mit kleinen Schmeicheleien aus einem widerwilligen Rekruten am schnellsten einen begeisterten Freiwilligen machen konnte.
Auf der anderen Flussseite schoss ein schnittiger weißer Sportwagen mit heruntergeklapptem Verdeck aus der Kurve hinter der Klinik hervor und raste auf das Ufer zu, wo die [16] Wohnwagen parkten. Beim scharfen Abbremsen wirbelten Kieselsteine auf, und ein blonder junger Mann sprang heraus, der mit seinem weißen Sporthemd und der cremefarbenen Hose wie zu einem Tennismatch vor achtzig Jahren ausstaffiert war. Schon lief er auf den Fluss zu und zog sich dabei das Hemd aus. Am Ufer angekommen, entledigte er sich auch noch der weißen Tennisschuhe.
»Der spinnt«, sagte Antoine und drückte seine Zigarette aus. »Der will tatsächlich ins Wasser!«
Nun entstieg dem Wagen noch eine zweite Gestalt, eine Frau mit erstaunlich langen Beinen, die in schwarzen Leggins steckten. Darüber trug sie etwas, das wie ein weißes Herrenhemd aussah und in der Taille mit einem schwarzen Schal zusammengefasst war. Sie hatte ein blasses Gesicht und einen schwarzen Turban um den Kopf. Ihre Bewegungen waren so anmutig, dass Bruno unwillkürlich an eine Ballerina denken musste. Sie ging auf den blonden Mann am Ufer zu. Beide blickten flussaufwärts und schienen den Kahn abpassen zu wollen. Als der Mann ins flache Wasser watete, winkte Bruno mit beiden Armen und forderte ihn mit lauter Stimme auf umzukehren.
Patrice hatte seine Angelschnur eingeholt, Köder und Schwimmer entfernt und befestigte gerade seinen größten Haken. Dabei blickte er immer wieder zu dem Kahn hinüber, um dessen Geschwindigkeit einschätzen zu können.
»Ich wäre so weit«, sagte er. »Geh einen Schritt zur Seite, Bruno! Ich hole jetzt ganz weit aus!«
Von seinem Standort aus konnte Bruno nichts von einer toten Frau sehen, wohl aber einen schwarzen, rund einen Meter hohen Gegenstand, der in der Mitte des Kahns wie ein [17] kurzer Mast aufragte. Antoine zuckte bloß mit den Schultern, als Bruno fragte, was das wohl sein mochte.
Der Kahn schrammte die Sandbank, wurde langsamer und drehte seinen Bug auf das gegenüberliegende Ufer zu. Die Menge oben auf der Brücke johlte, und es waren Pfiffe zu hören, als der Fremde weiter ins Wasser hineinwatete, wohl in der Hoffnung, die Sandbank zu erreichen. Es gelang ihm aber nicht, denn schon versank er in den Fluten. Als er wieder hochkam, schüttelte er das Wasser aus den Haaren und kraulte mit kräftigen Armbewegungen auf den Kahn zu.
Dieser wurde jedoch plötzlich von einer Welle erfasst, löste sich von der Sandbank und trieb mit der Strömung auf das gegenüberliegende Ufer zu, an dem Bruno stand. Patrice holte mit der Rute aus und schleuderte den Haken hoch und weit über den Fluss. Bruno sah, wie die Schnur sich durch die Luft schlängelte, gezogen von Haken und Senkblei, und kurz hinter dem Kahn aufs Wasser traf.
»Ich hab ihn«, flüsterte Patrice mit angehaltenem Atem.
Der Mann im Wasser hielt plötzlich inne. Er hatte inzwischen die Sandbank erreicht, kletterte hinauf und sah den Kahn außer Reichweite davontreiben. Mit einem weiten Hechtsprung stieß er sich von der Sandbank ab, als wollte er den Kahn nicht nur erreichen, sondern gleich darin landen. Mit einer Hand bekam er die Heckspitze zu fassen, worauf der Kahn bedrohlich hin und her schaukelte und noch mehr Wasser in sich aufnahm.
»Der Blödmann bringt das Boot noch zum Kentern«, stieß Antoine ärgerlich hervor.
Während der Kahn bedrohlich weiterschaukelte, sah Bruno [18] nun zum ersten Mal die Frau. Ihr blondes Haar schimmerte im Sonnenlicht, die Arme waren ausgestreckt, und der Kopf rollte mit der Bootsbewegung hin und her. Irgendein Gegenstand, der im eingedrungenen Wasser schwamm, blitzte auf, eine Flasche, wie es schien. Auf dem Oberkörper der Frau waren Zeichen zu erkennen, die auf die Distanz wie eine große Tätowierung aussahen. Das, was wie ein Stummelmast ausgesehen hatte, war umgefallen.
Der junge Mann tauchte im Wasser unter, seine Hand rutschte vom Dollbord. Vorsichtig versuchte Patrice die Schnur einzuholen und den Kahn an Land zu ziehen. Aber plötzlich stemmte sich der Schwimmer wieder aus dem Wasser, fast wie ein Wal, um in einem letzten, verzweifelten Versuch das Boot zu erreichen. Wieder konnte er den Bootsrand zwar berühren, sich aber nicht daran festhalten. Der Kahn schaukelte noch mehr, als der Mann ins Wasser zurückfiel.
Die Frau auf der anderen Uferseite kehrte zum Cabrio zurück, startete den Motor und wendete den Wagen. Dann stieg sie wieder aus, ließ aber den Motor laufen und eilte mit einem Handtuch, das sie von der Rückbank holte, auf den Mann im Wasser zu.
»Dieser Idiot hat meine Schnur zerrissen«, spuckte Patrice verächtlich aus, während der Kahn wieder Fahrt aufnahm und in der starken Strömung auf die Brücke zutrieb. »Mein bester Haken ist futsch, und so schnell kann ich keinen neuen aufziehen. – Tja, mehr kann ich leider nicht für dich tun, Bruno.«
[19] 2
Bruno bat Dr.Gelletreau, ihnen mit seinem Wagen zu folgen, und machte sich mit Antoine auf den Weg zum Campingplatz mit dem kleinen Strand davor, von dem die Kanus ablegten, die er an Touristen vermietete. Bruno fuhr durch den schmucken Torbogen mit den Steinlöwen, die zu beiden Seiten Wache hielten, und überquerte den Platz, wo bereits die bunt lackierten Sprungschanzen für den Geschicklichkeitswettbewerb aufgestellt waren. Vier Zelte ließen erkennen, dass die Campingsaison schon begonnen hatte. Bruno stellte den Wagen ab und ging über die offene Terrasse auf das Bootshaus zu, in dem Antoine Kanupaddel und Schwimmwesten aufbewahrte und für seine Gäste gelegentlich Omeletts und Würstchen zubereitete. Kaum hatten sie den Schuppen betreten, reichte Bruno ihm eine Schwimmweste, schnappte sich zwei Stechpaddel und wollte sofort zum Ufer gehen. Antoine aber hatte sich schon hinter seinen Tresen gestellt. Eine gerade angesteckte Gitanes klebte an seiner Unterlippe, und er kratzte sich durch sein dichtes graues Haar den Kopf, während er mit der freien Hand ein Chaos von Papieren – seine Buchführung – beiseitewischte und nach einer Flasche griff, um sich einen Ricard einzuschenken.
»Wir haben noch Zeit«, sagte er. »Zehn, fünfzehn [20] Minuten mindestens, bis der Kahn hier antreibt. Willst du auch einen?« Er zeigte auf den Ricard und öffnete den Kühlschrank, um eine mit Wasser gefüllte Weinflasche herauszuholen. Der Zigarettenrauch ließ ihn blinzeln. Abgesehen von seinem eher dunklen Teint war Antoine dem Äußeren nach nicht gerade die optimale Besetzung als Jesus, aber in Saint-Denis hatte nun einmal niemand einen so sonoren Bass wie er.
»Danke, ist für mich noch ein bisschen zu früh«, antwortete Bruno. »Aber wenn du einen Orangensaft für mich hättest?«
»Bedien dich!«, sagte Antoine, gab einen Schluck Wasser in seinen Ricard und ließ sich den ersten Aperitif an diesem Tag schmecken. Auf dem Fluss brauchte man zum Glück nicht damit zu rechnen, ins Röhrchen pusten zu müssen, dachte Bruno.
»Hast du dieses Tattoo gesehen?«, fragte er.
»Ach, war das ein Tattoo?« Antoine zuckte mit den Schultern. »Es war nicht so richtig zu erkennen. Sah irgendwie geometrisch aus, Dreiecke oder so. Ich hab’s nur flüchtig gesehen, und als dieser Esel das Boot zum Schaukeln brachte, dachte ich zuerst, er wollte es versenken.«
»Ich vermute, er wollte helfen«, entgegnete Bruno. »Irgendwie kam er mir bekannt vor, aber ich kann mich nicht erinnern, wo er mir schon mal über den Weg gelaufen ist.«
»An das Mädchen, das bei ihm war, würde ich mich mit Sicherheit erinnern«, sagte Antoine augenzwinkernd. »Beine bis zu den Schultern. Auch der Wagen war nicht übel.« Er leerte sein Glas und ging voraus zu dem kleinen Strand, an dem mit Paddelbooten voll beladenen Anhänger vorbei. Bei [21] Bedarf stopfte er seine Gäste in seinen verbeulten Renault Espace und schleppte die Boote flussaufwärts nach Les Eyzies, Saint-Léon oder sogar bis nach Montignac, von wo aus die Touristen mit der Strömung zurückpaddeln konnten. Antoine zeigte auf das erste der roten Kanus, die mit dem Boden nach oben vor dem Strand aufgereiht waren. Ein Schlauch und eine Bürste, die danebenlagen, ließen vermuten, dass er sie gerade vom Staub befreit und für die neue Saison in Schuss gebracht hatte.
»Wir nehmen das da!«, sagte er mit Blick auf sein größtes Kanu, in das ein halbes Dutzend Paddler passte. Es bestand aus festem Polyester, dem es nichts ausmachte, wenn der Boden in seichtem Wasser über Steine schrammte. Mit seinen großen Schwimmkammern an Bug und Heck, die auch als Sitze dienten, war es so gut wie unsinkbar. »Ich hole nur schnell ein Seil und einen Haken, mit dem wir den Kahn abschleppen können«, sagte Antoine.
Bruno stieg aus seinen Stiefeln, zog Socken, Hose und die Uniformjacke aus, legte die Schwimmweste an und schleppte das Kanu über den Strand ins Wasser. Der Fluss war für Motorboote gesperrt und für Segler zu schmal, weshalb nur Paddelboote zum Einsatz kamen. Manche Angler setzten batteriegetriebene Außenbordmotoren ein, mit denen sie flussaufwärts fahren konnten, wenn die Strömung nicht zu stark war. Der Sand, den Antoine in jedem Frühjahr ankarren ließ, um seinen Strand damit neu aufzuschütten, sah noch frisch aus und war, wie Bruno fand, angenehm kühl unter den Füßen. Das Wasser im Fluss würde jedoch noch bitterkalt sein, und darin zu schwimmen, wie es der junge Cabriofahrer getan hatte, war wohl alles andere als angenehm.
[22] Antoine knotete das Ende seines Seils um einen Bügel am Bug des Bootes, das sie dann gemeinsam ins Wasser schoben, bis sie knietief darin versanken. Bruno schwang sich auf den Sitzplatz im Heck, damit Antoine vorn ungehindert mit seinem Seil hantieren konnte. Die Strömung war hier recht stark und verlangte einen beständigen Paddeleinsatz, um in Ufernähe zu bleiben. Antoine tauchte sein Paddel tief ein und legte ein schnelles Tempo vor, um sein Kanu flussaufwärts zu bringen. Er würde Zeit brauchen, um das Seil am Kahn zu befestigen, erklärte er. Anderenfalls würden sie am Strand vorbeitreiben, und das mit einem havarierten Kahn im Schlepptau, der jederzeit sinken könne. Das Holz, so fügte er hinzu, sei sehr wahrscheinlich morsch, denn ein solches Boot habe man schon seit mindestens vierzig Jahren nicht mehr auf der Vézère gesehen.
Die Brücke von Saint-Denis war nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt. Aber vom weiter flussaufwärts gelegenen Montignac bis hinunter nach Limeuil, wo die Vézère in die größere Dordogne mündete, mäanderte der Fluss in langgezogenen Schleifen und engen Kehren durch fruchtbare Talauen. Früher waren sie im Frühling und Herbst regelmäßig überflutet und in eine weite Sumpflandschaft verwandelt worden, die eine Vielzahl von Enten und Gänsen angelockt hatte – ein Paradies für Jäger und all diejenigen, die foie gras herstellten. Inzwischen war der Fluss längst gezähmt, aber die Wildvögel suchten ihn nach wie vor auf. Mit jeder Frühjahrsflut wurden die Ufer in den Flusskehren immer weiter ausgewaschen und damit die Kehren selbst immer größer.
»Da sind die beiden ja schon wieder«, rief Antoine und [23] zeigte auf die Einfahrt zum Campingplatz, in die das weiße Cabrio gerade eingebogen war, gefolgt von Dr.Gelletreaus großem alten Citroën. Die junge Frau winkte. »Scheint ja eine echte Nervensäge zu sein, der Typ. Wer so einen Wagen fährt, wird bei mir bestimmt kein Zelt aufbauen wollen.«
Bruno hob kurz das Paddel, um auf den Gruß zu antworten, ehe der Wagen hinter der Hecke verschwand und auf den Parkplatz zusteuerte. Den Blick wieder nach vorn gerichtet, versuchte er, sich den erfahrenen Paddelschlägen Antoines anzupassen, der das Kanu flussaufwärts steuerte. Unter anderen Umständen hätte der Chef de police die Bootspartie genossen. Das Sonnenlicht fiel durch grün ausschlagende Bäume und brach sich glitzernd in den Wellen des seichten, plätschernden Wassers am Gleitrand der weiten Flussbiegung. Linker Hand ragten die hohen Kreidefelsen mit ihren Höhlen auf, von denen manche mit ihren Ritzzeichnungen und Wandgemälden von den künstlerischen Fähigkeiten jener Urahnen zeugten, die schon vor zigtausenden Jahren diesen Teil Frankreichs besiedelt hatten. In anderen Höhlen waren noch Reste mittelalterlicher Festungsmauern zu sehen, in denen die Anwohner vor marodierenden Engländern Zuflucht gesucht hatten.
»Da ist der Kahn«, rief Antoine, ohne sich zu Bruno umzudrehen. Er kniete im Bug und griff nach dem aufgerollten Seil. »Halt das Boot auf Kurs und versuch, so nahe wie möglich heranzukommen.«
Von dem Kahn, der tief im Wasser liegend auf sie zutrieb, war nicht mehr viel zu sehen, nur noch der Rand des Dollbords. Als er in Reichweite war, streckte Antoine einen Arm aus und langte nach der Bootswand. »Allmächtiger«, [24] murmelte er mit Blick auf die Frau. Ein Vogel, der auf ihr gehockt und gepickt hatte, flatterte verschreckt auf. Am hinteren Ende des Kahns entdeckte Antoine einen verrosteten Eisenring. Geschickt fädelte er sein Seil hindurch und verknotete es notdürftig.
»Das müsste reichen«, sagte er. »Aber zum Abschleppen ist der Kahn zu durchgeweicht. Wenn wir jetzt nicht Acht geben, geht er womöglich unter. Wir sollten ihn vorsichtig mit der Strömung zum Strand hin lenken.«
Die Frau konnte unmöglich noch am Leben sein. Sie war fast vollständig von Wasser überspült, nur die Brüste, das Gesicht und die Fußspitzen ragten daraus hervor. Die Haare fächerten sich wogend hinter ihrem Kopf, und die Hände schienen mit den Wellen zu spielen. Der Vogel hatte sich über ihr linkes Auge hergemacht, das andere starrte ausdruckslos zum Himmel empor. Dass die Frau sehr schön gewesen sein musste, war unverkennbar. Sie hatte eine makellose Haut und ein ebenmäßiges Gesicht. Nase und Kinn waren wohlgeformt, die Wangenknochen ausgeprägt. Bruno glaubte, einen leichten Brandgeruch wahrzunehmen und etwas Öliges, das an Paraffin erinnerte. Neben der Leiche schwamm eine leere Wodkaflasche.
Mit geübten Paddelschlägen steuerte Antoine das Boot quer zur Strömung auf den Strand zu, stieg dann im flachen Uferwasser aus und zog den Kahn auf den Sandstreifen. Der junge Mann in Weiß, dem die nasse Hose an den Beinen klebte, wollte helfen, doch Antoine scheuchte ihn weg. Bruno sprang aus dem Boot, zog es an Land und schüttelte Dr.Gelletreau die Hand, der sofort einen Blick in den Kahn warf. Antoine hatte ihn ein wenig zur Seite geneigt, um das [25] Wasser abfließen zu lassen, doch es stellte sich heraus, dass er ohnehin durch Risse im Boden leckte. Eine große schwarze Kerze, fast einen Meter lang, fiel heraus, eine zweite rollte gegen die Bordwand. Bruno kannte Kerzen dieser Größe nur aus der Kirche, aber die waren nicht schwarz. Immerhin wusste er nun, was es mit dem vermeintlichen Stummelmast auf sich hatte.
»Ist sie tot?«, fragte der junge Mann aus dem Sportwagen. Bruno erinnerte sich plötzlich, ihn auf dem Tennisturnier im vergangenen Jahr gesehen zu haben, umschwärmt von Mädchen. Sein unverschämt gutes Aussehen wirkte fast schon arrogant, so wie bei Models für Herrenmode in Hochglanzmagazinen. Er hatte mit einem Partner am Herren-Doppel teilgenommen und es mit seinem aggressiven und ungeduldigen Serve-and-Volley-Spiel bis ins Halbfinale geschafft.
»Warten wir ab, was der Arzt sagt«, antwortete Bruno. »Haben Sie uns eigentlich nicht gehört, als wir Ihnen zugerufen haben, dass Sie nicht ins Wasser springen sollen? Ihnen muss doch aufgefallen sein, dass ich Polizist bin. Sie hätten den Kahn fast zum Kentern gebracht.«
»Ich wollte nur helfen«, sagte er in freundlichem Tonfall und hob leicht spöttisch eine Augenbraue. Seine Stimme klang nach Bildung und hatte einen Pariser Akzent, und überhaupt ließ seine ganze Art darauf schließen, dass er mit seinem Aussehen und charmanten Auftreten überall gut ankam. »Ich dachte, ich könnte verhindern, dass der Kahn vor den Brückenpfeiler kracht.«
»Was führt Sie nach Saint-Denis?«, fragte Bruno.
»Wir sind zu einem Geschäftstreffen im [26] Bürgermeisteramt verabredet«, antwortete er. »Auf der Brücke sind wir von dieser Menschenmenge aufgehalten worden, und als ich ausstieg, sah ich diese Frau im Fluss treiben und dachte, es wäre von der anderen Uferseite aus vielleicht leichter, an den Kahn heranzukommen. Übrigens, mein Name ist Lionel Foucher.«
Er streckte die Hand aus. Bruno schüttelte sie und warf einen Blick auf die junge Frau, die immer noch am Steuer des Cabrios saß, eines neu aussehenden Jaguar, wie er jetzt feststellte. Sie trug eine Sonnenbrille und hob träge die Hand zum Gruß. Plötzlich wurde ihm bewusst, dass er nur seine Unterhose, das Hemd und eine Schwimmweste trug. Er musste grinsen und winkte zurück.
»Das ist Eugénie, meine Partnerin«, erklärte Foucher. »Tja, Sie haben also nun die Tote an Land gebracht und werden sich jetzt um sie kümmern müssen. Wir fahren dann mal wieder.«
»Dass Ihre Hose noch nass ist, wird den Bürgermeister nicht weiter stören«, bemerkte Bruno und wandte sich dem Kahn zu, als Foucher in den Wagen stieg und sich davonfahren ließ.
»Ein Name oder irgendwelche Markierungen sind auf dem Kahn nicht zu sehen«, stellte Antoine fest.
»Zum Todeszeitpunkt kann ich noch nicht viel sagen«, meinte Dr.Gelletreau und richtete sich neben dem Boot auf. Er hielt eine Pinzette in der Hand, in der etwas steckte, das wie aufgeweichte Pappe aussah, klein und rund. Aus seinem Arztkoffer holte er eine Plastiktüte und brachte das Fundstück darin unter.
»Weil nicht klar ist, wie lange sie im Wasser gelegen hat, [27] sind die gewöhnlichen Hinweise wie Körpertemperatur und Leichenflecken wenig aufschlussreich. Eine Todesursache lässt sich auf den ersten Blick auch nicht feststellen. Wir müssen sie obduzieren. Schmuck oder irgendwelche persönlichen Gegenstände, die auf ihre Identität schließen lassen könnten, fehlen. An Vulva und Anus sind leichte Blutergüsse zu sehen. Ich würde sagen, sie hatte vor ihrem Tod ziemlich heftigen Geschlechtsverkehr, der aber wohl nicht erzwungen war, denn sonst hätte sie auch Blutergüsse an den Handgelenken und Schultern.«
»Sie schließen äußere Gewaltanwendung aus?«, hakte Bruno nach. Die Schamhaare der Toten waren zu einem präzisen Dreieck rasiert.
»Ausschließen kann ich vorläufig nichts. Was ich da gerade für das kriminaltechnische Labor sichergestellt habe, habe ich der Toten aus der Scheide gezogen. Keine Ahnung, was es ist«, sagte Gelletreau. »Die Wodkaflasche könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die Frau das Leben genommen hat. Vielleicht war sie schwer gestört und hat ihren Abgang auf möglichst dramatische Weise zu inszenieren versucht. An sich wäre das nicht ungewöhnlich. Man hat schon häufiger davon gehört, dass sich manche vor ihrem Selbstmord auf seltsame Art kostümieren. Wir müssen den toxikologischen Befund abwarten, aber es würde mich nicht wundern, wenn in ihrem Blut jede Menge Alkohol und Barbiturate…« Er unterbrach sich und murmelte: »Das erinnert mich an was.« Er kramte in seinem schwarzen Koffer und holte ein glänzendes Metallteil daraus hervor, das Bruno schon einmal in einer HNO-Praxis gesehen hatte.
»An der Nadel hat sie offenbar nicht gehangen, denn [28] Einstiche sind keine zu finden«, sagte er und beugte sich über die Leiche. Anstatt ihr, wie Bruno erwartet hatte, den silbernen Hohlkegel ins Ohr zu stecken, stopfte er ihn in eins der Nasenlöcher und spähte hindurch.
»Aha«, ließ er verlauten und versuchte, seinen schweren Oberkörper wieder aufzurichten. Bruno musste ihm helfen.
»Sie hat Kokain geschnupft, und zwar reichlich. Die Nasenscheidewand ist fast aufgelöst«, sagte Gelletreau. »Ein Jammer. Sie muss einmal sehr schön gewesen sein. Ich schätze sie auf Ende dreißig, Anfang vierzig.«
Bruno nickte. Falten oder sonstige Alterserscheinungen waren nicht zu erkennen, weder am Hals noch an den langen, wohlgeformten Beinen und Hüften. Ihre Taille war schlank, die Brüste waren üppig.
»Sind das Schwangerschaftsstreifen?«, fragte Bruno.
»Sieht ganz danach aus, aber warten wir die Obduktion ab«, antwortete Gelletreau.
Tief bewegt vom traurigen Schicksal dieser schönen Frau, schwiegen die drei Männer und starrten auf den Leichnam, dem der Tod nicht zuletzt auch alle sexuelle Anziehungskraft geraubt hatte. Bruno sah ein verwischtes Zeichen auf ihrem Bauch, das ihn neugierig machte.
»Was könnte das sein?«, fragte er. Es war deutlich erkennbar kein Tattoo, sondern eher eine Schmiererei, deren Form ihm irgendwie bekannt vorkam.
»Ein Pentagramm, ein mystisches Symbol«, antwortete Gelletreau. »Und es ist nicht etwa eintätowiert, sondern mit einem Filzstift aufgemalt, wie es scheint. Wasserfest offenbar. Doch was hat das mit den beiden schwarzen Kerzen zu tun? – Und was um Himmels willen ist denn das?« Er zeigte [29] auf eine durchnässte, gestaltlose Masse, die im Kahn lag und bislang unbeachtet geblieben war.
»Ein junger Hahn«, sagte Antoine und stocherte mit einem Stock danach. »Und dort ist der Kopf, am anderen Ende des Bootes. Den hat jemand abgeschnitten.«
Bruno beugte sich über verkohlte Holzreste, die im verbliebenen Wasser schwammen und jenen Paraffingestank absonderten, den er schon vorher wahrgenommen hatte.
»Hat hier etwa jemand ein Feuer gemacht?«, fragte er. »Und was hat dieser dunkle Fleck da unten zu bedeuten?«
Alle drei schauten näher hin, auf die Stelle vor den Füßen der Toten. Es war inzwischen so viel Wasser abgelaufen, dass sie den besagten Fleck als Brandspur identifizieren konnten, die sich tief in den Boden des Kahns gefressen hatte und Wasser einließ. Weitere stark verkohlte dicke Knüppel und kleinere Holzscheite lagen überall verstreut.
»Keine Frage, hier hat ein Feuer gebrannt und den alten Kahn leckgeschlagen. Das eindringende Wasser hat die Flammen schließlich gelöscht«, dachte Bruno laut nach. »Und als Brandbeschleuniger ist Paraffin verwendet worden.«
»Ganz schön dumm, in einem Holzboot Feuer zu machen, ohne Steine oder irgendetwas anderes darunterzulegen«, meinte Antoine. »Das musste doch schiefgehen.«
»Wie ein verunglücktes Wikingerbegräbnis, nur mit dem Unterschied, dass hier schwarze Kerzen und ein toter Hahn als Grabbeigaben mit auf die Reise geschickt wurden«, sagte Gelletreau. »Seltsam. So etwas ist mir noch nie zu Gesicht gekommen, und ich hätte auch gern darauf verzichtet. Ich bin sehr gespannt auf das Autopsieergebnis.«
Bruno nickte und kehrte in den Schuppen zurück, wo er [30] seine Hose zurückgelassen hatte. Über sein Handy rief er Jean-Jacques an, den Hauptkommissar der police nationale in Périgueux. Weil sich nur der Anrufbeantworter meldete, berichtete er der Zentrale von dem mysteriösen Todesfall und fügte hinzu, dass Dr.Gelletreau um eine Autopsie gebeten habe. Die Leiche musste also in die Pathologie von Bergerac gebracht werden.
»Ich bleibe so lange hier«, sagte er. »Vielen Dank, euch beiden. Ihr könnt euch jetzt wieder um eure eigenen Sachen kümmern. Ich schaue später in der Klinik vorbei, Docteur, um den Totenschein abzuholen. Wenn Sie mir also bitte eine Kopie am Empfangsschalter hinterlegen würden…«
Antoine sagte, dass er ebenfalls bleiben werde, und verschwand hinter seiner Bar und den Rechnungen. Dr.Gelletreau ging zu seinem Wagen.
»Übrigens«, sagte Bruno, »ich dachte Fabiola hätte heute Dienst.«
»Sie macht, soweit ich weiß, einen Hausbesuch, bei einem Privatpatienten.«
»Sieht ihr gar nicht ähnlich«, erwiderte Bruno. »Sie lehnt doch sonst die Zweiklassenmedizin ab und plädiert für gleiche Behandlung für alle.«
»Ich weiß, deshalb arbeitet sie auch in der Klinik«, sagte Gelletreau. »Sonderbar, nicht wahr? Vielleicht braucht sie Geld. Sie will sich einen neuen Wagen kaufen.«
Er blickte Bruno an, und es schien, als wolle er noch irgendetwas sagen und fände nicht die richtigen Worte. Bruno erging es ähnlich. »Was Sie seltsam nannten – dieses Pentagramm und die schwarzen Kerzen…«, sann er einem unbestimmten Verdacht nach. »Ob diese Frau vielleicht [31] mit schwarzer Magie in Verbindung stand, einem Satanskult?«
[32] 3
Bruno hatte sich an seinen Schreibtisch in der Mairie zurückgezogen und las einen handgeschriebenen Brief, der ihm am Morgen zugestellt worden war. Der Text bestand ausschließlich aus Großbuchstaben und war eine jener anonymen Anzeigen, die allzu häufig bei der französischen Polizei eingingen. Andere anzuschwärzen war fast schon eine nationale Angewohnheit. Er hatte sie früher auf die Kriegsjahre und das Vichy-Regime zurückgeführt, das damals ausdrücklich zur Denunziation aufgerufen hatte. Doch dann war ihm ein Buch über die französische Revolution in die Hände gefallen, mit ausführlichen Zitaten aus anonymen Briefen, die Ende des 18.Jahrhunderts an das Komitee für Öffentliche Sicherheit geschickt worden waren, das tausende Menschen auf die Guillotine gebracht hatte. Die meisten jener Briefe, die Bruno erhielt und einfach ignorierte, unterstellten namentlich genannten Personen irgendwelche abwegigen Sexualpraktiken. Briefen, in denen von Steuerbetrug oder Schwarzarbeit die Rede war, musste er allerdings von Amts wegen nachgehen. Der Brief, der vor ihm lag, war mit schwarzer Tinte geschrieben und nicht, wie sonst bei den Anzeigen der schlüpfrigen Art üblich, in Grün oder Violett. In verstörend drastischen Worten wurde ein Bauer, den Bruno nur flüchtig kannte, beschuldigt, seine Frau zu schlagen.
[33] Bruno presste die Lippen aufeinander. Er hasste solche Geschichten, kam aber nicht umhin, sich mit ihnen zu befassen. Die meisten Magistrate brachten solche Fälle eher nicht zur Anklage, selbst dann nicht, wenn Gewaltanwendung ärztlich attestiert war. Die meisten Frauen weigerten sich nämlich, gegen ihre Männer auszusagen. Auch in Saint-Denis hatten ein paar brachiale Unsitten überlebt, vor allem auf entlegenen Bauernhöfen, und mehr als einmal waren Bruno in Bars und Cafés Sprüche über nervtötende Ehefrauen zu Ohren gekommen, denen, wie es hieß, ein paar hinter die Löffel gehörten. Und irgendein komischer Kauz würde dann den alten Spruch zum Besten geben: Pferde brauchen die Gerte, Weiber den Stock.
Brunos Amtsvorgänger Joe hatte, wenn es um häusliche Gewalt ging, seine ganz eigene, etwas rauhbeinige Art. War am Wochenende einem angetrunkenen Ehemann einmal die Hand ausgerutscht, drückte er ein Auge zu. Aber wenn sich solche Vorfälle häuften oder gar Kinder zu Schaden kamen, scheute er sich nicht, den Gerichtshof der öffentlichen Meinung anzurufen, und ließ in allen Bars bekannt machen, was Sache war. Hatte sich dann darüber eine klare Meinung gebildet, suchte Joe mit ein paar Freunden vom Rugbyteam den Hof des Angeklagten auf, um ihm hinter der Scheune ein paar bittere Pillen seiner eigenen Medizin zu verabreichen. Bruno schmunzelte in Erinnerung an Joes Worte, der solche Maßnahmen als Beispiele bürgernaher Polizeiarbeit bezeichnet hatte. Sie seien sehr effektiv, hatte er gesagt, was zu seiner Zeit durchaus der Fall gewesen sein mochte. Doch solche groben Mittel kamen für Bruno nicht in Betracht.
[34] Er wandte sich wieder dem Brief zu. Der Bauer, ein schweigsamer, verschlossener Mann, bewirtschaftete ein paar armselige Hektar Hügelland, die er von seinem Vater geerbt hatte und die gerade genug Ertrag zum Überleben einbrachten. Sein Name war Louis Junot. Seine Frau kam aus dem Norden, wo er sie während der Militärzeit kennengelernt hatte. Die gemeinsame Tochter Francette war eine ehemalige Tennisschülerin von Bruno. Sie war talentiert, schnell auf den Beinen und treffsicher gewesen, aber leider auch recht trainingsfaul. Nach der Pubertät hatte sie nur noch Augen für Jungen und schon früh damit angefangen, sich zu schminken. Bruno erinnerte sich, dass Francette, wenn sie den Bus bestieg, um nach Hause zurückzufahren, alles Make-up kurzerhand vom Gesicht wischte. Sie hatte die Schule schon früh verlassen und arbeitete an der Kasse des örtlichen Supermarktes. Soweit Bruno wusste, wohnte sie immer noch im Elternhaus. Vielleicht sollte er als Erstes mit ihr reden.
Der Anrufbeantworter hatte eine Nachricht von Delaron aufgezeichnet, der als erfahrener Journalist sehr wohl wusste, dass eine telefonische Anfrage über Brunos Anschluss in der Mairie beantwortet werden musste.
In aufgekratztem Tonfall berichtete Delaron, die Zeitung sei sehr interessiert an seinen Fotos von der toten Frau im Boot, habe aber als Familienblatt noch Bedenken in puncto Schicklichkeit. Ob Bruno rechtzeitig vor Redaktionsschluss bitte bestätigen könne, dass die Frau zum Zeitpunkt der Aufnahmen bereits tot gewesen und womöglich Opfer eines satanistischen Mordrituals sei.
»Merde«, murmelte Bruno vor sich hin, als Delaron dann [35] auch noch mitteilte, dass Pater Sentout davon gesprochen habe, der Leichnam sei »voller Kennzeichen teuflischer Frevelei«.
»So ein verdammter Mist.« Dem Bürgermeister würde das nicht passen, und Pater Sentout hätte sich gefälligst zurückhalten sollen. Bruno griff zum Hörer, rief Delaron an und sagte ihm, er solle sich mit seinen Fragen an den zuständigen Polizeisprecher in Périgueux wenden. Er selbst könne nur den Tod der Frau bestätigen. Die Todesursache beziehungsweise die Frage, ob Fremdverschulden vorliege, sei hingegen noch ungeklärt. Nach inoffizieller Meinung des Doktors sehe es nach Selbstmord aus. Was denn dran sei an der Satanismusgeschichte, wollte Delaron weiter wissen. Reine Spekulation, antwortete Bruno. Er legte den Hörer auf und machte sich auf den Weg, um den Bürgermeister zu warnen.
Gérard Mangin war schon seit über zwanzig Jahren Bürgermeister von Saint-Denis. Er hatte Bruno ins Amt des Stadtpolizisten geholt und ihn, den traumatisierten Veteranen der Balkankriege, mit den Traditionen und dem beschaulichen Leben in Saint-Denis vertraut gemacht. Bruno respektierte ihn als Bürgermeister und liebte ihn wie einen Vater. Er wusste aber auch, wie rabiat der Bürgermeister sein konnte, wenn es um die Interessen seiner Stadt ging. Am wichtigsten war es ihm natürlich, im Amt zu bleiben.
»Ah, Bruno, ich habe sehr gute Nachrichten«, sagte der Bürgermeister, als Bruno angeklopft und den hellen Raum betreten hatte. Der Bürgermeister legte den Füller aus der Hand, mit dem er alle schriftlichen Amtsgeschäfte erledigte, weil er sich hartnäckig weigerte, einen Computer zu benutzen. Er schob das Manuskript seiner Stadtgeschichte, an der [36] er arbeitete, zur Seite und öffnete einen Aktenordner mit grünem Band. Alle Projekte, die der Bürgermeister persönlich unterstützte, waren grün gekennzeichnet.
»Ich glaube, ich habe diesen Vorschlag für eine Feriensiedlung schon erwähnt, eine sehr exklusive Anlage mit Golfplatz auf halbem Weg nach Montignac. Eine große Investmentgruppe aus Paris mit vorzüglichen Referenzen macht sich dafür stark«, sagte der Bürgermeister sichtlich zufrieden mit sich. »Das Bauland schneidet die Flächen dreier Gemeinden, aber es sieht so aus, als würden wir steuerlich am meisten profitieren. Natürlich müssen wir uns an den Erschließungskosten beteiligen und die Straße verbreitern, aber die Ausgaben werden sich schon nach wenigen Jahren amortisiert haben. Außerdem sind für uns jede Menge Jobs drin, sowohl beim Aufbau wie auch später bei der Instandhaltung und Pflege der Anlage. Und unsere Restaurants dürfen sich auf viele wohlhabende Kunden freuen.«
Der Bürgermeister sah seine Hauptaufgabe darin, Arbeitsplätze für Saint-Denis zu schaffen und die vorhandenen zu sichern. Gleichzeitig bemühte er sich ständig um Zuschüsse aus Brüssel und Paris für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen. Es ging ihm vor allem darum, junge Leute an Saint-Denis zu binden, denn viele, die in Bordeaux oder Toulouse studierten, kamen nicht mehr zurück, weil sie wegen der globalen Rezession in der Provinz kaum berufliche Chancen hatten. Dass es Saint-Denis verhältnismäßig gut ging, während so viele andere ländliche Kommunen in Frankreich immer weiter schrumpften, war seinen Bemühungen und politischen Kontakten zu verdanken. Normalerweise unterstützte Bruno die Pläne des Bürgermeisters, [37] doch an diesem Projekt zeigte er nur aus Höflichkeit Interesse. Er stellte sich vor, dass die meisten Häuser des Feriendorfes für Reiche über die längste Zeit des Jahres leerstehen und Einbrecher anlocken würden, die dann auch zu seinem Problem würden, obwohl das Feriendorf am anderen Ende, gut zehn Kilometer außerhalb von Saint-Denis lag. Trotzdem beschloss er, seine Bedenken zurückzustellen.
»Wirklich erfreuliche Nachrichten. Ich hoffe nur, der Golfplatz wird auch für unsere Leute sein«, sagte er.
»Gute Idee. Ich werde sie Foucher sagen, wenn er sich wieder meldet.«
»Ist das der blonde Jüngling in Weiß in Begleitung einer dunkelhaarigen Frau?«, fragte Bruno.
»Ja, ein hübsches Paar, nicht wahr?« Der Bürgermeister wirkte verwundert. »Ich wusste gar nicht, dass Sie das Bauvorhaben so aufmerksam verfolgen.«
»Nicht das Bauvorhaben hat mich aufmerksam gemacht«, entgegnete Bruno trocken. Er wusste, dass das Gespräch eine weniger heitere Wendung nehmen würde, und berichtete von der toten Frau im Kahn, dem Mann im weißen Jaguar und Philippe Delarons Satanismus-Verdacht.
»Warum zum Teufel konzentriert er sich nicht auf seinen Fotoladen und rennt stattdessen durch die Gegend, um seine Zeitung mit Schund zu beliefern, den wir nicht öffentlich verbreitet sehen wollen«, beklagte sich Mangin. Bruno verzichtete darauf zu erwähnen, dass es dem Bürgermeister schon häufig genug gelungen war, Delarons Reportagen zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. Der Bürgermeister musste offenbar wieder einmal Dampf ablassen, und so lange Bruno [38] nicht als Prügelknabe herhalten musste, konnte er sich darüber amüsieren.
»Satanismus ist das Letzte, womit ich unsere Stadt in Verbindung gebracht sehen will. Dass das unserem Image schadet, müsste diesem Delaron doch klar sein. Wenn die Touristen ausbleiben, ist das nicht zuletzt auch zu seinem Nachteil.«
Bruno war sich da nicht so sicher. Womöglich würden die Touristen sogar in Scharen kommen, angelockt von einer kleinen Sensation. Wie auch immer, die Geschichte war nicht mehr kontrollierbar. Er erzählte dem Bürgermeister von Pater Sentouts Andeutungen gegenüber Delaron.
»Dieser alte Wichtigtuer«, blaffte der Bürgermeister. »Was steckt er seine Nase da rein? Er sollte lieber für das Chorkonzert proben. – Sollte ich vielleicht den Herausgeber anrufen?«, fragte der Bürgermeister.
»Das würde womöglich alles nur noch schlimmer machen. Ich werde mich gleich mit unserem Priester unterhalten. Sobald der Artikel in der Sud-Ouest erschienen ist, werden sich andere Reporter bei ihm melden. Denen kann er ja dann die Selbstmordgeschichte auftischen.«
»Ich fürchte, das funktioniert nicht«, sagte der Bürgermeister kopfschüttelnd. »Der Pater interessiert sich schon lange für Satanismus. Er hat sogar schon hier bei uns Exorzismen vorgenommen und armen Seelen den Teufel ausgetrieben. Ich weiß von ihm, dass er sogar Seminare in Sachen Exorzismus gegeben hat, oben in Dinan. Vermutlich sehnt er sich nach einer Gelegenheit, wieder einmal praktisch tätig zu werden. Nein, er wittert Schwefel, und ich glaube kaum, dass Sie ihm sein neuestes Scharmützel mit dem Teufel ausreden können.«
[39] Bevor er ging, erwähnte Bruno den anonymen Brief und sagte, dass er zu Junot auf den Hof hinausfahren werde.
»Junot ist ein Trinker, genau wie sein Vater«, bemerkte der Bürgermeister und sah auf die Uhr. »Er wird seinen Betrieb wahrscheinlich nicht halten können, weil es für Schafe keine Subventionen mehr gibt.« Er stand auf und zog sein Jackett über. »Tut mir leid, aber ich muss meine Frau im Krankenhaus in Sarlat abholen.«
»Doch hoffentlich nichts Ernstes?«, erkundigte sich Bruno besorgt. Er mochte die mütterliche Frau des Bürgermeisters, die ein Großteil des Jahres damit beschäftigt war, für die Mitarbeiter der Mairie Socken zu stricken, die sie ihnen dann zu Weihnachten übergab.
»Nein, Fabiola sagte, es sei nur eine Routineuntersuchung«, antwortete Mangin und hielt Bruno die Tür auf. »Viel Glück mit Junot! Tun Sie, was Sie machen müssen, Bruno, aber seien Sie bitte diskret.«
Bruno machte einen Abstecher zum Supermarkt, wo er erfuhr, dass Francette nicht mehr im Geschäft arbeitete. Sie habe vor gut zwei Wochen aufgehört, angeblich wegen eines anderen Jobs. Mehr wusste der Filialleiter nicht. Bruno fragte Michèle, die altgediente Kassiererin, aber auch sie konnte ihm nicht sagen, wo Francette jetzt beschäftigt war. Sie habe, so Michèle, völlig verändert ausgesehen, als sie die Kündigung einreichte, in ihren schicken Sachen, mit neuer Frisur und sorgfältigem Make-up und habe insgesamt einen wie verwandelten, ungewohnt fröhlichen Eindruck gemacht.
»Eine ihrer Freundinnen meinte, sie habe sich verliebt«, fuhr sie fort und führte Bruno in den Pausenraum, wo zwei [40] junge Frauen Kaffee tranken und rauchten. Über den angeblichen Freund wussten die beiden nur, dass er nicht aus Saint-Denis stammte. Sie bestätigten aber, Francette habe ihren Vater gehasst und sich immer wieder über ihn beklagt.
Bevor er ging, fragte Bruno, ob der Supermarkt große schwarze Kerzen im Angebot habe. Der Filialleiter sagte, davon noch nie etwas gehört zu haben. Er wusste auch nicht, wo man sie kaufen könne, nannte Bruno aber die Telefonnummer des Hauptlieferanten für Kerzen in dieser Region, einer Firma in Sarlat. Bruno setzte sich in das kleine Café neben dem Supermarkt, bestellte eine Tasse Kaffee und tippte die Nummer in sein Handy. Vom Verkaufsleiter, mit dem er verbunden wurde, erfuhr er lediglich, dass große schwarze Kerzen eine Seltenheit seien und im Ausland bestellt werden müssten. Immerhin konnte er ihm die Nummer eines Importeurs mit Sitz in Paris geben, der, wie Bruno bei seinem nächsten Telefonat in Erfahrung brachte, im vergangenen Jahr nur vier Läden mit schwarzen Kerzen beliefert hatte, zwei in Paris, einen in Lyon und einen weiteren in Marseille.
»An solchen Artikeln sind eigentlich nur Theaterleute interessiert«, fuhr die Stimme aus Paris fort. »Gallotin, der Großhandel für Theaterbedarf, bestellt regelmäßig. Er beliefert die Filmindustrie, Opernhäuser und das Festival in Avignon, alle größeren Events.«
Bruno machte sich eine Notiz, trank aus und warf einen Blick auf die Uhr. Bis zur Mittagspause blieb ihm noch Zeit für einen Besuch auf Junots Hof. Er wollte sich gerade auf den Weg machen, als sein Handy vibrierte. Es war sein guter Freund Jean-Jacques, der Hauptkommissar, der über die tote Frau informiert werden wollte.
[41] »Tut mir leid, dass ich nicht schon früher zurückgerufen habe. Ich hatte ein Treffen mit dem neuen Procureur de la République, der ein richtiges Energiebündel zu sein scheint. Er stammt aus Lyon, ist aber ein eingefleischter Rugbyfan. Sie werden sich also gut mit ihm verstehen.« Jean-Jacques’ neuer Vorgesetzter hatte als Staatsanwalt weitreichende Vollmachten. Er koordinierte die Strafverfolgung und benannte den Richter, der formell die Ermittlungen leitete. Sein Vorgänger, inzwischen pensioniert, hatte Jean-Jacques mehr oder weniger freie Hand gelassen. Es sah so aus, als würde Jean-Jacques’ Leben künftig komplizierter werden.
Bruno schlenderte zur Mairie zurück, um sein Dienstfahrzeug zu holen, und wunderte sich über eine kleine Prozession von ungefähr einem Dutzend Stadtbewohnern, die im Gänsemarsch vor ihm die Brücke überquerten. Die beiden Anführer trugen jeder ein selbstgebasteltes Transparent, und als Bruno den Zug überholte, las er auf dem einen: »Wohnraum für Einheimische, nicht für Touristen« und erkannte einige wieder, die sich offenbar keine Demonstration entgehen ließen. Ihn überraschte nur, auch Gaston Lemontin zu sehen, der das andere Transparent mit dem Slogan »Das Volk sagt nein« trug.
Lemontin war seit Jahren der stellvertretende Leiter der örtlichen Bank, ein stiller, kompetenter Mann. Er war verheiratet, Vater von Kindern, die inzwischen erwachsen und weggezogen waren, und lebte mit seiner Frau in einem weit außerhalb der Stadt gelegenen hübschen Haus am Fluss. Als Bruno sich daran erinnerte, ahnte er auch, worum es bei dieser Demonstration ging, und erkannte in der Reihe auch zwei Nachbarn von Lemontin.
[42] »Was ist los, Gaston?«, fragte er freundlich. »Es wäre nett gewesen, wenn Sie mir vorher Bescheid gesagt hätten, und sei es nur, um mir Gelegenheit zu geben, den Verkehr zu regeln.«
»Wir sind doch nur ein kleiner Haufen, Bruno, leider. Wir haben eine Petition für den Bürgermeister«, erklärte Lemontin. »Mit über hundert Unterschriften. Er muss uns jetzt anhören. Hier, wollen Sie nicht auch unterschreiben?«
Und schon hatte er eine Unterschriftenliste und einen Stift aus seiner Umhängetasche hervorgeholt. Bruno nahm das Blatt entgegen und las, ohne auf den gereichten Stift zu achten. Wie vermutet, richtete sich die Eingabe gegen die Pläne für das Feriendorf, von dem der Bürgermeister gesprochen hatte. Nach Ansicht der Protestierenden würde der Golfplatz wertvolles Trinkwasser verschwenden und der Ausbau der Straßen und des Kanalnetzes unweigerlich Steuererhöhungen nach sich ziehen; außerdem sei bislang keine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgenommen worden. Die Flussufer wären gefährdet, und für junge Leute würde es noch schwerer werden, vor Ort ein eigenes Haus zu finanzieren. Es gebe ohnehin schon viel zu viele Ferienwohnungen in der Region, also keinen Bedarf an weiteren Unterkünften, die die meiste Zeit des Jahres leerstehen würden.
Bruno fand die Bedenken gerechtfertigt, musste aber auch dem Bürgermeister zustimmen, der sich von dem Bauvorhaben zusätzliche Arbeitsplätze und Steuereinnahmen versprach.
»Immer nur das Gemeinwohl im Blick«, kommentierte er leicht ironisch, reichte den Zettel zurück und ging neben Lemontin auf das Rathaus zu. »Aber wäre es nicht ehrlicher [43] hinzuzufügen, dass Sie Ihre schöne Aussicht nicht verbaut haben wollen und fürchten, Ihr Haus könnte an Wert verlieren? Darum geht’s doch auch, oder? Ich habe Sie sonst noch nie auf einer Demonstration für kommunale Belange gesehen.«
»Klar vertrete ich auch persönliche Interessen. Und wenn schon! Das ist mein gutes Recht!«, entgegnete Lemontin mit geröteten Wangen. »Unsere Vorbehalte sind schließlich nicht von der Hand zu weisen. Es hat keine Umweltverträglichkeitsprüfung gegeben, aber der Bürgermeister ist wild entschlossen, das Projekt durchzuboxen. Wie ich gehört habe, hat er schon eine Vorabgenehmigung erteilt, und das ohne öffentliche Anhörung. Nicht einmal der Stadtrat kennt die Pläne. Je genauer ich mir die Sache ansehe, desto verdächtiger kommt mir der Investor vor.«
»Eine große, angesehene Pariser Firma, wie man mir versichert hat«, erwiderte Bruno. Die kleine Prozession hatte das Rathaus fast erreicht.
»Ja, das hört man immer wieder, aber wer steckt dahinter, hinter diesem undurchschaubaren Geflecht aus Finanz- und Fondsgesellschaften aus Luxemburg, der Schweiz und Konten auf den Cayman Islands? Es gibt sogar eine Querverbindung in den Libanon.«
Bruno spitzte die Lippen. Wenn zutraf, was Lemontin behauptete, war es in der Tat merkwürdig, dass sich ein solches Unternehmen für Saint-Denis interessierte. »Nun, ich schätze, all das wird in der nächsten Ratssitzung zur Sprache kommen. Haben Sie einen der Stadträte auf Ihrer Seite?«
»Nur Alphonse von den Grünen«, antwortete Lemontin mürrisch. Alphonse war der prominenteste Grüne im Ort, [44] ein ältlicher Hippie, der Ende der 1960er Jahre in den Hügeln über Saint-Denis eine Kommune gegründet hatte. »Ich weiß, er unterstützt alles oder ist, genauer gesagt, gegen alles. Deshalb habe ich ihn nie gewählt und werde es auch in Zukunft nicht tun.«
»Er hat trotzdem eine Stimme«, entgegnete Bruno und merkte, dass Alphonse der Demonstration ferngeblieben war. »Und es gibt viele, die ihn sehr schätzen. Ich gehöre dazu. Soll ich die Petition für Sie zum Bürgermeister bringen?«
»Nein, ich möchte Sie ihm persönlich überreichen. Aber dann muss ich sofort wieder zurück in die Bank. Ich habe meine Mittagspause nur ein bisschen vorgezogen.«
[45] 4
Der Bauernhof der Junots lag an einem der schönsten Aussichtspunkte des Tals, war aber wie zum Ausgleich für dieses Privileg von wenig fruchtbaren Feldern umgeben und im Winter den kalten Winden, die über das Plateau fegten, schutzlos ausgesetzt. Der Hof stammte aus der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs der 1880er Jahre, als die neue Wunderpflanze, der Tabak, dem Périgord Reichtum beschert und die Bevölkerungszahl hatte rasch ansteigen lassen. Seitdem war es mit dem Hof wirtschaftlich stetig bergab gegangen. Das nur spärlich wachsende Gras, die Dornbüsche und Farnkräuter reichten allenfalls zur Aufzucht von Schafen und Ziegen. Die Vorfahren der Junots hatten über Generationen hinweg fruchtbaren Mutterboden vom Tal auf ihren Hügel hinaufgeschafft und einen geschützten Gemüsegarten kultiviert, der die Familie mit Rüben, Bohnen und Kartoffeln versorgte und dem sie ein bescheidenes, schwer erarbeitetes Auskommen abtrotzte. Doch dazu war Louis Junot offenbar nicht in der Lage.
Bruno hielt auf dem Hügelkamm an und sah, dass Ziegel vom Dach des Hauses gefallen und nicht wieder eingesetzt worden waren. Auch um die verrotteten Zäune schien sich niemand zu kümmern, der Garten war von Unkraut überwuchert, selbst die sechs armseligen Rebstockreihen. Bruno [46] verzog unwillkürlich das Gesicht in Erinnerung an den sauren Wein aus Junots Herstellung. Wahrscheinlich war er der einzige Luxus, den er sich leisten konnte. Der Brennholzstapel auf der Terrasse war fast abgetragen. Normalerweise hatte jeder vernünftige Bauer einen Vorrat auf Lager, der für mindestens einen Winter reichte. Die Enten und Hühner sahen noch einigermaßen gesund aus, aber um ihre Versorgung kümmerte sich traditionell die Bäuerin, die den Erlös aus dem Verkauf der Eier auch für sich ansparen konnte.
Brunos Sorge galt jedoch nicht dem Zustand des Hofes, sondern ihrem Ehemann. Louis Junot war wahrscheinlich wieder einmal betrunken und entsprechend gewaltbereit. Die einzige Begründung für eine Festnahme wäre dieser anonyme Brief, und der allein reichte nicht aus. Ohne eine Anzeige der Frau hatte Bruno keine Handhabe. Im Büro hatte er einen Blick in die Liste geworfen, die er über alle Besitzer einer offiziellen Jagderlaubnis in Saint-Denis führte. Junots Name stand nicht darauf. Wenn also Hinweise auf Wilderei zu finden wären, und sei es nur der Kadaver eines Wildkaninchens, könnte er ihn deswegen vorübergehend festnehmen, und der Wunsch des Bürgermeisters nach Diskretion wäre erfüllt. Zuerst wollte Bruno allerdings in Erfahrung bringen, ob die Frau tatsächlich geschlagen worden war. Wenn ja, würde er sie um eine Aussage bitten, ein ernstes Wort mit ihrem Mann reden und ihn verwarnen. Viel mehr Möglichkeiten hatte Bruno in dieser Sache nicht.
Aus der Scheune, die ein Stück weiter unterhalb des Hauses stand, war ein Hämmern zu hören, unterbrochen von deftigen Flüchen. Hinter dem Fenster neben der Tür des Wohnhauses bewegte sich eine Gardine. Junots Frau hatte Bruno [47] also anscheinend kommen sehen. Trotzdem ließ sie sich Zeit dabei, ihm die Tür zu öffnen, und tat das auch nur einen Spaltbreit. Sie kannte ihn von den Tagen der offenen Tür, die der Tennisclub regelmäßig veranstaltete, wenn sie ihrer Tochter beim Spiel zugesehen und sich mit anderen Müttern unterhalten hatte, während die Kinder sich über Butterbrote, Kuchen und Limonade hermachten. Jetzt aber beäugte sie ihn voller Argwohn, als er die Mütze vom Kopf nahm und lächelnd darum bat, eintreten zu dürfen.
»Weswegen?«
»Ich würde Ihnen gern ein paar Fragen stellen.«
»Was meinen Sie mit ›Fragen‹?« Durch den Spalt in der Tür sah er, dass ihre Wange geschwollen und ein Auge blau unterlaufen war.
»Wegen einer Beschwerde, die bei uns eingegangen ist«, antwortete Bruno. »Wenn Sie sich weigern, mit mir zu reden, muss ich Sie und Ihren Mann von der Gendarmerie vorladen lassen.«
Er hatte nicht die Absicht, ihr zu drohen. Ihm blieb einfach keine andere Wahl; er musste sie auf die Konsequenzen aufmerksam machen. Anonyme Hinweise wurden dokumentiert. Das Inspektorat der Polizei nahm sie zur Kenntnis und hatte das Recht, nachzufragen, ob der Sache nachgegangen wurde. Das Thema Gewalt gegen Ehefrauen erhitzte zurzeit die Gemüter, und Bruno würde in ernste Schwierigkeiten geraten, wenn er in Verdacht geriete, Hinweise auf solche Übergriffe ignoriert zu haben.
»Ich hole Louis«, sagte sie und machte widerwillig die Tür ganz auf.
»Mit Ihnen will ich zuerst sprechen«, entgegnete Bruno [48] und stellte sich ihr in den Weg. Madame Junot wich schreckhaft zurück und presste die Zähne aufeinander, offenbar vor Schmerz, denn sie fasste sich unwillkürlich an die Rippen.
»Sie sind verletzt, Madame? Was ist passiert?« Er warf einen Blick in die große Küche, die mit Steinplatten ausgelegt war und im Winter bitterkalt sein würde. Das alte steinerne Waschbecken war ohne Wasseranschluss. Wasser musste draußen an der Pumpe gezapft werden. Die einzig moderne Annehmlichkeit war eine nackte Glühbirne, die von der Decke hing, sowie ein alter, mit Gasflaschen betriebener Herd.
»Ich bin die Treppe runtergefallen.«
»Aber davon haben Sie doch nicht das blaue Auge. Wie ist es dazu gekommen?«
Sie antwortete nicht und trat vor den Herd, auf dem ein großer Topf stand. Als sie den Deckel hob, roch es nach Entenfett und Knoblauch. Sie schlug zwei kleine Eier hinein und rührte sie mit einem alten, schwarz gewordenen Holzlöffel unter die Suppe.
»Sie kochen eine tourain