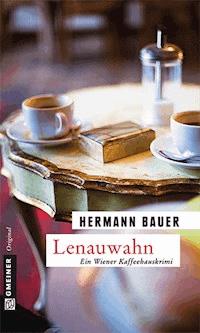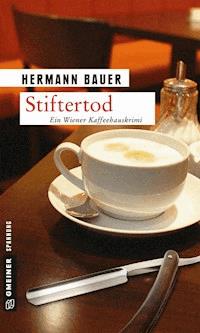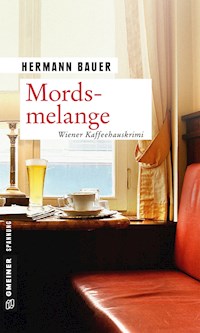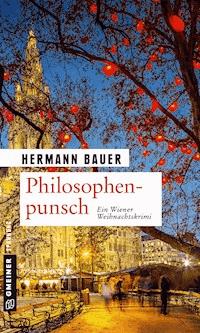Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Chefober Leopold W. Hofer
- Sprache: Deutsch
Ruhig liegt das Kaffeehaus »Heller« im nebligen Wien nördlich der Donau. Dies ändert sich schlagartig, als ein Stammgast, die pensionierte Susanne Niedermayer, erschlagen aufgefunden wird. Die Polizei vermutet einen Betrunkenen als Täter, doch Chef-Ober Leopold mag nicht an diese Version glauben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hermann Bauer
Fernwehträume
Kriminalroman
Zum Buch
Ausgeträumt Ruhig liegt das Kaffeehaus »Heller« im nebligen Wien nördlich der Donau. Dies ändert sich schlagartig, als ein Stammgast, die pensionierte Susanne Niedermayer, erschlagen aufgefunden wird. Die Polizei vermutet einen Betrunkenen als Täter, doch Chefober Leopold mag nicht an diese Version glauben. Auf eigene Faust stellt er Nachforschungen an. Eine heiße Spur führt ihn in den Klub »Fernweh«. Bei Filmvorführungen und Diavorträgen floh die alte Dame hier regelmäßig aus der Enge ihrer Heimat in die große weite Welt.
Hermann Bauer wurde 1954 in Wien geboren. Dreißig wichtige Jahre seines Lebens verbrachte er im Bezirk Floridsdorf. Bereits während seiner Schulzeit begann er, sich für Billard, Tarock und das nahe gelegene Kaffeehaus, das Café Fichtl zu interessieren, dessen Stammgast Bauer lange blieb. Von 1983 bis Anfang 2019 unterrichtete er Deutsch und Englisch an der BHAK Wien 10. Als Herman Bauer 1993 seine Frau Andrea heiratete, verließ er ihr zuliebe seinen Heimatbezirk. Im Jahr 2008 erschien sein erster Kriminalroman »Fernwehträume«, dem zwölf weitere Krimis um das fiktive Floridsdorfer Café Heller und seinen Oberkellner Leopold folgten.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
7. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von photocase.de
ISBN 978-3-8392-3078-7
Widmung
Für Elisabeth, die an dieses Buch geglaubt hat.
1
Wir dürfen Floridsdorf nicht mit London vergleichen – schon gar nicht das Uhrwerk der Kirche am Pius-Parsch-Platz mit dem Big Ben. Dennoch kroch am Abend des 6. November ein Nebel an den Häusern hoch, der wie in einem Edgar-Wallace-Film den gesamten Stadtteil nördlich der Donau umhüllte und nur mehr das Zifferblatt besagter Kirche über die dicke Suppe, die Floridsdorf bedeckte, schauen ließ.
Lockt so ein Nebel die Menschen eher ins oder aus dem Kaffeehaus? Das lässt sich schwer beurteilen. Fest steht nur, dass sich die Gäste, die schon drinnen sitzen, vorerst einmal durch nichts von der warmen, gepolsterten Sitzbank wegbewegen lassen.
So war es auch im Café Heller, nicht weit entfernt vom Pius-Parsch-Platz und damit dem sogenannten Zentrum Floridsdorfs gelegen, das wohl vor allem deshalb diese Bezeichnung für sich in Anspruch nahm, weil hier alle möglichen öffentlichen Verkehrsmittel aus den verschiedensten Richtungen wie durch ein Wunder zusammentrafen. Leopold, der Ober, der schon irgendwie zum Inventar gehörte, betrachtete die Szene gelassen, aber missmutig. Dass die Leute sitzen blieben, ohne etwas in entsprechender Quantität zu konsumieren, nur, weil es draußen unwirtlich war, passte ihm gar nicht.
Die heutige Besetzung des Café Heller ließ für den Rest des Abends tatsächlich das Schlimmste befürchten. Im hinteren Teil des u-förmig gebauten Lokals saß nur eine Kartenpartie – der Herr Kammersänger (ein verkrachter ehemaliger Heurigensänger mit Gesangsausbildung) spielte Tarock mit dem pensionierten Herrn Kanzleirat, dem Herrn Adi und dem Herrn Hofbauer. Als unverwüstlicher Kiebitz (Zuschauer beim Kartenspiel) saß noch der Herr Ferstl, eine Kaffeehauslegende unbestimmten, aber sehr hohen Alters, dabei, ein Gast, bei dem man immer Acht geben musste, dass er nicht unversehens einschlief, was oft ein sehr strapaziöses Aufweckritual zur Sperrstunde zur Folge hatte.
Keine sehr ergiebige Runde. Vielleicht würde jeder noch ein Achtel trinken, das war aber auch schon das höchste der Gefühle.
Am zweiten der drei Billardbretter im Mittelteil versuchten sich drei junge Burschen an einer Partie Karambole. Sie hatten sich erst unlängst Leopolds Unwillen zugezogen, da sie immer wieder, trotz seiner Ermahnungen, auch die rote Kugel als Spielball verwendeten. Das war nach Leopolds Wissensstand auf allen Billardbrettern der Welt untersagt. »Wir können aber trotzdem so spielen, wie wir wollen!«, hatte sich im Laufe des Disputs einer von ihnen erfrecht, ausgerechnet der Kleinste, der den Queue noch immer so hielt, als ob er damit ein lästiges Insekt an der Wand zerdrücken wollte. »Nicht da bei uns im Kaffeehaus. Da herrscht eine Ordnung!«, hatte Leopold mit gespielter Strenge erwidert. Denn streng musste man sein, um auch die jüngeren Gäste, zum Großteil Schüler des angrenzenden Gymnasiums, an die herrschenden Sitten und Gebräuche zu gewöhnen.
Nun schienen sich die Burschen absichtlich bei der Getränkekonsumation zurückzuhalten und schlürften nur langsam an ihren Cola- und Biergläsern.
Im vorderen Teil des Kaffeehauses, rechts vom Eingang, herrschte eine beinahe heilige Ruhe. Löffel rührten in Kaffeetassen, Zeitungen raschelten, zeitweise vernahm man aus einer Ecke ein schwaches Hüsteln. Die meisten hier saßen schon stundenlang da und hielten sich an die goldene Regel, dass man mit einer Schale Kaffee und dem dazu gereichten und vom Ober in regelmäßigen Abständen bereitwillig nachgefüllten Glas Wasser einen ganzen Nachmittag oder Abend sein Auskommen haben konnte.
Hier auf weitere Bestellungen zu hoffen, erforderte eine gehörige Portion Optimismus.
Leopold warf einen Blick in die Runde. Viele saßen alleine da, lesend, schweigend. Nur aus der Ecke, wo die Bauer-Geli – Schulabgängerin und treuer Stammgast – mit zwei Freundinnen tratschte, kam manchmal ein fröhliches Lachen, das hier beinahe störte.
›Die leben noch‹, dachte Leopold, aber bei den anderen war er sich da nicht so sicher. Sie kamen zwar jeden Tag zur Türe herein und gingen nach einiger Zeit auch wieder durch dieselbe hinaus, aber wenn sie so in sich erstarrt ihren Platz ausfüllten wie Marmorbilder, sahen sie aus wie gut konservierte Leichen.
Leopold antwortete auf die Frage nach seinem Beruf gerne mit ›Leichenbeschauer‹.
Die meisten von ihnen kamen dennoch immer wieder, tagtäglich, bis sie eines Tages nicht mehr kamen. Zunächst schien Leopold das gar nicht zu registrieren. Er verdrängte es. Wenn die Chefin fragte:
»Warum bleibt denn der Herr Amtsrat so lange aus? Drei Tag hab ich ihn jetzt schon nicht gesehen!«, antwortete er:
»Wird schon wieder kommen. Ist ja kalt jetzt. Und vorige Woche hab ich ihn ein paar Mal husten gehört.«
Niemand merkte, dass er sich Sorgen machte.
Eines Tages stand dann eine Dame in Schwarz vor der kleinen, halbkreisförmigen Theke und überreichte ohne viele Worte (»Hat ja er schon kaum was geredet!«, meinte Leopold) der Chefin einen schwarz umrandeten Partezettel1. Lungenentzündung, hörte Leopold, hohes Fieber, Gehirnschlag. Es war schnell gegangen, ja, ja. Aber alle Ärzte hatten der Witwe versichert, er habe kaum etwas gespürt.
Und dann war es amtlich, dass einer von den Scheintoten, die Leopold hier täglich bediente, auf immer gegangen war. Er würde eine Lücke hinterlassen. Mit der Zeit entstanden so immer mehr Lücken, und es gab zu wenige junge Leute wie die Bauer-Geli, die eine solche Lücke wieder füllten.
Leopold wollte zwar nicht an solche Dinge denken, aber er ertappte sich immer öfter dabei, wenn er eine ungewollte Pause hatte und zu sinnieren begann.
»Geh, Leopold, bring uns noch fünf Achterln Rotwein, gehen auf mich«, krächzte der Heurigensänger a.D., Ferdinand Brettschneider, vulgo der ›gschupfte Ferdl‹, von den Kartentischen nach vorne.
»Jawohl, Herr Kammersänger!«, rief Leopold erleichtert und demutsvoll nach hinten. Endlich wieder ein Geschäft!
*
Der Nebel über Floridsdorf verdichtete sich. Es schien einer der ungemütlichsten Abende des Jahres zu werden.
Leopold lehnte an der Theke und rauchte in hastigen Zügen eine Zigarette Marke Ernte 23. Der Abend zog sich.
»Herr Leopold!« Aus der Loge links hinten kam ein Ruf in zartem Befehlston.
»Bitte sehr, gnä’ Frau?« Leopold drückte die Zigarette aus und eilte nach hinten.
»Sagen Sie, haben Sie noch den köstlichen Apfelstrudel von gestern? Mit den vielen Rosinen drinnen?«
»Natürlich, Frau Susi! Wir heben doch immer eine Portion extra für Sie auf!«
»Dann kriege ich noch einen Apfelstrudel mit einer doppelten Portion Schlag. Und eine Melange!«
»Wie gnädige Frau befehlen.«
Während Leopold sich Richtung Küche entfernte, faltete Susanne Niedermayer, genannt die ›süße Susi‹, ihre Hände in freudiger Erwartung. Es waren diese Kleinigkeiten, die das Leben für sie lebenswert machten: Kaffee, Mehlspeisen, Süßigkeiten (in umgekehrter Reihenfolge). Sie war in bescheidenen Verhältnissen in einer Gärtnerei in Groß-Enzersdorf am östlichen Rand von Wien aufgewachsen, hatte nach abgeschlossener Lehre eine Zeit lang als Schneiderin gearbeitet und danach ihrer Schwester viele Jahre in einem Zuckerlgeschäft geholfen. Jetzt war sie Anfang 60 und lebte von einer kleinen Pension und einem bescheidenen Betrag, den sie nach dem Tod der Mutter sozusagen als Erbteil erhalten hatte. Viel hatte sie sich nie geleistet, aber sie kleidete sich anständig und wirkte trotz einiger überflüssiger Kilos durchaus noch adrett. Es konnte bisweilen sogar vorkommen, dass sie jemand jünger schätzte, als sie tatsächlich war.
Freilich, man sah sie immer ohne Begleitung. Der einzige Mann in ihrem Leben, von dem man wusste, hieß Emil Berger. Er war Witwer und erschien seit geraumer Zeit bei ihr als Kostgänger zum Mittagessen. Das Verhältnis war aber nicht einmal platonisch, höchstens ökonomisch.
Leopold sagte:
»Die hat in ihrem Leben keinen Mann gehabt.«
So blieben die kleinen Freuden des Lebens ihre größten. Sie führte ein geordnetes Leben in der kleinen, sauberen Wohnung, die sie früher mit ihrer Schwester geteilt hatte, verließ ihren Wohnbezirk nur selten und gönnte sich ein paarmal in der Woche einen Abstecher ins Kaffeehaus.
Seit geraumer Zeit sah man sie auch im Klub ›Fernweh‹. Sie träumte nämlich noch immer ihren großen Traum. Sie träumte von Amerika.
Sie hatte schon einmal hinfahren und dort bleiben wollen. Das war gleich nach ihrer Lehrzeit gewesen. Damals arbeitete sie in einem kleinen Schneidereibetrieb in Wien, nicht weit von ihrem Heimatort entfernt, und begann die Enge ihrer unmittelbaren Umgebung zu spüren. Zu Hause herrschte ein strenger Vater, bei dem sie auch mit 20 jeden Tag um 8 Uhr abends zu Hause sein musste. Eine kurze Affäre, ein ›Pantscherl‹ mit einem Burschen? Unvorstellbar. Einmal nach Wien in die Stadt hineinfahren und ausgehen? Unmöglich. Die Eintönigkeit der Arbeit im Betrieb ging täglich nahtlos in die Langeweile schweigsamer Abende im Kreise der Familie über. Die Eltern waren müde von der Gartenarbeit und gingen bald zu Bett. Susi hörte ein bisschen Radio, blätterte in Zeitschriften oder plauderte mit der älteren Schwester, dann hieß es auch für sie schlafen gehen, denn der Tag begann früh.
In den Zeitschriften las Susi etwas von den unbegrenzten Möglichkeiten in Amerika, vom ›American way of life‹, dazu sah sie Farbfotos von den Wolkenkratzern und Großstädten. Plötzlich wurde sie von einer beinahe unstillbaren Sehnsucht erfüllt. Warum sollte sie nicht hinüber über den großen Teich? Warum nicht dort einfach ein neues Leben anfangen?
Aber schon bald erkannte sie die ganze Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens. Woher das Geld nehmen? Und ganz alleine durchbrennen? Manchmal sah sie sich in ihren Träumen zwar nachts heimlich mit einem Koffer und ihrer wenigen Habe aus dem Haus schleichen; aber ebenso deutlich sah sie dann stets die überlebensgroße Figur ihres Vaters aus dem Winkel neben dem kleinen Schuppen hervortreten – gebieterisch, bedrohlich und Einhalt gebietend.
Sie blieb also zu Hause. Sie verbannte Amerika in den Bereich ihrer Schwärmereien. Sie fand sich damit ab, für immer und ewig in Groß Enzersdorf zu bleiben.
Dann kam der Anruf ihrer Schwester, der sie nach Wien holte. Ob sie ihr nicht in ihrem Zuckerlgeschäft helfen wolle? Ihre Freundin könne nicht mehr, sie sei gerade das zweite Mal schwanger. Die Wohnung sei groß genug für zwei, das Geschäft gehe gut.
Susi sagte ja. Sie zog in die Großstadt, lebte dort genauso ereignislos wie in Groß Enzersdorf, aber sie genoss es. Die Wohnung hatte sie jetzt für sich allein, denn die Schwester hatte das Geschäft verkauft und war mittlerweile ins Haus ihrer verstorbenen Eltern gezogen. Sie vermisste sie nicht sonderlich. Man hatte sich auseinandergelebt, öfters Streit gehabt. Gertrud – die Schwester – war neidisch gewesen, hatte ihr nie einen gerechten Anteil am Geld zukommen lassen, und als einmal ein Mann aufgetaucht war, für den sich Susi interessiert hatte, war Gertrud die Glücklichere gewesen – wenn auch nur für kurze Zeit …
Nein, nein, charakterlich war Susi von ihrer Schwester enttäuscht und mied den Kontakt mit ihr in den letzten Jahren tunlichst. Darum störte es sie auch, wenn sie einander begegneten, so wie heute. Doch das hatte sich nicht vermeiden lassen, diese Aussprache war wichtig gewesen.
Noch etwas anderes störte sie. Und zwar gewaltig.
Aber sie wollte sich nicht früher als nötig aufregen. Die Dinge würden kommen, wie sie kommen mussten, davon war sie überzeugt.
Da kam auch schon der Apfelstrudel mit den extra vielen Rosinen und der Schale Kaffee, von Leopold liebevoll gebracht. Susi stach sich mit der Gabel ein Stück herunter und schob es sich genießerisch in den Mund. Für den Augenblick wollte sie alle Probleme vergessen.
Gedankenverloren blickte sie zum Fenster hinaus in den grauen Nebel. Dabei meinte sie für einen Augenblick, die Freiheitsstatue aus der milchigen Suppe auftauchen zu sehen.
*
Noch einmal öffnete sich die Kaffeehaustür und ein später Gast trat ein. Er ging ein wenig unsicher Richtung Theke, rieb sich dabei die Hände, um sich aufzuwärmen, und schaute sich um. Seine Augen suchten Leopold, der gerade von hinten kam, wo die Tarockrunde überraschend noch fünf Achteln bestellt hatte. Es war genau 23 Uhr.
»Ja, der Stefan!«, rief Leopold überrascht. »So spät noch? Wie steht denn das werte Befinden?«
Stefan schaute grimmig, um erst gar keinen Zweifel an seiner schlechten Laune aufkommen zu lassen. »Beschissen«, sagte er. »Ziemlich beschissen.«
Leopold verzog leicht das Gesicht. Zum einen verbat er sich einen solchen Ton in diesen hehren Hallen, zum anderen hatte Stefan augenscheinlich ganz schön geladen. Wenn er um diese Zeit kam, hatte er eigentlich immer ganz schön geladen. Und da konnte der Abend noch einigermaßen anstrengend werden.
»Bring mir ein großes Bier, aber schnell, bitte!«, sagte Stefan und fuhr sich mit der Hand unwirsch durch sein dunkelbraunes, leicht gewelltes Haar. Stefan Wanko war mittelgroß, relativ schlank, gepflegt und immer elegant gekleidet. Sein ›Markenzeichen‹ war seine schwarze Lederjacke, unter der er heute ein weißes Hemd mit hellblauer Krawatte und einen grauen Anzug trug. Sein Gesicht wirkte auch in betrunkenem Zustand noch angenehm, obwohl er alles tat, um einen gegenteiligen Eindruck zu erwecken. Kein Wunder, dass Stefan als Versicherungsvertreter Erfolg hatte, kein Wunder auch, dass, was ihm noch mehr bedeutete, die Frauen nur so auf ihn flogen. Nur der genaue Beobachter – und Leopold war ein solcher – erkannte bereits die Spuren eines kurzen, bewegten Lebens an ihm. Stefan war erst Anfang 30.
Leopold stellte ihm das Bier auf die Theke, dann trug er die fünf Achteln nach hinten und machte die Karambolespieler darauf aufmerksam, dass in zehn Minuten Billardschluss sein würde. Beim Zurückgehen hörte er schon Stefans klagende Stimme:
»Nein, da soll einer klug werden aus den Weibern!«
Also daher wehte der Wind. Stefan hatte wieder einmal Probleme mit einer Frau. Das war keine Seltenheit, das war eigentlich bei Stefan die Regel. Meistens lernte er eine kennen, schwärmte von ihr über die Maßen, hatte die vorzüglichsten Absichten – nur, um dann unweigerlich wieder in seine alten, ausschweifenden Lebensgewohnheiten zurückzufallen. Dann gab es Schwierigkeiten, die er im Kaffeehaus bereden musste. Leopold gefiel das – er redete gern über Frauen, wahrscheinlich, weil er selbst keine hatte. Deshalb nahm er Stefan manchmal auch gegenüber der Chefin in Schutz, wenn sie, so wie jetzt, einen finsteren Blick in seine Richtung warf. Er konnte mit Stefan mitfühlen, wenngleich er seine Exzesse nicht guthieß.
Leopold dachte krampfhaft nach, wie Stefans jetzige Freundin heißen mochte. Vor Kurzem war noch eine Barbara aktuell gewesen, aber wer weiß …
»Hinausgeschmissen hat sie mich, einfach so!«, brummte Stefan in sein Bier, nachdem er einen großen Schluck genommen hatte.
»Die Babsi?«
»Ja!«
»Aber geh!«, bemerkte Leopold.
»Ja, heute! Ich komme von der Arbeit nach Hause zu ihr, sagt sie einfach, ich kann gleich wieder gehen. Und morgen soll ich meine Sachen holen. Sie will Schluss machen.«
»Hast am Wochenende leicht (denn) blau gemacht?«, fragte Leopold.
»Ja«, sagte Stefan einsilbig.
Es war immer dasselbe. War Stefan einmal unterwegs, bedeutete eine Nacht gar nichts. In diesen Fällen nahm er es auch mit der Treue nicht so genau. Für einen kleinen Seitensprung genügte dann ein hübsches, junges weibliches Wesen, das sich seine Probleme anhörte, ihn in seine Wohnung mitnahm und von seinen sexuellen Fähigkeiten im Vollrausch angetan war. Man musste froh sein, dass er nach solchen Ausrutschern noch den Ehrgeiz hatte, seinen beruflichen Verpflichtungen nachzukommen.
»Ist es wirklich aus?«, fragte Leopold.
»Scheint so!«
»Und da möchtest du heute wieder nicht schlafen gehen? Geh, komm! Du hast doch da vorne noch deine kleine Wohnung. Ruh dich ein bisschen aus. Morgen schaut die Welt wieder ganz anders aus.«
Diese Feststellung ließ einen Ruck durch Stefans Körper gehen. In seine Junggesellenbude zog er sich nur mehr in Notfällen zurück. Noch weigerte er sich, seine jetzige Situation als Notfall zu betrachten.
»Es ist alles beschissen«, sagte er. »Ich möchte jetzt nicht allein sein.«
In diesem Moment rief Frau Susi ein lautes »Zahlen!« aus der hinteren Loge nach vorne. Sie war schon spät dran. Aber auch sie hatte nicht allein sein wollen vor der Zusammenkunft, die ihr heute noch ins Haus stand.
»Komme sofort«, sagte Leopold und raunte zu Stefan:
»Siehst, die wär jetzt was für dich. Wohnt nur zwei Häuser weiter und ist alleinstehend. Aber Vorsicht: Die hat in ihrem Leben noch keinen Mann gehabt!«
»Ja, die würde gerade passen«, lachte Stefan. »Aber wirklich, ohne Spaß! Sag, ist das nicht die süße Susi, eure Zuckerpuppe?«
Leopold nickte. »Ich weiß nur nicht, was sie jetzt noch da macht. Normalerweise ist sie um diese Zeit schon im Bett.«
»Mit der könnte ich wenigstens noch ein bisschen plaudern«, sagte Stefan.
›Könntest du, wenn du nüchtern wärst‹, dachte Leopold nur und schritt bedächtig zum Inkasso. Anschließend half er Frau Susi in ihren nicht mehr modernen, aber auch nicht abgetragenen dunkelblauen Mantel:
»Vielen Dank, gnädige Frau, und beehren Sie uns bald wieder. Morgen?«
»Nein, erst übermorgen. Morgen ist ja Klub!«, sagte Frau Susi.
»Ach so, morgen geht’s wieder in die große weite Welt. Na, dann halt übermorgen. Passen Sie nur schön auf bei dem Nebel, dass Ihnen nichts passiert. Man sieht ja kaum mehr die Hand vor den Augen.«
»Mir passiert schon nichts. Ich wohn ja nicht weit.«
»Ich geh ein Stückchen mit Ihnen!«, hörte man Stefan von der Theke her lallen.
»Hören Sie nicht auf den«, beruhigte Leopold. »Ich hab ihn schon unter Kontrolle. Er meint es nicht so! Gute Nacht!«
»Und ob ich es so meine«, sagte Stefan, nachdem Susi verschwunden war.
»Jetzt reiß dich doch zusammen«, fauchte Leopold. »Du fängst an, mir die Gäste zu vertreiben!«
»Du bist selber schuld, Leopold. Schäkerst da mit der Zuckerltante und lässt mich alleine an der Theke stehen. Wo ich doch heute nicht allein sein will und kann. Ich brauche Betreuung, Leopold, Betreuung und Liebe! Ich brauche Menschen um mich.«
»Dein Problem ist die eine Sache, und alles andere hat damit nichts zu tun.«
»Oh, Leopold, wenn du wüsstest, wie unrecht du hast! Jetzt sei aber nicht mehr böse und stoß auf einen Versöhnungstrunk mit mir an. Außerdem hast du mir die Alte wie auf dem Servierbrettl angeboten. Und so zuwider ist sie ja nicht.«
»Perversling!« Jetzt lächelte Leopold wieder. »Ich will ja nur, dass du unsere Gäste in Ruhe lässt. Und wenn du dich noch ein paar Minuten geduldest, lasse ich mich von dir auf ein Getränk einladen. Aber vorher gehe ich schnell abkassieren.«
»Jetzt bleib doch da!«
Aber Leopold hatte sich bereits diensteifrigen Schrittes von Stefan wegbewegt. Dass der auch immer so kindisch und anhänglich sein musste, wenn er einen über den Durst getrunken hatte. Irgendwann, fürchtete Leopold, würde sich das rächen.
Mittlerweile eilte Susanne Niedermayer nach Hause zu ihrer Wohnung. Sie ging schneller als sonst durch den dichten Nebel, als würde sie ahnen, dass ihr nicht mehr viel Zeit zum Leben blieb.
1 In Österreich sehr gebräuchliches Wort für eine Todesnachricht; zu französisch ›donner (oder faire) part‹, ›Nachricht geben‹.
2
Am nächsten Tag öffnete Leopold kurz nach 7 Uhr früh die Pforten zum Kaffeehaus. Der Nebel hing noch immer über dem Stadtteil nördlich der Donau, aber es schien, als könne er sich während des Tages lichten – zumindest glaubten das die Wetterfrösche. Einstweilen huschten, nur schwach vom Schein der Straßenlaternen erfasst, die Menschen noch eher schemenhaft vorbei in Richtung U-Bahn, Schnellbahn oder zur gegenüber dem Café liegenden Straßenbahnhaltestelle.
Leopold mochte an sich diese Zeit, wenn der Tag, das Kaffeehaus und die Leute erwachten. Die ersten Gäste trafen zu einem Frühstück ein, und er war mit ihnen, bis auf eine Küchenhilfe, alleine. Herr und Frau Heller blieben am Morgen in ihrer Wohnung oberhalb des Kaffeehauses, und Aufsicht, Kontrolle und Organisation blieben alleine Leopold überlassen, sofern er und nicht ›Waldi‹ Waldbauer, Ober Nummer zwei im Café Heller, Dienst hatte.
Normalerweise wusste Leopold das in ihn gesetzte Vertrauen zu schätzen. Heute hatte er jedoch bleierne Glieder und einen dummen Kopf. Drei Seideln (Glas; 0,3 Liter) Bier und ein Stamperl (kleines (2cl) – oder größeres (4cl) – Glas Schnaps.) Weinbrand hatte er bis 1 Uhr früh noch mit Stefan getrunken, ehe die Chefin verspätet die Sperrstunde verkündet und Stefan hinauskomplimentiert hatte. Drei Seideln und ein Stamperl waren zu viel für einen schwachen Trinker wie Leopold, wenn er am nächsten Morgen arbeiten musste. Außerdem hätte man fast den alten Herrn Ferstl vergessen, der noch hinten bei den Kartentischen gesessen und eingeschlafen war. Ihn aufwecken, ihm sagen, wie spät es war, ihn zur Türe hinaus führen – vier Stunden Schlaf waren Leopold gerade noch geblieben.
Am liebsten hätte er Herrn oder Frau Heller gebeten, heute etwas früher herunterzukommen und ihm Gesellschaft zu leisten, aber er konnte sich noch an das grantige Gesicht der Chefin vom Vortag erinnern. Sie blieb zwar Leopold zuliebe öfter einmal länger auf, verzichtete jedoch nicht gerne wegen Stefan auf einen Teil ihres kostbaren Schlafes. Also nicht an die vergangene Nacht denken! Der Tag war jung.
Gleich würde ein Schwung Schüler aus dem nahe gelegenen Gymnasium das ehrwürdige Haus nach und nach beleben, um sich die Zeit bis zum Unterrichtsbeginn mit einem Schalerl Kaffee zu versüßen. Leopold kannte sie alle. Es waren treue Gäste, und viele blieben dem Kaffeehaus noch viele Jahre erhalten, wenn sie schon längst im Berufsleben standen und verheiratet waren. Sie sorgten für die nötige Blutauffrischung, ohne die die weitere Existenz eines Cafés wie des ›Heller‹ nicht gesichert war.
Und noch jemand würde aller Wahrscheinlichkeit nach wie beinahe jeden Morgen kommen: Professor Thomas Korber, Lehrer für Deutsch und Englisch und Leopolds bester Freund. Thomas war Ende 30, groß – beinahe 1,90 Meter – trug einen braunen Vollbart und leicht gewelltes Haar und zeigte erste Ansätze eines Bäuchleins. Thomas war ein Kaffeehausnarr, und Leopold wäre sein Lebtag gerne weiter ans Gymnasium gegangen, als er nach dem plötzlichen Tod des Vaters eine Lehre als Kellner hatte antreten müssen, weil das Geld zu Hause knapp wurde. So kreuzten sich ihre Interessen. Aber da war noch mehr. Thomas war ein Mensch, der andere in sich hineinschauen ließ. Er verbarg seine Stimmungen nicht. Er konnte ruhig und überlegt, aber auch überaus gereizt und verletzbar sein. Leopold las oft in ihm wie in einem Buch – und verstand ihn. Thomas wiederum schätzte Leopolds Witz und Menschenkenntnis. Daraus war von Anfang an jene Sympathie entstanden, die den Boden für eine jahrelange Freundschaft bereiten sollte.
Leopold fragte sich, wer heute zuerst eintreffen würde, sein Freund Thomas oder dessen Schülerin Gabi Neuhold. Sie kamen nie zusammen, aber immer fast gleichzeitig. Einmal hatte er beide auf seinem Weg ins Kaffeehaus in einer Ecke schmusen gesehen. Seither ahnte er Schlimmes und wusste, dass vieles, was wie Zufall wirkte, kein Zufall war. Hinter der Parallelität des Eintreffens steckte System.
Thomas hatte ein Verhältnis mit Gabi oder wollte eines mit ihr haben.
Aber warum tat er so etwas? Das verstand Leopold nicht. Warum gab Thomas sich mit einer Schülerin seiner Maturaklasse ab, die er noch dazu als Klassenvorstand leitete? Er musste doch wissen, dass das verboten war. Leopold nahm sich vor, sich in nächster Zeit ein wenig mehr um seinen Freund zu kümmern.
Etwas verschlafen wie immer schlurfte Gabi jetzt zur Türe herein, setzte sich zum ersten Tisch ans Fenster und bestellte einen Hauskaffee mit Kipferl. Fesch war sie schon mit ihrem schwarzen Haar, das locker zu den Schultern herabfiel, ihren schmalen, stark angemalten Lippen, auf denen immer ein leichtes Lächeln saß, den blauen, neugierigen Augen und den gut sichtbaren, aber nicht zu großen Brüsten. Das war jedoch noch lange kein Grund für Thomas, sich in sie zu verschauen.
Als der Herr Lehrer wenig später das Lokal betrat, wirkte er so schwungvoll wie eine Spielzeugpuppe, deren Batterien beinahe leer waren. Bei seinen Verrenkungen fielen Leopold unwillkürlich wieder die drei Seideln Bier und das Stamperl ein. Er kratzte sich leicht am Kopf.
»Guten Morgen, Leopold«, grüßte Thomas. »Na, was schaust du denn so? Musst erst auf Touren kommen? Keine Angst, ich auch!« Dabei zwinkerte er verständnisvoll in Richtung Leopold. »Bring mir einen kleinen Schwarzen, damit du auf andere Gedanken kommst.« Dann wandte er sich mit einer unschuldigen Geste in Richtung leere Sitzbank an Gabi:
»Darf ich? Oder musst du noch etwas lernen?«
»Nein, nein, nimm nur Platz«, lachte Gabi. Sie war gerade im Begriff, sich eine Zigarette anzuzünden.
›Jetzt duzen sie sich schon öffentlich‹, dachte Leopold, ›die kennen ja gar keinen Genierer (Schamgefühl). Und Thomas bekommt schon wieder dieses Leuchten in den Augen, kaum, dass er sich zu ihr gesetzt hat. So wie die beiden heute ausschauen, waren sie gestern sicher miteinander fort.‹ Er beschloss jedenfalls, sich zunächst einmal diskret hinter die Theke zurückzuziehen, um den kleinen Schwarzen für seinen Freund zuzubereiten.
Noch jemand kam, Isabella Scherer, eine Mitschülerin von Gabi. Sie winkte kurz schüchtern, blieb einen Augenblick lang stehen, gab sich dann aber einen Ruck und ging zögernd auf ihre Freundin und den Klassenlehrer zu. Thomas wirkte zunächst erstaunt, bedeutete Isabella jedoch, bei ihm und Gabi Platz zu nehmen.
»Ein Cola bitte«, rief Isabella in Richtung Leopold. Dann wandte sie ihren Blick sofort wieder Thomas zu. »Ich möchte nicht stören«, sagte sie, »aber ich muss dringend mit Ihnen reden, Herr Professor!« Es klang nach Geständnis, und Thomas fühlte sich in der Tat gestört.
»Was, jetzt, um halb 8 Uhr früh? Ich würde gerne meinen Kaffee in Ruhe trinken. Ist es denn so wichtig, dass es keinen Aufschub duldet?«, fragte er ein wenig verärgert. Er wäre jetzt lieber mit Gabi alleine gewesen.
Leopold brachte schweigend den kleinen Schwarzen und das Cola.
»Es ist sehr wichtig.« Isabella druckste ein wenig herum. Dann nahm sie sich ein Herz. »Ich … nämlich … ich bekomme ein Kind!«
Damit hatte sie ihren Klassenvorstand kalt erwischt. Thomas verschlug es die Sprache.
»Donnerwetter«, stammelte er. »Weißt du das schon lange?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, ein paar Tage erst. Und da wollte ich gleich mit Ihnen darüber reden. Ich meine, Sie müssen das ja wissen, und hier redet es sich leichter als in der Schule.« Sie nahm einen Schluck von ihrem Cola. »Ich weiß ja jetzt gar nicht, ob ich zur Reifeprüfung antreten kann, die Geburt ist Anfang Juni. Ich glaube, ich komme da in einen ganz schönen Schlamassel.«
»Nein, nein«, versuchte Thomas sie zu beruhigen. »Das mit der Matura kriegen wir schon irgendwie hin. Du musst zunächst einmal den Klassenabschluss schaffen, das ist das Wichtigste. Der ist Ende April, also müsste es sich ausgehen, wenn alles normal läuft. Einen Prüfungstermin finden wir dann schon für dich, auch wenn es sich nicht zum Haupttermin mit den anderen machen lässt. Du könntest etwa die Klausurarbeiten noch im Mai schreiben und dann mündlich im Oktober antreten oder aber alle Prüfungen im Herbst machen. Das ist nicht so schlimm. Zuerst einmal die Klasse, wie gesagt …«
»Von wem ist es denn?«, platzte Gabi dazwischen, die es vor lauter Neugier nicht mehr auszuhalten schien.
Isabella drückte sich um die Antwort herum. Sie trank hastig ihr Cola aus.
»Du musst es nicht sagen«, meinte Thomas mit einem vorwurfsvollen Blick auf Gabi.
»Doch, doch, es muss ja einmal heraus. Die Frage wird mir sicher noch öfter gestellt werden.« Isabella lächelte scheu. »Also, es ist vom … Erich.«
»Vom Erich?« Gabi beugte ihren Oberkörper mitsamt einer frisch angezündeten Zigarette weit über den kleinen Kaffeetisch und hielt sich die Hand vor den Mund, weil sie ein Lachen nicht unterdrücken konnte. »Das ist doch nicht möglich!«
»Es ist möglich!« Isabellas Ton wurde jetzt bestimmter. »Ich werde dir alles einmal erzählen, Gabi, und Ihnen vielleicht auch, aber bitte nicht jetzt. Für den Augenblick möchte ich nur, dass Sie Bescheid wissen, Herr Professor!«
Erich war Erich Nowotny, Sohn des Bauunternehmers und Mitglieds der Bezirksvertretung Ferdinand Nowotny. Er besuchte dieselbe Klasse wie Gabi und Isabella. Unter seinen Mitschülern galt er als durchaus ansehnlich, freundlich und hilfsbereit, aber auch ein wenig verklemmt und schüchtern. Es war ein offenes Geheimnis, dass er sich für Isabella interessierte, allerdings, so hieß es, ohne Erfolg. Sie hatte ihn zumindest öffentlich schon mehrmals abblitzen lassen.
»Weiß Erich es schon?«, fragte Thomas.
»Ja!« Es war ein kurzes, unliebsam hingeworfenes ›Ja‹.
»Und was … was werdet ihr jetzt machen?« Thomas bereute seine Frage, kaum dass er sie gestellt hatte. Er durfte als Klassenvorstand nicht so neugierig sein.
»Wir wollen heiraten«, sagte Isabella beinahe noch eine Spur kühler.
Gabi löste die sich anspannende Situation. »Komm«, sagte sie zu Isabella. »Gehen wir gemeinsam vor zur Schule und plaudern wir noch ein bisschen.« Sie konnte ihre Neugier kaum verbergen.
Isabella überlegte kurz, dann nickte sie, stand auf, nahm Mantel und Tasche und verabschiedete sich von ihrem Klassenvorstand. Gabi griff Thomas im Vorbeigehen auf die Schulter, als ob sie sich entschuldigen wollte, sagte:
»Tschüss, bis später!« und verließ gemeinsam mit Isabella das Lokal.
Zurück blieb ein einigermaßen verdatterter Thomas Korber. Aufpassen, dass es mit Gabi nicht so geht wie mit Isabella und Erich, dachte er. Das konnte er in der jetzigen Situation am wenigsten brauchen. Seine derzeitigen Gefühle waren nicht erlaubt, das wusste er, aber so sehr er sie auch hinterfragte, sie waren stärker als jedwede Rücksichtnahme auf seinen Beruf oder irgendwelche moralischen Wertvorstellungen.
›Was bin ich doch für ein Idiot‹, sagte er zu sich, während er hastig seinen Kaffee austrank und Leopold zum Zahlen rief.
Leopold schien von irgendwo weit her zu kommen. Er hatte in den vielen Jahren seiner Tätigkeit als Kellner gelernt, so unauffällig wie möglich die Nähe eines Tisches zu suchen, an dem sich eine interessante Entwicklung anbahnte. Auf diese Weise konnte er den Großteil einer Unterhaltung verfolgen, ohne dass es den Beteiligten auch nur im Geringsten auffiel. Er war, wie immer, bestens informiert, als ihn Thomas über die Schulter fragte:
»Na, was sagst du zu diesen Neuigkeiten?«
»Was soll ich sagen«, meinte er nur kurz, als er das Geld einstreifte. »Übers Jahr ist Hochzeit, kannst Gift drauf nehmen.«
*
Leopold sog tief und genüsslich an seiner Zigarette. Sein Dienst war gleich vorüber, und draußen schien sich die schwache Novembersonne gegen den Nebel durchzusetzen. Was wollte man mehr? Er musste nur noch warten, bis sein Kollege ›Waldi‹ Waldbauer in seiner Kellnerlivree herunterkam, dann konnte er sich umziehen, nach Hause gehen, einen Nachmittag und Abend ohne Kaffeehaus verbringen.
Was er tun würde? Zunächst einmal ein paar Stunden ausruhen, dann einen Sprung stadtauswärts fahren, zum ›Fuhrmann‹, einem kleinen Heurigenlokal, wo er wahrscheinlich Thomas treffen würde. Er wollte in aller Ruhe mit ihm reden. So durfte das nicht weitergehen. Ein Blinder hatte heute sehen können, dass er dieser Gabi nachstieg. Nicht nur, dass er sich damit vor Schülern und anderen Kaffeehausgästen lächerlich machte, er setzte sich auch jederzeit der Gefahr einer Denunziation aus. Das konnte ihn seinen Beruf kosten. Und was Gabi betraf, die spielte doch nur mit ihm, das war doch niemals ernst gemeinte Zuneigung.
Er musste mit Thomas sprechen.
Es war jetzt Viertel nach zwölf. Warum der ›Waldi‹ nur immer so lange mit dem Umkleiden benötigte. Eine großartige Bestellung konnte Leopold jetzt nicht mehr brauchen. Ganz in Gedanken versunken, merkte er gar nicht, wie die kleine, zerfurchte Gestalt, die plötzlich vor ihm stand, ins Lokal gekommen war. Es war Herr Berger, der Kostgänger von Frau Susi, der um diese Zeit normalerweise mit einem Schnitzel und nicht wie jetzt mit den Tränen kämpfte.
»Ja, grüß Sie, Herr Berger, Mahlzeit!«, begrüßte ihn Leopold. »Aber was haben Sie denn? Sie sind ja ganz aufgelöst.«
»Was ich habe?« Herr Berger bemühte sich, so deutlich zu sprechen, wie es in seinem derangierten Zustand möglich war. »Ich wollte nur zur Frau Susi essen gehen wie immer. Da hat es mich schon gewundert, dass mir niemand aufgemacht hat. Also habe ich meinen Schlüssel genommen und zuerst das Haustor und dann die Wohnungstür aufgesperrt.«
»Und?«, fragte Leopold.
»Nichts und. Auf dem Boden ist sie gelegen, die Frau Susi! Tot ist sie! Den Kopf hat ihr einer eingeschlagen!«
»Um Gottes willen!«
Leopold wirkte nach außen hin schockiert und ergriffen, durchdachte die Situation jedoch in seinem Inneren sofort rational und logisch. Ein Gast war tot, ein guter Gast sogar. Das stand zu bedauern. Andererseits war offensichtlich ein Verbrechen geschehen. Und Verbrechen gehörten zu den geheimen Passionen des Obers Leopold. Er liebte nichts mehr als eine Schreckenstat in seiner näheren Umgebung.
Seit er einmal mitgeholfen hatte, einen biederen Kaffeehausgast als Kopf einer Bande von Kunstdieben zu entlarven, fühlte er sich prädestiniert für die Aufklärung von Straftaten aller Art.
»Aus dir hätte ein großer Kriminalist werden können«, hatte Inspektor Juricek, mit dem er im Gymnasium dieselbe Schulbank gedrückt hatte und der damals mit dem Fall betraut gewesen war, gesagt und ihm herzlich für die Mitarbeit gedankt. »Kannst mir jederzeit wieder aushelfen, wenn es sich einmal ergibt.« Mittlerweile arbeitete Richard Juricek bei der Mordkommission und war Oberinspektor. Und Leopold nahm sein Angebot ernst, sehr ernst sogar.
Er konnte sich nicht helfen, aber die Botschaft von einem Mord war in diesem Fall eine gute Botschaft. Er schien Herrn Berger gar nicht zu hören, der verzweifelt vor sich hin stammelte:
»Wenn Sie das gesehen hätten, Leopold, das viele Blut … direkt abgebeutelt hat’s mich, beinahe hätte ich mich gleich neben die arme Susi gelegt … käsebleich muss ich gewesen sein … dabei wollte ich doch nur zum Mittagessen … aber jetzt ist mir der Appetit vergangen. Man muss die Polizei verständigen, Leopold!«
Den letzten Satz hatte er ein wenig lauter gesprochen und Leopold aus seinen Gedanken gerissen. Leise, Berger, leise! Zunächst einmal musste man dafür sorgen, dass jeder Aufruhr tunlichst vermieden wurde. Gott sei Dank waren im Augenblick kaum Gäste im Lokal, und Berger redete in seiner Verwirrung so undeutlich, dass noch niemand die Situation richtig erfasst hatte.
»Haben Sie gehört, Leopold? Wir müssen die Polizei anrufen!«
»Ja, ja, aber beruhigen Sie sich doch erst einmal, Herr Berger! Trinken Sie ein Stamperl auf Kosten des Hauses. Das ist gut für die Nerven.« In aller Eile kredenzte Leopold dem am ganzen Leibe zitternden Berger einen großen Weinbrand. »Na, geht’s schon besser?«, fragte er, nachdem der ausgetrunken hatte. Und weiter:
»Sie haben doch einen Schlüssel zu der Wohnung von der Frau Niedermayer?«
»Ja, natürlich! Aber warum?«
»Weil wir zwei dort noch einmal hingehen, Herr Berger. Keine Angst, es passiert schon nichts. Aber erstens ist es immer besser, vom Tatort selbst anzurufen, das wissen Sie ja.« Berger schüttelte verdattert den Kopf. »Damit wir sehen, ob die Leiche noch da ist, beziehungsweise, ob überhaupt eine da ist, verstehen Sie! Das möchte ich schon überprüfen. Was machen wir, wenn die arme Frau Susi plötzlich verschwunden ist? Ich wette, Sie haben in Ihrer Aufregung nicht einmal die Tür richtig zugemacht. Und zweitens muss ich noch dringend etwas aus der Wohnung holen.«
Für den verdutzten Berger war das alles ein Rätsel. »Müssen wir wirklich?«, fragte er nur ungläubig.
Aber Leopold hatte seinen Entschluss bereits gefasst. Es war eine einmalige Gelegenheit, noch vor der Polizei einen Blick auf den Tatort zu werfen und dafür auch noch einen halbwegs plausiblen Grund zu haben. Außerdem hatte er gestern etwas aus der Innentasche von Frau Susis Mantel leuchten gesehen, als er ihr in diesen hinein geholfen hatte, und hätte jetzt nur zu gerne gewusst, was das war. Es mochte belanglos sein – aber andererseits gab es bei einem Mord keine Belanglosigkeiten.
»Ja, ja«, sagte Leopold. »Schauen Sie, ob wir von hier oder von drüben die Polizei anrufen, ist doch ziemlich egal. Und ich hab der Frau Susi ja schon vor Wochen den Bildband über Kalifornien geborgt und nie mehr zurückbekommen. Wenn ich mir den jetzt nicht hole, ist er weg. Sie kennen das ja. Wo die Leute von der Spurensicherung ihre Finger einmal drin gehabt haben, findet man so leicht nichts mehr. Und wenn so einem so ein schönes Bücherl auch noch gefällt …« Leopold machte eine ziemlich eindeutige Handbewegung.
»Vielleicht haben Sie recht. Gehen wir aber schnell, damit wir’s hinter uns bringen«, jammerte Berger.
Da tauchte auch schon Herr Waldbauer in seiner Livree auf.
»Jetzt können wir gehen«, sagte Leopold. »Waldi, sag der Chefin, wegen der Abrechnung, ich komm gleich noch einmal. Ich muss nur schnell noch mit dem Herrn Berger was erledigen.«
Waldi Waldbauer wunderte zum Glück nichts mehr, dazu war er schon zu lange in diesem Geschäft und kannte außerdem Leopold viel zu gut. Er nickte nur stumm und trat mit steinerner Miene seinen Dienst an.
Leopold hingegen ging noch zu einer ominösen großen Lade, die sich links neben den Billardtischen befand, und kramte darin herum. Es war seine geheime Schatztruhe, sein Heiligtum, in dem er Dinge aller Art und für jeden Zweck verborgen hielt. Obwohl die Lade stets unverschlossen war, konnte sich niemand daran erinnern, dass sie schon einmal jemand außer Leopold geöffnet hatte. Nun zauberte er zwei Paar Handschuhe daraus hervor. Eines davon drückte er Berger in die Hand.
»Das werden Sie brauchen«, sagte er. »Erstens ist es noch ganz schön frisch draußen und zweitens sollten wir keine Fingerabdrücke am Tatort hinterlassen!«
3
Wen wundert’s, dass Herr Berger das Haus, in dem seine Kostgeberin zu Tode gekommen war, mit schlotternden Knien betrat? Zum einen hatte er noch nie so überraschend und unverhofft eine Leiche zu Gesicht bekommen. Zum anderen strahlen alte Häuser, wenn es sich nicht gerade um ein Stadtpalais oder ein romantisches Herrenhaus, sondern um einen von den Jahren gezeichneten Zeugen billigen Wohnbaus aus der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert handelt, eine eher düstere Atmosphäre aus.
Auf Berger wirkte das alte Gemäuer jetzt noch furchterregender als sonst. Im Eingangsflur und dem engen Stiegenhaus mit der gewundenen Treppe war es so dunkel, dass das schwache künstliche Licht zu jeder Tages- und Nachtzeit aufgedreht bleiben musste. Ein abgestandener Geruch, der durch die feuchten Wände noch verstärkt wurde, raubte denjenigen, die nicht hier wohnten, schon beim Hineingehen den Atem. Zurzeit roch es außerdem zusätzlich nach Kohl und Knoblauch.
Trotz all dieser Widerwärtigkeiten erreichten die beiden Herren unbeschadet den ersten Stock, wo sich die Wohnung von Frau Niedermayer befand.
»Ich will nicht noch einmal hineingehen«, murrte Berger.
»Sie können ja im Vorzimmer stehen bleiben, aber jetzt machen S’ bitte einmal auf«, erwiderte Leopold ungeduldig. Er konnte es nicht erwarten, einen geradezu jungfräulichen Tatort vor sich zu haben. Außerdem war ihm in dem dunklen, engen Gang wohl auch ein wenig mulmig.
Ein wenig zitternd nahm Berger den Wohnungsschlüssel hervor und schloss die Türe auf. Während Leopold kurz den kleinen Vorraum musterte und das Licht aufdrehte, blieb er nahezu unbeweglich hinter der Türe stehen.
»Wenn Sie wirklich nicht weiter gehen wollen, dann sagen Sie mir wenigstens, wo sie liegt«, brummte Leopold.
»Im Wohnzimmer«, kam es leise von Bergers Lippen.
Die Tür zum Wohnzimmer lag rechter Hand. Sie führte in einen einfach eingerichteten Raum mit einem Tisch und einer kleinen Sitzecke, einem Fernsehapparat, einer Zimmerpflanze, einem Wandschrank und einigen Regalen, auf denen Bücher und Zeitschriften gestapelt waren. Zwischen dem Schrank und den Regalen befand sich die Tür zum Schlafzimmer. Vor dem Schrank lag die Tote. Der Kopf war leicht zur Seite gedreht, und so sah Leopold sofort die Wunde am Hinterkopf, die den Tod herbeigeführt hatte. Der Teppich war voll Blut.
Leopold schüttelte den Kopf. »So ein schönes Nachthemd zum Sterben anziehen ist ja die reinste Verschwendung«, murmelte er.
Er vermutete, dass der gewaltsame Tod eingetreten war, als Frau Susi sich gerade zu Bett begeben wollte. Die Türe war nicht aufgebrochen worden. Also hatte der Mörder einen Schlüssel wie Herr Berger, oder Susi hatte ihn noch herein gelassen. Das alles musste sich sehr spät zugetragen haben, denn Susi hatte ja erst um halb zwölf das Kaffeehaus verlassen. Aber wann genau?
Neben dem Fernsehapparat lag eine aufgeschlagene Programmzeitschrift. Am Montag, dem 6. November, waren mehrere Sendungen unterstrichen, zwei Gameshows und einige Dokumentationen. Eine dieser angezeichneten Dokumentationen hieß ›Metropolen der Welt: Chikago‹ und war als Wiederholung von 0.30 Uhr bis 1.15 Uhr gelaufen.
Immerhin etwas. Möglicherweise hatte sich Susi Niedermayer diese Sendung noch angesehen, ehe – oder während – sie auf ihren Mörder getroffen war. Die Leiche lag jedenfalls schon länger da, und außerdem war ein gewaltsamer Tod im Morgengrauen statistisch eher unwahrscheinlich.
Erst jetzt fiel Leopold der eigenartige Geruch auf. Es roch in der Wohnung nach Rauch, wenn auch nur schwach. Zuerst hatte er es gar nicht richtig wahrgenommen. Seine Nase war an die verrauchte Kaffeehausluft so gewöhnt, dass ihm dieser leichte Geruch nach Zigarettenrauch gar nicht aufgefallen war. Aber jetzt merkte er es umso deutlicher: Hier hatte jemand geraucht, und er glaubte nicht, dass es Frau Susi gewesen war.
»Herr Berger, haben Sie die Frau Susi jemals rauchen gesehen?«, rief Leopold ins Vorzimmer.
»Nicht, dass ich wüsste«, kam es trocken von dort zurück. »Wann rufen Sie endlich an? Das Telefon steht neben dem Fernseher.«
»Gleich, Herr Berger, gleich! Ich kann nicht zaubern«, sagte Leopold. Dann warf er einen Blick ins Schlafzimmer und entdeckte auch hier Seltsames. Links über dem breiten Doppelbett, dessen Sinn Leopold jetzt nur mehr durch eine gewisse körperliche Verbreiterung bei Frau Susi begründet sah, das aber früher einmal beiden Schwestern als Schlafstatt gedient haben mochte, hing die eingerahmte Fotografie einer weiten Prärielandschaft. Der Platz rechts daneben war frei, eine etwa 50x70 cm große Fläche, bei genauerer Betrachtung heller als der Rest der Wand. Was auch immer dort gehangen hatte, hing jetzt nicht mehr da.
Das Bett selbst war unberührt. Frau Susi hatte sich also noch nicht schlafen gelegt, als sie umgebracht wurde.
»Kommen Sie, Leopold, rufen Sie an!«, klang es ungeduldig aus dem Vorzimmer.
»Jetzt beruhigen Sie sich doch, Herr Berger, und beantworten Sie mir noch eine Frage: Wie viele Bilder hängen für gewöhnlich über dem Bett der Frau Susi?«