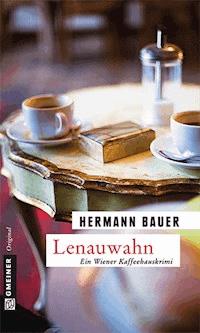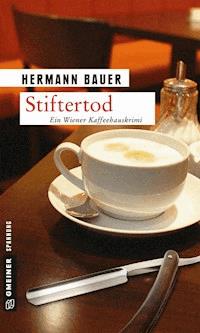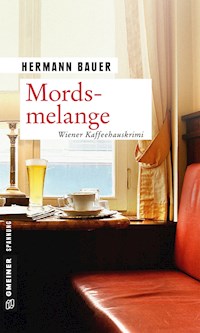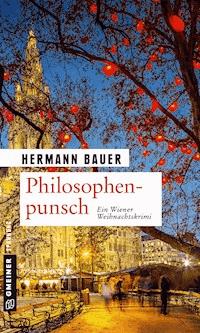Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Chefober Leopold W. Hofer
- Sprache: Deutsch
Nach der Geburtstagsfeier von Leopolds Freundin Erika Haller im Café Heller wird der Frauenheld Eberhard Aichholzer in seinem Zimmer, im nebenan gelegenen Hotel Floridus, erwürgt aufgefunden - mit einer Exit Bag über dem Kopf. Einige im Hotel übernachtende Freunde Erikas zählen genauso zum Kreis der Tatverdächtigen wie ein paar weitere Hotelgäste. Leopold macht sich in diesem komplizierten Fall auf die Suche nach dem Täter, obwohl die Polizei nicht ihn, sondern Erika zur Zusammenarbeit einlädt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Hermann Bauer
Mord im Hotel
Wiener Kaffeehauskrimi
Zum Buch
Gefährliche Verbindungen Leopolds Freundin Erika Haller feiert ihren Geburtstag ausgelassen mit Freunden im Café Heller. Einige von ihnen übernachten im ein paar Häuser entfernt gelegenen Hotel Floridus. Dort löst der betrunkene Conny Kiefer um drei Uhr früh einen Feueralarm aus. Danach wird der regelmäßige Hotelgast Eberhard Aichholzer mit einer Exit Bag über dem Kopf und Würgemalen am Hals tot in seinem Zimmer aufgefunden. Die Aufklärung des Mordes gestaltet sich schwierig, denn auch einige von Erikas Freunden zählen zu den Verdächtigen. Aichholzer war nämlich ein Frauenheld, der solche Gelegenheiten nutzte, um Anschluss zu finden. Obwohl die Polizei Leopold bittet, sich aus dem Fall herauszuhalten, und er von Erika getrennt wird, damit deren Freundin Evelyn Fichtinger zu ihr ziehen kann, beginnt er mit seinen eigenen Ermittlungen. Schon bald gesellt sich zu seiner Neugier eine gehörige Portion Eifersucht wegen Erikas Ex-Freund Lorenz Kessler. So fällt es ihm diesmal besonders schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Hermann Bauer wurde 1954 in Wien geboren. 30 wichtige Jahre seines Lebens verbrachte er im Bezirk Floridsdorf. Während seiner Zeit am dortigen Gymnasium begann er, sich für Billard, Tarock und das nahe gelegene Kaffeehaus, das Café Fichtl, zu interessieren, dessen Stammgast er lange blieb. Seit 1983 unterrichtet er Deutsch und Englisch an der BHAK Wien 10. 1993 heiratete er seine Frau Andrea, der zuliebe er seinen Heimatbezirk verließ. Bauers erster Kriminalroman »Fernwehträume« erschien 2008. Diesem folgten zehn weitere Krimis um das fiktive Floridsdorfer Café Heller und seinen neugierigen Oberkellner Leopold. »Mord im Hotel« ist der elfte Kaffeehauskrimi des Autors.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Mordsmelange (2019)
Mord im Hotel (2018)
Stiftertod (2017)
Kostümball (2016)
Rilkerätsel (2015)
Schnitzlerlust (2014)
Lenauwahn (2013)
Nestroy-Jux (2012)
Philosophenpunsch (2011)
Verschwörungsmelange (2010)
Karambolage (2009)
Fernwehträume (2008)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
3. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Ollyy / shutterstock
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-5812-5
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Kapitel 1
Freitag, 6. Oktober
Oberkellner Leopold stand wie ein Wächter auf der obersten der zwei Stufen vor dem Café Heller, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, und beobachtete interessiert das Geschehen auf der Straße. Seine Daumen rieben dabei immer wieder an den Kuppen von Zeige- und Mittelfinger, was darauf schließen ließ, dass seine sämtlichen Sinne angespannt waren. Das der Jahreszeit entsprechende kühle Wetter und der unangenehme Wind, der durch Floridsdorf fegte, störten ihn nicht. Es tat sich nämlich etwas. Vorn beim Floridsdorfer Gymnasium, das nur ein paar Häuser entfernt war, herrschte ein Riesenwirbel. Es wimmelte von Schülern, die sich statt in der Schule draußen in Gruppen unterschiedlicher Größe aufhielten und offensichtlich von uniformierten Polizisten aufgefordert wurden, einen größeren Abstand zum Gebäude herzustellen. Wandte Leopold seinen Blick aber nach links, sah er ein kleines Häufchen Menschen in einiger Distanz zum Hotel Floridus versammelt. Auch dort war die Polizei im Einsatz.
Irritiert tippte ihm Frau Heller, die Besitzerin des Kaffeehauses, von hinten auf die rechte Schulter. »Was ist los, Leopold?«, wollte sie wissen. »Sie tun, als ob es keine Arbeit gäbe. Dabei haben wir Gäste, und zwar erfreulich viele für einen Vormittag. Die erwarten, dass man sich um sie kümmert!«
»Der Bär ist los, Frau Sidonie«, entgegnete Leopold. »Links Polizei, rechts Polizei. Links ein kleiner Auflauf, rechts ein großer. Menschen in Aufruhr, wohin das Auge blickt.«
»Was hat das zu bedeuten?«, wunderte sich Frau Heller.
»Wenn Sie mich fragen: Es handelt sich um eine Bombendrohung!«
»Eine Bombendrohung? Woher wollen Sie das wissen?«
»Das sagt mir mein Instinkt«, erklärte Leopold. »Wenn die Schüler alle vorm Gymnasium sind und die Polizei dort steht, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Feueralarm oder Bombenalarm. Erstens schaut es aber nicht aus, als ob es brennen würde, zweitens sehe ich keine Feuerwehr, und drittens ist es höchst unwahrscheinlich, dass die Schule und das Hotel zugleich unter Feuer stehen. Also tippe ich auf eine Bombendrohung. Aber wir werden sicher bald Genaueres erfahren. Thomas Korber wird uns über den aktuellen Stand der Dinge berichten, sobald er Zeit hat, und Inspektor Bollek habe ich schon gesehen, wie er sich wichtig macht.«
»Na schön! Dann können Sie wieder hereinkommen und Ihrer Arbeit nachgehen«, forderte Frau Heller ihren Oberkellner mit Nachdruck auf.
Widerwillig folgte Leopold dieser Anweisung. Während er Kaffee, Mehlspeisen, diverse Getränke und kleine Schmankerl servierte, sah er durch die großen Fenster, wie sich die Ansammlung beim Hotel nach und nach auflöste. Also musste es auch bei der Schule bald so weit sein. Nach einiger Zeit betraten schließlich Leopolds Freund Thomas Korber, der am Floridsdorfer Gymnasium Deutsch und Geschichte unterrichtete, und Inspektor Norbert Bollek das Heller, um sich zu stärken. Beide bestellten einen großen Braunen und gesellten sich zu Leopold an die Theke.
»Na, was war der Grund für den Auflauf?«, erkundigte Leopold sich neugierig.
»Eine Bombendrohung beziehungsweise deren zwei«, informierte ihn Bollek unwirsch. Leopold zwinkerte indessen Frau Heller zum Zeichen, dass er recht gehabt hatte, schelmisch zu.
»Ich behaupte, es handelt sich um einen dummen Scherz eines unserer Schüler. Aber Norbert will mir einfach nicht glauben«, konstatierte Korber.
»In unruhigen Zeiten wie diesen, wo öffentliche Gewalt und Terrorismus an der Tagesordnung stehen, kann man nicht von einem Lausbubenstreich ausgehen und tun, als sei nichts gewesen, lieber Thomas«, belehrte Bollek ihn. »Das ist eine Angelegenheit, die genau untersucht werden muss. Wer sagt denn, dass die Drohung der Schule galt und nicht dem Hotel Floridus? Der Anruf dort erfolgte nur ein paar Minuten später.«
»Aber es ist keine Bombe oder sonst etwas gefunden worden«, beruhigte Korber ihn. »Alles hat sich in Wohlgefallen aufgelöst.«
»Davon kann man zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht sprechen«, erklärte Bollek. »Versuche einmal, dich in einen Terroristen hineinzudenken. Was sind seine Ziele? Er möchte möglichst viel Verwirrung und Unruhe stiften, die Menschen in einem Zustand der Unsicherheit belassen und seine wahren Absichten verschleiern, bevor es wirklich kracht. Im Augenblick ist alles auf das Gymnasium fokussiert: ein großes Gebäude, Hunderte von Schülern, aufgeregtes Lehrpersonal, besorgte Eltern. Aber was ist mit dem Hotel? Dort kann leicht der Eindruck entstehen, als sei die Sache schon gegessen. Dabei ist meiner Meinung nach das absolute Gegenteil der Fall und gerade dort besteht für die Menschen weiterhin höchste Gefahr.«
»Und was bestärkt Sie in dieser Vermutung?«, brachte Leopold sich in das Gespräch ein.
»Ich habe einen kurzen Blick auf die Gästeliste geworfen«, erläuterte Bollek. »Zwei Herren aus Afghanistan, ein Ehepaar aus Russland, ein Tschetschene, ein Syrer …«
»Menschen aus aller Herren Länder, wie das in einem Hotel üblich ist«, kommentierte Leopold trocken.
»Menschen, die nur zu prädestiniert dafür sind, als Opfer eines Anschlags auserkoren zu sein«, widersprach Bollek. »Andererseits kämen sie natürlich auch als Täter in Frage.«
»Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt?«, staunte Leopold.
»Das sagen gerade Sie, Herr Hofer?«, wurde Bollek eine Idee lauter. »Sie, dessen Schlussfolgerungen oft weiß ich wie weit hergeholt sind? Sie mögen damit den einen oder anderen überraschenden kleinen Erfolg erzielt haben, aber was die Prävention von Verbrechen angeht, haben Sie leider überhaupt keine Ahnung. Dazu gehört nämlich ein gewisser kriminalistischer Instinkt, und ich traue mich zu behaupten, dass ich den besitze. Er sagt mir, dass das Hotel und seine Gäste einer großen Bedrohung ausgesetzt sind. Aber das verstehen Sie offenbar nicht.«
Leopold amüsierten Bolleks Gedankengänge. »Und was wollen Sie dagegen unternehmen?«, erkundigte er sich. »Das Haus Tag und Nacht bewachen lassen?«
Bollek winkte ab. »Hier muss man diskret vorgehen«, stellte er klar. »Ich selbst werde an diesem Wochenende dort übernachten und nach dem Rechten sehen. Mehr möchte ich dazu im Augenblick nicht sagen. Und Sie, Herr Hofer, möchte ich nur dringendst ersuchen, mir dabei nicht ins Handwerk zu pfuschen!«
»Keine Sorge! Wir haben im Kaffeehaus eine kleine Feier, bei der ich voll eingesetzt bin«, beschwichtigte Leopold ihn.
»Dann ist es ja gut!« Bollek trank seinen Kaffee aus, blickte nervös auf seine Uhr und zahlte. Offenbar sah er den Beginn seiner Mission gekommen. Er verabschiedete sich von Korber und war schnell draußen auf der Straße.
Leopold schüttelte den Kopf. »Hast du so etwas schon gesehen? Der wird immer eigenartiger«, bemerkte er zu Korber.
»Ich habe eine Vermutung«, erwiderte dieser. »Die Bombendrohung ist Bollek gerade recht gekommen. Er hat sich nämlich mit Nora endgültig zerstritten, und sie hat ihn daraufhin aus ihrer Wohnung geworfen. Jetzt lebt er wieder in seiner kleinen Garçonnière und fühlt sich nicht wohl. Da ist das doch eine wunderbare Gelegenheit, ein Wochenende auf Staatskosten im Hotel zu verbringen.«
»Das schaut ihm ähnlich«, spöttelte Leopold.
»Mich wundert nur, dass du alles so gelassen siehst«, erwähnte Korber. »Normalerweise vermutest du doch hinter allem und jedem einen verbrecherischen Hintergrund.«
Frau Heller, die die ganze Zeit am Haustisch gesessen war und das Gespräch mit einem Ohr mitverfolgt hatte, meldete sich nun zu Wort: »Das ist mir auch aufgefallen, dass Sie diese Bombendrohung im Gegensatz zu Ihren sonstigen Gewohnheiten herunterspielen. Gibt es da vielleicht besondere Gründe dafür?«
Ihr durchdringender Blick traf Leopold, der deshalb kurz zögerte, ehe er »Eigentlich nicht« murmelte.
»Ich kenne Sie«, redete Frau Heller auf ihn ein. »Wenn Sie so dreinschauen, haben Sie ein schlechtes Gewissen. Ich befürchte Schreckliches! Gestehen Sie, Leopold! Wurde auch hier im Kaffeehaus angerufen? Haben wir ebenfalls eine Drohung erhalten?«
»Wie Thomas richtig sagt, das sind Lausbubenstreiche«, versuchte Leopold sich herauszureden.
»Gab es einen Anruf oder nicht?«, insistierte Frau Heller.
»Ja«, gab Leopold klein bei.
»Mit dem Inhalt, bei uns sei eine Bombe versteckt, die innerhalb kurzer Zeit hochgehen würde?«
»So in etwa, ja!«
»Und wie haben Sie darauf reagiert?«
»Ich habe gesagt: ›Könnten Sie bitte etwas deutlicher sprechen, ich verstehe Sie leider überhaupt nicht.‹ Es war eine männliche Stimme, und sie hat versucht, ausländisch zu klingen. Wirklich sehr undeutlich.«
»Und dann?«
»Dann hat er sein Sprücherl erneut heruntergebetet, aber ich habe ihm mitgeteilt, dass ich ihn nicht verstünde, weil die Verbindung sehr schlecht sei. Er solle noch einmal anrufen oder persönlich vorbeikommen. Danach habe ich aufgelegt.«
»Soso! Die Polizei haben Sie nicht verständigt?«
»Nein! Wozu auch? Der Kerl hat sich nicht mehr gemeldet«, verteidigte sich Leopold. »Wenn es ihm ernst gewesen wäre, hätte er sicher noch einmal angerufen, um sicherzugehen, dass seine Botschaft ankommt. Aber wahrscheinlich hat er es mit der Angst zu tun bekommen, dass ich seine Stimme erkenne, weil es sich um einen Schüler oder anderen Kaffeehausgast handelt. Ich hab mich eh unauffällig ein bisserl umgeschaut, ob ich etwas Verdächtiges entdecke, jedoch nichts gefunden. Seien Sie doch ehrlich, Frau Sidonie: Wie sollte es jemand zuwege bringen, bei uns eine Bombe zu verstecken, ohne dass es jemand bemerkt?«
»Das ist mir egal«, schnauzte Frau Heller ihn an. »Sie haben riskiert, dass unser schönes Lokal mitsamt unseren Gästen und, was wichtiger ist, mitsamt meiner werten Person in die Luft fliegt. Wie weit wollen Sie mit Ihren mittlerweile lebensbedrohenden Experimenten gehen? Ob es Ihnen passt oder nicht, dies ist ein Ernstfall, über den Sie mich in Kenntnis zu setzen haben. Was weiter geschieht, entscheide immer noch ich!«
»Sehr wohl, Frau Sidonie! Ich hab halt geglaubt, ich mache Ihnen eine Freude, wenn ich Ihnen den ganzen Wirbel erspare«, bekannte Leopold. Frau Hellers darauf folgender Blick war so wütend, dass er schnell eine Flasche Cola samt dazugehörigem Glas schnappte und damit zu einem Gast am zweiten Fenstertisch lief. Sie sah aus wie eine Bombe, die jederzeit explodieren konnte.
*
Konrad Kiefer hatte den Bombenalarm wie die wenigen anderen Gäste, die sich um halb elf Uhr vormittags im Hotel Floridus aufhielten, als unwillkommene Unterbrechung seiner Zimmerruhe empfunden. Es war ein unfreundlicher, windiger Tag Anfang Oktober, an dem es niemandem gefiel, für unbestimmte Zeit auf der Straße zu stehen und zu frieren. Hätte man etwas vorgehabt, wäre man längst nicht mehr im Hotel gewesen. Aber Konrad Kiefer hatte nichts Bestimmtes vor.
Nichts Bestimmtes, außer das Wochenende im Hotel zu verbringen. Er hatte seiner Frau und seinem Sohn erzählt, er sei auf Geschäftsreise, um größere Aufträge für seine Firma an Land zu ziehen und sich nebenbei die Stadt Wien ein wenig anzusehen. Das war jedoch gelogen. Konrad ›Conny‹ Kiefer konnte keine Büromöbel mehr verkaufen. Die Firma hatte ihn gekündigt. Qualität war offenbar nicht mehr gefragt. Billig musste es sein, und vieles wurde bereits über das Internet verkauft. In ein paar Jahren würden die Möbel wohl direkt aus dem Computer ausgedruckt werden.
Für Kiefer hieß das, dass er arbeitslos geworden war. Er hatte gut verdient, außerordentlich gut sogar, aber auch einen entsprechenden Lebenswandel geführt. Damit war es vorbei. Auf das Haus in der Nähe der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten war ein Kredit zurückzuzahlen, dessen Raten bald eine erhebliche Belastung darstellen würden. Es gab noch andere Schulden, Resultat von Kiefers Leidenschaft für Spiel und Frauen. Was würde seine Gattin Petra wohl sagen, wenn sie davon erfuhr? Oder sein Sohn Markus? Sie würden ihm nicht verzeihen, im Gegenteil: Verachten würden sie ihn.
Im Augenblick hatte sich Kiefer eine Nachdenkpause verschafft und musste niemandem Rechenschaft ablegen. Aber eine Reihe kleinerer Katastrophen in der nächsten Zeit schien unabwendbar. Er konnte nicht annehmen, in seinem Alter jenseits der 50 jemals wieder einen derart gut bezahlten Job zu bekommen. Die Abfertigung würde nicht ewig reichen. Dann würde er ohne finanzielle Mittel dastehen und keine andere Wahl haben, als das Haus gegen eine kleine Mietwohnung zu tauschen. Wahrscheinlich stand die Scheidung dann auch vor der Tür. Er würde leiden müssen. Dabei hatte seine Leidensfähigkeit ihre Grenzen. Kiefer war nun einmal nicht für Gram und Mühsal geboren.
Als eleganteste Möglichkeit, diesem Dilemma ein Ende zu setzen, bevor es richtig begonnen hatte, erschien es ihm, seinem Leben hier in der Anonymität eines Hotels ein Ende zu setzen. Das würde es ihm ersparen, sich auch nur vor irgendjemandem verantworten zu müssen. Wie hässlich es war, gezwungen zu sein, anderen Leuten ins Gesicht zu sehen, wenn man sich ihnen gegenüber schuldig fühlte. Man war doch dem Schicksal gegenüber ohnehin machtlos. Warum sahen das so wenige Menschen ein?
Das Beruhigende für Kiefer war nur, dass er im Augenblick nichts tun konnte, als sich ein wenig treiben zu lassen und seine Situation zu überdenken. Sollte er sich wirklich umbringen? Noch hatte er nicht den Mut dazu, denn er war ausgesprochen feige. Aber wenn seine Melancholie und Verzweiflung den kritischen Punkt erreichten, war alles möglich.
*
Leopold vergewisserte sich mit einem Blick in die Runde. Nein, es war eine Schnapsidee, dass jemand im Café Heller eine Bombe zünden wollte. Er würde es in dieser beschaulichen Atmosphäre gar nicht übers Herz bringen. Das Klicken der Billardkugeln, das Rascheln der Zeitungen und das Umrühren in den Kaffeetassen würde auf einen möglichen Attentäter viel zu beruhigend wirken. Wer hier mit einem Sprengsatz hereinkam, würde mit diesem auch wieder hinausgehen. Er würde höchstens noch ein Schalerl Kaffee trinken, ehe er die Bombe woanders explodieren ließ.
»Da habt ihr ja im Gegensatz zu uns einen aufregenden Vormittag gehabt«, stellte Leopold Robert Kienast, einem der Portiere des Hotels Floridus, gegenüber fest. Kienast kam gern vor seinem Dienstantritt auf einen kleinen Braunen ins Heller. Mit seinen schwarzen, glatt zurückgekämmten Haaren und der dunkel umränderten Brille wirkte er streng, obwohl er die Gutmütigkeit in Person war.
»Ich war nicht dabei«, bemerkte er beinahe entschuldigend. »Aber natürlich hat man mir alles brühwarm erzählt. Der Neue hat seine Sache übrigens recht gut gemacht.«
Bei dem ›Neuen‹ handelte es sich um David Panozzo, den Sohn von Christa Wohlfahrt, die in einer relativ engen freundschaftlichen Bindung zu Thomas Korber stand. David hatte sich nach der Scheidung seiner Eltern von seinem Vater aushalten lassen und lange um eine Beschäftigung gedrückt. Als sein Vater nicht mehr alle seine finanziellen Wünsche befriedigen konnte oder wollte, wandte er sich ziemlich aggressiv an seine Mutter und appellierte an ihr schlechtes Gewissen. Christa war nämlich Alkoholikerin gewesen und hatte David in dieser Zeit sehr vernachlässigt. Im Zuge dessen war Leopold David begegnet. Er hatte ihn zunächst als überheblichen Rotzbuben abgestempelt. Bei der Klärung seines letzten Falles hatte David sich jedoch als hilfreich erwiesen und gezeigt, dass er einen guten Kern hatte. Als Leopold von Kienast hörte, dass im Hotel eine Stelle in der Rezeption frei war, setzte er sich für David ein – und die Sache klappte.
»Er hat alles nach Vorschrift abgewickelt«, fuhr Kienast fort. »Die Polizei verständigt, die Gäste aus der Gefahrenzone gebracht und dabei unaufgeregt gehandelt, als ob er den Job jahrelang machen würde. Ein wirklich patenter Kerl.«
»Das freut mich zu hören«, bekundete Leopold. »Obwohl ich mir gleich gedacht habe, dass es sich um einen falschen Alarm handelt.«
»Das weiß man nie genau«, betonte Kienast. »Hoffen wir, dass sich die Sache nicht wiederholt, womöglich gar am Wochenende. Heute und morgen kommen einige Gäste der Geburtstagsfeier deiner Lebensgefährtin zu uns. Die sollen sich im Hotel Floridus wohl fühlen!«
Es war eine Feier, vor der Leopold bereits graute. Die Debatte um eine gemeinsame Wohnung mit seiner Freundin Erika Haller hatte sich gerade beruhigt, da war ihr die Idee einer großen Geburtstagsfete gekommen, obwohl es sich um gar kein rundes Jubiläum handelte. Sie wollte Freunde, Verwandte und auch Menschen, die sie länger nicht mehr gesehen hatte, dazu einladen, jeden, der Rang und Namen hatte. Wenn Leopold sie nach dem Grund fragte, meinte sie, ihr sei danach. Es sollte ein rauschendes Fest werden.
Um dieser Schar ihren Freund Leopold gebührend zu präsentieren, sollte das Fest am Samstagabend im Café Heller stattfinden, wo das Lokal normalerweise geschlossen hatte. Man war dann unter sich und hatte es bequem. Für Gäste, die von weiter her kamen oder in der Nacht nicht mehr nach Hause fahren wollten, hatten Erika und Leopold Zimmer im Hotel Floridus reserviert und einen günstigen Nächtigungstarif ausgehandelt.
»Ich hoffe das Beste«, setzte Leopold die Unterhaltung fort. »Inspektor Bollek befürchtet freilich, die Drohung war nur der Auftakt zu einem terroristischen Anschlag. Deshalb hat er sich über das Wochenende bei euch einquartiert.«
»Ach so? Na ja, wenn er meint«, ließ das Kienast kalt. »Wir haben da unsere eigenen Sicherheitsvorkehrungen. In solchen Fällen lassen wir meist einen Privatdetektiv nach dem Rechten sehen.«
»Gute Idee«, erwähnte Leopold lobend. »Denn so wenig ich an ein terroristisches Attentat glaube, so sehr fürchte ich etwas anderes. Erika hat die verschiedensten Leute zu ihrer Geburtstagsfeier eingeladen, die aus allen Himmelsrichtungen angereist kommen. Da trifft eine Menge Personen für kurze Zeit an einem Ort zusammen. Teilweise kennen sie sich, teilweise nicht. Teilweise werden sie sich mögen, teilweise nicht. Eine alte Theorie von mir besagt, dass in solchen Fällen das Konfliktpotenzial besonders hoch ist. Ich spüre die Gefahr eines Verbrechens in jeder Faser meines Körpers, Robert!«
Kienast musste schmunzeln. »Du hörst wieder einmal das Gras wachsen, wie man so schön sagt. Hie und da liegst du mit deinen Vermutungen leider richtig. Hast du mit Erika darüber gesprochen?«, erkundigte er sich.
»Natürlich, aber die hat mich nur ausgelacht«, antwortete Leopold. »Ich hätte eine kriminalistische Übersensibilität, hat sie gemeint. Ich wollte nicht weiter mit ihr darüber diskutieren. Aber dich bitte ich, passt mehr auf als sonst!«
Kienast lehnte seinen Oberkörper ein Stück über die Theke. »Wenn es dich beruhigt: In unserem Hotel ist noch nie etwas Schwerwiegendes passiert«, zog er Leopold ins Vertrauen. »Die meisten Gäste kommen und gehen schnell wieder, da ist für solche Reibereien, wie sie dir vorschweben, kein Platz. Ein paar Beschwerden, eine kurze Meinungsverschiedenheit, das ist alles. Nichts Sensationelles, wie es etwa im bekannten Buch Menschen im Hotel von Vicki Baum beschrieben ist.«
Leopold schaute Kienast fest in die Augen. »Ich glaube dir, und gegen den ausgezeichneten Ruf eures Hotels ist auch sicher nichts einzuwenden«, bekannte er. »Trotzdem wird mir mein blödes Gefühl sicher über das ganze Wochenende keine Ruhe lassen.«
*
Der Titel eines Freiherrn oder Barons war während der k. u. k. Monarchie in Österreich sehr beliebt. Man bekam ihn meist vom Kaiser für besondere Verdienste verliehen. Seit dem Jahr 1919 ist er allerdings, wie alle anderen Adelsprädikate auch, aus dem offiziellen österreichischen Vokabular verschwunden.
Offiziell, denn inoffiziell lebt vor allem die Anrede ›Baron‹ munter weiter, und viele der Menschen, die sich so betiteln lassen, stört es nicht im Geringsten, dass ihre adelige Herkunft auf äußerst nebulosen Annahmen basiert. Irgendwo gibt es einen ungewissen Punkt im Stammbaum, eine nicht nachweisbare Verästelung, die Behauptung einer ledigen Mutter. Schon schlägt der Geltungsdrang zu, und im Grunde ist niemand darüber böse. Der selbsternannte Baron erzählt von Urgroßvätern, die mit dem Kaiser auf Du und Du waren, woraufhin der Frisör, der Oberkellner im Kaffeehaus oder der Hotelportier Bescheid wissen und eine untertänige Verbeugung andeuten.
»Habe die Ehre, Herr Baron, wie steht das werte Befinden?«, grüßte auch Robert Kienast sein Gegenüber mit dem gebührenden Respekt. Eberhard Aichholzer war zur Rezeption gekommen, um die Lage zu sondieren und ein wenig mit ihm zu plaudern.
»Es geht wieder halbwegs nach dem unangenehmen Vorfall vom Vormittag«, ließ Aichholzer ihn wissen. »Plötzlich mir nichts, dir nichts hinaus auf die Straße, das war entwürdigend. Stell dir vor, ich hätte gerade Damenbesuch am Zimmer gehabt. Gar nicht auszudenken so etwas!«
»Vielleicht ein Wink des Schicksals, Ihre Damenbesuche zu reduzieren, Herr Baron«, erlaubte Kienast sich zu sagen. Er konnte Aichholzer gut leiden, obwohl der im Grunde nichts anderes war als ein Tagedieb und kleiner Gauner. Vielleicht war seine Abkunft tatsächlich höheren Geblüts, wie er angab, und unter Umständen bestritt er seinen Lebensunterhalt auch aus Grundstücken, die er geerbt und nach und nach verkauft hatte. Genau ließ sich das nicht sagen. Jedenfalls ging er keiner geregelten Tätigkeit nach, lebte, wie man hörte, in einer normalen Mietwohnung und klapperte zwischendurch einige der nicht zu hochpreisigen Hotels ab – einerseits, weil er sich in dieser Atmosphäre wohlfühlte, andererseits der alleinstehenden älteren Damen wegen, die er dort anzutreffen hoffte. Denn diese zu erobern, vor allem, wenn sie Geld auf der Seite hatten, war seine wahre Passion.
Er war elegant gekleidet: Sakko, weißes Hemd, Halstuch. Eine Locke seines gewellten Haares baumelte wie zufällig über seiner Stirn. Seine vollen Lippen lächelten gern und zeigten stets die Bereitschaft zu mehr. Er wirkte sympathisch wie ein gut angezogener, gepflegter Lausbub und setzte seinen gewinnenden und letztlich Gewinn bringenden Charme ein, wo er nur konnte. Nicht selten wurde nämlich seine Galanterie mit beachtlichen finanziellen Zuwendungen von weiblicher Seite belohnt. Um den Neid manch eifersüchtigen Mannes kümmerte er sich nicht. Nun verbrachte er wieder einmal ein paar Tage im Hotel Floridus.
»Die Damen sind das Salz in der Suppe des Lebens, Robert«, entgegnete er Kienast deshalb. »Gibt es einen schöneren Grund, sich auf den Weg zu machen als die Hoffnung, einer Vertreterin des anderen Geschlechts zu begegnen, die einen mit ihren Reizen umgarnt? Als das erwartungsvolle Funkeln in ihren Augen? Das Rot der Lippen ihres halb geöffneten Mundes? Ihre Nervosität, wenn sie auf den ersten Kuss wartet? Es gibt keinen schöneren Grund, glaube mir!«
»Da kann ich leider nicht mitreden«, gab Kienast zu. »Ich bin verheiratet. Meine Frau wartet daheim immer mit dem Essen auf mich. Das Salz in der Suppe ist daher im wahrsten Sinne des Wortes das Salz in der Suppe.«
»Mir gefällt an dir, Robert, dass du eine treue, ehrliche Seele bist. Aber sag: Wie sieht es mit euren Gästen über das Wochenende aus? Bin ich umsonst gekommen?«, kam Aichholzer auf sein Anliegen zu sprechen.
Kienast rückte seine Brille zurecht und vergewisserte sich, dass niemand in der Nähe war. »Im Gegenteil, Herr Baron«, teilte er Aichholzer vertraulich mit. »Drüben im Kaffeehaus findet eine Geburtstagsfeier statt. Dazu kommen etliche Gäste angereist, die bei uns übernachten. Zum Teil sind sie zu zweit, zum Teil alleine. Der Altersdurchschnitt dürfte passen. Es könnte etwas für Sie dabei sein.«
»Hervorragend«, freute Aichholzer sich. Dann hielt er einen Augenblick gespannt inne. Die Hoteltür öffnete sich, und herein trat eine Frau, die zwar nicht mehr die Jüngste war, auf den ersten Blick aber ungeheuer attraktiv wirkte: blondgelocktes Haar, dezentes Make-up, leicht gerötete Wangen, volle Lippen, dazu eine wohlgeformte Figur, bei der die Proportionen an den entscheidenden Stellen stimmten. Sie war außer Atem und zog ein kleines Köfferchen hinter sich her.
»Mein Name ist Fichtinger«, wandte sie sich mit ihren Reservierungsunterlagen an Kienast. »Evelyn Fichtinger. Ich habe ein Einzelzimmer bis Sonntag bei Ihnen gebucht.«
»Einen Augenblick, gnädige Frau.« Kienast holte sich die Daten am Computer. Aichholzer stand daneben, strich mit seiner Hand über sein gewelltes Haar und lächelte Evelyn Fichtinger an. Sie lächelte zurück. »Sie gehören zur Geburtstagsfeier?«, fragte Kienast unterdessen.
»Genau! Zur Geburtstagsfeier von Erika Haller im Café Heller«, bestätigte die Neuangekommene.
Kienast überreichte ihr den Zimmerschlüssel. »Zimmer 104, erster Stock«, informierte er sie. »Kann ich mit dem Gepäck behilflich sein?«
Aichholzer vernahm es mit Freuden. Er wohnte auf 103. Er würde Kienast später ein kleines Trinkgeld zukommen lassen. »Bemühe dich nicht, Robert, ich wollte soeben auch hinaufgehen«, meldete er sich galant zu Wort. »Darf ich?«
»Es wäre nicht notwendig, aber es ist wirklich sehr nett von Ihnen«, lächelte Evelyn Fichtinger ihm erneut zu.
Robert Kienast schaute den beiden nach, wie sie gemeinsam zum Aufzug gingen, und sagte zu sich: »Er ist wirklich ein Pülcher. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Er schafft es immer wieder.«
Kapitel 2
»Hör zu, Hannes! Ich finde, es ist keine gute Idee, dass du mitkommst.«
»Ich halte es sogar für eine ausgezeichnete Idee!«
Die Frau ging nervös im Zimmer auf und ab. Sie hatte ihre Jacke anbehalten und rauchte in hastigen Zügen eine Zigarette. »Wir leben getrennt. Wir haben uns nichts mehr zu sagen«, führte sie ins Treffen. »Wir sind froh, wenn wir einander nicht sehen. Warum um alles in der Welt möchtest du da unbedingt zu Erikas Geburtstagsfeier mitkommen?«
»Wer hat die Einladung bekommen?«, fragte Hannes grinsend.
»Mach dich nicht lächerlich«, reagierte die Frau verärgert. »Es ist klar, dass sie bei dir gelandet ist. Dein Domizil war früher unsere gemeinsame Adresse.«
»Und was steht drauf? An Ingeborg Förster und Hannes Auer in großer Schrift, ganz deutlich zu lesen. Wir sind beide eingeladen, also gehen wir auch beide hin. Es sei denn, du willst daheim bleiben.«
»Ich denke nicht daran«, protestierte Ingeborg, ihre Zigarette ausdämpfend. »Warum willst du überhaupt hin? Erika ist schließlich meine Schulkollegin.«
»Du wirst es nicht glauben: Ich habe sogar mit ihr telefoniert«, klärte Auer seine frühere Lebensgefährtin auf. »Erika freut sich auf uns. Und ich freue mich darauf, etliche Leute wiederzusehen. Es verspricht, ein vergnüglicher Abend zu werden.«
Ingeborg lachte kurz höhnisch auf. »Läuft etwa in Erikas Freundeskreis auch eine von deinen Weibergeschichten?«, erkundigte sie sich sarkastisch.
»Wenn, dann würde es dich nichts angehen«, lächelte Hannes spöttisch zurück. »Aber ich kann dich beruhigen, dem ist nicht so. Ich will mich schlicht und einfach gut unterhalten und sehe nicht ein, warum ich mir das von dir verbieten lassen soll.«
Ingeborg setzte sich nun doch auf das Sofa, das noch vor ein paar Wochen ihr Lieblingsmöbel gewesen war. Es erinnerte sie nur mehr an den Scherbenhaufen ihrer Beziehung. Sie und Hannes, zwei Egoisten, jeder stets mit dem Kopf durch die Wand. Eigentlich war es, nachträglich betrachtet, ein Wunder, dass ihre Lebensgemeinschaft stolze acht Jahre gehalten hatte. Niemand hätte das gedacht, und es war beinahe ein Kompliment, dass Erika Haller annahm, sie seien beide weiterhin zusammen.
»Und ich sehe nicht ein, warum du Erika, wenn du mit ihr telefonierst, nicht über unsere Trennung informiert hast«, reagierte Ingeborg Förster scharf. »Sie hat ein Doppelzimmer für uns reserviert.«
Hannes Auer zuckte mit den Schultern. »Das stört doch nicht. Diese eine Nacht wirst du es schon mit mir aushalten.«
»Ich werde es nicht mit dir aushalten, auf keinen Fall! Glaubst du, ich kann das, was zwischen uns geschehen ist, vergessen? Mir vorstellen, dass alles ist wie früher? Das kannst du dir abschminken! Wir werden auf zwei Einzelzimmer umbuchen!«
»So etwas ist normalerweise einen Tag vor der Ankunft nicht leicht möglich. Außerdem würde das alles unnötig verkomplizieren.«
»Dann wechsle ich eben in ein anderes Hotel!«
»Glaubst du, dass Erika dir dafür dankbar sein wird?«, redete Hannes auf Ingeborg ein. »Sie hat das Ganze arrangiert, bezahlt uns die Übernachtung. Und dann kommst du und bringst alles durcheinander. Warum lassen wir es nicht, wie es ist? Vor gar nicht langer Zeit haben wir uns auf unsere gemeinsamen Nächte gefreut!«
Ingeborg Förster zündete sich die nächste Zigarette an. Sie schwankte. Genau genommen war es wirklich egal, ob sie diese paar Stunden zusammen in einem Zimmer verbrachten oder nicht. Sie würden ohnehin beide viel trinken und dabei eine Bettschwere bekommen, die jeden die Anwesenheit des anderen vergessen ließ. Machte es Sinn, sich deswegen zu streiten? Es war wirklich spät, in die Planung einzugreifen. Und außerdem ging es niemanden von den anderen Gästen etwas an, dass sie und Hannes nicht mehr beisammen waren.
Aber sollte sie ihm recht geben? War die Art, wie er die Angelegenheit handhabte, nicht die reinste Provokation? Warum ließ sie sich ständig von Hannes aus der Ruhe bringen? »Wie stellst du dir das Wochenende also vor?«, fragte sie.
»Ganz einfach: Wir tun, als wäre alles beim Alten«, schlug er vor. »Ich reiße mich am Riemen, das verspreche ich dir. Mir liegt nichts ferner, als an diesen zwei Tagen dauernd meine Nerven zu strapazieren.«
»Wenn du Blödsinn machst, kratze ich dir die Augen aus«, warnte sie ihn kühl.
»Und wenn du dich unnötig aufregst, werfe ich dich mitsamt deinem Gewand unter die Dusche und begieße dich so lange mit eiskaltem Wasser, bis du Ruhe gibst«, konterte er.
»Na schön, dann können wir es ja wagen«, beendete Ingeborg daraufhin die Debatte.
Es sah nach einem Kompromiss aus, mit dem beide leben konnten. Man würde sich zusammenreißen, um für ein halbwegs erträgliches Klima zu sorgen. Was allerdings geschehen würde, wenn einer von ihnen unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über sich verlor, daran wagten weder Ingeborg Förster noch Hannes Auer im Augenblick zu denken.
*
»Ist es nicht herrlich, dass man seinen Geburtstag groß feiern kann, wann man will, und sich nicht von irgendwelchen Zahlen terrorisieren lassen muss?«, redete Erika Haller voller Vorfreude auf ihr großes Fest auf Leopold ein. »Wer weiß, ob ich zu meinem Fünfziger Lust dazu habe und wie ich beisammen bin. Vielleicht liege ich mit Fieber im Bett und bin sterbenskrank! Aber jetzt habe ich das unwiderstehliche Bedürfnis, meine alten Freunde und Bekannten wiederzusehen.«
Leopold konnte dieser Begeisterung nicht allzu viel abgewinnen. »Es wird ein Riesenwirbel werden«, seufzte er.
»So soll es sein, dann kommt endlich Stimmung in die Bude«, schwärmte Erika. »Ich bin mit der Gästezahl ohnehin im Rahmen geblieben, Schnucki. In Mexiko wurden zu einer Geburtstagsfeier unlängst 1,3 Millionen Menschen per Facebook eingeladen.«
»60 Leute reichen vollkommen! Die meisten hast du schon lange nicht gesehen. Wer weiß, wie sich die alle entwickelt haben, ganz abgesehen davon, dass es fraglich ist, wie gut sie sich miteinander verstehen«, gab Leopold zu bedenken.
»Das ist typisch«, beanstandete Erika. »Ständig meckerst du herum! Bevor du dir dein Hirn über meine Freunde zermarterst, solltest du dir über dein Umfeld Gedanken machen. Deine Spezln vom Kaffeehaus sind bisweilen äußerst zwielichtige Gestalten. Zu meinem Geburtstag hingegen kommen völlig normale Menschen, vor denen sich niemand zu fürchten braucht.«
Mit dieser Bemerkung hatte Erika eine Schwachstelle Leopolds getroffen. Manchmal, wenn er nachts einen unruhigen Schlaf hatte, stellte er sich nämlich die Frage, ob er wirkliche Freunde hatte, und wenn ja, wen er als solche bezeichnen konnte. Ernüchtert stellte er dann fest, dass der einzige Mensch, der ihm dabei einfiel, Thomas Korber war. Mit all seinen anderen Bekanntschaften hatte er beinahe ausschließlich durch seinen Beruf Kontakt oder, was beinahe schlimmer war, durch seine Verbrecherjagden. Normalerweise fiel ihm das gar nicht auf, aber in Situationen wie jetzt, wo Erika alles mobilisierte, was ihr lieb und wert war, spürte er eine große Leere in sich aufsteigen.
»So habe ich es nicht gemeint«, schwächte er ab. »Du kannst an deinem Ehrentag tun und lassen, was du willst. Und du brauchst keine Angst davor zu haben, dass ich als Revanche meinen Geburtstag mit 60 fragwürdigen Spezln feiere und dich um deine Anwesenheit bitte. Ich werde es nämlich mit meinen bisherigen Gepflogenheiten halten und meinen Geburtstag überhaupt nicht feiern!«
»Ach, sind wir wieder eingeschnappt?«
»Nein! Ich weiß bloß nicht, was es zu feiern gibt, wenn man ein Jahr älter wird. Genau genommen ist alles sowieso ein Schmäh, weil der Alterungsprozess ständig vor sich geht und sich Gott sei Dank keinen einzelnen Tag herauspickt, an dem man einen kräftigen Schub in Richtung Ableben bekommt.«
»Sollte ich einmal jemanden benötigen, der mich aus meiner Hochstimmung brutal zurück in die Wirklichkeit versetzt, suche ich mir garantiert dich aus«, klagte Erika. »Aber ganz vermiesen lasse ich mir mein Fest von dir nicht. Ein Geburtstag ist nämlich, Alterungsprozess hin oder her, genau das: ein guter Grund zum Feiern! Wusstest du, dass die meisten Geburtstage auf den 22. September fallen?«
Eine neue Marotte von Erika Haller bestand darin, aus Zeitschriften und dem Internet nutzloses Wissen und Rekorde aus allen Bereichen des Lebens zu sammeln und bei der erstbesten Gelegenheit in eine Unterhaltung einzustreuen. Leopold passte das gar nicht. Die Beliebigkeit dieser Fakten war ihm zutiefst zuwider. »Nein! Hat das eine besondere Bedeutung?«, lächelte er müde.
»Es ist, wenn man genauer darüber nachdenkt, völlig logisch«, erklärte Erika ihm. »Es hat mit den langen Winternächten zu tun, wo die Menschen trotz Computer und Fernsehen am liebsten miteinander kuscheln und sich auf die einfachste Art der Welt vergnügen. Vom 22. September neun Monate zurückgerechnet, das wäre mit dem 22. Dezember einer der kürzesten Tage des Jahres, außerdem knapp vor Weihnachten. Damit ist eindeutig widerlegt, dass es die angeblich romantischen lauen Sommernächte sind, in denen sich die Menschen besonders gerne paaren.«
»Das war außerordentlich lehrreich«, nörgelte Leopold herum.
»Und ob, Schnucki«, ließ sich Erika nicht beirren. »Du weißt gar nicht, wie viele interessante Dinge es rund um den Geburtstag zu entdecken gibt.«
»Dann werde ich dem eine statistische Tatsache hinzufügen, die mich äußerst bedenklich stimmt«, konterte Leopold. »Die Wahrscheinlichkeit, an seinem Geburtstag zu sterben, ist interessanterweise um 14 Prozent höher als an den anderen Tagen. Also sei bitte schön vorsichtig, damit dir nichts passiert!«
»Das sagst du nur, um mich zu ärgern!«
»Ich sage es, weil es stimmt, Erika! Man unternimmt eben an seinem Geburtstag mehr und auch ungewöhnliche Dinge, wodurch die Unfallquote beträchtlich ist. Man begegnet durch diverse Feiern vielen Menschen, die man lange nicht gesehen hat und die einem dadurch fremd geworden sind. Das kann dazu führen, dass …«
»Ich glaube, meinen nächsten Geburtstag begehe ich in der Nähe der Datumsgrenze«, unterbrach Erika ihn unsanft. »Erstens bin ich dann weit weg von dir und deinem Gemeckere, und zweitens könnte ich durch Hin- und Herfahren den Rekord des Schweden Sven Hagemeier brechen, der 46 Stunden gefeiert hat, indem er von Auckland nach Brisbane und Hawaii geflogen ist und die verschiedenen Zeitzonen für diese Bestleistung genützt hat.«
»Ach was, Bestleistung! Der Sedlmayer Erich hat einmal 48 Stunden durchgefeiert, und wenn sie ihn nicht mit der Rettung und einer Alkoholvergiftung ins Spital geführt hätten, wäre es sicher noch länger geworden«, entgegnete Leopold. Dabei hoffte er im Stillen, dass der Kelch von Erikas Geburtstag möglichst rasch und ereignisarm an ihm vorübergehen würde, bevor er sich weiter in seine düsteren Prognosen hineinsteigerte.
*
Freitag, 6. Oktober, abends
Inspektor Norbert Bollek saß an der Theke der Bar des Hotel Floridus und ließ sich sein kühles Bier schmecken. Trotz der nüchternen Atmosphäre gefiel es ihm hier. Es war ruhig, nicht so überfüllt wie in einem Innenstadtlokal. Bollek konnte ungestört das tun, was er am liebsten machte: seine Augen durch die Gegend schweifen lassen, ohne an etwas Besonderes zu denken, und genießen, nicht ganz alleine, aber auch nicht unter Kollegen zu sein. Dieses Wochenende kam ihm gerade recht. Er brauchte Balsam für seine Seele.
Natürlich glaubte er nicht daran, dass die Bombendrohung Folgen haben würde. In der Regel machte sich jemand mit so etwas einen Spaß, oder es handelte sich um einen Psychopathen, der versuchte, in die Nachrichten zu kommen. Bomben wurden in der Regel ohne Vorankündigung gezündet. Wäre es dem Anrufer ernst gewesen, hätte er sein Telefonat bleiben lassen und das Hotel stattdessen in Schutt und Asche gelegt. So aber konnte er, Bollek, mit dem Argument, die Sache unauffällig untersuchen zu müssen, einmal richtig ausspannen.
Die Trennung von Nora beschäftigte sein einfaches Polizistenleben über die Maßen. Nach Jahren gemeinsamen Lebens stand er plötzlich alleine da. Wann würde er mit seinen unregelmäßigen Dienstzeiten eine geeignete Partnerin finden? Und wie lange würde sie es mit ihm aushalten? Als er sich diese Frage stellte, überkam ihn in seinem Innersten ein leichter Schauder. Gedankenverloren griff er in die neben ihm stehende Schale mit Erdnüssen und stopfte eine Handvoll in seinen Mund. Dabei beobachtete er, dass der Mann am anderen Ende der Theke dasselbe tat. Auch er hatte ein kleines Bier neben sich stehen. Bollek vermeinte, den schlanken, grau melierten Herrn mit der Sonnenbrille und dem bereits etwas abgetragenen Sakko von irgendwoher zu kennen, konnte sich aber nicht entsinnen, von wo. Er reagierte daher nicht, als dieser ihn kurz anlächelte, denn er war zu keinem Gespräch mit fremden Menschen aufgelegt.
Ein besser gekleideter Mann mit sportlichem Blazer und bunter Krawatte stellte sich zwischen die beiden. Er schien allerdings bereits leicht illuminiert. »Abend« stieß er undeutlich hervor und bestellte beim Barkeeper ein Glas Weißwein. Bollek rückte automatisch ein Stück von ihm weg, denn hier schien ihm die Gefahr, angeredet zu werden, größer zu sein. Tatsächlich war der Mann mit der Krawatte sofort auf Unterhaltung aus – Gott sei Dank nicht mit ihm, sondern mit dem anderen Biertrinker. »Ich komme aus der Nähe von St. Pölten«, erzählte er ihm unaufgefordert. »Bin teilweise geschäftlich hier, teilweise privat. Schaue mir Wien an, ob es wirklich so schön ist. Und Sie?«
»Ich bin einfach so da«, antwortete der andere ausweichend.
»Und von wo sind Sie?«
»Aus Wien.«
Ein kurzer, dafür umso lauterer Lacher von Seiten des Mannes mit dem Blazer sollte signalisieren, dass er die Situation richtig zu deuten glaubte. »Sie sind wohl von zu Hause hinausgeworfen worden, was? Hatten Streit mit der Freundin oder Ehefrau. Mir können Sie nichts erzählen, ich bemerke so etwas sofort. Kiefer übrigens mein Name, Conny Kiefer.«
»Gerry Scheit«, entgegnete sein Gesprächspartner einsilbig.
Jetzt wusste Bollek, woher er den Mann kannte. Gerry Scheit war ein Privatdetektiv, der ihm schon ein paar Mal, meist auf Betreiben des unseligen Oberkellners Leopold Hofer, ins Handwerk gepfuscht hatte. Hatte dieser Leopold etwa wieder seine Hände im Spiel? Oder weshalb war Scheit sonst anwesend? Gab es tatsächlich eine Gefahr oder Bedrohung, von der Bollek nichts wusste und welche die Auszeit, die er sich zu nehmen dachte, stören konnte? Er rückte ein Stück weiter nach rechts, um mit nichts und niemandem etwas zu tun zu haben.
»Ich bin nämlich, ehrlich gestanden, auch in erster Linie hier, weil ich von zu Hause wegwollte«, setzte Kiefer Scheit in der Zwischenzeit auseinander. »Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Sie werden das sicher verstehen! Manchmal ist so etwas nötig. Erholung von der Familie.«
Scheit blieb interesselos. Er schwieg und knabberte weiter an seinen Erdnüssen.
»Trinken Sie einen mit mir?«, ließ Kiefer nicht locker. »Kommen Sie, wir müssen die Zeit totschlagen. Wer weiß, wann uns das Schicksal wieder zusammenführt.«