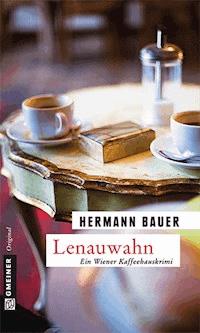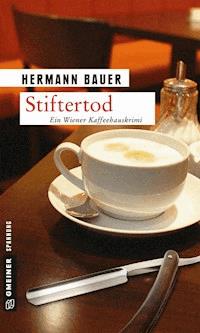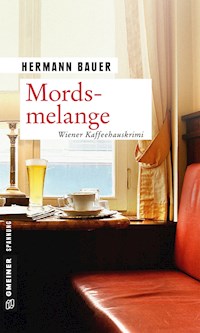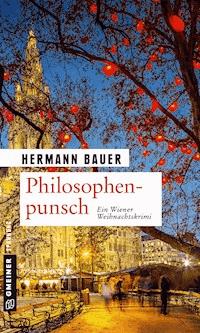Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Chefober Leopold W. Hofer
- Sprache: Deutsch
Der wöchentliche Schachabend im Café Heller wird durch das Auftauchen von zwei Neulingen gestört. Plötzlich geht es um alte Rivalitäten und sexuelle Begierden. Nach der Sperrstunde verlagert sich das Geschehen in Alois Popeks Haus. Am nächsten Morgen wird dieser erstochen aufgefunden. Es muss eine letzte, tödliche Schachpartie stattgefunden haben. Aber niemand will als Letzter gegangen sein. Oberkellner Leopold prüft alle Kombinationen, um den Täter matt zu setzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hermann Bauer
Schachmatt mit Melange
Wiener Kaffeehauskrimi
Zum Buch
Melange, Matt, Mord Jeden Donnerstag trifft sich eine Gruppe von Schachspielern im Café Heller zum wöchentlichen Kräftemessen. Zwei Neulinge bringen diesmal den üblichen Ablauf durcheinander. Johanna Springer bietet drei Gymnasiasten und anderen Teilnehmern ihre Liebesgunst als Einsatz an, Robert Hummel sucht die Auseinandersetzung mit seinem Erzrivalen Alois Popek. In Popeks Haus geht es auch nach der Sperrstunde im Heller weiter. Es wird gespielt und getrunken. Am nächsten Morgen findet eine Reinigungskraft Popek erstochen auf. Offensichtlich hatte er noch eine Schachpartie – allein mit seinem Mörder. Schon bald kristallisieren sich alte Feindseligkeiten, sexuelle Begierden und finanzielle Differenzen als mögliche Gründe für die Tat heraus. Die Aufklärung ist schwierig, denn die Schachgemeinde hält zusammen, und auch die Gymnasiasten hüten offenbar ein Geheimnis. Erst nach und nach gelingt es Oberkellner Leopold dank seiner Kombinationsgabe, diesen Abwehrriegel zu knacken und den Fall zu lösen.
Hermann Bauer wurde 1954 in Wien geboren. Dreißig wichtige Jahre seines Lebens verbrachte er im Bezirk Floridsdorf. Bereits während seiner Schulzeit begann er, sich für Billard, Tarock und das nahe gelegene Kaffeehaus, das Café Fichtl, zu interessieren, dessen Stammgast Bauer lange blieb. Von 1983 bis Anfang 2019 unterrichtete er Deutsch und Englisch an der BHAK Wien 10. Er wirkte in 13 Aufführungen der Theatergruppe seiner Schule mit. Im Jahr 2008 erschien sein erster Kriminalroman »Fernwehträume«, dem 14 weitere Krimis um das fiktive Floridsdorfer Café Heller und seinen Oberkellner Leopold folgten. »Schachmatt mit Melange« ist der 15. Kaffeehauskrimi des Autors. Er lebt mit seiner Frau Andrea in Wien und Eisenstadt.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © sheva10 / shutterstock und jakob5200 / Pixabay
ISBN 978-3-8392-7310-4
Kapitel 1
Donnerstag, 18. November, Abend
Ein junger Mann mit langem, wehendem schwarzem Haar stürmte aus der Kälte des frostigen Novemberabends ins Café Heller. Oberkellner Leopold, der gerade hinter der Theke einen großen Braunen aus der Kaffeemaschine herunterdrückte, merkte auf. Man betrat ein Kaffeehaus nicht wie ein Gehetzter, schon gar nicht, wenn es drinnen so ruhig und beschaulich zuging wie gerade eben.
»Suchen Sie jemanden?«, fragte Leopold deshalb den ungebärdigen Eindringling in schneidendem Ton.
»Ja, meinen Vater, Herrn Popek«, kam es im Vorüberhuschen undeutlich über die Schulter des jungen Mannes.
»Das geht nicht, der Herr Papa spielt gerade Schach«, rief Leopold ihm nach.
Doch der Mann war bereits an den Billardtischen vorbei in den hinteren Teil des Heller geeilt. Nach einem kurzen forschenden Rundumblick hatte er seinen Vater erspäht. »Ich brauche das Geld«, redete er ihn grußlos an.
Alois Popek verzog keine Miene und drehte sich auch nicht um. Seine Augen fixierten das Schachbrett vor ihm. »Du bekommst es aber nicht, Erich«, gab er mitleidslos zurück.
»Und warum nicht?«
»Erstens ist es nicht meine Schuld, wenn du dein Auto in den Graben fährst.«
»Ich leihe es mir ja nur. Du bekommst alles zurück!«
»Zweitens brauchst du an Zuwendungen meinerseits gar nicht zu denken, solang du mit dieser Schlampe liiert bist«, fuhr Popek unbeirrt fort. Dabei nahm er seinen weißen Läufer zwischen Daumen und Zeigefinger und schlug damit den gegnerischen Springer.
»Ich bin erwachsen. Ich kann zusammenleben, mit wem ich will«, entgegnete der junge Mann erregt.
»Und ich kann mit meinem Geld tun, was ich will. Wenn ich einmal tot bin, bekommst du sowieso alles«, erklärte Popek ihm.
»Ich brauche es aber jetzt«, empörte sich sein Sohn. »Du hast genug davon.«
Sein Kontrahent hatte inzwischen den Läufer mit seinem schwarzen Läufer geschlagen. Popek studierte die Situation auf dem Schachbrett. Sie gefiel ihm gar nicht. »Verschwinde jetzt! Sonst lasse ich dich aus dem Kaffeehaus entfernen«, schnauzte er Erich an.
Schon längst war es im hinteren Teil des Heller, wo heute der wöchentliche Schachabend stattfand, unruhig geworden. Leopold bemerkte die hilfesuchenden Blicke in seine Richtung und kam herbeigeeilt. »Das geht nicht! Sie machen mir ja die Gäste nervös«, drang er in den jungen Mann. »Besprechen Sie das Problem mit Ihrem Vater bitte woanders. Unsere Spieler wollen nicht gestört werden.«
Widerwillig, ein paar unverständliche Laute des Missmuts von sich gebend, bewegte sich Erich Popek daraufhin in Richtung Ausgang. Die Schachspieler atmeten auf und vertieften sich sofort wieder in ihre Partien. Im Nu war das unliebsame Ereignis vergessen. Beim Schachabend ließ sich niemand so schnell die Laune verderben.
*
Seit geraumer Zeit traf man sich jeden Donnerstagabend im Café Heller zum königlichen Spiel. Ob Jung oder Alt, Experte oder Liebhaber, man fand sich, egal, wie gut man das Schach beherrschte, in ungezwungener Weise dazu ein. Es gab Spieler, die ihre Kräfte immer mit demselben Gegner maßen, und es gab zufällige Begegnungen zwischen Menschen, die einander hier zum ersten Mal trafen. Am häufigsten wurden sogenannte »Radln« organisiert. Dabei fanden sich drei oder vier Spieler etwa gleicher Stärke zusammen, und jeder trat gegen jeden auf eine Partie mit Revanche an. Im Vordergrund stand der gesellige Aspekt. Man war schließlich im Kaffeehaus.
An den Spieltischen hatte Ruhe zu herrschen, wenngleich dieses Gebot nicht allzu streng gehandhabt wurde. Es hatte sich rasch eingebürgert, was sein durfte und was nicht. Eine Debatte wie vorhin zwischen Popek und seinem Sohn galt als verpönt. Wurde es bei den Billardtischen oder einer Tarockpartie hingegen kurz etwas lauter, nahm man dies ohne Aufregung zur Kenntnis.
Am wichtigsten war allen Beteiligten das Spiel selbst. Der Reiz des Schach bestand darin, dass immer der Bessere gewann. Glück oder Pech gab es nicht. Beide Gegner hatten 16 gleiche Figuren zur Verfügung, der eine in Weiß, der andere in Schwarz. Weiß begann und war damit im Vorteil, aber nach jeder Partie wurde die Farbe gewechselt, sodass am Ende die Möglichkeiten gleich verteilt waren. Es kam allein auf Strategie, Spielwitz, Konzentration und Charakterstärke an. »Ein guter Spieler hat immer Glück«, formulierte es einst der große Meister Capablanca. Auch bei vielen Kartenspielen, wie etwa dem Tarock, machten diese Eigenschaften den guten Spieler aus. Hier war man jedoch zum größten Teil von dem Blatt abhängig, das man in der Hand hielt. Ohne Trümpfe konnten auch die Besten nichts anfangen.
Der Schachspieler hingegen war auf sich allein angewiesen. Er durfte nicht mit dem Schicksal hadern, wenn er verlor, sondern nur mit sich selbst. Andererseits konnte er jeden Sieg seinem geistigen Geschick zuschreiben. Deshalb waren Schachliebhaber ausgeprägte Persönlichkeiten, deren besondere Eigenschaften zum Vorschein kamen, sobald sie sich auf eine Partie einließen. Da kaum geredet wurde, zeigten sie sich an ihren Gesten und dem Gesichtsausdruck. Manche legten ihre Stirn in Falten, andere starrten immerzu geradeaus; die einen lächelten vor jedem Zug, die anderen nahmen ihre Figuren so beiläufig in die Hand, als interessiere sie das ganze Spiel nicht; einige kramten zwischendurch in ihren Taschen, einige blickten vom Schachbrett nur auf, um ihren Gegner durch heftiges Blinzeln nervös zu machen; manche räusperten oder schnäuzten sich, manche hüstelten oder gähnten. Jeder entwickelte mit der Zeit eine für ihn charakteristische Macke.
Trotzdem verliefen die Schachabende im Heller freundschaftlich und unterhaltsam. Auch Herr Heller erwies sich als geübter Freund des königlichen Spiels. Auf die Frage seiner Frau Sidonie, warum er seine sonstige Lethargie gerade beim Schachspiel ablege, antwortete er nur: »Du verlangst ständig, dass ich mich mehr bewege. Das ist unmöglich. Beim Schach bewege ich wenigstens die Figuren.«
Herr Heller zeichnete auch verantwortlich dafür, dass immer genügend Schachbretter und Spielfiguren zur Verfügung standen. Am Ende eines Abends räumte er alles sorgfältig für das nächste Mal ein. Zwar gerieten die unterschiedlichen einzelnen Sets mit der Zeit ein wenig durcheinander, und mancher König war dann kaum größer als der Bauer vor ihm, aber Herr Heller meinte: »Alle können spielen. Das ist die Hauptsache!«
Leopold wurde rasch mit den Schrullen und Sonderwünschen dieser Kundschaft vertraut. Viel Umsatz war mit Menschen, die das Geistige über das Körperliche stellten, nicht zu machen. Dafür ging es ruhig zu, und es herrschte die von ihm geliebte Ordnung.
Was die Einschätzung der Harmlosigkeit dieses Publikums betraf, wollte er sich freilich nicht festlegen. Ein angeheiterter Gast ließ sich einmal zu der scherzhaft gemeinten Bemerkung hinreißen: »Ich seh’s dir an, du vermutest sogar hinter jedem Schachspieler einen Mörder.«
Leopold zog daraufhin seine Augenbrauen in die Höhe und äußerte kryptisch: »Man kann nie wissen. Jeder Mensch, auch wenn er noch so unscheinbar aussieht, ist zu einem solchen Verbrechen fähig. Die gedanklichen Abläufe bei Schachspielern sind oft äußerst kompliziert, genauso wie bei Mördern. Im Grunde geht es ihnen nur um eines: den gegnerischen König zu Fall zu bringen, matt zu setzen, quasi umzubringen. Warum soll ein Hirn, das sich täglich damit beschäftigt, nicht auch einen Mord planen können?«
Der Gast schüttelte daraufhin den Kopf, leerte sein Weinglas und schob ein paar Münzen über die Theke. »Zeitweise erscheinst du mir weltfremder als diese Gehirnakrobaten«, merkte er dabei an.
»Im Gegenteil«, widersprach ihm Leopold, verschmitzt lächelnd. »Ganz im Gegenteil!«
*
Nachdem der junge Popek das Heller verlassen hatte, erinnerte sich Leopold an dieses Gespräch. War seine damalige Aussage über die Schachspieler tatsächlich zu weit hergeholt gewesen? Gerade saßen sie wieder beieinander, als könnten sie keiner Fliege etwas zuleide tun. Täuschte dieser Frieden? Was wusste Leopold eigentlich über sie? In Gedanken fasste er seine Informationen über einige dieser neuen Stammgäste für sich zusammen.
Popek galt als launischer Exzentriker. Bei ihm wusste man als Oberkellner nie, wie man dran war. Manchmal verhielt er sich jovial und gab ein anständiges Trinkgeld. An anderen Tagen war er mürrisch und schweigsam, leerte nicht einmal die kleine Mokkatasse vor ihm vollständig und musste ans Zahlen erinnert werden. Seine Stimmungen standen dabei in keinem Zusammenhang mit seinem Erfolg beim Spiel. Er verlor oft heiter und siegte missmutig. Über sein Privatleben war Leopold so gut wie nichts bekannt. Von seinem Sohn hatte er eben erst gehört.
Hubert Zeller war ein weitaus mitteilsamerer Mensch, der das Herz jedes Oberkellners höherschlagen ließ. Er sei zweimal geschieden, teilte er bereitwillig jedem mit, der es hören wollte, und zwar »wegen dem Schach«. Zu Frauen habe er nie eine wirkliche Beziehung entwickeln können, sei aber erst spät draufgekommen. »Wenn du beim Liebesakt daran denkst, wie du den gegnerischen König im Endspiel mit deinem Springer mattsetzen kannst, weißt du, was es geschlagen hat«, gab er offenherzig zu. Seine große Liebe galt dem Schachspiel, das ihn mit so vielen Höhepunkten versorgte, dass er keine anderen brauchte.
Siegfried Herzig verkörperte einen vollkommen anderen Typ. Er sprach nur das Allernotwendigste. Sogar um seine Bestellung musste Leopold ihn mehrmals fragen – ein schwieriges Unterfangen, da er nie genau wusste, was er wollte. Leopold schätzte ihn um die 50, doch wirkte er durch seine elegante Kleidung und sein gepflegtes Aussehen jünger. Zwischen seinen Partien ging er öfters hinaus, um zu telefonieren. Dabei hörte Leopold immer dieselben, mit unterdrückter Stimme gesprochenen Worte: »Habe noch ein wenig Geduld, Chérie, es dauert nicht mehr lange.« Dass es sich bei dieser Chérie nicht um Herzigs Frau handelte, davon war Leopold überzeugt.
Dann war da noch Valentin Lenk, der durch sein schusseliges Auftreten wirkte, als könne er nicht zwei und zwei zusammenzählen. Doch in seinem Kopf war alles perfekt geordnet. Wenn er einen Gegner im Griff hatte, sagte er ihm mit seiner holpernden Stimme präzise sämtliche Züge bis zum Matt voraus. Er war auch erstaunlich gut über das Privatleben seiner Mitspieler unterrichtet. Das hatte Leopold aus verschiedenen Quellen erfahren.
Es gab noch mehr sonderbare Gestalten, von Josef Liebl, der keine Partie zwischen 22 und 22.30 Uhr begann, weil er laut eigener Statistik die meisten davon verlor, bis zu Karl Emminger, der stets eine Diskussion darüber anschnitt, wie man durch zielgerichtetes Denken sämtliche Hindernisse im Leben aus dem Weg räumen konnte. Je mehr er sich das alles durch den Kopf gehen ließ, desto überzeugter war Leopold davon, dass er recht hatte. So friedlich sie einander Donnerstag für Donnerstag auch gegenübersaßen, jedem dieser Sonderlinge war ein Mord zuzutrauen, wenn es die Situation erforderte.
Kapitel 2
Wenn Leopold dachte, der Abend würde nach dem kleinen Zwischenfall von vorhin beschaulich wie immer verlaufen, so täuschte er sich. Erstmals seit Beginn der Schachabende im Heller mischte sich eine Frau unter die Spieler. Ihr Erscheinen erregte sofort die größte Aufmerksamkeit. Sie war um die 40 und trug ein legeres, aber verführerisches schwarzes Kleid mit einem V-Ausschnitt, der tief blicken ließ. Ihr rotes Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden.
Herr Heller machte eine sorgenvolle Miene, als er sie bemerkte. »Das ist Johanna Springer«, raunte er Leopold zu. »Überall in Schachkreisen als ›die wilde Hanni‹ bekannt. Wo die auftaucht, bleibt kein Auge trocken.«
»Sie sorgt also für Unruhe?«, erkundigte sich Leopold.
»Sie trinkt gern, und wenn sie trinkt, hat sie zwei Leidenschaften: das Schachspiel und die Männer«, weihte Herr Heller ihn ein. »Eine teuflische Kombination, die schon so manchen Wirbel herbeigeführt hat. Wer sie schlägt, darf sich auf eine Fortsetzung des Abends in ihrem Bett freuen, wer verliert, scheidet aus und muss unter Umständen sogar mit einer Buße rechnen. Wenn ihr einer gefällt, lässt sie ihn manchmal gewinnen, sonst hat man nur eine Chance, wenn sie zu viel getankt hat. Du kannst dir vorstellen, was da hinten gleich los sein wird.«
»Warum weisen wir sie nicht einfach höflich, aber bestimmt hinaus?«, schlug Leopold vor.
»Das wäre heikel«, stellte Herr Heller fest. »Uns hat sie noch nie beehrt, also hat sie sich bei uns noch nichts zuschulden kommen lassen. Für ein Lokalverbot liegt kein Grund vor. Uns bleibt vorläufig nichts anderes übrig, als aufzupassen und zu schauen, dass wir die Situation im Griff haben.«
Leopold war neugierig. »Haben Sie eigentlich schon gegen sie gespielt?«, fragte er seinen Chef.
»Dem Problem bin ich bisher ausgewichen«, brummte Herr Heller und eilte zurück zu den Schachspielern.
Dort herrschte bereits einige Aufregung, vor allem unter denjenigen, die Hanni kannten. »Stör uns nicht, wir wollen in Ruhe Schach spielen«, rief man ihr entgegen. »Such dir deine Freier woanders.«
»Nicht so stürmisch, meine Herren! Hebt euch das für später auf«, entgegnete sie selbstbewusst. »Und bitte nicht gleich so frauenfeindlich! Wir spielen genauso gut Schach wie ihr. Um das zu beweisen, bin ich hier. Lasst also eure Pöbeleien und messt eure Kräfte mit mir, wenn ihr euch traut.«
Daraufhin wurde es still. Niemand wollte vor den anderen zugeben, dass er auf ein Abenteuer mit Hanni aus war. »Wir wollen das nicht. Wir möchten in Ruhe unsere Partien weiterspielen«, meldete sich schließlich Hubert Zeller zu Wort.
»Ihr traut euch nicht, gegen eine Frau anzutreten?«, äußerte Hanni ungläubig. Gleichzeitig zwinkerte sie den Männern herausfordernd zu.
»Du weißt genau, worum es geht«, entgegnete Zeller. »Du bist hier, um eine ungute Stimmung zu verbreiten und uns gegeneinander auszuspielen. Das passt uns nicht.«
»Ich will spielen, so wie ihr«, tat Hanni unschuldig. »Und zwar um die Ehre. Natürlich muss ich diesen Einsatz als Frau besonders ernst nehmen. Wenn ich verliere, könnten mich einige von euch als ehrloses Weibsbild einstufen und dementsprechend behandeln. Aber das riskiere ich!«
Ihr Blick kreiste. Noch immer hielten sich alle zurück, auch diejenigen, die ein Duell mit ihr durchaus in Erwägung zogen.
»Feiglinge«, gab Hanni verächtlich von sich. »Woanders reißen sie sich darum, mich herauszufordern.« Sie fixierte jetzt drei Schüler des nur wenige Schritte vom Café Heller entfernten Floridsdorfer Gymnasiums, die ein Radl untereinander ausfochten. »Was ist mit der Jugend, mit den Talenten von morgen?«, redete sie sie an. »Ihr bringt etwas zusammen, das sehe ich. Ihr steht euren Mann. Na, was ist? Traut ihr euch?«
Die drei Burschen, die vor der Matura standen, besprachen die Situation. »Wie stellen Sie sich das vor?«, fragte schließlich derjenige von ihnen, der mit seiner Nickelbrille und hochaufgeschossenen Figur am strebsamsten aussah.
»Ihr könnt mich duzen. Ich bin die Hanni«, antwortete sie. »Es ist ganz einfach: Ihr macht einer nach dem anderen eine Partie gegen mich. Es wäre nett, wenn ihr mir vorher einen Drink spendieren würdet. Das ist alles, worum ich euch bitte. Der Verlierer hat nichts zu befürchten. Gewinnt allerdings einer von euch …«
Die Augen der Gymnasiasten leuchteten. »Dann …?«, wollten sie wissen.
»Dann darf er sich was wünschen«, stellte Hanni mit laszivem Lächeln in Aussicht.
Herr Heller mischte sich nun doch ein. »Das sind Schüler, Verehrteste«, machte er Hanni aufmerksam. »Ich verbitte mir diese geschmacklosen Andeutungen.«
»Wir sind alle über 18«, erwähnte der Strebsame, der Mario hieß. »Jürgen und ich hatten im Oktober Geburtstag. Und Alex hat überhaupt ein Jahr länger gebraucht als wir.« Er kicherte boshaft.
»Klugscheißer«, brummte Alex.
»Ich halte die jungen Herren und ihre Wünsche für grundanständig, im Gegensatz zu Ihren Gedanken«, stichelte Hanni in Herrn Hellers Richtung. »Und jetzt will ich etwas trinken. Gibt es hier keinen Oberkellner?«
Leopold hatte sich bereits genähert und den Disput mitverfolgt. Mit einigen Schritten war er bei Hannis Tisch, wo Alex als Erster Platz nahm, während seine Freunde Schachbrett samt Figuren holten. »Was wünschen Gnädigste?«, nuschelte er in bester Oberkellnermanier.
»Ich trinke ein Achtel Rotwein auf Kosten der jungen Herren«, gab ihm Hanni zu verstehen.
»Wir trinken auch eines«, rief Jürgen, dem die Vorfreude deutlich anzusehen war.
»Also vier Achtel Rot«, notierte Leopold und entfernte sich wieder.
Es war ihm nicht verborgen geblieben, dass die drei Gymnasiasten aus Hannis Andeutungen mitbekommen hatten, welche amourösen Möglichkeiten für sie in Aussicht standen, und dass Hanni sie gleichzeitig dazu benutzte, einige der anderen Spieler bis aufs Blut zu reizen. Vor allem Popek wirkte seit ihrem Eintreffen nervös und missgestimmt. Aber was sollte Leopold machen? Bis jetzt war nichts geschehen, was ihm das Recht gegeben hätte einzugreifen. Im Augenblick befand er sich auf jenem glatten Parkett, das von einem Kaffeehausober diskretes Handeln erforderte. Man musste einerseits wachsam sein und gleichzeitig so tun, als sei alles in der schönsten Ordnung. Geschah etwas Auffälliges, hieß es dazwischenfahren und das Schlimmste verhindern. Ereignete sich aber nichts Nennenswertes, durfte unter keinen Umständen herauskommen, dass man einen Verdacht gehabt hatte.
Leopold brachte deshalb ohne Umschweife die vier Achtel Rotwein nach hinten. Dort bemühte sich Alexander redlich, aber es dauerte nicht lange, und Johanna Springer hatte ihre Partie gegen ihn gewonnen.
*
Leopolds Freund Thomas Korber, seines Zeichens Lehrer für Deutsch und Geschichte am Floridsdorfer Gymnasium, kam so verstohlen zur Tür herein, dass er ihn zunächst gar nicht bemerkte. Er war überrascht, ihn zu sehen. Korber kam zumeist früher ins Heller, wenn auch oft angeheitert. Diesmal war er spät dran und wirkte nüchtern.
»Was machst du hier um diese Zeit?«, fragte Leopold deshalb.
»Ein Bier trinken, was sonst?«, antwortete Korber.
»Und wo warst du bis jetzt?«, drang Leopold weiter in ihn.
»Ich habe zu Abend gegessen – mit einer Kollegin«, beeilte sich Korber hinzuzufügen. Seine erste Behauptung stimmte, die zweite war Schwindel. Korber hatte den Abend mit Leopolds unehelicher Tochter Sabine Patzak verbracht. Ihr Verhältnis zueinander versprach, nach einer kurzen Unterbrechung wieder harmonischer zu werden. Leopold sollte von dieser instabilen Beziehung jedoch nach wie vor nichts wissen.
»Was Ernstes?«, erkundigte sich Leopold, mit Korbers schwankenden Gefühlen vertraut, sofort.
»Das wird sich noch herausstellen«, blieb Korber knapp.
»Jedenfalls scheinst du einigermaßen ansprechbar zu sein«, stellte Leopold fest, während er Korbers Bier zapfte. »Ein Glücksfall! Hinten spielen nämlich drei Schüler aus eurem Gymnasium Schach auf ›Teufel komm raus‹. Soviel ich mitbekommen habe, gehen sie in die Maturaklasse und heißen Alexander, Jürgen und Mario.«
»Die kenne ich gut. Ich bin sogar ihr Klassenvorstand. Aber wo liegt das Problem? In ihrer Freizeit können sie tun und lassen, was sie wollen«, befand Korber desinteressiert.
»Sie spielen gegen die ›wilde Hanni‹, und ich befürchte das Schlimmste«, weihte Leopold seinen Freund daraufhin ein. Er erzählte ihm, was er über Hanni in Erfahrung gebracht hatte und wie die heikle Situation entstanden war. »Ich kann dir genau sagen, was sie vorhat«, behauptete er dann. »Sie hat es auf den Knaben mit der Brille abgesehen. Der wirkt so unerfahren, dass es für sie ein Vergnügen sein wird, ihm die Unschuld zu rauben.«
»Du meinst Mario? Das ist ein sehr guter Schüler. Der hätte sich eine erotische Nachhilfestunde wahrlich verdient«, lächelte Korber. »Du denkst, sie lässt ihn gewinnen?«
»Jede Wette! Sie fixiert ihn schon die ganze Zeit mit ihren verführerischen Augen!«
»Vergönnst du ihm das etwa nicht?«, wunderte sich Korber erheitert.
»Von mir aus soll das Bürscherl mit seinen 18 Jahren seinen Spaß haben«, äußerte Leopold seine Meinung. »Aber das ist doch kein stiller Genießer, dafür ist er zu jung. Er gibt damit an und erzählt es seinen Freunden. Dann macht es die Runde, und das Renommee von unserem Kaffeehaus ist beim Teufel. Im Nu heißt es, wir sind ein einschlägiges Lokal. Das muss verhindert werden, verstehst du?«
Korber trank bedächtig von seinem Bier. In Gedanken war er noch bei dem harmonischen Treffen mit Sabine. »Und? Wie willst du das tun?«, erkundigte er sich vorsichtig.
»Ich dachte, du könntest mir helfen«, gestand Leopold. »Herr Heller sitzt zwar hinten und hat ein Auge auf das Ganze, aber ihm sind vorerst wie mir die Hände gebunden.«
Korber gefiel das nicht. »Soll ich als Dompteur auftreten? Die drei Jungs nach Hause schicken und ihnen eventuelle Folgen für ihre schulische Laufbahn androhen? Damit mache ich mich nur lächerlich«, betonte er.
»Ich weiß auch nicht so recht«, räumte Leopold ein. »Du kennst deine Schüler besser. Geselle dich zumindest ein bisschen zu ihnen. Vielleicht fällt dir etwas ein, bevor es zu spät ist.«
Das habe ich nun davon, dachte Korber, während er murrend mit seinem Glas nach hinten ging. Warum war er nicht gleich nach Hause gegangen? Weshalb hatte er seine Nase noch bei der Kaffeehaustür hineinstecken müssen? Nichts als Scherereien brachte es ihm. Jetzt erwartete Leopold von ihm, dass er diese heikle Situation bereinigen würde. Immerhin wurden Alexander, Jürgen und Mario kleinlaut, als sie ihn sahen. »Guten Abend, Herr Professor«, grüßten sie artig. Jürgen war gerade dabei, eine Niederlage einzustecken.
An den übrigen Tischen wurde mittlerweile kaum mehr gespielt. Einige Männer warteten offenbar schon auf ein vielversprechendes Kräftemessen mit Hanni. Popek wirkte, als wolle er sich hierfür in die erste Position bringen, ebenso wie Siegfried Herzig, der auf seine Chérie komplett vergessen zu haben schien.
Aber noch waren die Gymnasiasten am Zug. Nach Alexander und Jürgen musste gleich Mario an der Reihe sein. Wenn Hanni mit ihm kurzen Prozess wie mit den beiden anderen machte, war alles in Ordnung. Aber bestand nicht tatsächlich die Gefahr, dass sie absichtlich verlieren würde, schon allein, um die langsam ihre Scheuklappen ablegende Männerwelt um sie herum zu provozieren? Dann gab es ein Problem.
Korber überlegte. Er sah sich gezwungen, Mario von seiner Partie gegen Hanni abzubringen, um diese Gefahr zu vermeiden. Aber wie? Er sah nur eine Möglichkeit: Er musste für ihn einspringen. Über ihn konnten die Leute denken, was sie wollten, und dem Heller sollte daraus kein Schaden entstehen. Das war die Hauptsache. Außerdem war er während seiner Studienzeit ein einigermaßen guter Spieler gewesen. In den letzten Jahren hatte er allerdings keine Figur mehr angerührt.
Jürgen hatte seine Partie aufgegeben. Jetzt hieß es schnell handeln. Korber räusperte sich. »Worum spielt ihr da?«, fragte er und war bemüht, streng zu wirken.
»Um nichts. Nur so zum Spaß«, antwortete Alexander.
»Flunkert mich nicht an. Ich habe etwas anderes gehört«, belehrte Korber ihn.
»Es geht nicht um Geld«, beeilte Mario sich zu sagen.
»Ich denke, ihr seid dabei, etwas zu tun, das euch in der Schule in große Schwierigkeiten bringen wird«, warnte Korber ihn. »Anscheinend gibt es einen heiklen Einsatz bei dem Spiel.«
»Welchen?«, tat Mario unschuldig.
»Um das herauszufinden, werde ich nun selbst eine Partie gegen eure Gegnerin wagen«, kündigte Korber an. »Ich bitte Sie, gegen mich zu denselben Bedingungen anzutreten wie gegen die drei jungen Herren«, wandte er sich dann an Johanna Springer.
»Warum so förmlich, Herr Lehrer?«, erwiderte sie mit süffisantem Lächeln. »Ich heiße Hanni und bin gewohnt, dass man mich duzt.«
»Thomas«, stellte Korber sich vor.
»Sehr erfreut, Thomas! Du scheinst ein richtiger Draufgänger zu sein. Das gefällt mir! Aber wenn du so ungeduldig bist, kommst du ohne Einsatz nicht davon«, machte Hanni ihm klar. »Bei einem Sieg hatten die Jungs einen Wunsch frei. Eine Niederlage hatte keine Folgen. Bei dir muss ich strenger sein. Wenn du verlierst, darf ich mir etwas von dir wünschen. Einverstanden?«
»Einverstanden«, nickte Korber, bei dem eine plötzliche Spielfreude aufkam.
»Dann fangen wir also an«, schlug Hanni vor, bestellte noch ein Glas Wein und stellte die Figuren auf ihre Ausgangspositionen. Es hagelte Proteste von einigen Spielern, die sich übervorteilt fühlten.
»Ich dränge mich nicht vor«, rechtfertigte Korber sich. »Ich springe nur für meinen Schüler ein.« Dabei deutete er auf Mario.
»Aber Herr Professor! Ich habe doch schon verloren«, teilte Mario ihm erstaunt mit. »Ich war vor Jürgen dran. Leider ging es ganz schnell, weil ich mich nicht konzentrieren konnte.«
*
Thomas Korber glaubte, sich verhört zu haben. Er war der Meinung gewesen, dass Mario als Letzter drankam. Offenbar waren Leopold und er so sehr in ihr Gespräch vertieft gewesen, dass sie den entscheidenden Augenblick verpasst hatten. So hatte er sich jetzt auf eine Partie eingelassen, die gar nicht notwendig gewesen wäre. Aber es gab kein Zurück mehr. Johanna Springers Augen sprachen eine deutliche Sprache. Sie wollte ihn fressen, mit Haut und Haaren. Und zu verlieren war keine Option, dann konnte sie mit ihm erst recht machen, was sie wollte.
»Die Schüler haben ihre Lektion bekommen, jetzt ist der Lehrer dran«, grinste Hanni hämisch. Sie hatte Weiß gezogen und griff sofort an. Korber hielt dagegen. Hannis Reize und ihre verruchten Blicke stachelten ihn zu einer beachtlichen Form an. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.
Plötzlich spürte Korber eine kräftige Hand auf seiner Schulter. Er drehte sich um. Hinter ihm stand ein großer, grau melierter Mann, den er nicht kannte, und zwinkerte ihm zu. »Spielen Sie langsamer, nicht so schnell«, forderte er ihn auf. »Das mag die Hanni nicht. Sie ist eine impulsive Spielerin. Sie müssen ihr den Wind aus den Segeln nehmen.«
»Lass uns in Ruhe, Robert«, fuhr Hanni ihn an, ohne vom Schachbrett aufzuschauen. »Was machst du überhaupt hier?« Sie war über den neuen Gast sichtlich nicht erfreut.
Der lachte laut auf. »Dasselbe könnte ich dich fragen«, erwiderte er. »Ich habe eben einen Riecher dafür, wo gerade was los ist. Und wo ich meinen alten Freund Popek treffe. Ich glaube, ich bin dir noch eine Revanche schuldig, Alois!«
»Sieh an, der Herr Hummel«, knurrte Popek wie ein Hund in abwartender Position. »Kommt großspurig herein und glaubt, man hat nur für ihn Zeit.«
»Die solltest du dir nehmen! Solch eine Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder«, ermunterte Robert Hummel ihn.
Eigentlich lauerte Popek auf ein Duell mit Johanna Springer. Aber Hummels Auftauchen warf dieses Vorhaben über den Haufen. Man erkannte sofort die Rivalität, die zwischen beiden herrschte. Popek konnte gar nicht anders, als Hummels Kampfansage anzunehmen. »Na schön«, seufzte er.
»Ich habe nichts anderes erwartet«, zeigte sich Hummel zufrieden. »Aber weine nicht, wenn ich dich auf dem Brett zermalme.«
»Wir werden noch sehen, wer von uns heute weint«, hielt Popek dagegen. Und schon saßen die beiden einander bei einer Partie gegenüber.
Es wurde nun nur mehr an zwei Tischen Schach gespielt. Hanni matchte sich mit Korber, Popek mit Hummel. Der Rest schaute zu. Dabei galt das Interesse eindeutig der Partie zwischen Hummel und Popek, wo es schnell ein dichtes Gedränge gab. Bei Hanni und Korber saß nur mehr Siegfried Herzig, der sich nach Popeks Wegfall das Anrecht sichern wollte, Hannis nächster Herausforderer zu sein.
Korbers Energie ließ nach. Er sehnte ein rasches Ende der Partie herbei. Dadurch hielt er sich nicht an Hummels Ratschlag und forcierte das Tempo. Er vermeinte, an der linken Flanke eine Schwäche in Hannis Verteidigung zu erkennen. Doch fehlte es ihm an der nötigen Abgeklärtheit, um diese auszunutzen. Er ging seinen Angriff zu hitzig an, und so geschah das Unvermeidliche: Ein Gedankenfehler brach ihm das Genick. Nach zwei Abtauschen war seine Offensive beendet, die Abwehr offen wie ein Scheunentor, und Hanni setzte ihn in wenigen Zügen matt.
»Respekt, du warst ein starker Gegner«, zollte sie ihm Anerkennung. »Gereicht hat’s aber nicht. Damit habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Wunsch bei einem Lehrer frei. Das muss ich ausnützen.«
Korbers Glas war leer. Er konnte die Niederlage nicht einmal mit dem Rest von seinem Bier hinunterspülen. Sein Mund fühlte sich trocken an. »Ich ergebe mich meinem Schicksal«, räumte er ein. »Sicher erfahre ich gleich, welche Strafe du dir für mich ausgedacht hast.«
»Wir wollen doch nicht von Strafe sprechen. Spielschulden sind Ehrenschulden«, erklärte Hanni ihm. Dabei fuhr sie mit der Zunge verführerisch über ihre Lippen. »Was ich mir von dir wünsche, kannst du leicht erfüllen. Ich war nie gut in der Schule, und meine Eltern hatten nicht das Geld für Nachhilfestunden. Deshalb hätte ich gern eine Privatstunde von dir. Ich bin überzeugt, dass du mir einiges beibringen kannst.«
»Eine Stunde?«, krächzte Korber dehydriert. »Wie in der Schule?«
»Eine Nachhilfestunde bei mir in der Wohnung«, bestimmte sie. »Zuerst müssen wir natürlich feststellen, wo meine Schwächen liegen. Dann werden wir sie gemeinsam bekämpfen. Dabei halte ich viel von der interaktiven Methode.«
Korber schluckte das Wenige an Speichel, das er im Mund hatte, hinunter. Das Angebot war eindeutig. So ein Abenteuer konnte er jetzt, wo sich seine Beziehung mit Sabine wieder einrenkte, nicht brauchen. Und doch – hatte er es nicht von Beginn an darauf angelegt? War der so genannte Rettungsversuch nicht primär aus einem sofortigen Verlangen nach Hanni entstanden?
»Heute noch?«, fragte er vorsichtig.
»Warum nicht? Am besten, du wartest auf mich«, schlug Hanni vor. »Vorher muss ich allerdings noch ein paar Partien gewinnen. Gib mir zur Sicherheit deine Telefonnummer.« Sie deutete mit ihrem frisch gefüllten Weinglas in Richtung Siegfried Herzig, der bereits mit wilden Gesten und einem lauten »Wann komme ich endlich dran?« auf sich aufmerksam machte.
Korber ging zur Theke und bestellte ein Bier für seinen trockenen Hals. Etwas Besseres fiel ihm in seiner momentanen Situation nicht ein. »Du hast mich ganz schön hineingeritten«, schalt er Leopold nach einem kurzen Bericht über die Ereignisse. »Es hat für mich überhaupt keine Notwendigkeit bestanden einzugreifen. Du hast mir eine völlig falsche Situation geschildert. Jetzt bin ich der Leidtragende.«
Leopold zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht, was du hast. Du hast dich zu nichts anderem verpflichtet als zu einer unbezahlten Nachhilfestunde. Die erteilst du ihr eben. Pauk ein bisschen Grammatik mit ihr, so in Richtung Dativ und Akkusativ, dann lässt sie dich schon in Ruhe. Wenn du willst, komme ich als Zeuge mit und gebe acht, dass alles sauber abläuft.«
Das war Korber auch nicht recht. Mit ein paar großen Schlucken hatte er sein Bier beinahe ausgetrunken. »Du glaubst doch selbst nicht, dass sie das so gemeint hat«, gab er Leopold zu verstehen.
Der grinste. »Aber gesagt! Das zählt, und sonst nichts. Wenn du ein Schäferstündchen draus machen willst, kann ich dir nicht helfen.«
»Hör mal …«, setzte Korber zu einer Rechtfertigung an. Er wurde jedoch jäh von dem herbeieilenden Herrn Heller unterbrochen. »Tratschen Sie nicht herum, Leopold, sondern beginnen Sie abzukassieren«, ordnete er an. »Wir machen heute pünktlich Schluss.«
Leopold hob zweifelnd die linke Augenbraue. »Das wird schwierig. Es ist eine Menge los«, gab er zu bedenken.
»Lassen Sie Ihre Einwände«, redete ihn Herr Heller scharf an. »Ich weiß, was ich tue. Der Hummel und der Popek liegen sich gleich in den Haaren. Sie streiten gerade, ob ein Zug vollendet ist, wenn man seine Figur auf ein Feld gesetzt hat, oder erst, wenn man sie loslässt. Und die Hanni ist auch jederzeit für ein Ärgernis gut. Wir machen Sperrstunde! Ich will alle draußen haben.«
Es ging nun flott zur Sache. Wer unbedingt wollte, bekam noch schnell ein Abschiedsgetränk mit dem Hinweis, dass gleich geschlossen werde. Die Schachpartien mussten umgehend zu Ende gespielt werden. Alle Versuche, Herrn Heller von seinem Vorhaben abzubringen, blieben erfolglos, was großteils mit Unmut zur Kenntnis genommen wurde. »Der hat halt seine Tage, da kannst nix machen«, war noch der harmloseste Kommentar.
Den Gästen blieb nichts anderes übrig, als aufzubrechen. Die Situation wurde unübersichtlich. Leopold musste achtgeben, dass ihm keiner durch die Lappen ging, ohne zu zahlen. Mit Sorge bemerkte er, dass Thomas Korber nicht mehr bei der Theke stand. Das ausständige Geld würde er von ihm bekommen, dessen war er sich sicher. Aber er hätte zu gern gewusst, ob er das Heller allein oder in Begleitung verlassen hatte.
Kapitel 3
Nacht zwischen Donnerstag, 18. November, und Freitag, 19. November
»Man kann sich seine Gäste nicht aussuchen, und ohne Handhabe kann man sie auch nicht hinauswerfen«, begründete Herr Heller gegenüber Leopold sein Vorgehen. »Das einzige probate Mittel für einen Cafetier, wenn es unangenehm zu werden droht, ist die Sperrstunde. Da darf man sich auf nichts einlassen und muss die Leute schonungslos hinauskomplimentieren.«
Der Frieden in seinem Lokal war jedoch nicht der einzige Grund für Herrn Hellers Entschluss gewesen. Ein kleines, schmächtiges Männchen, dessen dicke Brille die gesamte obere Gesichtshälfte bedeckte, hatte sich unbemerkt an den Haustisch gesetzt. Für Leopold war das kein Unbekannter. Sebastian Spangl pflegte zu kommen, wenn die anderen gingen. Dann spielte er mit Herrn Heller nach Mitternacht seine private Schachpartie. Man stellte außer dem Schachbrett noch eine Flasche Wein und zwei Gläser auf den Tisch und ließ nur mehr die kleine Lampe darüber brennen. So entstand eine intime Atmosphäre. Wenn ein später Heimkehrer das schummrige Licht von draußen wahrnahm, ans Fenster klopfte und man ihn gut kannte, durfte auch er noch auf einen Schluck hereinkommen. So konnte es sein, dass sich der Abend im kleinen Kreis bis in den frühen Morgen hinzog. Das waren oft noch sehr launige Stunden.
Leopold blieb in solchen Fällen für gewöhnlich noch ein wenig. »Die Stimmung war aufgeheizt«, setzte ihm Herr Heller weiter auseinander. »Dann ist auch noch der Hummel gekommen. Ich habe dauernd auf die Uhr geschaut. Irgendwann musste es ja Mitternacht werden. Es war schon höchste Zeit!«
»Wer ist das eigentlich? Ich kann mich nicht erinnern, ihn schon einmal bei uns gesehen zu haben«, erkundigte sich Leopold.
»Das ist ein Gauner, wie er im Buche steht«, teilte Herr Heller ihm mit. »Wirkt im ersten Augenblick freundlich und zuvorkommend, aber gerade das ist sein Schmäh. Damit hat er bereits vielen Menschen Geld aus der Tasche gezogen. Er hat eben ein gutes Auftreten und eine Nase für Leute, die auf seine Tricks hereinfallen. Denen schwindelt er was vor von Konten und Anlagemöglichkeiten, und du glaubst gar nicht, wie viele ihm ihr erspartes Geld in die Hand gegeben haben, ohne eine Sicherheit oder Unterschrift von ihm. Wenn eine naive junge Frau in ihn verliebt war, hat er ihr mit demselben Effekt etwas von einer Reise oder der Anzahlung für eine gemeinsame Wohnung vorgeschwärmt oder gar die Provision für die Vermittlung einer Stelle kassiert, die es gar nicht gegeben hat. Zwischendurch ist er immer wieder einmal aufgeflogen. Angeblich war er unlängst wieder in Tirol.«
»In Tirol?«, wunderte sich Herr Spangl und eröffnete mit dem Königsbauern.
Herr Heller musste lachen. »Wenn man einen von diesen Falotten lange nicht gesehen hat und fragt, wo er die ganze Zeit gewesen ist, ist das die Standardantwort. Klingt besser als ›im Häfn‹ oder ›im Knast‹. Wegen der guten Luft, erklären sie einem dann noch. Wird ja durch die Staberln vorm Fenster gefiltert …«
»Ich hab gleich vermutet, dass der Kerl schon einiges auf dem Kerbholz hat«, befand Leopold. »So etwas rieche ich am Parfum!«
Herr Heller erwiderte Spangls Zug mit seinem Königsbauern. »Er hat schon zeitig angefangen«, erläuterte er dann. »Und im Gefängnis hat er das Schachspielen gelernt. Er habe genug Zeit gehabt, sich mit der Fachliteratur auseinanderzusetzen, behauptet er, und er habe Hunderte Partien berühmter Meister nachgespielt und zum Teil auswendig gelernt. Wenn’s nicht stimmt, ist es zumindest gut erfunden.«
Leopold schüttelte nachdenklich den Kopf. »Komisch, dass der nie bei uns war.«
»Mein lieber Leopold, Sie haben eine viel zu elitäre Grundeinstellung«, belehrte ihn Herr Heller, während die weiteren Eröffnungszüge flott vonstattengingen. »Schach ist zwar ein königliches Spiel, aber das heißt nicht, dass diejenigen, die es ausüben, edlen Geblüts sind, und schon gar nicht, dass man es nur im Ambiente eines gutbürgerlichen Kaffeehauses betreibt. Wir haben unsere Kräfte früher oft in Beisln gemessen, wo der Tisch, das Schachbrett und die Figuren klebrig von dem fettigen Dunst aus der Küche waren. Dort habe ich den Hummel und die Springer-Hanni übrigens auch kennengelernt.«
»Ich meine das anders«, stellte Leopold richtig. »Ich meine, warum ist er ausgerechnet heute bei uns aufgetaucht? Und warum kam mit Johanna Springer ebenfalls eine sehr auffällige Person ins Heller, die uns vorher nie die Ehre gegeben hat? Ist das nur ein merkwürdiger Zufall, oder steckt da mehr dahinter?«
»Mit Ihnen kann man reden, worüber man will, überall sehen Sie verbrecherische Zusammenhänge«, stöhnte Herr Heller, der soeben wegen einer Unachtsamkeit einen Bauern verloren hatte. »Das ist eine sehr anstrengende Eigenschaft von Ihnen.«
Da klopfte es draußen am Fenster. Leopold unterbrach die Debatte und ging nachschauen. Aber anders, als er erwartet hatte, stand draußen statt einem trinkfreudigen Nachtschwärmer der junge Popek.
*
»Wir haben schon geschlossen«, machte Leopold Erich Popek aufmerksam. Er zählte nicht zu den vertrauenswürdigen Stammgästen und hatte außerdem einige Zeit vorher für eine unliebsame Szene gesorgt. Also musste er draußen bleiben.
»Ist mein Vater denn nicht mehr hier?«, fragte Popek unbeeindruckt.
»Nein! Er ist gegangen wie die anderen auch«, fasste sich Leopold kurz.
»Es ist dringend! Haben Sie eine Ahnung, wo er sein könnte?«, ließ Popek nicht locker.
»Ich nehme an, zu Hause.« Leopold wurde ungeduldig.
»Dort ist er nicht! Und er meldet sich auch nicht am Telefon.«
Leopold zuckte mit den Achseln. »Da kann ich Ihnen leider auch nicht weiterhelfen«, bedauerte er. »Vielleicht hat die Angelegenheit doch Zeit bis morgen.«
Erich Popek wollte noch etwas sagen, drehte sich schließlich aber wortlos um und verschwand im fahlen Licht der Straßenbeleuchtung.