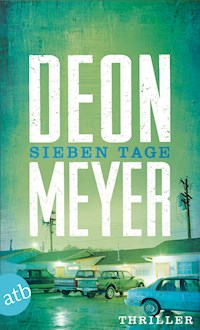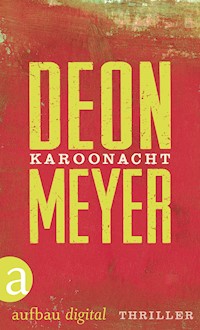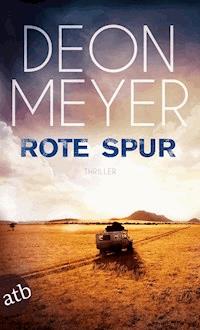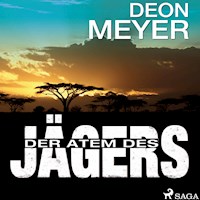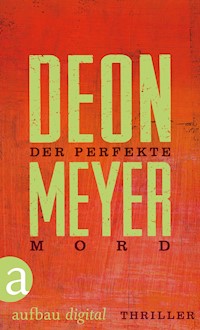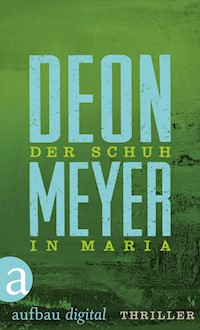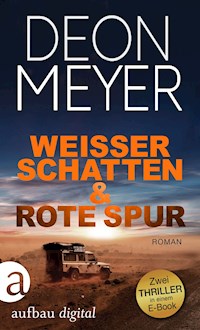9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer Stadt – und eines Mordes.
Nicolaas Storm erzählt eine große Geschichte – darüber, wie er gemeinsam mit seinem Vater einen Platz zum Leben sucht. Ein Fieber hat die Welt verändert: Gangs ziehen umher, es gibt keinen Strom mehr, wilde Tiere bedrohen die Dörfer. Wie die ersten Siedler müssen die Menschen alles neu lernen. Den vielen Widrigkeiten zum Trotz glaubt Nico an einen Neuanfang, und er verliebt sich in Sofia, das wildeste Mädchen, dem er jemals begegnet ist. Dann aber passiert ein Mord, der alles verändert ...
Ein spannendes Epos mit einem wunderbaren Helden – ein Roman über das, was Menschen und menschliches Zusammensein ausmacht. Vom besten Spannungsautor Südafrikas.
»Großartig.« Stephen King.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 854
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Deon Meyer
Deon Meyer, Jahrgang 1958, ist Südafrikas bester und erfolgreichster Thrillerautor. 1994 veröffentlichte er seinen ersten Roman. Er lebt in Stellenbosch, in der Nähe von Kapstadt. Seine Romane erscheinen in mehr als fünfundzwanzig Ländern.
Als Aufbau Taschenbuch liegen von ihm die Thriller »Tod vor Morgengrauen«, »Der traurige Polizist«, »Das Herz des Jägers«, »Der Atem des Jägers«, »Weißer Schatten«, »Dreizehn Stunden«, »Rote Spur«, »Sieben Tage«, »Cobra«sowie der Story-Band »Schwarz. Weiß. Tot« vor.
Mehr Informationen zum Autor unter www.deonmeyer.com.
Stefanie Schäfer studierte Dolmetschen und Übersetzen an den Universitäten Heidelberg und Köln. Für herausragende übersetzerische Leistungen wurde sie mit dem Hieronymusring ausgezeichnet. Sie hat bereits mehrere Bücher von Deon Meyer übersetzt und lebt in Köln.
Informationen zum Buch
Nicolaas Storm erzählt eine große Geschichte – darüber, wie er gemeinsam mit seinem Vater einen Platz zum Leben sucht. Ein Fieber hat die Welt verändert: Gangs ziehen plündernd umher, es gibt keinen Strom mehr, wilde Tiere bedrohen die Dörfer. Wie die ersten Siedler müssen die Menschen alles neu lernen. Den vielen Widrigkeiten zum Trotz glaubt Nico an einen Neuanfang, und er verliebt sich in Sofia, das wildeste Mädchen, dem er jemals begegnet ist. Dann aber passiert der Mord, der alles verändert: Sein Vater wird erschossen.
Ein spannendes Epos mit einem wunderbaren Helden – ein Roman über das, was Menschen und menschliches Zusammensein ausmacht.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
ROMAN
Aus dem Afrikaansvon Stefanie Schäfer
Inhaltsübersicht
Über Deon Meyer
Informationen zum Buch
Newsletter
Buch lesen
Kapitel 1
Das Jahr des Hundes
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Das Jahr der Krähe
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Das Jahr des Schakals
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Das Jahr des Schweins
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Das Jahr des Löwen
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
Kapitel 119
Kapitel 120
Danksagung
Quellenangaben
Glossar mit Erklärungen der afrikaanssprachigen Wörter und anderer Begriffe
Impressum
Das ursprüngliche Mysterium, das jeder Reise vorangeht, ist dies: Wieist der Reisende vorher zu seinem Ausgangspunkt gelangt?
Louise Bogan
Erinnerungen an eine Demütigung überdauern Jahrzehnte…
Olliver Burkeman, Help!
Jede Autobiografie beschäftigt sich mit zwei Charakteren, einem Don Quichotte, dem Ego, und einem Sancho Panza, dem Ich.
W.H. Auden
Eine Autobiografie ist in der Regel ehrlich, aber niemals wahrheitsgetreu.
Robert A. Heinlein, Freitag
Aber durch die schäbigen Straßen muss ein Mann gehen, der selbst nicht schäbig ist, der eine reine Weste hat und keine Angst. Er muss der beste Mensch auf der Welt sein und ein Mensch, der gut genug ist für jede Welt.
Raymond Chandler
1
Ich will euch vom Mord an meinem Vater erzählen.
Ich will euch erzählen, wer ihn ermordet hat und warum. Denn dies ist die Geschichte meines Lebens. Und es ist auch die eures Lebens, ihr werdet sehen.
Ich habe lange gewartet, bis ich mit dem Niederschreiben begann, denn ich glaube, man braucht dazu Weisheit und Erkenntnis. Und Abstand. Man muss in der Lage sein, das Böse in sich – ja, all seine Gefühle – zu beherrschen.
Ich bin jetzt siebenundvierzig. Genauso alt wie mein Vater, als er getötet wurde, im Jahr des Löwen. Genügend Abstand zu den Geschehnissen habe ich gewonnen, aber ob ich je das rechte Maß an Weisheit und Erkenntnis besitzen werde, weiß ich nicht. Ich befürchte, mit der Zeit viele entscheidende Ereignisse, Menschen und Erfahrungen zu vergessen. Deswegen will ich nicht länger warten.
Hier sind sie also. Meine Memoiren, die Geschichte eines Mordes. Ich trete nach vorn, damit alle davon erfahren.
Das Jahr des Hundes
2
20. März
Am deutlichsten erinnern wir uns an die Augenblicke der Angst, des Verlustes und der Erniedrigung.
Ich war dreizehn Jahre alt, am 20. März im Jahr des Hundes.
Der Tag verlief wie der gestrige und der davor. Wir wurden eingehüllt vom tiefen Dröhnen des Dieselmotors in unserer großen Volvo FH12-Zugmaschine und dem sonoren Rollen der sechzehn Räder unter dem langen, geschlossenen Anhänger dahinter. Draußen zog eine vorhersehbare, nicht erinnernswerte Landschaft vorbei. Ich spüre noch die künstliche Kühle der Klimaanlage im Führerhaus, das innen noch ganz neu und sauber roch. Ich hielt ein Schulbuch auf dem Schoß, doch meine Gedanken schweiften ab.
Mein Vater ging vom Gas. Ich blickte auf, zum Fenster hinaus und sah die weißen Buchstaben auf dem schwarzen Untergrund des Schildes am Wegesrand: WILLKOMMEN IN KOFFIEFONTEIN!
»Koffiefontein«, sagte ich vor mich hin, bezaubert von dem Namen und dem dazugehörigen Bild in meiner jugendlichen Phantasie – eine warme, aromatische Quelle von blubberndem, dunklem Gebräu.
Langsam fuhren wir in das Dorf hinein. Im schwindenden Licht des Spätnachmittags lag es geisterhaft und leblos da, wie all die anderen Orte auch. Unkraut auf den Bürgersteigen, der Rasen hinter den Zäunen hoch aufgeschossen und verwildert. Am Horizont, weit hinter den flachen Gebäuden entlang der breiten Hauptstraße zuckten kreuz und quer Blitze dramatisch über phantastische Wolkenformationen. Im Westen färbte sich der Himmel in einem tiefen Blutrot, seltsam und beunruhigend.
Mein Vater deutete mit dem Finger darauf. »Cu-mu-lo-nim-bus«, sagte er, jede Silbe einzeln betonend. »So nennt man diese Wolken. Das kommt aus dem Lateinischen. ›Cumulus‹ bedeutet ›Anhäufung‹, und ›Nimbus‹ heißt ›Regenwolken‹. Bei uns verheißen solche Wolken ein Gewitter.«
»Cu-mu-lo-nim-bus«, wiederholte ich zögernd.
Mein Vater nickte, lenkte den großen Truck geschickt an eine Tankstelle, hielt an und schaltete die Scheinwerfer an der Seitenwand des langen Auflegers ein. Der Mechanismus war selbst installiert. Die Zapfsäulen warfen nun lange Schatten, die menschlichen Gestalten glichen. Der Motor schwieg. Wir stiegen aus.
So sehr daran gewöhnt, dass keine Gefahr drohte.
Vom Asphalt stieg die Spätsommerhitze des Tages auf, und die Zikaden zirpten schrill, begleitet von anderen, tieferen Lauten.
»Was ist das, Pa?«
»Das sind Frösche. Dahinten fließt der Rietrivier.«
Wir gingen am Anhänger entlang. Er war weiß, beschriftet mit drei großen, grünen Kursivbuchstaben: RFA. Die Bedeutung der Abkürzung fand sich auf der hinteren Bordwand – Road Freight Africa. Wir hatten den Volvo auf einem Lkw-Parkplatz kurz hinter Potchefstroom gefunden – starke Zugmaschine, so gut wie neu, der Tank voll. Jetzt gingen wir, Vater und Sohn, nebeneinanderher. Die Haare meines Vaters waren lang, ungekämmt und blond, meine ebenso wild, aber braun. Ich war dreizehn, im Niemandsland zwischen Kind und Teenager, und fühlte mich wohl dort.
Eine Fledermaus strich tief über meinen Kopf.
»Wie fängt eine Fledermaus ihre Beute?«, fragte mein Vater.
»Durch Echoortung.«
»Und zu welcher Gruppe von Tieren gehört die Fledermaus?«
»Zu den Säugetieren, nicht zu den Vögeln.«
Er zerstrubbelte meine Haare noch mehr. »Prima.«
Ich mochte das.
Wir begannen mit dem vertrauten Ritual, das wir seit Wochen mindestens einmal täglich durchführten: Mein Vater trug das kleine Honda-Stromaggregat und die Elektropumpe zu den Nachfüllstutzen der Tankstelle, die in einer Reihe angeordnet und mit verschiedenfarbigen Deckeln gekennzeichnet waren. Dann holte er den großen Engländer, um den schwarzen Dieseldeckel zu öffnen. Meine Aufgabe war es, den langen Gartenschlauch auszurollen. Dieser war mit der elektrischen Pumpe gekoppelt, und das andere Ende musste ich in die Tanköffnung des Volvos schieben und dort festhalten.
Tanken in einer Welt ohne Tankstellenwärter und Elektrizität.
Ich erledigte meinen Teil der Arbeit, stand gelangweilt herum und las die Beschriftung auf der weißen Mauer des länglichen Tankstellengebäudes. Myburgh Elektries. Myburgh Bande. Ich nahm mir vor, meinen Vater nach der Bedeutung zu fragen, denn ich wusste, dass »Burgh« »Burg« bedeutete – das hatte er mir erklärt, als wir durch Orte wie Trompsburg und Reddersburg gefahren waren –, doch dies war eine seltsame Schreibweise und nicht der Name dieses Dorfes.
Urplötzlich schwiegen die Grillen.
Irgendetwas weckte meine Aufmerksamkeit, jenseits von meinem Vater, hinten auf der Straße. Ich rief ihn, erstaunt über dieses plötzliche Zeichen von Leben und etwas besorgt über die schleichende Art der Fortbewegung. Mein Vater saß in der Hocke und war dabei, den Pumpenstutzen in die Tanköffnung zu schieben. Er schaute zu mir auf, folgte der Richtung meines Blickes und sah die Schatten in der Dämmerung.
»Einsteigen!«, rief er. Er sprang auf, den Engländer in den Händen, und rannte zum Führerhaus des Lastwagens.
Ich blieb stehen wie angewurzelt. Die Scham über mein unerklärliches, unbesonnenes Verhalten sollte anschließend noch monatelang an mir nagen. Reglos stand ich da, die Augen auf die heranschleichenden Schatten geheftet. Sie nahmen allmählich Gestalt an.
Es waren Hunde. Geschmeidig, schnell.
»Nico!«, schrie mein Vater entsetzt und drängend. Er blieb stehen, um sein Kind vor den angreifenden Tieren zu schützen.
Die Verzweiflung in der Stimme meines Vaters versetzte mir einen Ruck und durchbrach die Mauer der Furcht. Schlug den ersten Funken des Schuldbewusstseins. Ich schluchzte, rannte am langen Hänger entlang. Durch meine Tränen hindurch sah ich den ersten Hund in den Lichtkegel hineinhechten und meinem Vater an die Kehle springen, das Maul weit aufgesperrt, die langen, scharfen Zähne entblößt. Ich sah den Schwung des großen Schlüssels, den fließenden Schatten dieser Bewegung. Ich hörte einen dumpfen Schlag, als das Werkzeug den Kopf traf, ein kurzes Aufjaulen. An der Treppe zum Führerhaus angekommen, griff ich das Chromgeländer. Die Angst jagte mich die Stufen hinauf. Ein Hund sprang auf mich los, und ich schlug die Tür zu. Er sprang hoch, bis fast zum offenen Fenster. Krallen kratzten über das Metall, gelbe Zähne leuchteten im Scheinwerferlicht neben dem Lkw auf. Ich schrie. Der Hund fiel zurück. Mein Vater stand dort unten. Fünf, sechs Hunde umkreisten ihn geduckt, weitere kamen in den Lichtschein hineingaloppiert, federnd, erbarmungslos.
Danach geschah alles ganz schnell, und zugleich war es, als bliebe die Zeit stehen. Ich erinnere mich an alles bis ins kleinste Detail. Die Verzweiflung im Gesicht meines Vaters, als die Hunde ihn vom sicheren Lkw abschnitten, der nur einen Meter von ihm entfernt war. Das sausende Geräusch, als er den massiven Engländer wieder und wieder schwang. Die Elektrizität in der Luft, der Geruch von Ozon, der Gestank der Hunde. Sie wichen flink vor dem tödlichen Schwung des Schraubenschlüssels zurück, blieben aber hartnäckig zwischen dem Mann und der Tür des Trucks, knurrend, schnappend.
»Die Pistole, Nico! Schieß!« Es war kein Befehl, sondern ein ängstliches Flehen, als hätte mein Vater in diesem Augenblick dem Tod ins Auge geblickt und die Konsequenzen gesehen: sein Sohn, der hier allein überlebte, gestrandet, verdammt.
Sein Gesicht verzog sich vor Schmerz; ein Hund sprang ihn von hinten an und schlug ihm die Zähne tief in die Schulter. Das riss mich aus meiner Angststarre, und ich griff nach der Beretta im Fach des breiten Armaturenbretts. Mühsam schob ich mit dem Daumen den Sicherheitshebel weg, wie es mein Vater mir wieder und wieder gezeigt hatte. Ein anderer Hund biss meinen Vater in den schützend erhobenen Unterarm und hängte sich daran. Ich umklammerte mit beiden Händen die Waffe. Legte zwei Finger auf den Abzug, um den ersten Widerstand der Double Action zu überwinden, und schoss zum Fenster hinaus in die Luft, wild, der Knall ohrenbetäubend laut im Innenraum, so dass mir die Ohren sausten und alle Geräusche verstummten. Scharfer Korditgestank stieg mir in die Nase. Die Tiere erstarrten für einen Augenblick. Mein Vater schlug mit dem Schraubenschlüssel zu, der Hund an seinem Arm fiel zu Boden, mein Vater näherte sich der Tür. Die Meute reagierte und sprang auf ihn los. Ich zielte auf die Flanke eines Hundes und schoss. Der Hund fiel um. Ich schoss wieder und wieder. Die Tiere stießen hohe, kaum hörbare Schmerzlaute aus, und die unverletzten zogen sich zurück, zum ersten Mal.
Mein Vater schaffte es bis zur Tür, riss sie auf, sprang in die Kabine, ein Hund hing an seinem Bein, er schlug nach ihm. Der Hund fiel hinunter. Arme und Rücken meines Vaters waren blutig, er stieß mich vom Fahrersitz, schlug die Tür zu. Auf seinem Gesicht zeigten sich Ekel, Verbissenheit, Angst, Abscheu und Wut. Ich fühlte, wie er mir die Pistole aus den Händen nahm. Ich sah, wie er das Magazin herausfallen ließ und ein neues hineinschob. Er hielt die Pistole zum Fenster hinaus. Er schoss und schoss und schoss. Die Schüsse hallten dumpf in meinen tauben Ohren wider, die Patronenhülsen sprangen geräuschlos gegen die Windschutzscheibe, auf Armaturenbrett, Lenkrad und den Boden neben mir, überallhin. Ich sah das zerrissene Hemd meines Vaters, die tiefe Rückenwunde, genauso blutrot wie die Wolken.
Die Pistole war leer, und immer noch drückte mein Vater den Abzug. Rauch erfüllte die Kabine.
Es war der 20. März im Jahr des Hundes. Elf Monate nach Ausbruch des Fiebers.
Vornübergebeugt saß mein Vater da, die Pistole auf dem Schoß. Reglos. Ich konnte nicht erkennen, ob seine Augen geschlossen waren.
Die Geräusche von draußen kehrten allmählich zurück, in sanften Wellen, die über uns hinwegspülten.
Die Frösche, die frühabendlichen Grillen. Fern im Westen verblasste der blutrote Horizont und wurde schwarz, und immer noch saß er so da.
Ein leises Schluchzen. Es dauerte einen Moment, bevor ich begriff, dass es von mir kam. Ich versuchte, es zu unterdrücken, denn es schien mir unpassend. Irgendwie undankbar. Aber ich konnte mich nicht beherrschen, das Schluchzen wurde lauter, herzzerreißend. Mein Vater drehte sich zu mir, legte die Pistole beiseite und nahm mich in die Arme. Es schüttelte mich jetzt am ganzen Körper, und das Herz hämmerte mir laut in den Ohren. Ich atmete den Blut- und Schweißgeruch meines Vaters ein, klammerte mich an ihm fest.
Mein Ohr lag an seiner Brust, und ich hörte sein Herz, das so schrecklich schnell schlug.
»Schon gut«, sagte er. Die Worte hörte ich nicht, ich fühlte nur ihre Vibrationen. Schon gut. Schon gut, schon gut, schon gut.
Er drückte mich fester, und langsam beruhigte ich mich.
»Du bist mein Held, Nico«, sagte er. »Du hast das gut gemacht, hörst du?«
Endlich brachte ich das Wort heraus, was schon so lange in mir festsaß. »Mama.«
Und als es meine Ohren erreichte, brannte die Scham in mir.
»O mein Gott«, sagte mein Vater und drückte mich noch fester. Dann schaltete er die Seitenscheinwerfer aus.
Der Name meines Vaters war Willem Storm.
Im Licht einer zischenden Gaslampe säuberte ich die Wunden auf seinem Rücken. Meine Hände zitterten. Das Desinfektionsmittel musste wie Feuer in den langen roten Hautrissen brennen, aber er gab keinen Laut von sich. Das war ungewöhnlich. Es machte mir Angst, verstärkte die Sorge, dass ich ihn im Stich gelassen hatte.
Später öffnete er zwei Dosen Enterprise Spaghetti mit Fleischklößchen. Wir aßen schweigend. Ich starrte die blaurote Dose an und fragte mich, was so schlimm an Schweinefleisch war. Denn auf dem Etikett war ein gelber Stern, und darauf stand in fetter roter Schrift: OHNE SCHWEINEFLEISCH.
»Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde«, sagte mein Vater schließlich.
»Was denn, Pa?«
»Das mit den Hunden«, sagte er, begleitet von einer vagen Geste mit der Gabel. Dann schwieg er wieder.
3
21. März
Am nächsten Morgen schleifte mein Vater die Kadaver der Hunde hinter die Tankstelle und zündete sie an.
Wir betankten den Truck. Pa war schweigsam. Es herrschte eine angespannte Atmosphäre. Die Angst schlich wie ein Schatten hinter mir her.
Wir fuhren los, ohne Kaffee, ohne Frühstück. »Wir suchen uns jetzt eine schöne Stelle zum Essen«, versprach Pa. Es sollte wie ein Versprechen klingen, aber ich war alt genug, um zu bemerken, wie gezwungen seine Heiterkeit war. Ich dachte, es läge an den Schmerzen durch die Bisswunden. »Okay, Pa«, antwortete ich freudig, als teile ich seine gute Laune.
Er trank Wasser aus einer vollen Einliter-Plastikflasche. Schon nach kurzer Zeit war sie leer.
Eine Stunde später hielten wir an der versprochenen besonderen Stelle, und ich vergaß das unselige Gefühl, das uns den ganzen Morgen bedrückt hatte. Ich stieß einen Freudenschrei aus, der gar nicht zu meinem Alter passte. Voller Erstaunen sah ich mich um, denn hier war es so wunderschön und ungewöhnlich – und laut: eine Brücke, eine Talsperre, ein Brausen. Links von uns lag der See, spiegelglatt, eine riesige, ausgedehnte Wasserfläche. Rechts floss tief unten im Tal ein Fluss, verschleiert von dem Sprühnebel, dort, wo das Wasser durch die Schleusen hinunterstürzte.
Pa stellte den Lkw auf der massiven Betonstaumauer ab und ließ beide Fenster herunter. Das Rauschen der stürzenden Wassermassen erfüllte die Kabine und ließ den ganzen Lkw vibrieren.
Pa musste laut sprechen, damit ich ihn verstand. Er deutete auf den See: »Das ist der Vanderkloofdam.« Dann blickte er in die tiefe Schlucht hinein. »Und das ist der große Oranje.«
»Wow!« Das Gestern war vergessen, so bezaubert war ich.
»Ich glaube, sie haben die Schleusen offen gelassen. Als das Fieber kam. Ist auch besser so.«
Voller Erstaunen sah ich mich um. Bis mir bewusst wurde, dass Pa die Worte »das Fieber« so merkwürdig ausgesprochen hatte. Nicht wie sonst, sondern leise, schnell und widerwillig, als wolle er sie bloß nicht betonen. Ich sah ihn an, doch er mied meinen Blick. »Komm, lass uns Kaffee kochen«, sagte er rasch.
Wir bewahrten einen kleinen Gaskocher und eine große Espressokanne unter dem Bett hinter den Sitzen auf, dazu Zwieback, eine Packung Biltong und Süßigkeiten. Ich kletterte nach hinten und nahm das Kaffeekochen in Angriff.
Normalerweise stiegen wir unterwegs zum Essen aus, aber diesmal blieb Pa sitzen. Bestimmt wollte er kein Risiko eingehen, nach der Sache mit den Hunden.
Ich reichte ihm Zwieback. Er aß nur einen. Ich aß drei, weil ich plötzlich hungrig war.
Die Espressokanne blubberte. Kaffeeduft erfüllte die Kabine.
Ich schenkte Vater zuerst ein, der seinen Kaffee schwarz und bitter trank. Ich mochte meinen mit zwei Stück Zucker und Kaffeeweißer.
»Hier, Pa.«
Er drehte sich zu mir um. Ich wartete darauf, dass er sagte »solange wir können«. Das sagte er jeden Morgen, wenn wir Kaffee tranken. Dann hob er den Becher, als wolle er mir zuprosten, und lächelte ein wenig schief. Denn der Kaffee würde irgendwann in Zukunft ausgehen, und schon vorher würde er alt werden und nicht mehr schmecken, und dieser Tag kam näher. Das hatte mir Vater erklärt, nachdem er zum ersten Mal »solange wir können« gesagt hatte.
Heute Morgen sagte er es nicht.
Erst sah ich, wie seine Hand zitterte. Dann sah ich den Schweiß auf seiner Stirn und die Röte in seinem Gesicht. Und seine Augen, stumpf und ausdruckslos.
Plötzlich ergaben sein Schweigen und alles andere einen Sinn. Ich fing an zu weinen vor Schreck.
»Es ist nicht das Fieber«, sagte er. »Hörst du?«
Die Angst war kein Schatten mehr, sie hatte von mir Besitz ergriffen.
»Nico, hör zu«, sagte mein Vater, und er klang wieder genauso verzweifelt wie gestern Nachmittag bei den Hunden. Ich unterdrückte für einen Augenblick mein Schluchzen.
Er stellte seinen Kaffee auf das Armaturenbrett und umarmte mich. Ich spürte die Hitze, die von ihm ausging.
»Es ist nicht das Fieber. Es liegt an den Hundebissen. Das ist nur eine Infektion, durch die Bakterien aus ihren Mäulern. Ich brauche Antibiotika und viel Wasser und Bettruhe. Hörst du?«
»Du hast Fieber, Pa! Das sehe ich doch.«
»Ich verspreche es dir, das ist eine andere Art von Fieber, ich gebe dir mein Ehrenwort. Du hattest auch schon mal Fieber, bei Grippe oder Erkältung, oder als du gezahnt hast als Baby. Es gibt viele Arten von Fieber, die ganz harmlos sind. Diese Hunde haben kein Futter mehr von den Menschen bekommen. Sie haben Müll gefressen oder verdorbenes Fleisch, und als sie mich gebissen haben, sind die Bakterien in mein Blut eingedrungen. Daher kommt das Fieber. Ich werde nur eine kurze Zeitlang krank sein. Ich verspreche es dir, Nico, ich verspreche es dir. Wir haben die richtigen Medikamente dagegen, ich nehme gleich welche.«
Wir fuhren immer weiter in die Hügel hinauf, bis wir ins Dorf Vanderkloof kamen. Es war ein kleiner, merkwürdiger Ort oben in den Hügeln, der sich ungeordnet und weit auseinandergezogen am Seeufer entlang erstreckte. Pa schien nach irgendetwas zu suchen. Er fand es erst in den Ausläufern des totenstillen Dorfs. Ein einfaches Haus, von dessen Holzbalken die Farbe abblätterte und dessen Tür und Fenster durch massive Metallgitter gesichert wurden. Gegenüber gab es einen Parkplatz für unseren Truck.
Dort hielt Vater an. Er stieg aus, mit einer Pistole und einer Jagdbüchse bewaffnet. Ich musste im Volvo bleiben. Er wollte sich im Haus umsehen. Ich ließ die Haustür nicht aus den Augen, aus Angst, dass er nicht zurückkehren würde. Was sollte ich dann machen?
Alles war jetzt anders, nach unserer gestrigen Begegnung mit den Hunden. Und jetzt fieberte Pa.
Dann kehrte er zurück. Ich sah, dass er unsicher auf den Beinen war.
Er sagte: »Das hier ist gut genug. Komm, bring deine Bücher mit.«
Ich steckte sie in meinen Rucksack und stieg aus. Pa ging jetzt langsam, tat alles vorsichtig. Er schloss den großen Anhänger hinten auf und zog den Klapptritt heraus. Der Inhalt des Anhängers hatte unser Leben in den vergangenen Monaten bestimmt. Er enthielt eine Vielzahl von Dingen, die unterwegs immer wieder ergänzt wurden und so ordentlich gepackt und befestigt waren, dass wir genau wussten, wo sich was befand. Neben der Tür standen Kartons voller Nahrungsmittel in Dosen und dazu Reis, Mehl, Nudeln, Milchpulver, Kaffee, Kaffeeweißer und Hunderte Flaschen Wasser. Dann, in keiner spezifischen Reihenfolge: Bücher, genau wie das Essen sorgfältig dort herausgepickt, wo man gefahrlos herumschnüffeln konnte. Do-it-Yourself-Bücher über Reparaturen, medizinische Versorgung, das Überleben in der Wildnis und »Das ultimative Anfängerhandbuch für Waffen«, dank dem wir beide schießen gelernt hatten. Erzählbände, Schulbücher, Kochbücher und Ratgeber über Viehschlachtung und Erste Hilfe bei Schlangenbissen und Insektenstichen.
Es gab Gewehre, Pistolen, Munition, Jagdmesser, Schlachtermesser und Küchenmesser, unsere Ausrüstung zum Benzinpumpen sowie Wasserfilter. Medikamente, Verbandszeug, Salben, Sonnenmilch. Ein kleines Zelt, Campingstühle, Luftmatratzen, Feldbetten, zwei Klapptische, zwei große Sonnenschirme, noch unbenutzt in ihren Plastikhüllen vom Makro-Markt. Drei benzinbetriebene Stromgeneratoren, zehn Fünfzig-Liter-Kanister, Toilettenartikel: mehr Zahnpasta, als wir im Leben verbrauchen würden, Shampoo, Seife, Deo, Zahnbürsten. Waschpulver, Bleichmittel. Laptops, Drucker. Besteck, Geschirr, Werkzeug, Elektrowerkzeuge …
Pa holte uns ein paar Kartons Proviant heraus und suchte so lange, bis er die richtigen Medikamente fand. Er stieg wieder aus, schob den Klapptritt zurück, schlug die Ladetüren zu und schloss sie sorgfältig ab. Wir trugen die Kartons ins Haus. Es war verlassen und ordentlich, als hätten die Leute es erst saubergemacht und aufgeräumt, bevor sie starben. Jedes leere Haus, das wir betraten, besaß seinen eigenen Geruch. Manche rochen angenehm, manche eklig. Dieses roch ein klein wenig nach Gummi. Ich wusste nicht, warum.
»Der Herd funktioniert mit Gas«, erklärte Vater. Ich nickte.
»Und wir haben Wasser.« Er meinte, dass die Wasserleitung noch funktionierte.
Mein Vater kehrte zurück zu unserem Lkw und schloss auch das Führerhaus ab. Dann kam er wieder ins Haus und versperrte erst das Metallgitter und dann die Haustür. Er gab mir eine Pistole.
»Nico, ich werde jetzt erst noch einmal die Hundebisse desinfizieren und dann die Medikamente einnehmen. Ich brauche Schlaf. Ich lege mich da hinten ins Schlafzimmer. Du darfst das Haus nicht verlassen! Wenn du irgendetwas siehst oder hörst, komm sofort zu mir. Nimm dir etwas zu essen, da sind Dosen mit deinem Lieblingsessen. Und Biltong und Kekse. Und Suppe, heute Abend esse ich mit dir zusammen Suppe. Bitte wecke mich, wenn die Sonne untergeht. Ich weiß, dass du jetzt Angst hast, Nico, aber ich werde nur ungefähr zwei Tage lang krank sein, hörst du?«
Ich berührte ihn. Er war glühend heiß.
Ich weinte nicht. Ich nickte nur.
»Wie schützen wir uns?«, fragte er.
»Wir vertrauen nur einander.«
»Richtig. Komm mit, schau dir an, wo ich mich hinlege. Falls ich noch schlafen sollte, wenn es dunkel wird: Denk daran, kein Licht!«
Er sah meinen Gesichtsausdruck und sagte: »Alles wird gut.«
Aber es war nicht alles gut.
Ich holte einige meiner Bücher heraus und ging in die Sitzecke des offenen Wohnzimmers, das mit der Küche und dem Esszimmer eine Einheit bildete. Nach einer Ewigkeit hielt ich es nicht mehr aus. Ich ging zum Schlafzimmer. Mein Vater lag unter mehreren Decken und zitterte furchtbar, obwohl es nicht kalt war. Er bemerkte mich gar nicht.
Ich wollte ihn nicht sterben sehen. Langsam ging ich den Flur entlang. Ich hörte Geräusche unter dem Dach des Hauses und von draußen. Ich spähte durch die Fenster der anderen Schlafzimmer hinaus, doch alles war wieder still. Im Wohnzimmer sah ich durch die Tüllgardine eine Bewegung. Ein Tier trabte die Straße entlang. Ich erschrak, weil ich dachte, es sei ein Hund. Ich blieb am Fenster stehen und sah, dass es ein Löffelhund war, klein mit silbrigen Reflexen im Pelz. Plötzlich blieb er stehen und schaute zum Haus hinüber. Er hob die Schnauze, als wittere er etwas. Dann lief er weiter, eilig, als sei er spät dran.
Ich schlich wieder ins Schlafzimmer. Mein Vater atmete noch.
Das Haus hatte einen einfachen Grundriss, ein langes Rechteck, der Wohn-Ess-Bereich gleich hinter der Haustür, drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer im hinteren Teil. Ich erkundete alle anderen Zimmer des Hauses sorgfältig, öffnete Schränke, schaute unter Betten. Es war kein Spielzeug in den Schränken, nirgendwo gab es Bücherregale. In einer Holzkiste neben einem Sessel im Wohnzimmer lagen Zeitschriften. Sarie, Rooi Rose und Huisgenoot. Ich mochte sie nicht lesen, denn all die Menschen darin waren inzwischen tot, all die Fernsehsendungen und Spielfilme gab es nicht mehr. Die ganze Welt hatte sich verändert.
In den Kühlschrank schaute ich nicht, denn mein Vater und ich wussten, dass die Kühlschränke verdorbenes Essen enthielten. Man hielt sie besser geschlossen.
Hoch oben in einem Vorratsschrank fand ich zwei große Packungen Simba-Chips. Räucherfleischgeschmack. Orientalisch mochte ich lieber. Eine große Tafel Cadbury-Schokolade. Ich öffnete sie. Ich wusste, dass sie hellbraun, weiß angelaufen und ungenießbar sein würde, aber ich war optimistisch, mit meinen dreizehn Jahren.
Die Schokolade war schlecht.
Ich aß eine Tüte Chips leer. Sie schmeckten schon etwas muffig, waren aber knusprig und füllten den Magen. Ich aß auch noch die andere Packung.
Ich schaute nach meinem Vater. Er zitterte nicht mehr. Er hatte sich aufgedeckt. Er schwitzte. Die Hundebisse waren feuerrot und geschwollen.
Ich kauerte mich an die Wand seines Zimmers und betrachtete ihn. Es war furchtbar still. Ich hörte nur den Atem meines Vaters. Ein und aus. Zu schnell.
Das Fieber hatte ihn gepackt.
4
Der Mann unter dem Mangobaum
Man wusste, dass das Fieber aus Afrika gekommen war. Man wusste, dass zwei Virenstämme miteinander verschmolzen waren, einer vom Menschen, einer von der Fledermaus. Damals wurde viel darüber geschrieben, bevor die Leute alle starben.
Ein Arzt veröffentlichte einen Artikel mit einer Hypothese darüber, wie alles begonnen haben könnte:
Ein Mann lag irgendwo im tropischen Afrika unter einem Mangobaum. Der Mann war anfällig für Krankheiten, weil er HIV-positiv war und keine Medikamente dagegen erhielt. Im Blut des Mannes befand sich bereits ein Coronavirus. Das war nichts Außergewöhnliches; Coronaviren kamen relativ häufig vor. In der Zeit vor dem Fieber kannte man mindestens vier Typen, die Grippe- und Erkältungssymptome bei Menschen auslösten.
Coronaviren lebten auch in Tieren. In Säugetieren und Vögeln.
In dem Mangobaum saß eine Fledermaus mit einer anderen Art Coronavirus im Blut.
Die Fledermaus war krank. Sie hatte Durchfall und schiss dem Mann unter dem Mangobaum ins Gesicht, in die Augen, die Nase oder den Mund. So gelangte das zweite Coronavirus ins Blut des Mannes. Die beiden Virenstämme vermehrten sich gemeinsam in denselben Zellen in der Luftröhre des Mannes und vermischten ihr Genmaterial. Ein neues Coronavirus wurde geboren – ein hochansteckendes, das durch Tröpfcheninfektion verbreitet wurde und schwere Krankheitssymptome verursachte.
Der Mann unter dem Mangobaum lebte in einer armen Gegend. Die Leute wohnten beengt, viele waren HIV-infiziert. Rasch steckte der Mann andere an. Das neue Virus verbreitete sich innerhalb des Dorfes und mutierte dabei weiter. Eine der Mutationen war perfekt. Sie verbreitete sich rasend schnell durch die Luft und brauchte genau so lange, um einen Menschen zu töten, dass jeder Erkrankte vorher noch viele andere anstecken konnte.
Ein Verwandter des Mannes unter dem Mangobaum arbeitete am Flughafen in der nahegelegenen großen Stadt. Dieser Verwandte trug das perfekte Virus in sich. Er hustete eine Reisende an, kurz bevor sie ins Flugzeug nach England stieg.
In England fand ein riesiges internationales Sportereignis statt.
Alle Industriestaaten besaßen ein Seuchenschutzprogramm gegen tödliche, ansteckende Krankheiten. Sogar die meisten Entwicklungsländer hatten ausgeklügelte Pläne für einen solchen Fall. Es gab Maßnahmen und systematische Reaktionen im Fall einer Epidemie. Theoretisch hätten sie greifen sollen.
Doch die Natur scherte sich nicht um Theorien. Und gegen menschliches Versagen nützten sie auch nichts.
5
21. März
Ich saß dort auf dem Fußboden neben dem Bett, in dem mein Vater mit Fieber lag, und schlief aus Versehen spätnachmittags ein.
Etwas weckte mich. Ich hörte ein Fahrzeug. Zunächst glaubte ich, ich bildete es mir ein. Das Geräusch wurde lauter. Leise huschte ich ins Wohnzimmer.
Es war tatsächlich ein Fahrzeug, das mit jaulendem Motor die Anhöhe zum Dorf hinaufgejagt kann. Ich rannte zurück ins Schlafzimmer.
»Pa!«
Er hörte mich nicht.
»Pa!«, sagte ich lauter, drängend. »Ich höre ein Auto!«
Mein Vater atmete schnell. Sein Mund war leicht geöffnet. Er regte sich nicht. Ich hätte am liebsten geschrien, ihn laut angebrüllt: Stirb nicht, ich habe Angst, da draußen ist ein Auto, wir vertrauen nur einander! Komm zurück aus dem Fieber, ich bin noch zu klein, um allein zu sein. Pa, bitte stirb nicht!
Doch ich schämte mich noch dafür, dass ich gestern Abend nach meiner Mutter gerufen hatte. Ich stand einfach nur da und sah zu, wie mein Vater nicht erwachte.
Das Auto kam näher.
Ich rannte zurück ins Wohnzimmer. Die Schatten draußen waren lang, die Sonne stand jetzt tief. Das Auto kam näher und näher. Es fuhr langsamer, das hörte ich. Es war jetzt im Dorf.
Am liebsten wäre ich hinausgerannt und hätte zu den Ankömmlingen gesagt: »Kommt, helft meinem Vater, er ist krank!«
Wir vertrauen nur einander. Das hatten mein Vater und ich beschlossen, als uns die Leute hinter Bultfontein berauben wollten, vor fünf Wochen. Ich durfte nicht hinausgehen.
Das Auto bog um die Ecke. Jetzt war es draußen vor dem Haus auf der Straße.
Ein schwarzer Jeep Wrangler mit offenem Verdeck. Er raste vorbei. Es schien, als säßen drei Leute drin. Dann war er weg, die Straße hinunter.
Ich hätte sie anhalten sollen, denn mein Vater war sehr krank.
Ich hörte, wie der Jeep zurückkam. Ich sah, wie er gegenüber vom Volvo anhielt. Ein Mann mit sehr langem, schwarzem Haar schaltete den Motor aus. Er trug kein Hemd, nur eine lange Hose. Er war mager, sein Brusthaar dunkel und dicht. Er sprang hinaus und ging auf unseren Truck zu. Er trug ein Gewehr in der Hand.
Ich würde sie rufen. Ich würde sie bitten, mir zu helfen. Mir und meinem Vater. Ich ging zur Tür. Dann sah ich die Frau hinten im Jeep. Sie hatte braunes, wirres Haar. Sie ließ den Kopf hängen. Ihre Hände waren an den Überrollbügel gefesselt. Sie schrie irgendetwas, als hätte auch sie große Angst.
Ich blieb stehen.
Der andere Mann, der noch vorne im Jeep saß, trug ein ärmelloses T-Shirt und hatte dicke Armmuskeln. Er schlug die Frau mit der flachen Hand. Sie weinte. Er rief dem Mann bei unserem Volvo zu: »Wann sind wir zum letzten Mal hier vorbeigekommen?«
»Vor einer Woche?«, rief der Mann mit den langen Haaren zurück.
»Da stand der Truck hier noch nicht.«
Der Langhaarige stieg zum Führerhaus hinauf und versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie war abgeschlossen. Er kam wieder herunter. Er legte die Hand auf den Auspuff. »Er ist kalt!«, rief er zum Jeep hinüber. »Bist du sicher? Wir waren besoffen letztes Mal. Der kann schon lange hier stehen.«
Das Muskelpaket lachte. »Stimmt.«
Ich setzte mich in den Sessel und schaute über das Sofa hinweg durch die Tüllgardine zu ihnen hinaus. Leute, die eine Frau ans Auto fesselten, waren keine guten Menschen. Ich konnte ihnen nicht vertrauen.
Das Muskelpaket stieg aus dem Jeep. Er sagte etwas, was ich nicht verstehen konnte. Er schaute zum Haus, sah mich genau an. Ich rührte mich nicht; ich wusste, dass er mich durch die Tüllgardine nicht sehen konnte, aber ich hatte das Gefühl, er sähe mich an.
Der Langhaarige lief am Anhänger des Lkws entlang. Er befühlte die Hintertür, versuchte sie zu öffnen.
»Kann nicht schaden, uns mal ein bisschen umzusehen«, rief das Muskelpaket und starrte unverwandt zum Wohnzimmerfenster. Vielleicht konnte er mich doch sehen? Endlich drehte er sich zu der gefesselten Frau um und zerrte an ihren Armen. Er rief dem Langhaarigen zu: »Ich schaue in dem Haus nach, schau du in das da!« Er deutete zu den Häusern auf der anderen Straßenseite.
»Okay«, sagte der andere.
Der Muskulöse kam auf unsere Haustür zu. Er trug einen großen, silberglänzenden Revolver an der Hüfte.
Die Frau im Jeep riss plötzlich fest am Überrollbügel. Ich konnte ihr Gesicht jetzt erkennen. Auf ihrer Wange klebte Blut und auch in ihrem Haar, über der Stirn.
Das Muskelpaket lachte. »Du kannst dich nicht losreißen.« Er blickte sie an, bis sie aufhörte, an ihren Fesseln zu zerren und nur noch leise Laute von sich gab, als sei sie sehr traurig. Der Mann kam die Eingangstreppe unseres Hauses hinauf. Er rüttelte an der Sicherheitstür. Der laute Krach erschreckte mich, aber ich blieb ganz still.
Unsere Pistole lag auf dem niedrigen Tisch in der Mitte des Wohnzimmers, zwischen den Sesseln von dem Fernseher. Ich nahm sie in die Hand und setzte mich wieder.
Der Muskelmann trat ans Wohnzimmerfenster, presste das Gesicht gegen die Scheibe und schützte die Augen mit einer Hand gegen die Sonne. Ich ließ mich vom Sessel rutschen und legte mich flach hin, so dass die Sofalehne zwischen uns war. Er konnte mich nicht sehen, auf keinen Fall, es war zu dunkel hier drin. Ausgestreckt blieb ich liegen, bis ich hörte, dass er wieder an der Gittertür rüttelte. Ich richtete mich auf. Ich sah, dass er den Revolver in der Hand hatte und auf das Schloss der Gittertür zielte. Der Schuss krachte sehr laut. Ich glaube, diesmal stieß ich einen leisen Schrei aus.
Die Kugel durchdrang die Holztür und schlug in die Wohnzimmerwand links von mir ein. Der Muskelprotz zerrte am Metallgitter. Es ließ sich nicht öffnen.
»Keine Sorge«, rief er dem Langhaarigen zu. »Ich schieße nur die Schlösser auf.« Dann schoss er wieder.
Ich umklammerte die Pistole. Ich rutschte zurück, bis ich mit dem Rücken am Wohnzimmersessel saß. Ich hob die Pistole. Wenn er hereinkam, würde ich auf ihn schießen müssen. Falls ich es fertigbrachte.
Er riss und zerrte an der Gittertür. Sie quietschte, als er sie öffnete. Er griff nach dem Knauf der Eingangstür und drehte ihn. Die Tür war abgeschlossen. Er zielte mit dem Revolver auch auf dieses Schloss. Ich versuchte, die Pistole auf die Tür zu richten. Aber mein Kopf sagte: Nein, das kannst du nicht.
Ich wollte keinen Menschen erschießen.
Ich ließ die Pistole wieder sinken.
Ich schloss die Augen. Sollte er doch hereinkommen. Sollte er mich auch an den Jeep fesseln, genau wie die Frau. Vielleicht sah er sich nicht weiter im Haus um. Vielleicht kam mein Vater mich später holen, wenn er nicht am Fieber starb.
Ich wartete auf den Schuss, die Augen geschlossen.
Ich fühlte eine Hand, die sich über meinen Mund legte. Ich erschrak, ich schrie, aber die Hand verschloss eisern meine Lippen.
Es war mein Vater. Er nahm mir die Pistole aus der Hand, legte den Mund an mein Ohr und flüsterte: »Leise!«
»Was ist?«, schrie der Muskelprotz vor der Tür und schaute hinüber auf die andere Straßenseite. Er ließ den silbernen Revolver sinken.
Der Langhaarige rief etwas, was wir nicht verstehen konnten.
»Nein, das ganze Haus ist abgeschlossen«, rief der Muskelprotz.
Mein Vater hob die Pistole, als wäre sie sehr schwer. Er zielte auf die Haustür. Ich spürte, wie er hinter mir am ganzen Leib zitterte und glühte. Ich fragte mich, ob mein Vater einen Mann genauso würde erschießen können wie die Hunde. Nach der Sache in Bultfontein hatte er gesagt: »Jemanden erschießen …«, dann hatte er nur den Kopf geschüttelt, als wäre er dazu nicht imstande.
Der Mann mit den dicken Muskeln drehte sich wieder zur Straße um. »Ja, ja … Nein, ich habe nicht …«, sagte er. Er beendete den Satz nicht, sondern hörte, was der Langhaarige erwiderte.
»Okay«, sagte der Muskelprotz und hob wieder den Revolver.
Er zerschoss das Schloss unserer Haustür. Es war furchtbar laut, und Holzsplitter und Putzstücke flogen umher.
Mein Vater richtete die Pistole auf die Tür, die Hand immer noch auf meinen Mund gelegt.
Doch der Muskelprotz drehte sich einfach um und ging weg, die Stufen hinunter zum Jeep. Der Langhaarige kam von der anderen Seite. Der Muskelprotz schlug die Frau gegen den Kopf. Sie stiegen in den Jeep, ließen den Motor an und fuhren weg.
Eine Weile lang blieben wir einfach so im Wohnzimmer liegen. Der Atem meines Vaters ging schnell. »Es tut mir leid, Nico, ich habe dich rufen gehört, aber ich dachte, es wäre ein Traum.« Er flüsterte. Er hatte mich gelehrt, dass Schall immer weiter trägt, als man glaubte. Vor allem jetzt, nach dem Fieber, weil es keine anderen Geräusche mehr gab.
»Du hast das sehr gut gemacht«, sagte er. »Du kannst stolz auf dich sein.«
Später standen wir auf. Er trank viel Wasser aus dem Hahn, und ich erhitzte die Suppe auf dem Gasherd. Baxters Hühnercremesuppe.
Wir aßen. Mein Vater sagte: »Wir können heute Abend kein Licht machen – wir wissen nicht, wie nah sie sind.«
»Wir können morgen früh auch keinen Kaffee trinken«, ergänzte ich. Denn Kaffeeduft ist ein Menschenverräter. Das hatte mein Vater mich auch gelehrt.
»Du hast recht.« Er versuchte zu lächeln, aber es schien, als würden seine Kräfte nicht ganz ausreichen.
Ich aß meine Suppe auf.
»Mir geht’s schon besser«, sagte mein Vater.
Er log, und er sah mir an, dass ich ihm nicht glaubte.
»Morgen wird es mir schon viel besser gehen«, versprach er.
»Prima«, sagte ich. »Die Typen hatten übrigens eine Frau am Jeep gefesselt.«
»Habe ich gesehen. Morgen unternehmen wir etwas dagegen.«
Ich lag die ganze Nacht neben ihm. Er redete viel im Schlaf. Zweimal rief er den Namen meiner Mutter: Amelia.
6
Die Vergangenheit ist ein Fluss
Mein Vater hat das gesagt: Die Vergangenheit ist ein Fluss. »Es war im Jahr des Schweins, wenn ich mich recht erinnere. Ich war siebzehn.«
Eines Sonntagabends hatten wir mit ein paar anderen noch bis zu später Stunde im Forum gesessen und uns unterhalten. Als mein Vater, Okkie und ich nach Hause gingen, fragte ich ihn, warum alle immer noch so oft über das Fieber redeten, es sei doch längst vorbei, schon seit fünf Jahren.
Da antwortete er: »Die Vergangenheit ist ein Fluss, Nico. Wir können uns nicht an alles Wasser erinnern, was vorbeigeflossen ist. Wenn wir zurückdenken, erinnern wir uns hauptsächlich an das Treibgut, diese einzelnen Bruchstücke, die die Stürme und die Fluten hoch oben an den Ufern zurückgelassen haben.«
»Keine Ahnung, was das schon wieder heißen soll«, erwiderte ich mürrisch. Das Verhältnis zwischen meinem Vater und mir war bereits zerrüttet, und als Teenager gingen mir die Erwachsenen ganz allgemein auf die Nerven.
»Wir erinnern uns am deutlichsten an die Augenblicke großer Verzweiflung. Angst, Verlust, Erniedrigung … Du wirst es verstehen, eines Tages.«
Jetzt verstehe ich es. Jetzt, während ich diese Memoiren zu Papier bringe, jetzt, wo ich alles wieder hervorrufen möchte, nicht nur die schmerzlichen Meilensteine. Auch die Ereignisse dazwischen. Aber es fällt mir nicht leicht. Ich habe eingangs Auden und Heinlein zitiert, weil sie ausdrücken, wo das Problem liegt: Gelangt man in die trüberen Wasser des Erinnerungsflusses, ist man auf seine eigenen, manchmal unzuverlässigen und subjektiv eingefärbten Erinnerungen sowie die Erzählungen anderer angewiesen. Hinzu kommen die Bedürfnisse und Ängste der eigenen Persönlichkeit, die nur gewisse Begebenheiten mit einbeziehen und andere lieber weglassen möchte.
Ich gebe es also unumwunden zu: Dies ist die Geschichte, die sich nach dem Fieber ereignet hat, so wie ich mich an sie erinnere. Meine Wahrheit. Subjektiv und wahrscheinlich leicht verzerrt. Und doch schulde ich allen, die Teil dieser Geschichte sind, größtmögliche Objektivität und Wahrhaftigkeit, vor allem jenen, die nicht hier sind, um selbst Zeugnis abzulegen.
Die Wahrheit ist meine größte und einzige Triebfeder. Das schwöre ich.
7
22. März
Ich schlief an der Seite meines Vaters. Als er frühmorgens erwachte, wusste er zunächst nicht, wo er war. Er wirkte abgekämpft; sein Haar war wirr, sein Blick unstet. Es dauerte einen Moment, ehe er mich erkannte. Er wirkte kleiner und schmächtiger; verwundbar, zerbrechlich und fehlbar in diesem ungeschützten Augenblick. Aber in dem Moment sah ich es noch nicht – vielleicht war ich noch nicht bereit dazu.
Ich kochte uns Haferbrei. Mein Vater aß im Bett. Dankbar. Er sagte: »Eines Tages gibt es wieder richtige Milch.«
Das sagte er oft.
Er fügte hinzu: »Bis morgen müsste ich wieder ganz gesund sein, Nico.«
»Und dann fahren wir weiter, Pa?«
Langsam schüttelte er den Kopf. »Nein. Wir bleiben hier.«
»Hier?«
»Na ja, nicht unbedingt in diesem Haus. Es gibt so viele, wir können uns eines aussuchen. Ich meine an diesem Ort, in diesem Dorf.«
»Und was ist mit den Männern?« Ich deutete zur Straße, dorthin, wo der Jeep gestanden hatte. Wir redeten noch immer gedämpft, als wären sie in der Nähe.
»Sie sind … eine Komplikation.«
»Eine Komplikation?«
»Ja. Interessantes Wort, übrigens. Es stammt aus dem Lateinischen. ›Complicare‹ …« Mein Vater holte ein paarmal Luft, als sammle er Kraft. »Das bedeutet zusammenfalten, verwickeln, verwirren.« Er bemühte sich, seine übliche Begeisterung aufzubringen: »Lustig, nicht wahr, wie Sprache funktioniert. Verkomplizieren bedeutet, etwas vielschichtiger …«
»Warum fahren wir nicht weiter und suchen uns etwas anderes?«
»Weil Vanderkloof für mich der beste Ort im ganzen Land ist. Für einen Neuanfang.«
»Wieso das denn?«
Mein Vater aß den letzten Rest von seinem Brei. »Maslow … die menschlichen Bedürfnisse … Hier finden wir alle Grundvoraussetzungen …« Er seufzte erschöpft. »Das ist eine lange Geschichte. Morgen erkläre ich es dir ausführlicher. Versprochen. Einverstanden?«
»Okay.«
Er reichte mir seinen leeren Breiteller und schüttelte Tabletten aus der kleinen Flasche. »Ich lege mich wieder hin. Vergiss nicht, dir die Zähne zu putzen.«
Mittags hörte ich meinen Vater reden. Ich ging ins Schlafzimmer und sah nach ihm. Er hatte alle Decken von sich abgeworfen, schwitzte, halluzinierte und stieß mit ängstlicher Stimme verwirrte Worte aus.
Dann wurde er wach. Er richtete sich sofort auf und drehte sich so, dass er nicht das Bett beschmutzte. Er übergab sich auf den Fußboden.
Ich half ihm beim Saubermachen. »Tut mir leid, Nico«, sagte er. »Tut mir leid, mein Junge.«
Abends machte ich Suppe warm, aber mein Vater verschlief das Essen.
Der Jeep kehrte nicht zurück.
Es war furchtbar heiß und stickig im Haus.
8
23. März
Als ich morgens erwachte, schlief mein Vater immer noch.
Ich aß Zwieback, trank Wasser, schaute aus den Fenstern hinaus, lauschte, konnte nicht stillsitzen, war zappelig und unruhig. Es war mehr als Langeweile, mehr als die unbestimmte Angst, die ich gestern gespürt hatte. Ich war dreizehn, ich konnte das alles noch nicht verarbeiten.
Ich stand am Wohnzimmerfenster. Plötzlich fing mein Herz an zu klopfen, meine Hände schwitzten, die Erde schien mich verschlingen zu wollen, die Luft war kaum zu atmen, der Tag lastete schwer auf mir, die Wände schienen näher zu rücken. Ich wusste nicht, was da vor sich ging, aber ich wollte meinen Vater nicht wecken, er musste unbedingt wieder gesund werden.
Ich legte mich in eines der anderen Zimmer. Der Raum schnurrte zusammen. Ich kniff die Augen zu. Die Hunde und alles, was an dem Abend geschehen war, machten mir zu schaffen. Dauernd spielten sich die Szenen wieder vor meinem inneren Auge ab. Die Scham, weil ich nach meiner Mutter gerufen hatte. Ich war dreizehn. Ich war groß! Die Hunde, Pas Fieber, die beiden Männer vorm Haus, die Schüsse auf unsere Tür, die gefesselte Frau, alles durchlebte ich erneut, die Bilder, die Gerüche, die Angst. Wie mein Vater vorgestern Morgen mit seinem schmerzenden Körper aus dem Lkw geklettert war: Er hatte ängstlich ausgesehen, zum ersten Mal, ich hatte es an seinen Blicken und an der Art gesehen, wie er widerstrebend die steifen, ekligen Kadaver angefasst hatte, als er die Hunde wegschleifte. Das Herz sprang mir fast aus der Brust, ich rang mühsam nach Atem, es war, als überwältigte mich das alles.
Am liebsten hätte ich laut geschrien. Ich war stinkwütend, auf die ganze Welt. Auf die Hunde, die uns töten wollten, einfach so. Ausgerechnet uns! Dabei hatten wir nach dem Fieber so viele Zäune von Wildfarmen und -parks durchgeschnitten und alle Tiergehege im Zoo von Bloemfontein geöffnet. Wir waren Tierfreunde – warum wollten die Hunde uns töten? Die Wut loderte in mir, eine unbändige Wut. Auf alles, auf das Fieber, das meine gesamte Existenz vernichtet hatte. Ich ballte die Fäuste, wünschte, ich hätte jemanden anschreien können wegen dieser Ungerechtigkeit, und gleichzeitig wurde das Zimmer, die Welt, ja, das ganze Universum immer enger und schwerer, der Druck immer größer und größer.
»Nico!«
Plötzlich war mein Vater da, und der Druck löste sich.
Ich sah ihn an. Er setzte sich neben mich. »Du hast geschrien. Ich glaube, du stehst unter Schock.«
Mein ganzer Körper war angespannt, geladen wie ein Gewehr.
»Ich bin da«, sagte mein Vater.
Ich konnte nichts hervorbringen.
»Ich habe kein Fieber mehr«, sagte mein Vater.
9
24. März
In den frühen Morgenstunden regnete es, es donnerte und blitzte, die Tropfen prasselten auf das Wellblechdach des Hauses.
Die Luft war feucht und drückend, und genauso sah es auch in mir aus, denn die Wut und die Angst waren nicht verschwunden, sondern verbargen sich nur irgendwo in meinem Hinterkopf.
Pa meinte, bei Regen könnten wir gefahrlos Kaffee kochen, weil der Geruch nicht weit tragen würde. Die Fenster mussten wir aber weiterhin geschlossen halten. Wir tranken unseren Kaffee in der Küche. Mein Vater erzählte mir von Abraham Maslow und seiner Theorie über die Hierarchie der menschlichen Bedürfnisse. Mein Vater sprach niemals von oben herab mit mir. Er erklärte mir alles ganz genau; wenn ich etwas nicht verstand, erwartete er, dass ich nachfragte. (Jahre später wurde mir klar, dass er damals bei den physiologischen Bedürfnissen den Sex weggelassen hatte. Ich bin ihm nicht böse.) Er sagte, Vanderkloof sei von der Lage her ideal; es biete so viel Wasser, wie wir nur brauchten, und gute Bedingungen für die wichtigsten Arten der Landwirtschaft. Das Klima sei gemäßigt, die Felder könnten leicht bewässert werden, und mit Hilfe des Wassers würden wir auch Strom gewinnen können, wenn wir erst die richtigen Leute mit den entsprechenden Kenntnissen gefunden hätten, um das bestehende System zu modifizieren und zu unterhalten.
Er wusste genau, welche Frage mir auf der Zunge lag. Er sagte, natürlich gebe es andere Orte, andere Dämme und Flüsse, die mehr oder weniger dasselbe böten. Aber er kenne sich hier eben gut aus; er sei vor ein paar Jahren schon einmal hier gewesen. Daher wisse er eines: Vanderkloof sei einzigartig, was das Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit angehe. Vanderkloof sei eine Festung, eine Burg, ein natürliches Fort, dank der Hügel mit ihren steilen Felsen und dem Damm. Nur eine einzige befestigte Straße führe den steilen Hügel hinauf, und es gebe nur eine Flanke zu verteidigen, es sei denn, der Feind rücke mit einer Schiffsflotte an – was jedoch ziemlich unwahrscheinlich sei auf dem Oranjefluss, fügte mein Vater hinzu und lachte. Da merkte ich, dass er sich noch nicht ganz von dem Fieber erholt hatte. Sein Lachen klang hohl. Es war, als sei ein Teil von ihm nicht zurückgekehrt.
»Und was ist mit den beiden Typen im Jeep? Wenn die hier irgendwo in der Nähe sind?«
»Stimmt. Die Komplikation … Dazu lasse ich mir noch etwas einfallen.«
Die Schwüle bedrückte mich und weckte ungute Vorahnungen. »Ich finde, wir sollten weiterfahren, Pa.«
Doch mein Vater hörte nicht auf mich.
»Die fahren nicht mit ihrem offenen Jeep herum, solange es regnet«, meinte mein Vater. »Komm, holen wir das Arsenal.«
Vor der Tür hielten wir zunächst gründlich Augen und Ohren offen, bevor wir zum Volvo hinüberrannten, um unsere Waffen und die Pflegemittel dafür zu holen. Wir nannten das unser »Arsenal«, nachdem mir mein Vater erklärt hatte, woher dieses Wort stammte – von dem arabischen Wort für »Lagerhaus« über das venezianische Italienisch zum Englischen und endlich bis zum Afrikaans.
Wir legten unsere Pistolen und die beiden Jagdbüchsen auf die Küchenanrichte. Ich wischte die Regentropfen vom dunkelgrauen Stahl. Wir setzen uns nebeneinander, reinigten die Waffen eine nach der anderen und ölten sie.
»Wir können uns heute Abend mal umsehen, wenn es dunkel geworden ist«, schlug mein Vater vor. »Vielleicht sehen wir irgendwo Licht. Dann wissen wir, wie sicher sie sich fühlen und wie weit sie entfernt sind.«
Ich fragte mich, warum ich noch nicht daran gedacht hatte.
»Und dann spionieren wir sie ein bisschen aus.« Nach kurzem Nachdenken fügte er hinzu: »Es könnten mehr als nur die beiden Männer und die Frau sein.«
»Was machen wir dann?«
»Dann fahren wir doch lieber erst mal weiter. Das Risiko, dass …«
»Wieso fahren wir nicht gleich, Pa? Jetzt sofort? Heute Abend?«
Mein Vater schwieg so lange, dass ich mir nicht sicher war, ob er meine Frage gehört hatte. Dann sagte er: »Ich möchte hier mit dir zusammen einen Neuanfang machen. Eine Gemeinschaft gründen, die moralisch handelt, ethische Grundsätze hat, in der Mitmenschlichkeit herrscht. Und daran müssen wir uns von Anfang an halten. Wir können die Frau nicht einfach so ihrem Schicksal überlassen. Wenn die Männer nur zu zweit sind, müssen wir zumindest versuchen, sie zu befreien. Auch wenn wir bisher auch nur zu zweit sind.«
Es war das erste Mal, dass mein Vater davon sprach, eine Gemeinschaft zu gründen. Ich war in dem Moment mit den Gedanken woanders, so dass ich dem keine Bedeutung beimaß. Erst viel später wurde mir klar, dass er zu dem Zeitpunkt bereits alles durchdacht hatte. Er hatte eine Vision gehabt, schon vor dem Zwischenfall mit den Hunden, schon vor unserer Ankunft in Vanderkloof.
Gegen vier Uhr nachmittags hörte es auf zu regnen. »Schade«, meinte mein Vater. »Die Regen hätte uns genützt.«
Als es Abend wurde, behandelte mein Vater die Bisswunden mit Salbe und verband sie. Er nahm Schmerzmittel. Dann schmierte er uns zur Tarnung schwarze Striche ins Gesicht, mit Schuhcreme aus dem Küchenschrank. Wir zogen dunkle Kleidung an und luden jeder eine Beretta und ein Gewehr: ich die Tikka.222 mit dem langen Zielfernrohr und er die .300 CZ.
»Leute, die eine Frau so behandeln, sind … gefährlich. Wir schauen uns nur um, Nico, sonst nichts.«
»Okay«, sagte ich und hoffte, dass mein Vater meine Erleichterung nicht heraushörte. Ich hatte einfach so ein ungutes Gefühl, spürte, dass Unheil in der Luft lag.
Um zehn war es stockdunkel; der Mond war noch nicht aufgegangen. Wir ließen die Waffen in der Küche liegen und kletterten von der hinteren Terrasse aus auf das Wellblechdach unseres Hauses. Wir sahen sie sofort. Ihr Unterschlupf lag hoch oben am Hügel, etwa drei Kilometer entfernt. Sie mussten einen starken Generator besitzen, denn einen so hellen Schein warf nur elektrisches Licht. Es war ein großes Haus mit drei Stockwerken.
»Völlig ahnungslos«, flüsterte mein Vater, leise, obwohl sie viel zu weit weg waren, um ihn zu hören.
Zurück in der Küche fragte er: »Und du hast keine anderen Fahrzeuge gehört, als ich krank war?«
»Nein, Pa.«
Er war tief in Gedanken, als er mir die Pistole und die Büchse reichte. Auf dem Weg zur Tür murmelte er vor sich hin: »Können die wirklich so unvorsichtig sein?« Ich wusste, dass die Frage nicht an mich gerichtet war.
Unterwegs erhielt er die Antwort.
Vanderkloof im Jahr des Hundes war ein ungeordnetes Dorf, noch genauso, wie es vor dem Fieber gewesen war – wie eine lockere, etwas löchrige Flickendecke über die Hügel geworfen. Nur eine Straße führte zum höchstgelegenen Wohngebiet und dem Lichterschloss der Jeepleute. Wir schlichen leise und vorsichtig durch die Dunkelheit, ich etwa einen halben Schritt links hinter meinem Vater. Unsere Sportschuhe machten kein Geräusch auf dem Asphalt, und ich konnte meinen Vater atmen hören. Zuerst verirrten wir uns, mussten umkehren. Dann fanden wir die richtige Straße.
»Nico!«, sagte mein Vater leise, aber eindringlich. Ich erschrak. Mit ausgestrecktem Arm hielt er mich zurück. Ich sah nichts.
»Hier ist ein Draht gespannt«, flüsterte er.
Er fuhr mit einem Finger durch die Luft, um mir den Draht zu zeigen. Ich musste näher herangehen und genau hinsehen, ehe ich ihn im Licht des Hauses schimmern sah, das noch über einen Kilometer entfernt lag. Die Schnur war nur wenig höher als mein Kopf.
»Na so was«, sagte mein Vater, »sieht aus wie Angelschnur.«
»Und die hast du gesehen?«
»Ja, ich habe mir überlegt, was ich an ihrer Stelle tun würde, um mich zu verteidigen – wenn ich ein Haus erleuchtet hätte wie eine Kerze, die automatisch Motten anlockt.«
»Wow«, sagte ich voller Bewunderung. »Aber wie soll eine Angelschnur jemanden aufhalten?«
»Komm mit«, sagte mein Vater und bedeutete mir, ihm zu folgen. Er ging an der Angelschnur entlang, bis sie über die Leitplanke neben der Straße hinwegführte.
»Schau mal.« Ich sah, dass die Schnur an etwas befestigt war.
Mein Vater legte seinen Mund dicht an mein Ohr. »Das ist eine Signalrakete. Wenn man die Angelschnur berührt, schießt sie in die Luft, und dann wissen sie, dass jemand kommt.«
Er zeigte mir alles genau. »Diese Kerle … Wir müssen sehr vorsichtig sein. Pass gut auf, wenn du unter der Schnur durchkriechst.«
Wir gingen weiter, wesentlich langsamer. Ich versuchte jetzt auch wachsam zu sein und fragte mich, wie die Jeepleute es anstellten, wenn sie nach Hause fuhren. Hoben sie dann die Angelschnur hoch?
Mein Vater entdeckte die nächste und dann noch eine, nur eine Straße von ihrem Haus entfernt, etwa zweihundert Meter. Sie war tief gespannt, unterhalb meiner Knie. Wieder hielt er mich mit der Hand auf, deutete hin, sagte nichts. Ich sah ein paar Regentropfen an der Angelschnur hängen. Dadurch hatte mein Vater sie entdeckt. Ich hatte nicht nach unten geschaut, ich hatte gedacht, alle Signalraketen-Schnüre seien hoch gespannt worden.
Wir stiegen darüber. Gingen drei, vier Schritte. Mein Vater blieb stehen und hob die Hand. Er schaute zum Haus des Lichts vor dem Felsen, das so hell erstrahlte. Es wirkte fröhlich, einladend. Aber es war keine Bewegung zu sehen, kein menschlicher Laut zu hören, kein Lebenszeichen.
Mein Vater zog das Gewehr von der Schulter und nahm es in die Hände. Er ging nicht weiter, sondern starrte unverwandt das Haus der Jeepleute an. Dann blickte er nach links, zu der Reihe kleinerer, dunkler Häuser, die sich dort aneinanderreihten. Und dann nach rechts, wo nur offenes Veld lag.
Irgendetwas beunruhigte ihn.
Ein Schakal heulte auf, ganz in der Nähe, auf einem der Hügel.
Ich wäre am liebsten umgekehrt. Ich wollte nichts lieber, als zum Volvo zurückzukehren und wegzufahren. Dieses Drückende, die Schwüle, die Geschehnisse von gestern rumorten tief in mir wie ein Ungeheuer in dunklem Wasser.
Auch ich nahm das Gewehr von der Schulter.
Mein Vater bückte sich ein wenig, als wolle er sich kleiner machen. Er ging weiter, noch langsamer. Für einen Moment richtete er sich auf. Es waren noch hundertfünfzig Meter bis zum Lichthaus. Eine Eule rief im Feld und übertönte das leise Rascheln und Zirpen der Insekten.
Wir wollten sie doch nur ausspionieren, warum ging er dann immer weiter?
Als wir noch knapp hundert Meter vom Haus entfernt waren, schoss plötzlich ein Kaphase aus den Sträuchern links von uns hervor. Ich schnappte vor Schreck nach Luft. Viel zu laut. Mein Vater erstarrte und blickte sich langsam zu mir um. Ich wollte mich entschuldigen, aber er drückte mir nur beruhigend die Schulter.
Er drehte sich zu mir um, flüsterte mir ins Ohr: »Siehst du den Felsen?«, und zeigte nach rechts. Ein Felsblock so groß wie ein Kühlschrank war den Hang hinuntergerollt und lag auf dem Bürgersteig.
Ich nickte.
»Warte dort. Ich gehe noch ein kleines Stück weiter.«
Als ich zögerte, sagte er: »Nur so weit, dass du mich die ganze Zeit siehst.«
Ich nickte.
Er wartete. Ich ging zu dem Felsen und achtete dabei genau darauf, wo ich meine Füße hinsetzte. Der Steinblock reichte mir bis zur Brust. Ich legte mein Gewehr darauf, so dass ich durch das Zielfernrohr schauen konnte, wenn es nötig war. Dann lehnte ich mich gegen den Stein. Er war kalt.
Mein Vater ging einen Schritt weiter. Blieb stehen. Noch einen Schritt. Stehenbleiben. Schritt. Stehenbleiben. Der Lichtschein des Hauses fiel bis hierher. Ich konnte meinen Vater gut erkennen, ein wenig gebeugt, das Haar lang und wirr.
Er ging wieder einen Schritt, blieb stehen, lauschte und blickte sich um. Schritt nach vorn, Stehenbleiben, Lauschen, Umsehen. Weiter und weiter nach vorn, weg von mir. Warum so langsam und vorsichtig? Es gab keine Bewegung, keine Geräusche, nichts, nur das hell erleuchtete Fort vor uns. Eine Angelschnur würde er leicht erkennen können, so nah am Licht. Vielleicht waren die Jeepleute und die geprügelte Frau schon lange weg, vielleicht hatten sie vergessen, das Licht abzuschalten, vielleicht waren die Leuchtraketen nur ein Scherz, ein Witz. Eine Ewigkeit, die Zeit blieb stehen, mein Vater war schon mehr als zehn Schritte entfernt, dann fünfzehn, dann zwanzig. Ich sah seinen Rücken, immer kleiner. Wir wollten sie doch nur auskundschaften, Pa, wir haben genug gesehen, die Frau ist nicht mehr hier, komm, wir kehren um, lass uns fahren. Fünfundzwanzig Schritte, mein Vater war weit weg, nah am Licht, er sah klein aus.
Ich wollte meinen Vater nicht so sehen, ich wollte nicht hier sein, etwas fraß mich von innen auf.
»Hi«, sagt eine Stimme, beinahe überrascht. Mein Vater erschrak und drehte sich nach links. Ich sah den Mann dort stehen. Es war der Muskelprotz. Er hielt den großen Revolver in der Hand und hob ihn an.
Mein Vater zielte mit der Büchse auf ihn, doch er schoss nicht.
Der Muskelprotz hob den Revolver höher.
Mein Vater schoss nicht.
Ein Schuss krachte mit vielfachem Echo, mein Vater stürzte zu Boden.
10
Mein Vater fiel. Die Erde hörte auf, sich zu drehen.
Ich zitterte am ganzen Körper. Das Echo des Schusses aus dem schweren Revolver hallte über mich und den Felsen hinweg, es löste den Druck in meinem Kopf, und ich wusste im selben Moment, was gestern mit mir los gewesen war, was die Angst und die Wut ausgelöst hatte. Ich war nicht böse auf die Hunde und ihren Verrat gewesen, ich hatte mich nicht geschämt, weil ich meine Mutter gerufen hatte. Ich war wütend auf meinen Vater gewesen, stinksauer, weil er an der Tankstelle so klein, so ängstlich und so verloren gewirkt hatte, als ihn die Hunde knurrend umkreisten. Ich war wütend, weil er mich gebraucht hatte, weil ich ihm in diesem Augenblick helfen musste, und ich war noch nicht bereit dafür gewesen. Ich war wütend, weil er sich in meinen Augen verändert hatte, als er am Morgen nach dem Zusammenstoß mit den Hunden hinkend und gebückt aus dem Führerhaus des Volvos geklettert war, die .300 CZ über der Schulter und die Beretta in der Hand. Vorsichtig den Hundeleichen ausweichend, war er durch sie hindurchgegangen, mit kleinen Schritten, steif und voller Schmerzen nach dem Angriff und der schlechten Nacht. Ich sah etwas, von oben aus dem Truck, was ich nicht sehen wollte.
Mein Vater war kleiner geworden. Er war geschrumpft.