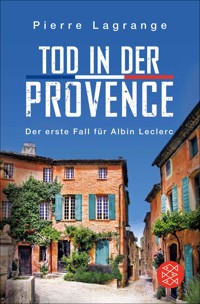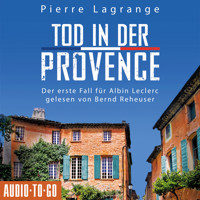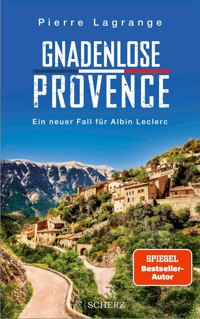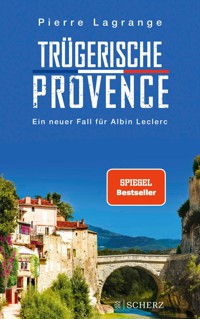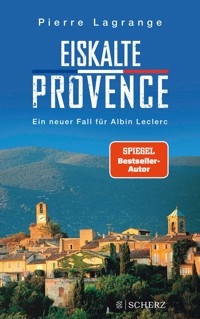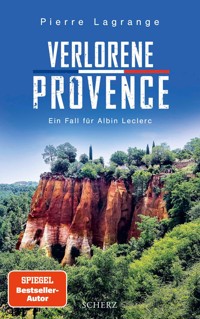12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Commissaire Leclerc
- Sprache: Deutsch
Das Wandern ist des Mörders Lust … Der elfte Band der Provence-Krimi-Reihe von Bestseller-Autor Pierre Lagrange Herbst in der Provence: Ein trüber, verregneter November – und mitten im Lac du Paty wird ein toter Wanderer gefunden. Die Polizei-Capitaines Caterine Castel und Alain Theroux ermitteln. Das Opfer war ein bekannter Immobilienmogul. Haben seine dubiosen Geschäfte mit seinem Tod zu tun? Doch dann landet ein Hinweis im Briefkasten von Ex-Commissaire Albin Leclerc. Anscheinend steckt ein Serientäter dahinter, der sich Finsternis nennt und seit Jahren unentdeckt ein grausiges Spiel treibt. Und dieser Täter fordert Albin heraus, ihn zu fassen. Der Preis: die Familie Leclerc. Es geht um Leben und Tod, und Albin zerrinnt die Zeit zwischen den Fingern …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Pierre Lagrange
Finstere Provence
Der elfte Fall für Albin Leclerc
Über dieses Buch
Ein toter Wanderer im Stausee Lac du Paty. Schnell wird klar, dass es sich um Mord handelt. Das Opfer war ein bekannter Immobilienmogul mit einem Hang zu dubiosen Geschäften. Bald darauf trudelt bei Ex-Commissaire Albin Leclerc ein Brief ein, unterzeichnet von „Tènèbres“ (Finsternis), einem Serienmörder, der seit Jahren unentdeckt ein grausiges Spiel treibt. Und er fordert Albin heraus, ihn zu fassen. Der Preis: die Familie Leclerc.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Pierre Lagrange ist das Pseudonym eines bekannten deutschen Autors, der bereits zahlreiche Krimis und Thriller veröffentlicht hat. In der Gegend von Avignon führte seine Mutter ein kleines Hotel auf einem alten Landgut, das berühmt für seine provenzalische Küche war. Vor dieser malerischen Kulisse lässt der Autor seinen liebenswerten Commissaire Albin Leclerc gemeinsam mit seinem Mops Tyson ermitteln.
Inhalt
PROLOG
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
PROLOG
Ténèbres, die Finsternis, beobachtete Albin Leclerc im Licht einer Straßenlaterne. Das fast weiße Haar war unverkennbar. Er drehte seine allabendliche Runde mit dem Mops. Das Gespann wirkte ungewöhnlich – der große Mann und ein so kleiner Hund. Auf gewisse Weise war es sogar sympathisch.
Ténèbres verfolgte die Karriere von Leclerc bereits seit einigen Jahren. Na ja, was hieß Karriere? Seine Laufbahn. Seine Fälle. Zu seiner aktiven Zeit bei der Polizei war er bereits sehr erfolgreich gewesen, wenngleich ihm stets der Ruf des Unkonventionellen angehaftet hatte. Vermutlich deswegen hatte er es nie in eine leitende Funktion gebracht. Im Ruhestand war er weiter aktiv, tauchte immer wieder auch namentlich bei der Lösung einer Reihe von aufsehenerregenden Mordfällen auf.
Er war wie …
Ja, er war wie Ténèbres und konnte es einfach nicht lassen. Wie Ténèbres, die Finsternis. Der selbst verliehene Spitzname hatte einen guten Klang und passte. Denn alles im Universum hatte seine zwei Seiten. Hell und dunkel. Gut und böse. Arm und reich. Mann und Frau. Hoch und tief. Heiß und kalt. Leben und Tod. Dazwischen gab es einige Mischzustände. Menschen pendelten mal mehr in die eine, dann wieder in die andere Richtung. Aber irgendwann musste man sich für eine Seite entscheiden, und wenn tief im Herzen und in der Seele Dunkelheit herrschte, dann sollte man dem Abgrund in sich selbst aufgeschlossen gegenüberstehen.
So war auch Leclerc. Der war von der Dunkelheit fasziniert. Er hatte von der Finsternis gekostet und konnte nicht von ihr lassen. Wie anders war es zu erklären, dass er nach wie vor mit an Kriminalfällen arbeitete? Er war besessen davon und nahm natürlich an, dass er der Menschheit damit etwas Gutes tat. Das stimmte nicht zwangsläufig, und im Kern wollte er doch nichts anderes, als Licht ins Dunkel seiner selbst bringen – und er musste sehr genau wissen, wie anziehend die Finsternis war, wie verlockend. Was im Hellen lag, barg kaum Geheimnisse. Das Dunkel jedoch, das Verbotene …
Keine Frage: Leclerc war der Finsternis erlegen und süchtig danach, mochte es sich selbst gegenüber aber nicht zugeben und lag damit eine Evolutionsstufe hinter Ténèbres. Und wie Ténèbres hatte Leclerc böse Dinge getan. Schlimme, ungesühnte Dinge, die unter der Oberfläche brodelten wie klebriger Teer. Doch auch hier galt: Ténèbres war mit sich im Reinen, was das anging.
Ténèbres verfolgte durch die Windschutzscheibe, wie Leclerc sich langsam vorwärtsbewegte. Er kickte etwas vor sich her, vielleicht ein kleines Steinchen. Gelegentlich stieß er vom Rauchen eine weiße Wolke von sich.
Sie beide, dachte Ténèbres, waren Raubtiere. Man sah es weder Ténèbres noch Leclerc an, so wenig wie ihre gemeinsame Sucht nach der Finsternis, aber sie waren Prädatoren, die ihre Opfer zu Tode hetzten, gnadenlos. Sie waren Raubtiere, die andere Raubtiere jagten.
Sie hatten sehr viel gemeinsam. Und deswegen hatte sich Ténèbres Leclerc ausgesucht und seine schwächste Stelle ausgemacht, um näher an ihn heranzukommen.
Seine Achillesferse war die Tochter Manon. Wie erregend war es gewesen, Manon Leclerc kennenzulernen? Seine Tochter. Sein Fleisch und Blut. Und das zunächst rein zufällig und komplett ungeplant. Überwältigend und verwirrend zugleich. Doch am Ende war sie nur Mittel zum Zweck und würde allenfalls ein Kollateralschaden sein – je nachdem, wie sich alles entwickeln würde und zu welchen Mitteln Ténèbres greifen müsste.
Am Ende ging es ausschließlich um Ténèbres selbst und um Leclerc: den besten Mann, den die Polizei zu bieten hatte. Nur der beste Mann wäre in der Lage, sich mit Ténèbres zu messen und zu begreifen, wie genial, großartig und erfolgreich dieses Raubtier bislang im Verborgenen, in der Dunkelheit, gewesen ist.
Denn es war noch niemandem bei der Polizei aufgefallen, dass es jemanden wie Ténèbres überhaupt gab. Sie war zu dumm gewesen, um auf Ténèbres zu stoßen, und Ténèbres zu gewieft für die Polizei, die offensichtlich nach wie vor annahm, dass es sich bei den in den vergangenen Jahren verschwundenen Menschen lediglich um vermisste Personen handelte, die wieder auftauchen würden, sich ins Ausland abgesetzt oder Selbstmord an einem versteckten Ort begangen hatten.
Einige hatten tatsächlich Selbstmord begangen. Aber nur deswegen, weil Ténèbres es ihnen vorgeschlagen hatte, um dem zu entgehen, was ansonsten mit ihnen geschehen würde. Es war hochgradig erregend gewesen zu erleben, wie Worte wirken konnten – dass sich Menschen allein aus Angst vor einer Drohung umbrachten. Faszinierend.
Nicht, dass das Töten inzwischen langweilig geworden wäre. Nein, das Töten hatte ja einen Zweck. Es war ein Muss. Wie bei einem Job – und jede Arbeit sollte schließlich auch Spaß machen, oder? Und was das anging, war der pure und nötige Akt des Tötens wiederum gar nicht so wichtig. Es ging mehr um das Spiel, die Vor- und Nachbereitung.
Dennoch hatte sich eine gewisse Routine eingeschlichen. Ténèbres war einfach zu gut in dem Job. Und wenn man so ganz allein mit der eigenen Größe war und niemand sie würdigte, war das natürlich schade. Es war doch so, dass jeder Künstler den Applaus liebte und brauchte.
Für Ténèbres hatte noch niemand jemals geklatscht. Aber das würde sich ändern. Ténèbres würde einige Spuren legen, um Leclerc auf die Fährte zu bringen – und dann würde das große Spiel beginnen.
Bald.
Wie aufregend, dachte Ténèbres, wartete noch, bis Leclerc hinter der nächsten Straßenecke in der Finsternis verschwand, und trat dann aufs Gaspedal. Die Heckleuchten des Autos glühten wie rote Augen, bevor sie mit der Dunkelheit verschmolzen.
1
Olivier Poinas blickte an diesem trüben Morgen von der Staumauer aus auf den See und wusste instinktiv, dass etwas nicht in Ordnung war. Schwer zu sagen, was. Aber er hatte ein ungutes Gefühl. Die Art von Vorahnung, über die Tiere verfügten, wenn Gefahr drohte oder ein Unwetter aufzog.
Dabei sollte das Wetter stabil bleiben. Bewölkt und kühl wie so oft in diesen späten Oktobertagen, aber nicht stürmisch.
Er zog einen Schokoriegel aus der Jackentasche mit dem Aufdruck der regionalen Forstverwaltung und ließ den Blick über den Lac du Paty schweifen, musterte den grauen Beton des Stauwehrs und schätzte den Wasserstand ab. Er war deutlich gestiegen seit den starken Regenfällen der vergangenen Tage und sehr viel höher als im heißen Sommer, in dem die Provence nach Wasser nur so gelechzt hatte. Später war es in solchen Massen vom Himmel gefallen, dass die ausgetrockneten Böden es nicht aufnehmen konnten. Überschwemmungen waren die Folge gewesen. Kleine Bäche waren zu reißenden Strömen geworden und hatten immense Sachschäden verursacht.
Poinas öffnete die Verpackung des Schokoriegels und sah sich weiter um. Eben hatte er das Ufer des kleinen Stausees oberhalb von Caromb inspiziert, das im Sommer von vielen Besuchern in Badehosen und Bikinis frequentiert wurde, hatte einige Bäume auf Standfestigkeit nach dem letzten Herbststurm überprüft, dem ersten heftigen dieser Saison. Er hatte keine bedenklichen Schäden festgestellt. Die Wälder waren starken Wind gewohnt, denn der Mistral blies regelmäßig in dieser Region.
Was die Wälder allerdings nicht gewohnt waren, war die schlimmer werdende Trockenheit in den Sommern. Sie war eine Folge des Klimawandels, und es gab immer mehr Schädlingsbefall an den Bäumen, der zusammen mit den brüchigen Böden die Festigkeit des Wurzelwerks beeinträchtigte. Außerdem kam es immer häufiger zu Bränden. Dabei reichte nur eine einzelne Scherbe aus, um den ersten vernichtenden Funken zu setzen. Allerdings war in diesem Sommer das Vaucluse zum Glück verschont geblieben.
Alles in allem war es also ein Routinegang, doch bereits beim Umrunden des Sees hatte Poinas dieses komische Gefühl gehabt. Eigentlich schon auf dem mit Laub bedeckten Parkplatz unter den Platanen, wo er vorhin den Geländewagen der Forstverwaltung abgestellt hatte. Und damit war es nicht besser geworden, seit er auf der Staumauer stand. Irgendetwas war nicht in Ordnung. Irgendetwas …
Er biss ein Stück Schokoriegel ab, kaute und drehte sich herum, blickte die Staumauer hinab und suchte nach etwas Unbestimmtem. Nach etwas, das nicht hierher gehörte oder das nicht in Ordnung war.
Aber ihm fiel nichts weiter auf. Außer, dass der Wind hier ziemlich pfiff, weswegen er den Reißverschluss der Jacke zuzog. Ungemütlich, dachte er, aß den Riegel auf und stopfte die Verpackung in die Tasche. Schließlich wandte er sich wieder um zum See, blickte ein letztes Mal über das heute braungrün und unwirtlich wirkende, sich kräuselnde Wasser und ging dann zurück.
Doch nach einigen Schritten blieb er stehen. Er drehte sich noch einmal um.
Direkt an der Staumauer, etwa drei Meter unterhalb der Stelle, wo er eben gestanden hatte, war ein dunkler Fleck zu erkennen, den er von seinem vorherigen Standort aus nicht hatte sehen können. Als ob etwas Großes unter der Oberfläche schwamm. Hatte irgendein Idiot dort etwas hineingeworfen, das der leichte Seegang nun hochgeschwemmt hatte? Oder war es ein verendetes Tier? Ein Reh?
Poinas runzelte die Stirn und ging wieder zurück, ließ die Stelle dabei nicht aus den Augen. Je näher er kam, desto sicherer war er, dass es sich um Stoff handelte, so wie sich das Material im Wasser direkt an der Mauer bewegte. Vielleicht eine Jacke, die der Wind in der Nacht herübergeweht hatte. Etwas, das ein Tourist oder Wanderer vergessen oder verloren hatte. Oder ein Müllsack? In dem trüben grünlichen Wasser war es schwer zu erkennen.
Was auch immer, dachte Poinas – jedenfalls konnte man das nicht einfach im See lassen. Es war einerseits eine Verschmutzung und konnte andererseits einen Abfluss verstopfen. Allerdings würde er den Fremdkörper nicht einfach so erreichen können.
Also ging er zum anderen Ende der Staumauer, ließ die dortige Absperrung hinter sich und ging einige Schritte in Richtung des Pinienwalds oberhalb der Felsen. Er sah sich um und fand einen brauchbaren Ast am Boden, der lang genug sein sollte und außerdem nicht allzu schwer war.
Er packte ihn, zog ihn hinter sich her, ging zurück auf das Wehr und nutzte das Stück Holz dann wie eine Angel, um den Fremdkörper aus dem See zu fischen, damit er keinen Schaden anrichtete.
Er schaffte es weder beim ersten noch beim zweiten Mal. Poinas gelang es lediglich, den Fremdkörper anzustoßen – und er merkte dabei, dass es nicht nur eine einzelne Plastiktüte oder ein Stück Stoff war, sondern etwas Schwereres. Schließlich verhakte sich ein fingerdicker Zweig des Astes darin. Poinas zog kräftig – und dann bewegte sich die Masse am anderen Ende.
Und Poinas verstand, dass es tatsächlich kein Müllbeutel war.
Vielmehr handelte es sich um einen Menschen, der in einer aufgeblähten Windjacke steckte und dessen Gesicht nun aus dem Wasser auftauchte.
Poinas schrie auf und ließ den Ast fallen. Um ein Haar wäre er von der Staumauer in die Tiefe gestürzt. Zum Glück fing er sich wieder.
Denn ansonsten hätte es an diesem Herbstmorgen womöglich gleich zwei Leichen am Lac du Paty gegeben.
2
Castel stand neben dem Auto und zog ihren Fleecehoodie über, während Theroux bereits losgegangen war. Er trug lediglich ein Hemd und die obligatorischen Jeans mit eingearbeiteten Löchern. Die kühle Luft schien ihm nichts auszumachen. Er gehörte zu der Sorte Mensch, denen immer warm war – im Winter wie im Sommer.
Castel nicht. Sie fror schnell, insbesondere an den Füßen, weswegen sie bereits heute ein Paar gefütterte Schnürboots trug, in denen ihre khakifarbene Cargohose steckte.
Die Fleecejacke war am rechten Ärmel mit kleinen weißen Punkten besprenkelt. Das gehörte nicht zum Design. Es war Wandfarbe vom Streichen. Cat und ihr Lebensgefährte Jean hatten endlich eine gemeinsame Wohnung gefunden und gerade mit dem Renovieren begonnen – ein Prozess, der sich vermutlich noch über einige Zeit hinziehen würde. Die Wohnung war groß, Altbau, hohe Räume, und lag am Rand von Carpentras in der Nähe der Autobahn – strategisch günstig für Jean, der in Aix-en-Provence als Kurator im Musée Granet arbeitete.
Mittelfristig wollte er den Job nun kündigen und als Kunsthistoriker, Gutachter und Kurator freiberuflich arbeiten, weil die tägliche Anfahrt nach Aix einfach zu weit war. Zwar hatte er dort noch eine Wohnung, doch die würde er aufgeben und künftig von zu Hause aus in Teilzeit für das Museum tätig sein und außerdem andere Aufträge annehmen. Dazu brauchte er jedoch ein Homeoffice, und die neue Wohnung war zwar groß, hatte aber nur wenige Räume, weswegen sie zwei Wände neu eingezogen hatten, damit Jean sich in einem abgetrennten Bereich einrichten konnte.
Das war viel Arbeit, und seit sicherlich zwei Wochen hatte Cat schmerzende Muskeln an Stellen ihres Körpers, an denen sie bislang noch nie Muskeln vermutet hätte – eine verzichtbare, jedoch aktuell kaum vermeidbare Erfahrung.
Cat streckte sich, sah sich um. Der kleine Parkplatz neben dem Freizeitbereich mit Kiosk am Lac du Paty war mit einigen Fahrzeugen zugeparkt. Zwei Streifenwagen, ein Rettungsfahrzeug, der Notarzt, die Autos der Spurensicherung und die der Rechtsmedizin, ein Jeep der Forstverwaltung, ein Feuerwehrauto und der SUV des Wehrführers. Das Areal mit den Picknicktischen aus Holz unter den Platanen war verwaist und voller Laub, ebenso die Tanzfläche der überschaubaren Bühne mit der Aufschrift »Les Amis de l’Écluse«.
Cat fasste sich in den Nacken, massierte im Gehen die Muskulatur und ging in Richtung der Staumauer. In deren Nähe gab es eine Art Strand, der im Sommer von Badenden und Familien frequentiert wurde, die manchmal auch mit bunten Schlauchbooten auf dem Wasser fuhren. Heute jedoch war dort nur ein graues Boot mit der Aufschrift der Feuerwehr zu sehen. Auf der Mauer und am Strand arbeiteten die Forensiker der Spurensicherung in ihren faserfreien Overalls – und unter der mobilen Zeltüberdachung befand sich ohne Frage die Rechtsmedizinerin Berthe aus Nîmes mit ihrer Crew. Dort stand auch schon Theroux und winkte Cat herbei, die nun einen Schritt zulegte und ihre Kollegen unter dem Stoffdach mit einem Nicken grüßte. Ein Gendarm informierte Theroux darüber, dass ein Mitarbeiter der Regionalverwaltung bei einem Routinerundgang die Leiche im Wasser an der Staumauer entdeckt und zuerst angenommen hatte, es könnte sich um ein verendetes Tier handeln oder lediglich um ein Kleidungsstück. Er hatte mit einem Ast versucht, es herauszufischen, dann aber gemerkt, dass es sich um einen toten Menschen handelte, worauf er sofort die Polizei verständigt hatte. Die Gendarmerie war erschienen und hatte die Feuerwehr benachrichtigt, die mit zwei Rettungstauchern und dem Schlauchboot gekommen war und den Körper geborgen hatte.
Theroux nickte und stellte ein paar Nachfragen, während Cat mit einem Ohr der Rechtsmedizinerin zuhörte, die leise mit ihren Assistenten sprach. Im Rahmen der Erstbeschauung wurden Videoaufnahmen von der Leiche gemacht. Der Körper lag auf einer mobilen Liege, wie sie von Rettungssanitätern verwendet wurden, um Verletzte zu transportieren. Schließlich schien Berthe so weit zu sein und sammelte sich einen Moment lang. Cat gab ihr die Zeit.
Das Offensichtliche hatte sie ohnehin schon gesehen und abgespeichert. Die Leiche war männlich, vermutlich im mittleren Alter. Dem Zustand nach konnte sie noch nicht sehr lange im Wasser gelegen haben. Wie lange genau, würde Berthe bei der Obduktion herausfinden, die sich später anschließen und im Rechtsmedizinischen Institut stattfinden würde, das an die Unikliniken in Nîmes angegliedert und für die Region Vaucluse sowie einige andere zuständig war. Die Leiche war bekleidet mit einer Jeans und einer dunkelblauen Windjacke mit dem Polospieler-Logo von Ralph Lauren. Die Schuhe waren aus braunem Leder mit goldenen Schnallen an den Seiten. Sie wirkten teuer und nicht so, als würde man darin eine Wanderung in der Gegend von Caromb oder einen Spaziergang in der Natur unternehmen wollen. Denn so hatte es zunächst gelautet: Es sei ein toter Wanderer von der Forstverwaltung aufgefunden worden. Eine klare Fehldarstellung.
Neben der Leiche lag ein durchsichtiger Beweismittelbeutel. Darin befanden sich eine Geldbörse, persönliche Dokumente, ein Schlüsselbund und ein Handy sowie eine aufgeweichte Packung Zigaretten der Marke Gauloises Blondes nebst pinkfarbenem Einwegfeuerzeug.
Berthe zog die Latexhandschuhe von den Fingern, warf sie in einen Kunststoffbeutel und blickte Cat über den Rand ihres knallroten Brillengestells hinweg an. »Bei Wasserleichen«, sagte sie, »finden wir oft wenige Spuren bei der Erstbeschau. Das ist auch hier der Fall. Die Liegezeit im See würde ich auf maximal zwölf Stunden schätzen. Ich kann keine offensichtlichen Spuren erkennen, die auf Gewaltanwendung schließen lassen, keine augenscheinlichen Verletzungen. Aber ich gehe davon aus, dass der Tod durch Ertrinken eintrat, worauf zumindest einiges hindeutet. Ob es freiwillig war, ein Unfall oder ob Fremdeinwirkung im Spiel war, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht einschätzen. Das muss ich mir alles sehr viel genauer ansehen.«
Cat nickte, zog eine Packung Kaugummi aus der Jackentasche und schob sich eines zwischen die Zähne. Bruno Grinamy, der Noch-Leiter der Spurensicherung, kam nun hinzu. Er steckte in einem faserfreien Overall und hatte ein Clipboard unter dem Arm. Grinamys Gesicht war faltig, seine Figur drahtig. Sein Schädel war kahl, und er sprach ständig davon, dass er ihn bald in der Karibik bräunen würde, denn Grinamy stand kurz vor dem Ruhestand und hatte nur deswegen etwas Zeit angehängt, weil man ihn aus Personalgründen ausdrücklich darum gebeten hatte. Im Schlepptau hatte er Kevin Toullardin, der ebenfalls einen weißen Overall trug und mindestens einen Kopf größer war als Grinamy und die meisten anderen. Er trug eine Nerd-Brille und würde Grinamy sicherlich bald beerben.
Grinamy machte eine ahnungslose Geste, indem er beide Arme hob. »Wir haben nichts Besonderes finden können«, sagte er. »Was wiederum interessant ist – dass wir gar nichts gefunden haben.«
Cat merkte auf.
Toullardin redete nun weiter. »Wir hätten zumindest ein geparktes Auto erwarten können. Oder ein Motorrad, ein E-Bike. Aber nichts dergleichen war zu finden, woraus man schließen müsste, dass der Mann zu Fuß herkam, wobei ich mir nicht sicher bin …« Toullardin nickte mit dem Kopf in Richtung der feinen Anzugschuhe an der Leiche. »Aus Caromb kommend«, sagte er, »würde man auf einem der Wanderwege oder entlang der Straße einige Höhenmeter bewältigen müssen sowie einige Kilometer Wegstrecke. Ich würde eher nicht zu Fuß herkommen, schon gar nicht mit solchem Schuhwerk. Dennoch wäre es möglich. Die Alternative ist, dass er mit einer anderen Person im Auto herkam, die sich dann wiederum mit dem Auto entfernt hat.«
Cat nickte. Kaute auf dem Kaugummi. Sie wollte gerade etwas fragen, als sie im Kies knirschende Schritte hörte, die sich rasch näherten. Sie blickte über die Schulter nach hinten – und sah Staatsanwalt Luc Bonnieux, der sich offensichtlich ein Bild von der Lage machen wollte, nachdem er von dem Leichenfund gehört hatte.
Bonnieux war hochsensibel, wenn es um Tote in seinem Verantwortungsbereich ging. Einerseits verlangten Kapitaldelikte natürlich eine ganz besondere Beachtung. Auf der anderen Seite standen sie ebenfalls unter besonderer Beachtung – nicht nur der der Öffentlichkeit, sondern auch der von übergeordneten Behörden – und waren daher prestigeträchtig. Was Bonnieux wiederum wichtig war.
Er trug einen leichten, schwarzen Wollmantel, darunter einen grauen Anzug und ähnliche Schuhe wie der Tote, weswegen er sich auf dem Untergrund aus Kies und Sand am Strand des Sees nicht sehr elegant vorwärtsbewegte. Er ging eher wie auf rohen Eiern. Schließlich traf er am Zelt ein, grüßte alle mit einem Nicken und ließ sich kurz ins Bild setzen.
»Also ein Selbstmord?«, fragte er, nahm die randlose Brille ab und putzte sie mit einem Tuch, das er aus einem Etui in seiner Manteltasche gezogen hatte.
Berthe zuckte mit den Schultern, Grinamy, Toullardin und Theroux taten es ihm gleich.
»Ich würde sagen«, erklärte Cat, »dass es noch offen ist. Möglicherweise war es auch ein Unfall. Der Mann spazierte auf der Staumauer, wollte vielleicht ein Foto machen, stolperte, fiel ins Wasser und ertrank.«
Berthe ergänzte: »Wenn er sich ertränken wollte, würde man annehmen, dass er etwas dabeihatte, das ihn beschweren würde. Selbstmörder, die sich ertränken, wollen sicherstellen, dass sie es sich nicht anders überlegen, wenn ihnen erst einmal die Luft ausgeht und die Überlebensinstinkte die Kontrolle übernehmen. Manche beschweren sich die Taschen mit Steinen oder binden sich einen Sack mit etwas Schwerem an den Körper. Nichts davon haben wir hier gefunden.«
»Und Mord?«
Wieder zuckten alle mit den Schultern, und wieder war es Cat, die etwas sagte. »Auch das können wir noch nicht sagen. Die Erstbeschau ergab keinerlei Hinweise auf irgendeine Gewalteinwirkung.«
»Aber das kann sich bei der Obduktion noch ändern, richtig?«, fragte Bonnieux.
»Alles kann sich ändern«, erklärte Berthe. »Oder auch nicht.«
Bonnieux machte eine beschwichtigende Geste. »Ich will die Angelegenheit nur richtig einschätzen und wissen, ob da etwas auf uns zukommt. Ich bin ab morgen einige Tage im Kurzurlaub. Meine Frau und ich fliegen zum Weihnachtsshopping nach London.« Den letzten Satz ließ er betont beiläufig klingen.
Theroux runzelte die Stirn. »Weihnachten? Das ist doch noch etwas hin? Ungefähr zwei Monate.«
»Niemand will im allgemeinen Trubel Weihnachtsshopping unternehmen. Lieber ganz entspannt.«
Grinamy sagte: »London soll ja im Herbst sehr schön sein. Vier Grad und Nieselregen.«
Bonnieux lächelte unverbindlich. »Wir werden sehen.«
Theroux fragte: »Aber – warum gehen Sie nicht nach Paris shoppen?«
»Weil …«
»Ich meine: Paris hat doch viel mehr zu bieten als London oder mindestens ebenso viel, und Sie sind doch Franzose?«
»Alain«, murmelte Cat und legte ihm die Hand auf den Unterarm. Manchmal stand Theroux auf der Leitung. Es war, als ob irgendwelche Synapsen nicht verbunden waren.
»Was denn?«, fragte er Cat, die nur leicht mit dem Kopf schüttelte, um ihm zu bedeuten: Nein, ist gut jetzt damit.
Bonnieux räusperte sich und wechselte das Thema. »Jedenfalls möchte ich lediglich sicherstellen, dass ich in der Freizeit nicht mit Anrufen terrorisiert werde und meine Vertretung nicht überfordert wird – beziehungsweise würde ich meine Vertretung gerne vorwarnen, falls da etwas Komplexes auf sie zukommen sollte. Wie heißt eigentlich unser Opfer?«, fragte der Staatsanwalt.
Theroux blickte auf den Ausweis, der in dem Klarsichtbeutel steckte. »René Valois«, las er und ergänzte: »Ach.«
Er blickte Cat an. Cat blickte zurück. Sie kannte den Namen, Theroux offensichtlich ebenfalls und insbesondere der Staatsanwalt. Denn Bonnieux streckte sich etwas, sog die Luft scharf durch die Nasenlöcher ein und setzte sich die Brille wieder auf.
»René Valois«, murmelte er. »So sieht man sich also wieder.« Er seufzte, zog sein Handy aus der Innentasche und sagte: »Dann sollte ich meine Vertretung besser doch vorwarnen.«
3
Man sagte, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist steckte. Man sagte im Umkehrschluss aber nicht, dass zu einem gesunden Geist auch zwangsläufig ein gesunder Körper gehörte. Mit Albins Geist unter den fast schlohweißen Haaren war trotz seines Alters von Ende sechzig alles noch einigermaßen in Ordnung – aber was war mit dem Rest?
Seine körperlichen Defizite spürte er seit ungefähr einer Stunde sehr deutlich. Die Beine taten ihm weh. Die Füße ebenfalls, was sicher daran lag, dass er sich lediglich ein Paar Turnschuhe angezogen hatte. Falsche Entscheidung. Aber anderes festes Schuhwerk besaß er nicht. Er war schließlich kein Alpinist und kein Wanderer. Nein, das war er ganz und gar nicht. Trotzdem befand er sich auf einer Wanderung. Und das in seinem Alter. In Turnschuhen. Fabelhaft. Jedenfalls stapfte er in den Sneakers vor sich hin und gab sich alle Mühe, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
Aber er war ja selbst schuld daran. Gewissermaßen jedenfalls. Teilweise.
Kürzlich war Albins Tochter Manon mit ihrer Tochter Clara zum Frühstück vorbeigekommen und hatte ihren Freund im Schlepptau gehabt. Christian Papillon war in etwa in Manons Alter, Ende dreißig, und Architekt. Er sah nicht schlecht aus und war ein netter Kerl, wenngleich Albin sich immer noch nicht an seinen kuriosen Nachnamen – »Papillon« bedeutete »Schmetterling« – gewöhnen konnte und auch nicht daran, dass Manon ihn am Kühlregal im Supermarkt kennengelernt hatte.
Wenn Albin ehrlich war, konnte er sich noch nicht einmal daran gewöhnen, dass Manon einen Freund hatte. Er gönnte es ihr natürlich von Herzen, nachdem vor kurzem endlich ein Schlussstrich unter die Ehe mit ihrem psychopathischen Ehemann Gilles gezogen worden war, der sie mental und körperlich missbraucht hatte.
Jedenfalls war Papillon ein Naturbursche und auf vielfältige Art gerne an der frischen Luft unterwegs. Zum Beispiel wanderte er und plante, mit Manon einen größeren Trip entlang den Calanques bei Marseille zu unternehmen – wahlweise auch am Gorges du Verdon. Dazu waren allerdings als Vorbereitung einige kleinere Trips erforderlich, zumal Manon sich gerade neue Wanderschuhe gekauft hatte, die noch eingelaufen werden mussten, bevor es ernst wurde.
Albin hatte freundlich gelogen, dass Wandern ja eine wunderbare Sache sei, hatte jedoch absolut nicht damit gerechnet, dass ihn diese doch eher vage Äußerung ins Verderben stürzen würde.
Denn seine Frau Veronique griff sofort den Ball auf und sagte: »Dann solltest du einmal gemeinsam mit deiner Tochter eine Wanderung unternehmen, Albin. Bewegung tut dir gut, und du hast den ganzen Tag lang ja sowieso nichts zu tun im Ruhestand.«
Albin hatte protestieren wollen, dass er zwar pensioniert war, aber dennoch über ein offizielles Amt als polizeilicher Berater verfügte, für das ihm sogar Capitaine Caterine Castel mit Billigung des Staatsanwalts Luc Bonnieux Visitenkarten gedruckt und zum Geburtstag geschenkt hatte. Er hatte außerdem sagen wollen, dass er jeden Tag mehrfach mit seinem beigefarbenen Mops Tyson spazieren ging und damit statistisch gesehen mehr Bewegung hatte als viele andere Ruheständler in seinem Alter – aber dazu kam er nicht. Denn Manon klatschte schon verzückt in die Hände und meinte: »Au ja, Papa.« Und da konnte er natürlich schlecht nein sagen.
Tja, und da marschierte er nun. An einem Tag mit trübem Himmel bei kühlen Temperaturen mitten im Herbst stapfte er durch die Landschaft und brachte alles schauspielerische Talent auf, um sich die schlechte Stimmung nicht anmerken zu lassen. Er wollte Manon den Ausflug nicht verderben und versuchte gleichzeitig, sich einzureden, dass das Wandern gar nicht so schlecht war und es ihm sogar gefiel, mal etwas anderes zu sehen und in der Natur unterwegs zu sein.
Aber das stimmte nicht. Er hasste es. Wo lag nur der Sinn darin, in der Gegend herumzulaufen? Was kam dabei Produktives heraus – von der Übersäuerung der Muskulatur mal abgesehen, die sich an den Folgetagen fraglos bei jeder noch so kleinen Bewegung bemerkbar machen würde? Außerdem wurde ihm auf schamlose Weise vor Augen geführt, wie wenig sein Körper an Belastungen gewohnt war.
Zum Glück war er nicht allein damit. Auch Tyson, sein Mops, wirkte nicht besonders fit. Er hechelte neben Albin her – und wenn alle Stricke reißen und Albin schließlich die Nase vom Wandern voll haben würde, dann würde Albin Tyson als Alibi nutzen und sagen: »Es hat keinen Sinn mehr. Der Hund hat zu kurze Beine. Er kann nicht mehr. Ich muss umkehren, bevor er zusammenbricht.«
Der Weg zurück zum Auto war zum Glück nicht allzu weit. Albins SUV parkte in etwa drei Kilometern Entfernung an dem Feldweg, wo sie ihre Wanderung begonnen hatten, die oberhalb von Caromb zur Chapelle du Paty führen sollte, die nahe dem Stausee lag.
Manons Freund Christian Papillon wirkte allerdings so, als habe er sich gerade erst warmgelaufen und wollte jeden Moment in seinen ausgelatschten Wanderstiefeln einen neuen Rekord auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela aufstellen oder die Alpen im Laufschritt überqueren. Er machte seinem Nachnamen Papillon alle Ehre und bewegte sich wie ein Schmetterling über Stock und Stein und schien dabei rufen zu wollen: »Hey, Natur, ist das alles, was du zu bieten hast? Wo sind die ernst zu nehmenden Hindernisse? Her damit!«
Dabei waren besonders sportliche Menschen Albin seit jeher suspekt. Das lag nicht dran, dass er selbst absolut nicht sportlich war. Nein, übertriebener Fitnesswahn unterschied sich nach seiner Meinung nicht sehr von anderen wahnhaften Zuständen wie zum Beispiel religiösem oder politischem Fanatismus. Zu viel des Guten war niemals zuträglich, und – wie man so sagte – Gift war immer eine Frage der Dosis: Etwas konnte heilen, zu viel töten.
Und das galt nach Albins Meinung auch für Sport. Wie viele Athleten waren denn schon umgekippt oder hatten sich verletzt? Unzählige. Und was taten die? Machten einfach weiter. Ein klassisches Suchtverhalten war das.
Albin wusste, wie das funktionierte, schließlich war er in Sachen Nikotin selbst ein Junkie und hätte hier und jetzt gerne angehalten, sich auf einen Baumstumpf gesetzt und eine geraucht, statt wie ein Blöder durch die Gegend zu rennen. Aber er hatte es nun einmal versprochen – doch just in diesem Moment schien eine höhere Macht Albins Gedanken gelesen zu haben.
Manon stoppte und keuchte. Sie fasste sich an die Ferse und verzog das Gesicht.
»Ich glaube«, sagte sie, »ich habe mir eine Blase gelaufen.«
»Oh, verdammt«, erwiderte Christian und stoppte. »Das kann bei neuen Schuhen passieren. Deswegen müssen sie eingelaufen werden. Lass uns mal nachsehen, wie schlimm es ist.«
Manon nickte und setzte sich auf einen umgestürzten Stamm am Wegesrand inmitten des Kiefernwalds am Hang des Lac du Paty, dessen Oberfläche man von hier oben in einiger Entfernung zwischen den Baumkronen erkennen konnte.
Perfekt, fand Albin. Gerade hatte er über einen Baumstumpf und eine Zigarette nachgedacht – und da war schon die Sitzgelegenheit, der optimale Moment …
Du, hechelte Tyson, willst … dich nicht im Ernst … jetzt neben deine Tochter … setzen und …
»Meine Güte«, erwiderte Albin in Gedanken, »natürlich nicht. Soll sie erst mal ihre Hacken begutachten. Danach kann ich immer noch eine rauchen.«
An … der frischen Luft bei einer… Wanderung … Wie sieht … denn das aus … Das macht man doch nicht, man …
»Tyson! Geht es dir auch gut? Du hechelst wie ein Hundertmeterläufer.«
Wenn … es mal nur hundert Meter gewesen wären, Chef …
Tyson setzte sich auf den Hintern, während Albin sich ins Kreuz fasste und Manon und Christian dabei zusah, wie sie Manons rechten Schuh aufbanden, mitsamt Socke auszogen und eine respektable Blase an der Ferse entdeckten.
»Hm«, machte Christian, »das sieht wirklich nicht gut aus.«
»Fühlt sich auch nicht gut an«, erwiderte Manon mit angestrengter Stimme. »Dabei hat mir Robert genau diese Boots empfohlen, und er kennt sich ja aus. Er arbeitet nicht nur im Sportartikelmarkt, sondern ist auch Wanderführer.«
»Robert Soler?«, fragte Christian.
Manon nickte. »Kennst du ihn?«
»Ich weiß, dass er dort arbeitet.«
Manon nickte, kaute auf der Unterlippe und sah kurz weg – als ob es ihr irgendwie unangenehm war, dass sich Christian und dieser Schuhverkäufer kannten. Albin maß dem keine große Bedeutung zu, nahm es aber wahr. Polizistensinne stellte man nicht einfach von heute auf morgen aus.
»Tja«, murmelte Christian, »manchmal merkt man erst, dass etwas doch nicht das Richtige ist, wenn man es ausprobiert. Wenngleich das gute Schuhe sind. Ich habe mir auch sehr oft wunde Füße gelaufen. Das gibt sich mit der Zeit.« Er öffnete Manon dann den anderen Schuh, um auch diesen Fuß zu kontrollieren. Eine weitere Blase – zum Glück nicht so schlimm wie die erste, aber dennoch respektabel.
»Aua«, machte Manon.
»So kannst du nicht weiterlaufen«, sagte Albin. »Du hättest Turnschuhe anziehen sollen wie ich. Die sind wenigstens bequem. Mit meinen Füßen ist alles bestens«, log er.
»Mit Sneakern«, erklärte Christian, »unternimmt man aber besser keine richtige Wanderung. Manons Stiefel sind gut. Deswegen laufen wir sie ein. Ich habe zwar einige Blasenpflaster dabei, aber – hm, ich weiß nicht.«
»Machst du mir eines drauf?«, fragte Manon.
»Klar«, erwiderte Christian, löste seinen Rucksack von den Schultern und stellte ihn neben sich ab, um die Seitentaschen zu durchforsten, in denen auch eine Trinkflasche steckte und das Etui eines kleinen Feldstechers.
Albin brummte etwas. War der Bursche ihm gerade einfach so über den Mund gefahren? Ja, das war er. Einerseits gefiel Albin, dass dieser Schmetterling Schneid hatte. Andererseits zeigte ein Mangel an Respekt ausgerechnet gegenüber dem Vater …
Krieg dich wieder ein, murmelte Tyson.
»Pfff«, erwiderte Albin telepathisch, steckte sich in Gedanken eine Gitanes an und blickte sich etwas in der Gegend um. Er sah jede Menge Bäume, grauen Himmel, zwischen den Baumkronen das Wasser des Lac du Paty und einen schmalen Strich, bei dem es sich um die Staumauer handeln konnte. Kleine Punkte bewegten sich am Ufer. Waren das Menschen? Bei diesem Wetter? Gingen da etwa welche schwimmen?
Albin kniff die Augen zusammen und erinnerte sich ein weiteres Mal daran, dass er sich unbedingt eine Brille zulegen sollte. Allerdings hätte ihm die jetzt auch nicht weitergeholfen. Stattdessen fragte er: »Darf ich mal?«, während Christian die Pflaster gefunden hatte und auf Manons Füße klebte, und beugte sich herab, um das kleine Fernglas aus Christians Rucksack zu nehmen.
Es war bestimmt kein Profigerät, wirklich nicht, vielmehr wirkte es wie ein Spielzeug. Albin änderte jedoch seine Meinung, als er den Aufdruck eines namhaften deutschen Optik- und Fotoherstellers las und schließlich durch das Fernglas blickte. Die Sehqualität war hervorragend, die Vergrößerung ebenfalls. Er drehte an dem kleinen Rädchen zwischen den Okularen und fokussierte auf den Bereich mit den sich bewegenden Punkten.
»Ach«, flüsterte er zu sich selbst, »ach was.«
Er schwenkte nach rechts, wo sich der Parkplatz des Sees befinden musste. Zwischen den Ästen konnte Albin nur einen Teil der Fläche ausmachen – aber immerhin sah er, dass dort einige Fahrzeuge hielten. Rettungswagen. Feuerwehr. Gendarmerie. Und war das … Albin kannte den silbernen Kastenwagen der Rechtsmedizin aus Nîmes, und dieser dort sah so aus, als ob …
»Brat mir doch einer einen Storch«, murmelte Albin, nahm das Fernglas wieder runter und zog sein Handy aus der Hintertasche seiner Jeans.
»Was ist denn?«, fragte Manon, die vorsichtig die Wanderstiefel wieder anzog.
Albin sah, dass weder ein Anruf eingegangen war noch eine Textnachricht. Beides musste nichts bedeuten. Cat oder Theroux ließen ihn stets im Unklaren darüber, wenn etwas vor sich ging. Er überlegte, ob er einen von beiden anrufen sollte, ließ es dann aber bleiben. Er hatte eine andere Idee. Eine viel bessere.
»Nichts weiter«, erwiderte Albin. »Ich habe nur ein wenig herumgeschaut. Tolles Fernglas.«
Er gab das Gerät zurück an Christian, der gerade aufstand und den Rucksack wieder schulterte. Er nahm es an sich, nickte und sagte: »Klein, aber fein.« Er steckte es zurück in die Schatulle und ergänzte: »Ich denke, wir sollten es nicht auf die Spitze treiben und die Wanderung hier abbrechen. Ich hoffe, du schaffst es zurück zum Auto, Schatz?«
Manon stand wieder auf und nickte.
Albin fischte den Autoschlüssel aus der Seitentasche seiner gewachsten Jacke. Er warf ihn Manon zu, die ihn mit der rechten Hand auffing und Albin fragend anblickte.
»Ihr solltet tatsächlich abbrechen«, sagte Albin. »Die Blasen an den Füßen sehen nicht gut aus. Für meinen Teil würde ich gerne noch ein wenig weiterlaufen. Die Bewegung tut mir gut. Ich rufe mir dann ein Taxi, wenn ich irgendwo abgeholt werden will – oder melde mich bei euch.«
»Ernsthaft?«, fragte Manon.
Ernsthaft?, schien auch Tyson zu fragen.
»Ernsthaft«, antwortete Albin. »Und Tyson tut die Bewegung ebenfalls gut. Ich werde mit ihm noch etwas weiterwandern.«
Aber Chef! Meine kurzen Beine!
»Ruhe da unten«, erwiderte Albin in Gedanken und sagte zu Christian: »Keine Sorge. Ich komme schon klar.«
»Sind Sie auf den Geschmack gekommen?«
»Unbedingt«, log Albin, klopfte Christian auf die Schulter und gab Manon links und rechts einen Kuss auf die Wange. »Alles gut«, sagte er. »Geht ihr ruhig zurück zum Wagen und kümmert euch nicht weiter um mich.«
»Wie du meinst, Papa.« Manon sah Albin mit einem Zweifeln an. Sie konnte offensichtlich nicht ganz einschätzen, was ihr Vater plante und warum – ahnte aber wohl, dass es Grund zur Skepsis gab.
Schließlich verabschiedeten sie sich. Albin sah Christian und Manon hinterher, die zunächst vorsichtig ging, dann aber wieder einigermaßen normal. Nachdem sie hinter einer Kurve verschwanden, zog Albin die Gitanes-Packung hervor und steckte sich eine an. Er inhalierte den Rauch tief, schloss genießerisch die Augen und stieß den Qualm durch die Nasenlöcher wieder aus.
»Na dann«, sagte er zu Tyson, »vielleicht haben wir noch einen oder zwei Kilometer vor uns. Aber bergab geht alles leichter – und ich habe das Gefühl, dass sich unser Ziel lohnen wird.«
4
Eine gute Viertelstunde später spazierten Albin und Tyson bereits am Ufer des Sees entlang. Sie passierten das Freizeitareal mit dem Kiosk, den Picknicktischen und der Tanzfläche sowie den Parkplatz. Sie gingen in Richtung der Staumauer, wurden aber vorher von einem recht jungen Gendarmen in Uniform in Empfang genommen, der Albin erklärte, dass wegen eines Einsatzes der Polizei der See zurzeit abgesperrt sei.
»Worum geht es denn?«, fragte Albin.
»Dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen«, erwiderte der Uniformierte. »Jedenfalls geht es ab hier nicht weiter für Sie, Monsieur. Sie sollten daher besser umdrehen.«
»Wurde eine Leiche gefunden?«
»Wie kommen Sie darauf?«
Albin deutete mit der Stirn zum Parkplatz. »Das ist das Fahrzeug der Rechtsmedizin aus Nîmes. Außerdem sehe ich dort Dienstfahrzeuge der Police National aus Carpentras, vor allem das eine, das stets von Castel und Theroux genutzt wird, sowie das Auto des Staatsanwalts.«
Der Gendarm drehte sich um, betrachtete die Wagen und zuckte mit den Schultern.
»Mein Name ist Albin Leclerc. Ich bin polizeilicher Berater, und …«
»… und ich habe dennoch die Anweisung«, erwiderte der Gendarm, »hier niemanden durchzulassen.«
»Polizeiliche Berater aber schon?«
»Nicht einmal Ihre Großmutter, Monsieur Leclerc. Abgesehen davon sagt mir Ihr Name nichts, und schließlich kann jeder behaupten, ein polizeilicher Berater zu sein. Sie sollten mit solchen Behauptungen sehr vorsichtig sein. Das kann Ihnen viel Ärger einbrocken. Tut mir leid.«
»Meine Großmutter ist längst verstorben. Von daher …«
»Monsieur«, sagte der Gendarm und stemmte die Hände in die Hüften, »bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts für Sie zu sehen.«
»Sie kennen mich nicht?« Albin legte den Kopf schief.
Der Gendarm zuckte mit den Schultern.
»Sie kommen nicht von hier, oder?«
»Aus Lyon. Ich bin seit zwei Wochen hier. Aber das tut nichts zur Sache und …«
»Absolut nie von mir gehört?« Albin konnte es kaum glauben.
»Niemals. Und jetzt muss ich Sie wirklich bitten, dass Sie …«
Eine laute Stimme ertönte. »Ich! Fasse! Es! Einfach! Nicht! Leclerc!«
Einen Augenblick später erschien der Mann, der zu der Stimme gehörte: Staatsanwalt Luc Bonnieux, der offenbar gerade am Seeufer gewesen war und sich nun auf dem Rückweg zu seinem Auto befand.
»Sehen Sie«, sagte Albin zu dem Gendarmen, »der Staatsanwalt kennt mich in jedem Fall.«
Und ob er das tat. Albin und Bonnieux hatten sich bereits zu Albins aktiver Zeit nicht besonders gut verstanden. Er fand Albins Methoden seit je unerträglich, sein »Laisser-faire« und die eher lockere Einstellung gegenüber Dienstanweisungen geradezu skandalös. Damit war es nicht besser geworden, seit Albin sich im Ruhestand nach wie vor in ihre Ermittlungen einmischte.
Bonnieux hatte schließlich dennoch eingewilligt, Albin als Pensionär zum polizeilichen Berater zu ernennen, wenngleich es sich dabei um kein offizielles Amt handelte. Vielmehr ging es darum, Albins Aufenthalte als Pensionär an Tatorten zu legitimieren, damit kein Anwalt den Behörden einen Strick daraus drehen konnte, dass sich ein Privatier dort herumtrieb.
Die Alternative wäre gewesen, Albin mit einstweiligen Verfügungen zu überziehen und ihm Haft anzudrohen. Allerdings war er erfolgreich in seinen Ermittlungen und oft genug eine Stütze der Polizei, was auch Bonnieux zähneknirschend eingestehen musste und deswegen auf derlei Mittel verzichtete – was Albin in jedem Fall einen taktischen Vorteil verschaffte: Sie hassten und sie liebten ihn. Sie wollten ihn loswerden, doch sie brauchten ihn. So war das nun einmal, und Albin wusste das sehr gut.
Natürlich wusste er auch, dass er seinen Kollegen und dem Staatsanwalt Bonnieux fürchterlich auf die Nerven ging. Aber das war eben der Preis, den sie bezahlen mussten. Albin war gegen Ärger und Beschimpfungen sowieso immun – nur nicht gegenüber Ignoranz und Respektlosigkeit. Das konnte ihn auf die Palme bringen. Zum Beispiel kürzlich Theroux’ Androhung, ihm im Hôtel de Police Hausverbot erteilen zu lassen. Unerhört, wirklich.
»Leclerc«, schimpfte Bonnieux und baute sich neben dem Gendarmen auf, »was, zum Teufel, tun Sie hier? Woher wissen Sie schon wieder, was hier los ist? Gibt es denn überhaupt keine Ruhe vor Ihnen? Ich muss wirklich sehr darum bitten, dass Sie sich endlich zusammenreißen und …«
Albin hob beschwichtigend die Hände, während sich Tyson neben ihn hockte und zwischen den Männern hin- und herblickte. »Ganz ehrlich, Monsieur le Procureur, ich bin lediglich zu einer kleinen Wanderung unterwegs gewesen. Ohne jeden Hintergedanken. Dann komme ich hier entlang … und das war’s.«
»Sie und wandern?«
»Meine Tochter entdeckt es gerade für sich. Ich habe sie begleitet, aber sie lief sich eine Blase.«
»Ihre Ausreden können Sie Ihrer Großmutter erzählen, Leclerc.«
»Ich habe bereits dem jungen Gendarmen gesagt, dass meine Großmutter nicht mehr lebt.«
»Gehen Sie nach Hause, wirklich.« Bonnieux blickte nach unten, wo Tyson saß. Mit einem Mal änderte sich seine Stimmlage. »Oh, und das ist Tyson, richtig?«
Albin hielt Tysons Leine locker und nickte. »Das ist er. Sie haben doch einen seiner Welpen.«
Bonnieux lächelte. »Ja, unser Henri – er macht uns so viel Freude. Man kann sogar Ähnlichkeiten entdecken.«
Albin schmunzelte, obwohl es ihm überhaupt nicht gefiel, dass Tysons Nachwuchs sich ausgerechnet bei Bonnieux eingenistet hatte. Albin hatte seinen Hund zwei Wochen lang bei Castel in Pension gegeben, deren Lebensgefährte ebenfalls einen Mops besaß – ein