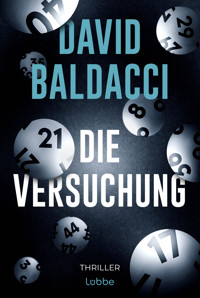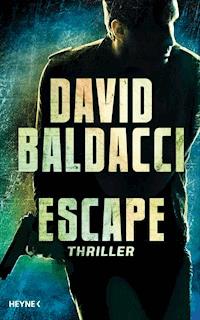10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Memory-Man-Serie
- Sprache: Deutsch
Alte Sünden werfen lange Schatten
Amos Decker, der Memory Man, besucht seine Heimatstadt, als plötzlich ein alter Bekannter vor ihm steht. Meryl Hawkins ist ein verurteilter vierfacher Mörder und der Erste, den Decker als junger Polizist hinter Gitter gebracht hat. Hawkins, der aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes vorzeitig entlassen wurde, beteuert seine Unschuld. Sein letzter Wunsch: der FBI-Ermittler soll seinen Namen reinwaschen. Kurz darauf wird Hawkins erschossen. Nun kommen Decker echte Zweifel: Hat er dabei geholfen, den Falschen zu bestrafen? Als er den Fall wieder aufrollt wird klar: Jemand wird weiter töten, um ein altes Geheimnis zu verbergen . . .
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ZUMBUCH
Am vierzehnten Geburtstag seiner Tochter steht Amos Decker auf dem Friedhof. Er ist in seine Heimatstadt Burlington, Ohio, gereist, um an Mollys Grab und dem seiner Frau Cassie zu trauern. Vor Jahren hatte Decker die beiden brutal ermordet zu Hause entdeckt. Da spricht ihn überraschend ein alter Mann an: Meryl Hawkins war der erste Fall in Deckers Karriere. Vier Menschen soll er eines Nachts kaltblütig hingerichtet haben. Jetzt behauptet der todkranke Hawkins plötzlich er sei unschuldig. Doch alleine kann er das nicht beweisen. Obwohl Decker skeptisch ist, erklärt er sich bereit, den Fall nochmals zu prüfen – und stellt fest, dass die eindeutigen Beweise ein wenig zu eindeutig waren. Kurz darauf wird Hawkins mit einer Kugel im Kopf gefunden. Decker erkennt, dass der einzige Grund, einen sterbenden Mann zu töten, darin besteht, ihn zum Schweigen zu bringen. Der Memory Man will das Unrecht von damals wiedergutmachen. Und kommt einer unglaublichen Geschichte auf die Spur …
ZUMAUTOR
David Baldacci, geboren 1960 in Virginia, arbeitete lange Jahre als Strafverteidiger und Wirtschaftsjurist in Washington, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Sämtliche Thriller von ihm landeten auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Mit über 150 Millionen verkauften Büchern in 80 Ländern zählt er zu den weltweit beliebtesten Autoren. »Flashback« ist nach »Memory Man«, »Last Mile«, »Exekution« und »Downfall« der fünfte Band seiner Bestsellerserie um Amos Decker.
DAVID BALDACCI
FLASHBACK
THRILLER
Ins Deutsche übertragen von Norbert Jakober und Jens Plassmann
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel REDEMPTION bei Grand Central Publishing/Hachette Book Group Inc., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Columbus Rose, Ltd.
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Wolfgang Neuhaus
Herstellung: Udo Brenner
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock (Pictureguy, Stokkete)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30529-1V001
www.heyne.de
Für Lindsey Rose.
Du hast immer dafür gesorgt, dass die Züge pünktlich fahren und hast alles mit Geschick und leichter Hand geschaukelt.
Gratuliere zur neuen Aufgabe!
1
An einem erfrischend kühlen, wunderbar klaren Herbstabend war Amos Decker von Toten umgeben. Was jedoch fehlte, war das stahlblaue Licht, das er in solchen Situationen sonst jedes Mal sah.
Und das hatte seinen guten Grund: Diese Toten waren nicht erst kürzlich verstorben.
Er war in seine Heimatstadt Burlington, Ohio, zurückgekehrt, eine triste alte Industriestadt, die schon bessere Zeiten erlebt hatte. Davor hatte er sich in einer anderen kleinen Stadt im Rostgürtel im Nordosten der USA aufgehalten – in Baronville, Pennsylvania, um genau zu sein, wo er nur knapp dem Tod entronnen war, denn Baronville hatte sich als wahres Minenfeld erwiesen. Wenn es nach ihm ginge, würde er solche Todeszonen und Bereiche des Schreckens für lange Zeit meiden, vorzugsweise für den Rest seines Lebens.
Nur blieb ihm diesmal nichts anderes übrig, als in ein Reich düsterer Erinnerungen zurückzukehren.
Decker war nach Burlington gekommen, weil heute der vierzehnte Geburtstag seiner Tochter Molly war. Unter normalen Umständen wäre es ein Freudentag gewesen, doch Molly war ebenso wie Deckers Frau Cassie und sein Schwager Johnny Sacks vier Jahre zuvor ermordet worden. Der erschütternde Vorfall hatte sich kurz vor Mollys zehntem Geburtstag ereignet. Der ahnungslose Decker hatte die drei entstellten Leichen im Haus der Familie aufgefunden.
Jemand hatte sie auf brutalste Weise abgeschlachtet. Für immer und ewig aus seinem Leben gelöscht. Weil irgendein krankes, perverses Gehirn es so gewollt hatte. Der Mörder weilte ebenfalls nicht mehr unter den Lebenden, was Decker jedoch kein bisschen trösten konnte, auch wenn er selbst für den Tod des Killers verantwortlich war.
Deshalb fand der Geburtstagsbesuch für Molly auf einem Friedhof statt. Ohne Kerzen, ohne Lachen, ohne Geschenke. Nur mit frischen Blumen auf dem Grab anstelle der alten, die längst verrottet waren.
Falls es möglich war, würde Decker an jedem Geburtstag seiner Tochter hierherkommen, bis er seiner Familie eines Tages ins Grab nachfolgte. Mollys Geburtstag war so ziemlich der einzige Fixpunkt, der in seinem Leben geblieben war.
Er verlagerte sein enormes Gewicht auf der Bank aus Holz und Schmiedeeisen, die neben den beiden Gräbern stand, und drehte sich leicht zur Seite, denn Molly lag neben Cassie, ihrer Mutter. Die Bank war vom Burlington Police Department gestiftet worden, dem Decker einst angehört hatte, zuerst als Streifenpolizist, später als Detective der Mordkommission. An der Bank war ein verwittertes Messingschild angebracht: Zum Gedenken an Cassie und Molly Decker.
Der Friedhof war menschenleer, bis auf Decker und seine Kollegin beim FBI, Alex Jamison. Sie war mehr als ein Dutzend Jahre jünger als der Mittvierziger Decker. Während er neben den Gräbern saß, stand sie ein Stück abseits, um ihn mit seinen Lieben und seinen Gedanken allein zu lassen.
Jamison hatte als Journalistin gearbeitet, bevor sie die FBI-Akademie in Quantico, Virginia, absolviert hatte und Special Agent geworden war. Seit sie ihren Job beim Bureau aufgenommen hatte, war sie in einer Sondereinheit tätig gewesen, der außer ihr und Amos Decker die beiden erfahrenen Agents Ross Bogart und Todd Milligan angehörten.
Während er neben den Gräbern saß, verfluchte Decker einmal mehr seine Hyperthymesie, sein nahezu perfektes Gedächtnis – eine von mehreren außergewöhnlichen Eigenschaften, die er einem Sportunfall viele Jahre zuvor verdankte. So auch die Eigenart, Empfindungen mit Farben in Verbindung zu bringen. Das Stahlblau hasste er besonders, denn es stand für den Tod.
Decker besaß diese zweifelhaften Gaben, seit er zweiundzwanzig war, damals ein aufstrebender Collegefootballer, der – wenn auch mit einiger Mühe – den Sprung in ein NFL-Team geschafft hatte, der höchsten Liga in den USA.
Es geschah gleich beim ersten Spiel der Saison. Der bullige Decker gehörte zu denen, die das gegnerische Team aufmischen sollten, indem sie Durcheinander stifteten und Lücken in die Reihen der gegnerischen Mannschaft rissen, damit die Teamkameraden Punkte machen konnten. Football ist ein rauer Sport, und so beschloss Decker, gleich zu Beginn des Spiels den gefährlichsten Gegner von den Beinen zu holen.
Und das war auch schon alles, woran er sich noch erinnerte.
Der kleinere, leichtere, aber schnellere Gegenspieler streckte ihn mit einem Bodycheck nieder, den Decker nie kommen sah.
Nach diesem Zusammenprall war für ihn nichts mehr wie früher. Der Grund dafür war eine schwere Hirnverletzung. Als Decker aus dem Koma erwachte, besaß er mit einem Mal die Fähigkeit, sich an schlichtweg alles zu erinnern. Mochte noch so viel Zeit verstrichen sein – die Erinnerung an Dinge aus der Vergangenheit blieb für ihn so lebhaft wie am ersten Tag. Auf der anderen Seite bedeutete diese Gabe, dass er nichts vergessen konnte, rein gar nichts. Manchem mochte dies als beneidenswerte Eigenschaft erscheinen, doch sie hatte neben einigen Vorteilen auch einen schrecklichen Nachteil: Für Decker konnte noch so viel Zeit vergehen – die Erinnerung an schöne, aber auch grauenhafte Dinge aus der Vergangenheit blieb für ihn so frisch wie am ersten Tag. Er sah die Zeit als Bilder, die nie verblassten.
Die Ärzte bezeichneten es als hyperthymestisches Syndrom, was in der Praxis bedeutete, dass Decker nichts und niemanden vergessen konnte, selbst wenn er es wollte. Der Grund dafür waren die physischen Veränderungen durch den Sportunfall, die bewirkt hatten, dass er nun über Fähigkeiten verfügte, die zwar in jedem von uns schlummern, in der Regel aber ungenutzt bleiben.
Es gab nicht viele Menschen wie Amos Decker auf dieser Welt.
Und das war noch nicht alles. Decker zählte in Farben und »sah« die Zeit. Synästhesie, nannten es die Ärzte. Offenbar hatten sich bei seinem Sportunfall sensorische Nervenbahnen im Hirn neu verknüpft, sodass er nicht nur in Farben zählte, sondern bestimmte Emotionen mit bestimmten Farbtönen in Verbindung brachte. Manchmal verknüpfte er Farben auch mit Personen oder Gegenständen.
Aus dir ist ein verdammter Freak geworden.
In Gedanken versunken, blickte er auf die Gräber, während er sich mit einer Intensität an die Ereignisse vor vier Jahren erinnerte, als wären Cassie und Molly eben erst getötet worden.
Er las ihre Namen, die Inschriften auf den Grabsteinen, obwohl er längst auswendig wusste, was darauf stand. Auf dem Weg hierher war ihm vieles durch den Kopf gegangen, was er den beiden sagen wollte. Nun aber fand er aus unerklärlichen Gründen einfach nicht die richtigen Worte.
Das heißt, ganz so unerklärlich war es nicht. Die Hirnverletzung hatte ihn nicht nur mit einem unfehlbaren Gedächtnis ausgestattet, sie hatte auch seine Persönlichkeit grundlegend verändert. Seine sozialen Fähigkeiten waren, gelinde gesagt, nicht mehr das, was sie in seinen jungen Jahren gewesen waren. Er hatte große Mühe, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen und mit Menschen umzugehen. Vor dem Unfall war er ein normaler junger Mann gewesen, umgänglich, humorvoll, gesellig. Doch er hatte sich grundlegend verändert. Es war still geworden, in sich gekehrt, düster. Er mochte es nicht mehr, angefasst zu werden. Und er hatte Mühe, Witze zu verstehen. Was nicht weiter schlimm war, da er ohnehin nicht mehr lachen konnte.
In seinen Gedanken rief er als Erstes das Bild seiner Tochter auf. Er sah sie klar und deutlich vor sich, mit ihren lockigen Haaren, ihrem Lächeln, den hohen Wangenknochen. Dann das Bild seiner Frau Cassie. Sie war der ruhende Pol der Familie gewesen, hatte ihm die Kraft gegeben, sich nach seiner schweren Verletzung nicht gehen zu lassen. Stattdessen hatte sie ihn ermutigt, sich wieder unter Menschen zu begeben und in ein fast normales Leben zurückzufinden.
Er zuckte vor Schmerz zusammen. Es tat unsagbar weh, den beiden so nahe und zugleich unendlich weit von ihnen getrennt zu sein. Es gab Tage – und sie waren nicht selten –, an denen er es kaum ertragen konnte, dass er noch lebte, während sie tot waren.
Er schaute zu Jamison, die dreißig Meter entfernt an einer stämmigen Eiche lehnte. Sie war ihm eine gute Freundin und eine fähige Kollegin, doch bei dem, womit er es hier zu tun hatte, konnte sie ihm nicht helfen. Das konnte niemand.
Er wandte sich wieder den Gräbern zu, ging in die Knie und legte auf jedes Grab einen Blumenstrauß.
»Amos Decker?«
Er blickte auf und sah einen älteren Mann, der sich ihm mit langsamen Trippelschritten näherte. Aus irgendeinem dunklen Winkel aufgetaucht, erschien ihm der hagere, eingefallene Mann beinahe wie ein Gespenst, das auf ihn zuschwebte.
Jamison hatte den Mann zuvor schon entdeckt und ging nun wachsam auf ihn zu. Vermutlich war er jemand von hier, den Decker kannte. Aber man konnte nie wissen. Jamison hatte schon genug verrückte Dinge erlebt, seit sie mit Amos Decker zusammenarbeitete. Ihre Hand bewegte sich zum Griff der Pistole, die sie in einem Holster an der rechten Hüfte trug. Sicherheitshalber.
Decker musterte den Mann. Die Art, wie der Alte sich bewegte, war ihm seltsam vertraut. Sein trippelnder Gang war nicht allein dem Alter oder einer Krankheit geschuldet; so bewegte sich ein Mann, der über lange Zeit hinweg Ketten an den Füßen getragen hatte.
Der Typ hat viele Jahre im Knast verbracht, erkannte Decker.
Aber da war noch etwas, und das war beinahe noch bedeutsamer. Deckers synästhetische Gabe meldete sich. Das Auftauchen des Mannes war für ihn mit einer ganz bestimmten Farbe verknüpft. Burgunderrot. Ein Farbton, der Decker in einem solchen Zusammenhang noch nie untergekommen war.
Was zum Henker hat Burgunderrot zu bedeuten?
»Wer sind Sie?« Decker stand auf und wischte sich die feuchte Erde von den Knien.
»Es wundert mich nicht, dass Sie mich nicht wiedererkennen, Decker. Im Gefängnis verändert man sich nun mal. Genau genommen verdanke ich das Ihnen.«
Er war also wirklich im Knast.
Jamison hatte die Bemerkung ebenfalls gehört und zog die Pistole halb aus dem Holster, während sie schneller ausschritt und zu den beiden Männern eilte. Wer weiß, vielleicht war der Alte auf Rache aus. Decker hatte Dutzende verschiedenster Dreckskerle hinter Schloss und Riegel gebracht, und dieser Typ war offenbar einer von ihnen.
Decker musterte ihn von oben bis unten, als der Mann zwei Meter vor ihm stehen blieb. Decker war ein Riese mit seinen eins fünfundneunzig und etwas über hundertdreißig Kilo. Von Jamison ermutigt, hatte er begonnen, sich gesünder zu ernähren und regelmäßig Sport zu treiben, sodass er im Laufe der letzten zwei Jahre vierzig Kilo abgenommen hatte. Heute war er für seine Verhältnisse beinahe schon schlank, aber dünner würde er sicher nicht mehr werden.
Der alte Mann war knapp über eins achtzig und wog nach Deckers Schätzung höchstens sechzig Kilo. Sein Körper war kaum breiter als einer von Deckers Oberschenkeln. Aus der Nähe wirkte seine Haut so spröde wie uraltes Pergament.
Der Mann zog etwas Schleim hoch, drehte sich zur Seite und spuckte auf den geweihten Boden. »Erkennen Sie mich wirklich nicht wieder? Haben Sie nicht so ’ne Art Turbogedächtnis?«
»Wer hat Ihnen das erzählt?«, fragte Decker.
»Ihre alte Kollegin hier in Burlington.«
»Mary Lancaster?«
Der Mann nickte. »Sie hat mir auch gesagt, dass ich Sie möglicherweise hier finden kann.«
»Warum sollte sie Ihnen das sagen?«
»Ich heiße Meryl Hawkins«, erwiderte der Mann, als würde das allein schon seine Anwesenheit erklären.
Decker fiel die Kinnlade herunter.
Hawkins grinste, als er es sah, doch seine Augen blieben trüb und leer, als wäre nur noch ein matter Funke Leben darin übrig.
»Erinnern Sie sich jetzt an mich?«
»Warum sind Sie auf freiem Fuß? Sie haben lebenslänglich bekommen, ohne Aussicht auf Bewährung.«
Als Jamison bei ihnen war, stellte sie sich zwischen Decker und Hawkins.
Der Mann nickte ihr zu. »Sie sind seine neue Partnerin. Alex Jamison, nicht wahr? Lancaster hat mir von Ihnen erzählt.« Er schaute wieder zu Decker. »Tja, um Ihre Frage zu beantworten – man hat mich entlassen, weil ich Krebs im Endstadium habe. Bauchspeicheldrüse. Absolut tödlich. Die Fünf-Jahres-Überlebensrate ist minimal, trotz Chemo, Strahlentherapie und dem ganzen Scheiß, den ich mir sowieso nicht leisten kann.« Er fasste sich ans Gesicht. »Gelbsucht. Wenn es erst mal so weit ist, kann man nichts mehr machen. Metastasen im ganzen Körper. Der Krebs frisst mich innerlich auf. Das Hirn ist auch schon betroffen. Wie man’s dreht und wendet, es geht zu Ende. Vielleicht habe ich noch eine Woche, viel mehr aber nicht.«
»Hat man Sie deswegen entlassen?«, wollte Jamison wissen.
Hawkins zuckte mit den Schultern. »Ja. Krankheitsbedingte Entlassung. Müssten Sie als Cop doch wissen. Normalerweise ist das mit Anträgen verbunden, aber mir läuft die Zeit davon, also sind sie von sich aus mit den Formularen zu mir gekommen. Ich habe den Kram ausgefüllt, und die Ärzte gaben grünes Licht. Tja, deshalb bin ich jetzt hier. Wissen Sie, der Staat wollte die Behandlungskosten für mich nicht übernehmen. Ich war in einem von diesen Privatgefängnissen. Die schicken die Rechnungen an den Staat, bekommen aber nicht alles rückerstattet. Das kann sauteuer werden. Außerdem halten sie mich jetzt für harmlos. Als ich in den Knast kam, war ich achtundfünfzig. Jetzt bin ich siebzig und ein Wrack, das aussieht wie hundert. Ich habe eine Tonne Medikamente genommen, damit ich’s überhaupt herschaffe. Später werde ich wahrscheinlich ein paar Stunden kotzen und danach eine Handvoll Pillen einwerfen, damit ich ein bisschen pennen kann.«
»Moment mal. Wenn man Ihnen Schmerztabletten verschrieben hat, heißt das doch, Sie bekommen Unterstützung, oder?«
»Ich habe nicht gesagt, dass mir jemand die Pillen verschrieben hat. Aber ich brauche das Zeug trotzdem. Die werden mich schon nicht wieder einsperren, nur weil ich die Pillen bei ’nem Straßendealer kaufe. Drinnen komme ich denen zu teuer, und für die paar Tage lohnt der Aufwand eh nicht mehr.« Er lachte leise. »Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich schon viel früher krank geworden.«
»Wollen Sie damit sagen, dass Sie draußen überhaupt keine Unterstützung bekommen?«, fragte Jamison ungläubig.
»Sie sagen, ich könnte einen Platz im Hospiz kriegen, aber ich wüsste nicht, wie ich da hinkommen soll. Außerdem will ich da gar nicht hin.« Hawkins verstummte und schaute Decker an.
»Was wollen Sie von mir?«, fragte Decker.
Hawkins deutete mit dem Finger auf ihn. »Sie haben mich in den Knast gebracht. Aber Sie lagen falsch. Ich bin unschuldig.«
»Sagt das nicht jeder Verurteilte?«, erwiderte Jamison skeptisch.
Hawkins zuckte mit den Schultern. »Ich kann nicht für andere sprechen, nur für mich.« Er schaute zu Decker. »Mary Lancaster jedenfalls glaubt mir, dass ich unschuldig bin.«
»Kann ich mir nicht vorstellen«, entgegnete Decker.
»Fragen Sie sie. Das ist jedenfalls der Grund dafür, dass sie mir verraten hat, wo ich Sie finde.« Er hielt einen Augenblick inne und blickte zum dunklen Himmel. »Sie bekommen die Chance, Ihren Fehler auszubügeln. Vielleicht gelingt es Ihnen, solange ich noch lebe. Wenn nicht, ist es auch okay. Hauptsache, Sie kriegen es hin. Das wäre dann mein Vermächtnis«, fügte er mit einem schwachen Lächeln hinzu.
»Decker ist jetzt beim FBI«, warf Jamison ein. »Für Burlington und Ihren Fall ist er nicht mehr zuständig.«
Hawkins schien nicht zu wissen, was er darauf antworten sollte, versuchte es dann aber noch einmal. »Ich habe gehört, dass Sie ein Wahrheitsfanatiker sind, Decker. Hat man mir da was Falsches erzählt? Wenn ja, habe ich den weiten Weg umsonst gemacht.«
Decker schwieg.
Hawkins zog einen Zettel aus der Tasche. »Ich bin noch zwei Tage in der Stadt. Hier ist die Adresse. Vielleicht sehen wir uns ja noch mal. Falls ich nichts mehr von Ihnen höre, schicke ich Ihnen eine Karte aus dem Jenseits mit dem Wortlaut ›Schöne Grüße, Arschgeige‹.«
Decker nahm den Zettel, ohne etwas zu sagen.
Hawkins schaute auf die beiden Gräber. »Lancaster hat mir das von Ihrer Familie erzählt. Freut mich, dass Sie den Mörder gefunden haben. Aber Sie fühlen sich wahrscheinlich immer noch schuldig, obwohl Sie nichts dafür können, stimmt’s? Ich könnte es Ihnen verdammt gut nachempfinden.«
Hawkins drehte sich um und trottete zwischen den Gräbern hindurch, bis die Dunkelheit ihn verschluckte.
Jamison schaute zu Decker. »Ich weiß zwar nicht, was der Kerl verbrochen hat, aber es klingt verrückt. Wahrscheinlich will er dich provozieren, damit du dich schuldig fühlst. Es ist schon ein starkes Stück, dass er hier reinplatzt, während du deine Familie besuchst.«
Decker schaute auf das Stück Papier. Seine Miene ließ erkennen, dass ihn Zweifel beschlichen.
Jamison musterte ihn einen Moment lang und nickte resignierend. »Du wirst ihn besuchen, oder?«
»Ja. Aber vorher muss ich mit jemandem reden.«
2
Decker stand allein auf der Veranda. Er hatte Jamison gebeten, ihn nicht zu begleiten. Diesen Besuch wollte er aus verschiedenen Gründen allein machen.
Er erinnerte sich an jeden Zentimeter des mit einem Zwischengeschoss versehenen Hauses. Dies lag nicht allein an seinem unfehlbaren Gedächtnis, sondern auch daran, dass dieses Gebäude eine nahezu exakte Kopie des Hauses war, in dem er mit seiner Familie gewohnt hatte.
Mary Lancaster lebte mit ihrem Mann Earl und ihrer Tochter Sandy schon hier, seit sie bei der Polizei von Burlington angefangen hatte, etwa zur gleichen Zeit wie Decker. Earl war in seinem Beruf als Generalunternehmer, der die Oberaufsicht bei Bauvorhaben führte, nur sporadisch tätig, da Sandy mit dem Downsyndrom geboren war und besondere Aufmerksamkeit benötigte. Mary hatte lange Zeit den Hauptteil des Familieneinkommens beigesteuert.
Decker trat zur Haustür. Als er anklopfen wollte, wurde sie geöffnet.
Mary stand in ausgeblichenen Jeans und einem blutroten Sweatshirt vor ihm. Ihre einst blonden Haare hingen schlaff und grau auf die Schultern herab. In einer Hand hielt sie eine Zigarette, von der eine Rauchfahne emporstieg. Ihr Gesicht war von ebenso vielen Linien durchzogen wie ein Daumenabdruck. Mary war so alt wie Decker, sah aber zehn Jahre älter aus.
»Hab ich mir fast gedacht, dass ich dich heute noch sehe«, sagte sie mit der rauen Stimme einer Raucherin. »Komm rein.«
Er warf einen kurzen Blick auf ihre linke Hand, ihre Waffenhand, um zu sehen, ob das Zittern noch da war, das ihm vor einiger Zeit aufgefallen war. Er bemerkte nichts davon.
Was schon mal gut ist.
Mary drehte sich um, und er folgte der viel kleineren Frau ins Haus und schloss die Tür. Es war, als würde ein kleiner Schlepper ein riesiges Frachtschiff in den sicheren Hafen geleiten. Oder vielleicht auf eine Klippe, das war noch nicht heraus.
Decker stellte fest, dass Mary noch dünner geworden war. Ihre Knochen zeichneten sich unter dem Sweatshirt ab, als hinge es auf einem Kleiderbügel.
»Funktioniert es nicht mehr mit dem Nikotinkaugummi?«, fragte er mit Blick auf ihre Zigarette.
Sie setzten sich in das kleine Wohnzimmer, in dem Spielzeug, Zeitungsstapel und offene Kartons herumlagen. Ihr Zuhause war immer schon ein einziges Durcheinander gewesen, wie Decker wusste. Vor einigen Jahren hatten die Lancasters einen Reinigungsdienst in Anspruch genommen, aber auch das hatte seine Probleme mit sich gebracht. Schließlich hatten sie sich damit abgefunden, im Chaos zu leben.
Mary nahm einen Zug von ihrer Camel und ließ den Rauch durch die Nase entweichen.
»Ich genehmige mir eine pro Tag, immer um diese Zeit, und das auch nur, wenn Earl und Sandy draußen sind. Danach renne ich mit dem Duftspray durchs ganze Haus.«
Decker schnupperte und hustete. »Dann solltest du’s mit ein bisschen mehr Spray probieren.«
»Meryl Hawkins hat dich gefunden, stimmt’s?«
»Ja. Er hat behauptet, du hättest ihm gesagt, wo ich bin.«
»Stimmt. Hab ich.«
»Geht das nicht ein bisschen zu weit? Du weißt, warum ich in der Stadt bin. Ich hatte dich vorher angerufen.«
Sie lehnte sich zurück und kratzte sich mit dem Fingernagel am Handrücken. »Ich hab das nicht leichtfertig getan, das kannst du mir glauben. Aber ich dachte mir, du willst es wissen.«
»Hawkins hat gesagt, du glaubst ihm, dass er unschuldig gesessen hat.«
»Da hat er ein bisschen übertrieben. Ich habe ihm nur gesagt, ich verstehe sein Anliegen.«
»Welche Argumente hat er für seine Unschuld?«
»Warum sollte er so kurz vor dem Tod hierherkommen und uns bitten, seinen Namen reinzuwaschen, wenn er nicht wirklich unschuldig ist?«
»Da fällt mir schon ein möglicher Grund ein.«
Mary nahm einen Zug von ihrer Zigarette und schüttelte den Kopf. »Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass man so kurz vor dem Ende manches anders sieht. Da hat man keine Zeit mehr zu vergeuden.«
Decker blickte zu den offenen Kartons. »Sag mal, wollt ihr umziehen?«
»Vielleicht.«
»Vielleicht? Seid ihr euch noch nicht sicher?«
Lancaster zuckte mit den Schultern. »Was ist schon sicher im Leben?«
»Wie ist die Lage in Burlington?«
»Nicht gerade rosig, aber die Leute hier sind zäh.«
»Die Arbeitslosigkeit sinkt überall.«
»Ja, es gibt jetzt viele Billigjobs, wo man zehn Dollar die Stunde verdient. Wenn du in einer Situation wie meiner mit zwanzig Riesen im Jahr auskommst, ziehe ich den Hut vor dir.«
»Wo sind Earl und Sandy?«
»Auf einer Schulveranstaltung. Earl kümmert sich mehr um solche Dinge als ich. Mein Job war in letzter Zeit nicht lustig. In miesen Zeiten hast du es mit vielen miesen Fällen zu tun. Jede Menge Drogendelikte.«
»Ja, ist mir auch aufgefallen. Sag mal, warum ist Hawkins ausgerechnet zu dir gekommen?«
»Du und ich haben damals zusammen ermittelt, Decker, schon vergessen? Es war unser erster Mordfall.«
»Wann ist er rausgekommen? Und hat er wirklich Krebs im Endstadium? Er sieht jedenfalls so aus.«
»Er ist vor zwei Tagen ins Revier spaziert. Ein verdammter Schock, kann ich dir sagen. Zuerst dachte ich, er sei ausgebrochen. Ich hab ihm seine Geschichte nicht abgekauft und sofort im Gefängnis angerufen. Hawkins sagt die Wahrheit. Der Mann hat Krebs und wurde tatsächlich entlassen.«
»Die können unheilbar kranke Häftlinge einfach so auf die Straße setzen und sie allein sterben lassen?«
»Anscheinend ist das ihre Art, Kosten zu sparen.«
»Er hat gesagt, er ist noch zwei Tage in der Stadt. Er wohnt im Residence Inn.«
»So wie du damals.«
»Die haben dort ein gutes Buffet. Hawkins könnte ein paar üppige Mahlzeiten vertragen, aber wahrscheinlich hat er keinen großen Appetit. Er sagt, er versorgt sich bei Straßendealern mit Schmerzmitteln.«
»Tja, ziemlich traurig, wie es hierzulande läuft.«
»Er will noch einmal mit mir reden.«
Mary nahm einen Zug von der Zigarette. »Davon gehe ich aus.«
»Er hat mich auf dem Friedhof angesprochen.«
Nach einem weiteren tiefen Zug drückte Mary die Zigarette im Aschenbecher aus und betrachtete die Kippe einen Moment lang wehmütig.
»Das tut mir leid. Ich habe ihm nicht direkt gesagt, warum du dich in der Stadt aufhältst. Was mit deiner Familie passiert ist, habe ich ihm zwar erzählt, aber nicht, dass er dich auf dem Friedhof finden kann.« Sie zögerte einen Moment und schaute dann zu ihm, bis ihre blassen Augen seine fanden. »Ich nehme an, du hast dir den Fall Hawkins noch einmal in allen Details durch den Kopf gehen lassen?«
»Ja, hab ich. Und ich sehe nirgends ein Problem bei dem, was wir getan haben. Wir haben den Tatort gründlich untersucht und Hinweise gesammelt. Alles hat auf Hawkins hingedeutet. Er wurde festgenommen und vor Gericht gestellt. Wir haben unsere Aussage gemacht. Hawkins’ Anwalt hat uns beide ins Kreuzverhör genommen, und die Geschworenen haben ihn schuldig gesprochen. Er bekam lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung, obwohl auch die Todesstrafe möglich gewesen wäre. Für mich war der Fall glasklar.«
Mary Lancaster lehnte sich im Stuhl zurück.
Decker beäugte sie einen Moment lang. »Du siehst nicht besonders gut aus, Mary.«
»Ich sehe schon seit mindestens zehn Jahren wie ’ne alte Schachtel aus, Amos. Das müsstest du doch am besten wissen.«
»Trotzdem.«
»Du hast viel abgenommen, seit du weggegangen bist.«
»Da ist hauptsächlich Jamison dran schuld. Sie treibt mich an, Übungen zu machen und gesünder zu essen. Sie kocht oft selbst. Es gibt viel Salat, Gemüse und Tofu. Sie hat inzwischen ihre FBI-Dienstmarke. Die hat sie sich redlich verdient. Ich bin echt stolz auf sie.«
»Heißt das, ihr zwei lebt zusammen?«, fragte Lancaster mit gehobenen Brauen.
»Wir wohnen zusammen, das ja.«
»Aber ihr seid mehr als nur Arbeitskollegen, oder?«
»Mary, ich bin viel älter als sie.«
»Es kommt heute gar nicht so selten vor, dass ältere Männer etwas mit jüngeren Frauen haben.«
»Wir sind bloß Arbeitskollegen.«
»Verstehe.« Sie beugte sich vor. »Was ist jetzt mit Hawkins?«
»Warum hast du plötzlich Zweifel an dem Urteil? Der Fall war so klar wie sonst was.«
»Vielleicht ein bisschen zu klar.«
»Wie kommst du darauf? Hast du Hinweise, die wir damals nicht hatten?«
»Nein. Und ich weiß auch nicht, ob Hawkins die Wahrheit sagt oder nicht. Aber wenn er sich die Mühe macht, in seinem Zustand hierherzukommen, sollte man vielleicht noch mal einen Blick auf die Sache werfen.«
Decker wirkte nicht überzeugt, sagte dann aber: »Okay, dann am besten gleich.«
»Was?« Sie sah ihn überrascht an.
»Sehen wir uns den Tatort noch einmal an. Da ist doch bestimmt niemand eingezogen nach dem, was damals passiert ist, oder?« Er zögerte einen Augenblick, ehe er hinzufügte: »In meinem alten Haus will ja auch keiner mehr wohnen.«
»Da irrst du dich. In deinem Haus wohnt wieder jemand.«
»Was?« Ihm fiel die Kinnlade herunter. »Wer?«
»Ein junges Paar mit einem kleinen Mädchen. Die Hendersons.«
»Du kennst sie?«
»Kaum. Ich weiß nur, dass sie vor einem halben Jahr eingezogen sind.«
»Und das andere Haus? Wohnt da auch jemand?«
»Vor fünf Jahren sind Leute eingezogen, aber vor einem Jahr wieder weggegangen, als die Kunststofffabrik dichtgemacht und die Produktion ins Ausland verlegt hat, so wie alle anderen Fabriken, die es im Mittleren Westen mal gegeben hat. Seitdem steht das Haus leer.«
Decker erhob sich. »Also gut, kommst du mit? Wie in alten Zeiten?«
»Ich weiß nicht, ob ich die alten Zeiten vermisse.« Dennoch stand Lancaster auf und nahm eine Jacke vom Haken. »Und wenn sich herausstellt, dass Hawkins die Wahrheit sagt?«, fragte sie auf dem Weg zur Tür.
»Dann müssen wir herausfinden, wer es wirklich getan hat. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Nicht annähernd.«
»Du arbeitest nicht mehr hier, Decker. Einen alten Mordfall aufzuklären, ist nicht dein Job.«
»Mein Job ist es, Mörder zu finden, egal wo sie sind.«
3
Das Haus der Richards. Der Schauplatz eines Verbrechens, das sich vor dreizehn Jahren ereignet hatte.
Es stand an einer Schotterstraße mit zwei Gebäuden auf der linken und zwei auf der rechten Seite. Das heruntergekommene Haus der Richards befand sich am Ende der Sackgasse, auf einem 4000 Quadratmeter großen, von Gras und Büschen überwucherten Grundstück.
Es hatte schon damals etwas Unheimliches an sich gehabt. Der Eindruck hatte sich im Laufe der dreizehn Jahre verstärkt.
Sie hielten vor dem Haus und stiegen aus Deckers Wagen. Mary Lancaster zitterte leicht, was nicht nur an der Kälte lag.
»Hat sich nicht sehr verändert«, bemerkte Decker.
»Die Familie, die ein paar Jahre hier gewohnt hat, hatte einiges repariert und ausgebessert. War auch bitter nötig. Das meiste haben sie drinnen gemacht. Neue Einrichtung, frischer Anstrich, neue Teppiche, solche Sachen. Das Haus hat lange leer gestanden. Nach dem, was hier passiert ist, wollte hier keiner mehr wohnen.«
»Man sollte meinen, ein Bankmensch könnte sich etwas Schickeres leisten.«
»Er war Kreditberater. Keiner von diesen Investmentleuten oder so. Da verdient man nicht so toll, schon gar nicht in einer Stadt wie Burlington. Außerdem ist dieses Haus viel größer als meins, mit viel mehr Grund und Boden.«
Sie gingen zur Veranda. Decker versuchte, die Tür zu öffnen.
»Abgeschlossen.«
»Warum schließt du nicht auf?«, schlug Lancaster vor.
»Heißt das, du gibst mir die Erlaubnis einzubrechen?«
»Wäre nicht das erste Mal. Und es ist ja nicht so, dass wir einen Tatort kontaminieren. Die Sache ist ewig her.«
»Hast recht.« Decker schlug die Fensterscheibe neben der Tür ein, langte ins Innere und schloss auf. Er knipste seine Maglite-Stablampe an und ging hinein, gefolgt von einer angespannten Mary Lancaster.
»Erinnerst du dich an damals?«, fragte sie und fügte hinzu: »Ist eine rhetorische Frage, versteht sich.«
Decker schien sie gar nicht zu hören. In seinen Gedanken war er wieder der frisch ernannte Detective der Mordkommission, der zuvor zehn Jahre Streifenpolizist und danach einige Jahre als Detective für Raub-, Betrugs- und Drogendelikte zuständig gewesen war. Er und Lancaster waren zum Haus der Richards gerufen worden, nachdem jemand verdächtige Geräusche gemeldet und zwei Polizisten die Toten gefunden hatten. Es war ihre erste Mordermittlung gewesen; sie hatten sich besondere Mühe gegeben, keine Fehler zu machen.
Als junge uniformierte Polizistin hatte Mary Lancaster sich nie geschminkt, vielleicht, um nicht zu sehr als Frau wahrgenommen zu werden. Sie war die einzige Frau bei der örtlichen Polizei gewesen, sah man von denen ab, die Schreibtischarbeit erledigten oder für die Jungs Kaffee kochten. Mary war die Einzige, die eine Waffe trug, Leute festnahm und ihnen ihre Rechte vorlas. Die sogar befugt war, ihnen notfalls das Leben zu nehmen.
Damals hatte sie noch nicht geraucht. Damit fing sie erst an, als sie als Ermittlerin mit Decker zusammenarbeitete. Als der Job düsterer und bedrückender wurde, was bei der Mordkommission nicht ausblieb. Als sie regelmäßig mit Toten zu tun hatte und deren Mörder finden musste. Damals war Mary fülliger gewesen, aber gesund und fit. Sie hatte sich den Ruf einer ruhigen, besonnenen Polizistin erworben, die sich für jede Situation mehrere Optionen zurechtlegte. Und sie ließ sich durch nichts erschüttern. Als Streifenpolizistin war sie für ihr umsichtiges Vorgehen des Öfteren belobigt worden, hatte auch in kritischen Situationen dafür gesorgt, dass niemand zu Schaden kam. Später, als Detective, hatte sie diese Linie beibehalten.
Decker wiederum hatte als der schrulligste Typ gegolten, der je in Burlington eine Polizeiuniform getragen hatte. Seine Fähigkeiten als Polizist waren jedoch unbestritten gewesen. So richtig zum Tragen kamen seine Qualitäten als Detective an der Seite von Mary Lancaster. Zusammen hatten sie jeden ihrer Fälle aufklären können – eine Bilanz, um die sie alle Mordkommissionen im Land beneidet hätten.
Sie hatten sich schon vorher gekannt, hatten gemeinsam die Polizeischule besucht, aber beruflich kaum miteinander zu tun gehabt, bis sie die Uniform gegen die Zivilkleidung eines Detectives eintauschten.
Nun ging Decker die Ereignisse jener Nacht Schritt für Schritt in seiner Erinnerung durch, während Lancaster ihn aus einer Ecke des Wohnzimmers beobachtete.
»Weißt du noch?«, fragte er. »Jemand verständigte den Notruf und gab an, verdächtige Geräusche aus dem Haus gehört zu haben. Das war um einundzwanzig Uhr fünfunddreißig. Fünf Minuten später waren zwei Streifenwagen da. Die Jungs sahen sich kurz draußen um und drangen dann ins Haus ein. Es war nicht abgeschlossen.«
Er ging auf die andere Seite des Zimmers.
»Opfer Nummer eins, David Katz, wurde hier gefunden.« Er deutete auf eine Stelle an der Tür zur Küche. »Fünfunddreißig Jahre alt. Zwei Schusswunden – eine in der Schläfe, die andere im Hinterkopf. Beide absolut tödlich.« Er zeigte auf eine andere Stelle neben der Tür. »Hier wurde eine Bierflasche gefunden, mit Katz’ Fingerabdrücken drauf. Sie war nicht zerbrochen, aber das Bier war auf dem Fußboden ausgelaufen.«
Mary nickte. »Katz hatte ein Restaurant in der Stadt geführt, den American Grill«, fügte sie hinzu. »Er war zu Besuch hier.«
»Ja. Nichts hatte darauf hingedeutet, dass er das Ziel des Mörders war«, hielt Decker fest.
»Absolut nichts«, bestätigte Lancaster. »Er war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Wie Ron Goldman im Fall O. J. Simpson. Einfach nur Pech.«
Sie gingen in die Küche mit ihrem schmierigen Linoleumboden, den verschrammten Schränken und der rostigen Spüle.
»Opfer Nummer zwei, Donald Richards, von allen Don genannt. Vierundvierzig. Banker. Ein Schuss ins Herz. Er war auf der Stelle tot.«
Wieder nickte Lancaster. »Er kannte Katz, weil seine Bank dem Mann einen Kredit für sein Restaurantprojekt gegeben hatte.«
Decker ging zurück ins Wohnzimmer und blickte zur Treppe in den ersten Stock.
»Nun zu den beiden anderen Opfern.«
Sie stiegen die Treppe hinauf, und Decker deutete auf zwei einander gegenüberliegende Türen. »Diese beiden Zimmer.«
Er drückte die Tür auf der linken Seite auf und trat ein. Lancaster folgte ihm.
»Opfer Nummer drei«, fuhr Decker fort. »Abigail ›Abby‹ Richards. Zwölf Jahre alt.«
»Sie wurde erdrosselt. Lag auf dem Bett. Die Strangmarken haben darauf hingedeutet, dass irgendein Seil benutzt wurde, das der Mörder nach der Tat wieder mitgenommen hat.«
»Sie ist nicht sofort gestorben«, fügte Decker hinzu.
»Nein. Sie hat sich mit aller Kraft gewehrt.«
»Und sie hatte Hautreste von Meryl Hawkins unter den Fingernägeln«, hielt Decker fest. »Die DNA-Analyse hat den Hurensohn eindeutig überführt. Also hat Abby ihn in gewisser Weise noch im Tod besiegt.«
»Was Hawkins’ Behauptung, es gar nicht gewesen zu sein, umso aberwitziger macht«, murmelte Lancaster.
Decker ging hinaus, durchquerte den Flur und betrat das Zimmer gegenüber. Lancaster kam hinterher.
Decker ging zu einer Stelle an der Wand. »Opfer Nummer vier. Frankie Richards. Vierzehn Jahre. Hatte kurz zuvor an der Highschool begonnen. Wurde hier auf dem Boden gefunden. Ein Schuss ins Herz.«
»Wir haben in seinem Zimmer Drogenzubehör und Bargeld gefunden. Offenbar hatte er trotz seines zarten Alters nicht nur Drogen konsumiert, sondern auch vertickt. Aber ein Zusammenhang mit den Morden war nicht zu erkennen. Wir hatten allerdings den Mann ausfindig gemacht, der Frankie den Stoff verkauft hat: Karl Stevens, ein kleiner Fisch. Weit und breit kein Motiv für einen vierfachen Mord. Zudem hatte Stevens ein wasserdichtes Alibi.«
Decker nickte. »Wir wurden um zwanzig nach zehn gerufen und waren vierzehn Minuten später vor Ort.«
Er lehnte sich an die Wand, blickte aus dem Fenster auf die Straße hinunter. »Vier Nachbarhäuser. In zweien war in der Mordnacht jemand zu Hause. Aber niemand hatte etwas gesehen oder gehört. Der Mörder kam und ging unbemerkt. Vielleicht wäre ihm nie jemand auf die Schliche gekommen.«
»Schon möglich«, sagte Mary. »Aber als wir dann das Haus durchsuchten, hast du eine entscheidende Spur gefunden.«
Decker nickte. Er ging voraus die Treppe hinunter und zurück ins Wohnzimmer. »Ein Daumenabdruck an diesem Lichtschalter, mit einer Blutspur von Katz.«
»Dazu die blutigen Hautfetzen unter Abbys Fingernägeln und damit die DNA des Täters.«
»Er hat sie stranguliert. Sie wehrt sich, packt seine Arme mit aller Kraft. Dabei bleiben Hautfetzen unter ihren Nägeln hängen. So viel weiß jeder, der schon mal eine Folge CSI gesehen hat.«
Lancasters Hand verschwand in der Jackentasche. Sie fischte Zigaretten heraus und stippte mit der Fingerspitze eine aus der Schachtel.
Decker blickte zu ihr, als sie sich die Zigarette anzündete. »Du nimmst eine Anleihe auf die morgige Ration?«
»Es ist fast schon Mitternacht, und ich bin gestresst. Du wirst es mir nachsehen müssen.« Sie schnippte etwas Asche auf den Boden. »Also, weiter. Hawkins’ Fingerabdrücke waren in der Datenbank, weil die Firma, bei der er gearbeitet hatte, auch für das Verteidigungsministerium tätig war. Deshalb wurden die Mitarbeiter gründlich überprüft und allen die Fingerabdrücke abgenommen. Als wir die Übereinstimmung mit Hawkins’ Abdruck aus der Datenbank feststellten, gingen wir mit einem Durchsuchungsbeschluss zu ihm.«
Decker übernahm es, den Rest zu rekapitulieren. »Aufgrund des Fingerabdrucks wurde er festgenommen. Ein DNA-Abstrich ergab eine Übereinstimmung mit den Hautfetzen unter Abbys Fingernägeln. Zudem hatte er für die Tatzeit kein Alibi. Bei der Hausdurchsuchung wurde außerdem in einem Versteck in seinem Wandschrank eine Pistole vom Kaliber .45 gefunden. Die ballistische Überprüfung ergab, dass es die Tatwaffe war. Er behauptete, die Pistole gehöre ihm nicht und er wisse nicht, wie sie da hingekommen sei. Er habe gar nicht von dem Versteck gewusst. Es stellte sich heraus, dass die Pistole zwei Jahre zuvor aus einem Waffengeschäft gestohlen worden war. Die Seriennummer war abgefeilt. Wahrscheinlich war sie bereits bei mehreren Verbrechen zum Einsatz gekommen, bevor sie in Hawkins’ Schrank landete.« Er sah zu seiner ehemaligen Kollegin. »Bei dieser klaren Beweislage komme ich wieder auf meine Frage zurück: Wie kommst du darauf, dass wir uns geirrt haben könnten? Für mich sieht das alles zu hundert Prozent schlüssig aus, so wie damals.«
Lancaster drehte die Zigarette zwischen den Fingern. »Ich kann nur wiederholen, was ich bereits gesagt habe. Es ist bemerkenswert, dass ein Sterbender sich die Mühe macht, seinen Namen reinzuwaschen. Hawkins weiß selbst, dass alle Hinweise gegen ihn sprechen. Warum sollte er das bisschen Zeit, das ihm noch bleibt, damit verschwenden, wenn an seiner Unschuldsbehauptung nicht etwas dran wäre?«
»Was hätte er denn Besseres zu tun?«, hielt Decker dagegen. »Ich behaupte ja nicht, dass er mit dem Vorsatz ins Haus gekommen ist, vier Leute zu ermorden. Vielleicht war es ein Einbruch, der aus dem Ruder gelaufen ist. So etwas haben wir oft genug erlebt. Verbrecher verlieren in einer Extremsituation leicht die Nerven.«
»Aber du kennst ja Hawkins’ Motiv, falls er es denn getan hat«, sagte Lancaster. »Es ist im Prozess zur Sprache gekommen. Ohne die Schuld des Angeklagten ausdrücklich einzugestehen, hat die Verteidigung versucht, damit Sympathiepunkte zu sammeln. Vielleicht war das der Grund, warum ihm die Todesstrafe erspart blieb.«
»Ja, das angebliche Motiv.« Decker nickte. »Hawkins’ Frau war todkrank. Er brauchte Geld für Schmerzmittel. Er hatte seinen Job und seine Versicherung verloren. Außerdem hatte seine erwachsene Tochter ein Drogenproblem, und er wollte, dass sie auf Entzug ging. Also hat er Kreditkarten und Schmuck gestohlen, außerdem einen Laptop, einen DVD-Player, ein paar Uhren und verschiedene andere Dinge aus diesem Haus. Es passte alles zusammen. Sein Motiv mag menschlich verständlich gewesen sein, aber das entschuldigt nicht, was er am Ende getan hat.«
»Aber diese Gegenstände sind nirgends aufgetaucht. Nicht in seinem Haus, nicht in einem Pfandhaus. Also hat er nie Geld dafür bekommen.«
»Aber er hatte doch Geld bei sich, als er festgenommen wurde. Wir konnten nicht beweisen, ob es vom Verkauf der gestohlenen Wertsachen stammte. Der Staatsanwalt hat gemeint, Hawkins könne nach den Morden aus Angst gezögert haben, die Diebesbeute zu verscherbeln. Aber die Geschworenen haben wohl eher die Ansicht vertreten, dass das Geld vom Verkauf der gestohlenen Sachen stammte. Es ist schlichtweg naheliegender.«
»Es hat aber kein Nachbar ein Auto kommen oder wegfahren sehen, außer dem von David Katz«, gab Lancaster zu bedenken.
»Du weißt ja, dass in der Nacht ein Unwetter tobte und dass es wie aus Eimern geschüttet hat. Man konnte kaum die Hand vor Augen sehen. Wenn Hawkins ohne Licht zum Tatort gefahren war, wäre es nur logisch, dass keiner ihn bemerkt hat.«
»Aber jemand muss doch etwas gehört haben«, hielt Lancaster dagegen.
»Bei dem Gewitter? Nicht unbedingt. Aber ich sehe schon, du hast wirklich ernste Zweifel.«
»Ich finde nur, es kann nicht schaden, sich die Sache noch einmal genauer anzusehen.«
»Ehrlich gesagt, ich wüsste nicht warum.«
»Ha! Ich seh’s dir doch an, dass auch du neugierig geworden bist.« Sie nahm einen Zug von der Zigarette. »Und dann ist da noch die Sache mit Susan Richards.«
»Die Ehefrau. Sie fuhr um fünf Uhr nachmittags weg, machte ein paar Besorgungen, war beim Elternabend und ging dann noch mit zwei Freundinnen essen. Ist alles belegt und bestätigt. Sie kam um elf nach Hause. Als sie uns in ihrem Haus sah, verlor sie völlig die Nerven.«
»Kann man wohl sagen. Du musstest sie festhalten, sonst hätte sie sich vielleicht etwas angetan.«
»Ja. Nicht die Reaktion einer Schuldigen. Außerdem belief sich die Lebensversicherung ihres Mannes nur auf fünfzigtausend Dollar.«
»Ich habe Leute gesehen, die jemanden für viel weniger umgebracht haben.«
»Komm, lass uns gehen«, sagte Decker.
»Wohin?«
»Wohin schon? Zu Meryl Hawkins.«
*
Als sie vor dem Residence Inn hielten, hatte Decker ein kurzes Déjà-vu. Er hatte eine Weile in dem Hotel gewohnt, nachdem er das Haus, in dem seine Familie ermordet worden war, durch Zwangsvollstreckung verloren hatte. Das Hotel hatte sich kaum verändert, wirkte allenfalls noch eine Spur schäbiger als damals. Man wunderte sich fast, dass es noch stand.
Sie gingen hinein, und Decker blickte nach links zu dem kleinen Speiseraum, den er damals als Büro genutzt hatte, um sich mit Klienten zu treffen, die ihn als Privatdetektiv engagieren wollten. In den wenigen Jahren, die seither vergangen waren, hatte sich viel für ihn verändert. Es hätte auch ganz anders kommen können. Er hätte sich zu Tode fressen und in dem Pappkarton auf dem Walmart-Parkplatz sterben können, der für kurze Zeit, auf dem absoluten Tiefpunkt, sein Zuhause gewesen war, bevor er in das »noblere« Residence Inn übersiedelte.
Decker war nicht überrascht, als er Alex Jamison in die Lobby kommen sah.
Jamison nickte Lancaster zu, ehe sie sich an Decker wandte. »Du hast mich vermutlich hier erwartet, oder?«
»Ich habe dich nicht erwartet«, widersprach er. »Ich habe dir nur den Zettel mit der Adresse gezeigt.«
»Ich habe die wichtigsten Fakten des Falles online nachgelesen«, erklärte Jamison. »Die Beweislage war hieb- und stichfest.«
»Darüber haben wir gerade diskutiert«, warf Lancaster ein. »Die Frage ist, ob wirklich alles so hieb- und stichfest war oder eher wurmstichig.« Sie schaute auf Jamisons Dienstmarke. »Ich habe schon gehört, dass Sie jetzt offiziell FBI-Agentin sind. Gratuliere.«
»Danke. Es schien mir ein logischer Schritt zu sein. So kann ich Decker ein bisschen besser … nun ja, managen.«
»Viel Glück dabei. Das ist mir nie gelungen, trotz meiner Dienstmarke und allem.«
»Hawkins hat Zimmer vierzehn«, kam Decker auf den Punkt. »Die Treppe rauf.«
Sie stiegen hintereinander in den ersten Stock hinauf. Das Zimmer befand sich auf halber Höhe des Flurs. Decker klopfte an. Dann noch einmal.
»Mr. Hawkins? Ich bin’s, Amos Decker.«
Von drinnen kam kein Laut.
»Vielleicht ist er weggegangen«, überlegte Jamison.
»Wohin sollte er schon?«, meinte Decker skeptisch.
»Das lässt sich feststellen.« Lancaster eilte die Treppe hinunter. Eine Minute später war sie zurück.
»Der Mann am Empfang sagt, er sei vor zwei Stunden zurückgekommen und seither nicht mehr weggegangen.«
Decker klopfte mit mehr Nachdruck. »Mr. Hawkins? Alles in Ordnung bei Ihnen?« Er schaute die zwei Frauen an. »Möglicherweise braucht er Hilfe.«
»Vielleicht ist er gestorben«, meinte Lancaster. »In seinem Zustand wäre es kein Wunder.«
»Oder er ist eingeschlafen«, erwog Jamison. »Vielleicht hat er zu viel von seinen Medikamenten geschluckt. Er hat die Pillen auf der Straße gekauft – das Zeug ist oft unberechenbar.«
Decker versuchte die Tür zu öffnen. Sie war abgeschlossen. Er rammte die Schulter dagegen, dann noch einmal. Die Tür bebte unter seinem beträchtlichen Gewicht, krachte in den Fugen und gab schließlich nach.
Sie traten ein und sahen sich um.
Auf einem Stuhl gegenüber vom Bett saß Hawkins.
Man sah auf den ersten Blick, dass er tot war.
Er war jedoch nicht an Krebs gestorben.
Die Schusswunde in der Stirn war der Krankheit zuvorgekommen.
4
Ein Toter wird ermordet.
Es klang wie der Anfang eines schlechten Witzes. Ein Mann mit Krebs im Endstadium, der höchstens noch ein paar Wochen zu leben hat, stirbt durch eine Kugel in den Kopf.
Der Gedanke ließ Decker nicht los, als er in Meryl Hawkins’ Hotelzimmer beobachtete, wie die zwei Leute von der Spurensicherung ihrer Arbeit nachgingen.
Ein Arzt hatte bereits den Tod des alten Mannes festgestellt. Auch der Gerichtsmediziner war erschienen und hatte verkündet, was ohnehin offensichtlich war: Hawkins war an einem Schuss in den Kopf gestorben. Dass es keine Austrittswunde gab, deutete darauf hin, dass es sich um eine kleinkalibrige Kugel handelte. Die, aus kurzer Entfernung abgefeuert, um nichts weniger tödlich war als eine großkalibrige Magnum.
Der Tod sei auf der Stelle eingetreten, hatte der Gerichtsmediziner erklärt. Schnell und schmerzlos.
Kann man das wirklich mit Sicherheit sagen?, fragte sich Decker. Bei dem Toten können wir uns jedenfalls nicht mehr erkundigen.
Er schaute auf den Leichnam.
Entschuldigen Sie, hat es wehgetan, als man Ihnen das Hirn rausgepustet hat?
Besonders aussagekräftig waren die Schmauchspuren auf der Stirn. Die Mündung der Waffe musste die Haut berührt haben oder zumindest Millimeter davon entfernt gewesen sein. Die Wirkung war so, als würde man ein glühend heißes Eisen berühren. In diesem Fall waren die Spuren durch die heißen Rückstände des Mündungsfeuers einer Schusswaffe verursacht worden.
Decker sah zu Lancaster, die die Arbeit der Spurensicherung überwachte. Die beiden uniformierten Cops, die vor der Tür postiert waren, machten einen müden, gelangweilten Eindruck. Jamison hingegen beobachtete das Geschehen interessiert von der anderen Seite des Zimmers.
Schließlich kam Mary Lancaster zu Decker herüber. Jamison schloss sich den beiden an.
»Von den Leuten, die wir befragt haben«, erklärte Mary, »hat niemand etwas gesehen oder gehört.«
»So wie damals, als Hawkins ins Haus der Richards eindrang und die Familie ermordete«, meinte Decker.
Mary nickte. »Und die benachbarten Zimmer sind unbewohnt. Außerdem kann der Täter einen Schalldämpfer benutzt haben.«
»Als ich hier gewohnt habe, gab es eine Hintertür, die sich nicht richtig abschließen ließ«, erinnerte sich Decker. »Der Killer kann auf diesem Weg hereingekommen sein, ohne dass er am Empfang vorbeimusste.«
»Ich lasse das überprüfen. Die Zimmertür war jedenfalls abgeschlossen, als du sie aufgebrochen hast.«
»Vermutlich hat Hawkins den Mörder selbst hereingelassen«, meinte Jamison. »Und diese Türen schließen automatisch, wenn man rausgeht und sie ins Schloss fallen lässt. Kennen wir schon den Todeszeitpunkt?«
»Der Gerichtsmediziner schätzt, dass der Tod zwischen elf Uhr und Mitternacht eingetreten ist.«
Decker schaute auf die Uhr. »Das heißt, wir haben den Täter knapp verpasst. Wären wir gleich hierhergekommen, statt zum Haus der Richards …«
»Hinterher ist man immer klüger«, meinte Lancaster.
»Decker?«
Er drehte sich um und schaute auf eine Frau im blauen Overall hinunter. Die Kriminaltechnikerin war Mitte dreißig und schlank, hatte rote Haare und Sommersprossen auf der Nase.
»Kelly Fairweather«, sagte Decker.
Sie lächelte erstaunt. »Sie erinnern sich an mich?«
»Keine große Kunst«, erwiderte Decker ohne jede Ironie.
Fairweather schaute auf Hawkins’ Leiche hinunter. »An den hier erinnere ich mich auch.«
Lancaster trat zu ihnen. »Ja, stimmt. Sie waren damals am Tatort im Haus der Richards.«
»Genau. In meinem ersten Jahr. Vier Opfer, zwei davon Kinder. Kein leichter Start in den Job. Warum sind Sie hier, Decker?«
»Ich wollte nur ein paar Dinge klären.«
»Viel Glück dabei. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte Hawkins die Giftspritze bekommen müssen für das, was er getan hat. Auch wenn das natürlich nicht entschuldigt, was hier passiert ist.«
»Nein, tut es nicht«, betonte Lancaster.
Fairweather verstand es als Aufforderung, mit ihrer Arbeit weiterzumachen. »Hat mich gefreut, Sie zu sehen, Decker.«
Als sie außer Hörweite war, trat Decker noch einmal vor den Stuhl, auf dem der Tote immer noch wie eine Statue saß. Lancaster und Jamison schlossen sich ihm an.
»Der Täter geht auf Hawkins zu«, begann Decker, »setzt ihm die Pistole an die Stirn und drückt ab.« Er schaute sich um. »Keine Anzeichen eines Kampfes?«
»Vielleicht hat er geschlafen«, mutmaßte Lancaster.
»Nachdem er den Täter hereingelassen hat, setzt er sich auf den Stuhl und schläft ein?«, hielt Jamison dagegen.
Decker rieb sich das Kinn. »Nun ja, er hat gesagt, er nimmt regelmäßig Medikamente. Habt ihr welche gefunden?«
Lancaster schüttelte den Kopf. »Weder hier noch im Badezimmer. Auch keine Verpackungen oder leeren Fläschchen. Nur ein kleiner Seesack mit Kleidung und ein paar Dollar in der Brieftasche. Die Obduktion wird zeigen, ob er irgendeine Substanz genommen hat.«
Decker sah sich erneut im Zimmer um, achtete auf jede Kleinigkeit und prägte sie sich ein. Es war im Grunde überflüssig, denn jede Einzelheit hatte sich bereits in sein außergewöhnliches Hirn eingebrannt, aber er wollte sichergehen, nichts zu übersehen. In letzter Zeit hatte sein Gedächtnis ein paar Aussetzer gehabt, deshalb wollte er besonders gründlich vorgehen. Es war, als würde man ein Foto ein zweites Mal ausdrucken.
Hawkins’ gelbliche Haut hatte eine durchscheinende Blässe angenommen. Der Tod hatte zur Folge, dass der Blutfluss zum Erliegen kam. Wenigstens konnte der Krebs sein Zerstörungswerk nicht fortsetzen. Mit dem Tod hatte die tückische Krankheit augenblicklich aufgehört, Hawkins’ Organe zu zersetzen. Decker dachte sich, dass der schnelle Tod durch eine Kugel einem langsamen, qualvollen Dahinsiechen vorzuziehen war. Mord war es trotzdem.
»Also, wie sieht es mit Motiven und möglichen Verdächtigen aus?«, fragte Lancaster in den Raum.
»Ihr habt wahrscheinlich auch schon daran gedacht«, meinte Decker, »aber ich frage trotzdem: Lebt Susan Richards noch in der Gegend?«
»Ja.«
»Dann würde ich hier ansetzen.«
Lancaster sah auf die Uhr. »Ich lasse sie aufs Revier bringen, dann können wir sie befragen.«
»Heißt das, Sie wollen uns in die Ermittlung einbeziehen?«, fragte Jamison überrascht.
»Wie sagt man – mitgefangen, mitgehangen.«
»Es ist nur so, dass wir auch unseren Job haben«, erwiderte Jamison. »Und der hält sich nicht an die Bürozeiten, sondern nimmt uns oft Tag und Nacht in Anspruch.«
»Ich kann Bogart anrufen«, schlug Decker vor. Ross Bogart war der altgediente FBI-Agent, der die Sondereinheit leitete, der Decker und Jamison angehörten.
»Heißt das, du willst dich noch einmal mit dem Fall beschäftigen?«, fragte Jamison skeptisch.
»Habe ich eine Wahl?«, erwiderte Decker.
»Man hat immer eine Wahl«, meinte Lancaster und musterte Decker mit wissendem Blick. »Aber ich glaube, ich weiß, wofür du dich entscheidest.«
»Decker«, setzte Jamison nach, »hast du dir das gut überlegt?«
Er deutete auf den Toten. »Das spricht eine klare Sprache. Der Mann kommt in die Stadt, behauptet, unschuldig zu sein, und will, dass Lancaster und ich es beweisen. Kurz darauf wird er ermordet.«
»Du hast ja selbst angedeutet, dass es Susan Richards gewesen sein könnte, die Witwe des Mannes, den Hawkins ermordet hat.«
»Vielleicht. Vielleicht auch nicht.«
Decker drehte sich um und ging.
Lancaster schaute zu Jamison. »Manche Dinge ändern sich nie. Er zum Beispiel.«
»Wem sagen Sie das«, murmelte Jamison.
5
»Das können wir nicht machen, Decker«, stellte Ross Bogart klar. »Das ist völlig inakzeptabel.«
Decker hatte ihn auf dem Weg zum Polizeirevier von Burlington angerufen.
»Ich kann verstehen, dass Sie das so sehen, Ross«, räumte er ein, »aber …«
»Dann ist es ja gut. Ich habe Ihnen schon mehr als einmal grünes Licht für Ihre Alleingänge gegeben. Denken Sie an den Fall Melvin Mars. Oder die Sache in Baronville, als Alex’ Familie betroffen war. Aber ich kann Sie nicht auf eigene Faust ermitteln lassen, wann immer Ihnen danach ist.«
»Das ist ein ganz spezieller Fall«, betonte Decker.
»Das sagen Sie jedes Mal«, blaffte Bogart. »Aber wenn ich für Sie ständig eine Ausnahme mache, wird die Ausnahme irgendwann zur Regel. Falls Sie es vergessen haben, Sie arbeiten immer noch fürs FBI.«
»Tut mir leid, Ross. Burlington ist nun mal die Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Ich kann mich nicht einfach umdrehen und gehen.«
»Heißt das, Sie haben sich entschieden?«
»Ja.«
»Dann zwingen Sie mich auch zu einer Entscheidung.«
»Das betrifft nur mich. Alex hat nichts damit zu tun.«
»Mit Special Agent Jamison rede ich später.«
Bogart trennte die Verbindung.
Langsam steckte Decker das Mobiltelefon weg. Allem Anschein nach waren seine Tage beim FBI gezählt.
Er sah zu Lancaster, die mit ihm im Auto saß.
»Probleme?«, fragte sie.
»Die gibt es immer.«
Sie fuhren schweigend weiter.
*
Susan Richards war außer sich. »Sie wollen mich verarschen, oder? Sie glauben, ich habe den Dreckskerl umgebracht? Oh, ich habe es mir gewünscht, sehnlichst gewünscht, mehr aber auch nicht.«
Decker und Lancaster hatten soeben das Vernehmungszimmer im Polizeihauptquartier betreten. Jamison war ins Hotel zurückgekehrt, weil Decker von Bogart nicht die Erlaubnis bekommen hatte, in dem Fall zu ermitteln. Und daran würde sich auch nichts ändern. Bogart hatte Jamison wahrscheinlich schon informiert.
Sie hatten einige Stunden warten müssen, bis der Papierkram erledigt war, da Richards sich strikt geweigert hatte, sie aufs Revier zu begleiten. Die wütende Frau hatte sich viel Zeit gelassen, sich fertig zu machen, während die zwei Uniformierten ungeduldig warteten.
Nun war es bereits fünf Uhr morgens.
Mary Lancaster machte den Eindruck, als könne sie im Stehen einschlafen.
Decker hingegen sah aus, als könne er die Frau zehn Jahre lang befragen, wenn es sein musste.
Die Wände des Vernehmungszimmers waren immer noch senfgelb. Decker hatte sich nie erklären können, warum man diese Farbe ausgesucht hatte; vielleicht hatte der Hausmeister bloß ein paar alte Farbtöpfe im Keller gefunden und sich dann diese Geschmacksverirrung geleistet. Es hätte jedenfalls hübscher ausgesehen, die grauen Schlackenbetonsteine so zu belassen, wie sie waren. Aber vielleicht war es nicht beabsichtigt, dass ein Vernehmungszimmer hübsch aussah.
Susan Richards war zweiundvierzig Jahre alt gewesen, als ihre Familie ausgelöscht worden war. Jetzt, mit Mitte fünfzig, sah sie besser aus als damals, fand Decker. Er hatte sie als groß gewachsene, aber rundliche Frau von unscheinbarem Äußeren mit schlaffen hellbraunen Haaren in Erinnerung.
Nun war sie schlank und hatte modisch kurz geschnittenes, dezent gefärbtes Haar. Und sie hatte absolut nichts mehr von einer eingeschüchterten grauen Maus an sich, wie ihre unwirsche Reaktion deutlich machte, als die beiden Detectives zu ihr ins Vernehmungszimmer kamen.
Richards blickte zwischen Lancaster und Decker hin und her, als die beiden sich ihr gegenüber setzten. »Hey, Moment mal. Sie sind doch die zwei, die schon damals mit dem Fall zu tun hatten. Jetzt erkenne ich Sie wieder. Sie wissen doch, was er getan hat.« Sie beugte sich vor und drückte ihre kantigen Ellbogen auf die Tischplatte. »Sie wissen, was dieser Bastard verbrochen hat«, wiederholte sie mit zornbebender Stimme.
»Ja«, sagte Lancaster ganz ruhig. »Deshalb dachten wir uns, wir müssen mit Ihnen reden, als er tot aufgefunden wurde. Können Sie uns sagen, wo Sie gestern zwischen elf Uhr und Mitternacht waren?«
»Was glauben Sie denn? Ich war im Bett und hab geschlafen.«
»Kann das jemand bestätigen?«, fragte Decker.
»Ich lebe allein. Ich habe nicht wieder geheiratet. Es geht nicht spurlos an einem vorbei, wenn die ganze Familie ermordet wird!«, fauchte sie.
»Wann sind Sie gestern Abend nach Hause gekommen?«, hakte Decker nach.
Richards nahm sich einen Augenblick, um sich zu sammeln. »Um sechs bin ich von der Arbeit weg. Drei Tage die Woche helfe ich noch im Obdachlosenheim am Dawson Square aus. Dort war ich bis ungefähr acht. Das können alle bezeugen.«
»Und danach?«, fragte Lancaster.
Richards breitete die Hände aus. »Dann bin ich nach Hause gefahren und hab mir was zu essen gemacht.«
»Was haben Sie gegessen?«, setzte Lancaster nach.
»Meine Güte, das Übliche. Als Appetithappen Räucherlachs auf Toast mit Frischkäse und Kapern, dann einen Waldorfsalat und Linguine mit Muscheln. Zum Nachtisch noch ein schönes kleines Tiramisu. Dazu habe ich ein gutes Glas von meinem Lieblings-Prosecco getrunken.«
»Im Ernst?«, fragte Lancaster.
Richards verzog das Gesicht. »Natürlich nicht. Ich hab mir ein Thunfisch-Sandwich gemacht und dazu eine Essiggurke und Maischips gegessen. Das können Sie nachprüfen. Danach hab ich ferngesehen.«
»Was haben Sie sich angeschaut?«, hakte Decker nach.
»Ich habe Outlander gestreamt. Das schaue ich regelmäßig. Staffel zwei. Jamie und Claire in Frankreich.«
»Worum ging es in der Folge?«
»Um politische Geplänkel und ziemlich deftigen Sex.« Mit unverhohlenem Sarkasmus fügte sie hinzu: »Wollen Sie es genauer wissen?«
»Nein. Und nach Ihrer Fernsehstunde?«, fragte Decker.
»Hab ich geduscht, bin ins Bett und habe geschlafen, bis die Cops mich aus dem Schlaf gerissen haben. Ziemlich unsanft«, fügte sie düster hinzu.
»Fahren Sie einen dunkelgrünen Honda Civic?«, erkundigte sich Lancaster.
»Ja. Ich hab nur den.«
»Und Sie wohnen in der Primrose Avenue, auf der Nordseite?«
»Genau. Seit ungefähr fünf Jahren.«
»Haben Sie Nachbarn?«
»Auf beiden Seiten und gegenüber.« Sie richtete sich auf. »Irgendjemand kann Ihnen sicher bestätigen, dass ich an dem Abend zu Hause war. Oder zumindest, dass ich nach dem Nachhausekommen nicht mehr weggefahren bin.«
»Wir werden es überprüfen«, sagte Lancaster. »Wussten Sie überhaupt, dass Meryl Hawkins in der Stadt war?«
»Ich hatte keine Ahnung. Glauben Sie vielleicht, er hat bei mir angeklopft und mich um ein paar Dollar angebettelt? Ich dachte, der Hurensohn wäre für immer hinter Gittern. Ich verstehe gar nicht, warum er frei rumlaufen durfte.«
»Er hatte Krebs im Endstadium, deshalb haben sie ihn entlassen.«
»Was für eine Schweinerei«, meinte Richards. »Verstehen Sie mich nicht falsch, ich hab das Arschloch gehasst. Aber dass sie die Leute auf die Straße setzen, wenn sie todkrank sind …«
»So sieht’s aber leider aus. Hat er nie versucht, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen?«
»Nie. In dem Fall hätte ich wahrscheinlich versucht, ihn umzubringen. Aber er hat nie von sich hören lassen. Also hab ich’s nicht getan.«
»Sie haben einen Blumenladen aufgemacht, nicht wahr?«, fuhr Decker fort. »Mit dem Geld aus der Lebensversicherung Ihres Mannes. Ich bin mal vorbeigefahren. Am Ash Place, stimmt’s?«
Sie beäugte ihn misstrauisch. »Einen guten Teil des Geldes habe ich für die Beerdigung meiner Familie gebraucht. Danach hab ich mich irgendwie weiter durchgeschlagen. Wie, weiß ich selbst nicht.«
»Und der Blumenladen?«, beharrte Decker.
»Wie gesagt, von dem Geld war nicht mehr viel übrig. Ja, ich hab das Blumengeschäft eröffnet. Ich habe Blumen immer schon gemocht. Und von dem Laden konnte ich so einigermaßen leben. Ich habe sogar den Blumenschmuck für Polizeifeste übernommen.« Sie hielt kurz inne. »Vor ein paar Jahren habe ich das Geschäft verkauft, führe es aber im Auftrag der neuen Besitzer weiter. Im Ruhestand werde ich dann im eigenen Garten arbeiten.«
Mary Lancaster schaute zu Decker. »Sonst noch etwas?«
Er schüttelte den Kopf.
»Wie wurde er umgebracht?«, fragte Richards.
»Das behalten wir vorläufig noch für uns«, sagte Lancaster.
»Kann ich jetzt gehen?«
»Ja.«
Die Frau erhob sich und sah die beiden an. »Ich habe ihn nicht umgebracht«, sagte sie leise. »Vor Jahren wäre ich vielleicht dazu fähig gewesen, aber heute nicht mehr. Die Zeit heilt zwar nicht alle Wunden, aber sie hilft einem, mit solchen Schicksalsschlägen zu leben.«
Sie ging hinaus.
Lancaster blickte zu Decker. »Glaubst du ihr?«
»Ich hatte jedenfalls nicht den Eindruck, dass sie lügt.«
»Es gab keine brauchbaren Fingerabdrücke oder andere Spuren in Hawkins’ Hotelzimmer.«
»Das habe ich auch nicht erwartet.«
»Okay. Was nun?«
»Wir tun, was wir immer getan haben. Wir bohren weiter.«
Lancaster sah auf die Uhr. »Ich muss nach Hause und ’ne Runde schlafen, bevor ich umfalle. Ich ruf dich später an. Du solltest dich auch aufs Ohr hauen.«
Er stand auf und folgte ihr aus dem Zimmer.
Draußen blieb Lancaster stehen. »Ich kann dich irgendwo absetzen.«
»Danke, ich laufe lieber. Es ist nicht weit.«
Sie lächelte. »Es ist nett, wieder mit dir zusammenzuarbeiten.«
»Das sagst du jetzt. Ich hoffe, du bereust es nicht.«
»Ich hab mich an deine Eigenheiten gewöhnt.«
»Bist du sicher?«
Er drehte sich um und ging hinaus in den anbrechenden Tag.
6
Es hatte leicht zu regnen begonnen, als Decker über den Bürgersteig stapfte.
Es war ein seltsames Gefühl, wieder in einem Verbrechen zu ermitteln, das sich in seiner Heimatstadt ereignet hatte. Bei seinem letzten Fall in Burlington war es um seine brutal abgeschlachtete Familie gegangen. Schon von daher war der Hawkins-Fall etwas ganz anderes; dennoch fühlte Decker sich persönlich betroffen.
Was, wenn ich wirklich dazu beigetragen habe, einen Unschuldigen ins Gefängnis zu bringen?
Im Gehen sah er sich um. Er hatte beschlossen, weder zu Cassies Geburtstag noch zu ihrem Hochzeitstag wieder nach Burlington zu kommen. Es wäre ihm einfach zu viel gewesen. Nur zum Geburtstag seiner Tochter kam er immer in die Stadt. Das musste sein, auch wenn es ihm jedes Mal das Herz zerriss.
Deckers lange Beine trugen ihn rasch an seinem Hotel vorbei. Nach ein paar Meilen gelangte er in das Viertel, in dem er früher gelebt hatte. An einer Straßenecke blieb er stehen und schaute zu dem Haus, in dem er einst gewohnt hatte.
Zum letzten Mal war er vor zwei Jahren hier gewesen. Das Haus wirkte unverändert, als wäre seit Deckers letztem Besuch die Zeit stehen geblieben. Außer, dass zwei ihm unbekannte Autos in der Auffahrt standen – ein Ford Pick-up und ein Nissan Sentra.