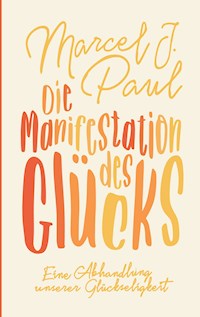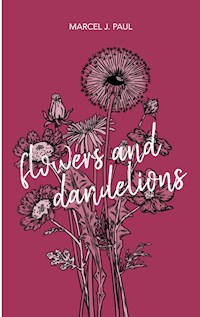
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Wir alle sind Blumen, auch wenn einige denken, dass Löwenzahn nicht dazu zähle." Flowers and Dandelions ist eine Prosa- und Lyriksammlung. Ihr liegt die Überzeugung zugrunde, dass jeder Mensch, sei er noch so schön oder nicht, eindrucksvolle Blüten trägt - jeder auf seine Weise, jeder ganz verschieden. Denn auch wenn in den Vorstellungen vieler nur eine begrenzte Auswahl an 'wirklichen' Blumen existiert, seien es Dahlien, Narzissen, Sonnenblumen oder Rosen, entspricht es nicht der Wirklichkeit. Auch Löwenzahn blüht, auch vermeintliches Unkraut mag uns mit seiner Pracht entzücken. Diese Sammlung von Erzählungen und Gedichten soll aufzeigen, wie verschieden und schön das Leben sein kann - auch wenn man sich eher als Löwenzahn statt Enzian versteht. Wir blühen, auch wenn andere meinen, wir hätten keine Krone. Doch wir tragen sie, jeder seine ganz besondere. Vielleicht schafft diese Zusammenstellung an Texten dem ein oder anderen auch ein wenig Trost zu spenden, wenn er glaubt, seine Krone verloren zu haben. Vielleicht kann dieses Buch in einer Zeit Halt geben, die durch so viel Veränderung geprägt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Marcel J. Paul, geb. 1998 in Berlin-Biesdorf, ist ein deutschsprachiger Schriftsteller der Lyrik und Prosa. Neben dem Charakteristikum, anders zu sein, ist es für ihn essentiell, die Welt zu verbessern. Sein Debütwerk » Die Banalität der Andersartigkeit « (2015) steht maßgeblich für sein Streben, steife Instanzen der Gesellschaft zu durchbrechen. In seinem zweiten Werk » Die Manifestation des Glücks « (2018) verarbeitet er persönliche Erfahrungen in Kombination mit gesellschaftlichen Denkmustern. Seit Oktober 2017 studiert er an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und versucht, nicht allzu viel Geld auszugeben.
Gewidmet den Menschen,
die lieben.
Gewidmet denen,
die ihr Herz öffnen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Zur aktuellen Lage
Briefe eines Anderen
Stadtgeschichten
Warum?
Abendsonne
Am Horizont der Himmel
Nummer Zwei
Träume im Kopf
Er
Familie Ipatjew
Zweisam
Würdest du?
Fragmente
Tränen aus Eis
Französische Fenster
Ma-sc+hi(e)nenw^erk2
Die Unendlichkeit der Zeit
Ballsaal des Muts
Erinnerungen
Wie der goldene Gral
Nathan und die Entdeckung seiner Männlichkeit
Wie ich damals dich
Schwarz-Weiß
Ungerechtigkeit
Eine Schatzkiste zum Verlieben
Horizontsprüche
Cospeda
Schwarz wie hier drunten
Schatten über Stargard
Gedankennebel
Szenerien
Wir stehen unter Sternen
Adagio
Der Aufstieg und Fall Richard Alexanders
Charlott
Du warst mein Glück
Ich liebe zu viel
Gemeinsam träumen
Hoffnungsträume
Von oben nach unten
Nachtgedanken II.
Menschleins Wunder
Zwei Bären
Kimonogeschichten
Ein theoretischer Ansatz des Glücks
Aquarell
Der große einsame Mann
Geschichten aus dem Haus am Eck
Hinter hohen Fichten
Ein theoretischer Ansatz der Besonderheit
Zwischen den Welten
Lebensgewinne
Ehrlichkeit
Leben zeichnen
Ein theoretischer Ansatz menschlicher Zuneigung
Ein Blick
Es macht mich so schlecht
Hingabe
Höllenfeuer
Anne, Part I
Größendenken
Falterlein
Pappelsommer
Dein Schatten
Helsinki
Das komplette Werk
Unter Gottes Augen
Schwarz und Rot
Stürm’sche Zeiten
Kein Traum
Ein Leben zurück
Von Monstern und Menschen
Unsere Stadt
Pollux
Du und Ich
Schwarz meine Seele
Gesellschaftskoma
Einsam unter Bäumen
Trauerspiel
Anne, Part II
Glaskasten
Die Unglücklichen von La Mar du Roe
Blütentraum
Zwei Gesichter
Unter einem wolkenlosen Himmel
Ein Lied, ein Junge, das Meer
Das Leben des Milan J. Plettenberg
Ende ohne Liebe
Wir l(i)eben allein
Leben dem Tod
Risse im Bild
Ein anderes Leben
Mein dritter Advent
Unter Berlins Blättern
Dieser Anker im Meer
Verbindungen
Das Weihnachtsfest der Familie Peterson
Die Rosen am See
Ein so schönes Fest
Geschenkverpackung
Orléans’ Kinder
In der Straße am Wald
Stillstand
Deutschland MMXVIII
Das Meer der tausend Toten
Krieg in Venedig
VORWORT
» Um sagen zu können: ›Ich liebe dich‹, muss man
zunächst sagen können: ›Ich‹. «
— Ayn Rand
Liebe Leserinnen und Leser,
auf den ersten Blick mag der Titel dieses Buches vielleicht etwas verwirrend klingen: » Flowers and Dandelions « oder eben: » Blumen und Löwenzahn « ist sicherlich kein Name, der häufig in Buchläden aufzufinden ist. Und tatsächlich: wenn man näher über den Titel dieses Werkes nachdenkt, sich gar dazu animiert, sich länger damit auseinanderzusetzen, könnte man meinen, dass sich all das ziemlich widerspricht. Auch Löwenzahn hat eine Blüte, selbst wenn man sie sich wohl nicht unbedingt in eine Vase stellen würde. Allerdings gehe ich davon aus, dass diese Erkenntnis nicht in jedem Bereich unseres Lebens einen Platz findet. Wenn Sie selbst nachdenken: welche Blumen sehen Sie vor Ihrem Auge, wenn ich hier über ebenjene schreibe? Es würden mit Sicherheit Dahlien, Rosen oder Ranunkeln sein — aber auf keinen Fall, unter gar keinen Umständen, haben Sie an Löwenzahn oder Gänseblümchen gedacht.
Menschen sind sicherlich eine Spezies, die es wert ist, erforscht zu werden. Jeder Einzelne ist ganz besonders, unikal, und dafür geschaffen, die Welt zu bereichern. Doch leider hat ein Gedanke Einzug gefunden, dass bestimmte Menschen nicht zu beachten, sie nicht einzigartig genug sind und am besten aus der großen weiten Welt verschwinden sollten. Sie seien wie Unkraut. Sie seien ein Fehler, der nicht gewürdigt werden sollte.
In dieser Tradition sieht sich nun auch dieses Werk, das für all jene Menschen geschrieben worden ist, die sich eher als Unkraut, statt als blühende Rose verstehen. Dieses Buch richtet sich an all jene Menschen, die morgens vor dem Spiegel stehen, an ihren Bauch fassen und denken: » Wieso? «. Es richtet sich an alle, die auf ihren Unterarmen und Oberschenkeln Narben sehen, die sie sich selbst hinzugefügt haben. Und natürlich ist das Buch auch für all jene geschrieben worden, die das Glück haben, sich nicht derartig fühlen zu müssen. Es ist für jene, die glücklich sind und vielleicht hiermit verstehen können, was es heißt, anders zu sein.
Viele Menschen erzählen uns im Laufe des Lebens, dass es wichtig sei, individuell zu sein. Und ja, ich bin davon ebenfalls überzeugt. Wer sich seiner selbst hingibt, anstatt fremden Idealen zu folgen, bleibt sich treu und kann von sich behaupten, immer ›selbst‹ gewesen zu sein. Die Aufgabe, die hinter dieser endlichen und endgültigen Entscheidung, sich selbst zu akzeptieren, steckt, wird häufig aber missachtet, ignoriert und vor allem nicht wahrgenommen. Es ist eine Aufgabe, die mehr Kraft benötigt, als man es vielleicht denken vermag. Vielleicht ist es auch gar nicht so gut, so einfach, individuell zu sein, wie viele es behaupten. Gibt es Probleme, gibt es Tücken, die sich damit in Verbindung setzen lassen? Ganz gleich, welche Perspektive man einnimmt: alles hat seine Vor- und Nachteile.
In diese Situation reiht sich häufig das Gefühl von Liebe ein. Ist man mehr wert, nur weil man geliebt wird? Es ist offensichtlich, dass viele zu einer Antwort neigen, die diese Frage bekräftigt. Doch über welche Liebe wird dabei gesprochen? Ist es die Liebe, die von anderen Personen ausgeht — oder sollte hierbei nicht eher die eigene Liebe, die Selbstliebe, betrachtet werden? Wie glücklich kann sich ein Mensch schätzen, der sich selbst liebt. Wie soll man von anderen Leuten Zuneigung erfahren, wenn man selbst dazu unfähig ist? Wie viele Probleme könnten gelöst werden, wenn wir die Kraft, die wir in unsere eigene Kritik stecken, in die Liebe unserer selbst investieren würden?
Wir sollten anfangen, uns selbst zu lieben — nicht nur unseretwegen, sondern auch wegen derer, denen wir noch begegnen. Es ist niemals zu spät, sich zu akzeptieren und als blühender Löwenzahn in der Vase auf dem Marmortisch seinen Platz zu finden. Wir müssen nur an uns glauben und verstehen, dass eine Unterscheidung zwischen ›Blume‹ und ›Unkraut‹ lediglich von denjenigen gefällt worden ist, die zwischen ›gut‹ und ›böse‹ differenzieren.
ZUR AKTUELLEN LAGE
Am Himmel leuchten so gülden die Sterne
meinem Herzen ganz nah, doch weit in der Ferne
Hier unten wein’ ich ganz bittere Tränen
wünschte, ich könnte den Kummer erwähnen
Den Kummer meiner eisigen Augen
von einem Körper, dessen Taten nichts taugen
Ich stehe hier unten und sehe nach oben
seh’ in die Sterne und höre mich loben:
» Die Welt ist so schön mit güldenen Sternen
Es ist wie ein Wunder, wann werd’ ich es lernen?
Es kann doch nicht sein, wann werd’ ich es seh’n:
Unser Glück ist zu lieben, wie wir’s auch dreh’n «
BRIEFE EINES ANDEREN
Fräulein
Fanny Lüders
Straße am Dorf 35
8400 Ostende
Liebe Fanny,
dass es dir derzeit mit Carl nicht gut geht, tut mir sehr leid. Ich kann nachvollziehen, wie sich eine solche Entfernung anfühlen muss und es tut mir ebenfalls weh, wenn ich von dir lese, dass du derzeit nicht glücklich bist. Gerade, weil ich dich doch als einen solch fröhlichen Menschen kennengelernt habe und es wohl nicht zu dem Bild passt, das ich von dir erhalten habe. Aber Zeit verändert wohl viele Dinge, und ja, wahrscheinlich ist das auch normal und eventuell sogar gut. Kein Mensch ist durchweg glücklich. Schade, nicht?
Dennoch versteh’ ich nicht, warum ihr euch nicht öfter sehen könnt? Zwischen Ostende und Dunkerque ist es doch nicht immens weit, oder täusche ich mich?
Gerade, wenn man zum ersten Mal in einer Beziehung ist, fühlt man wohl dieses » auf-und-ab «, was du so treffend beschrieben hast, am stärksten, denke ich. Zeit scheint manchmal sehr, sehr lang und ich kann verstehen, dass sie dir, bis ihr euch wiedersehen könnt, zu schleppend vorangeht. Aber, so hast du es ja selbst verfasst, ist die Zeit so schnell vorüber, wenn ihr euch dann seht. Lass dir wirklich nicht eure gemeinsamen Stunden verderben, nur weil du weißt, dass das alles enden muss. Das tut einem nicht gut. Ich habe damit früher auch angefangen: Einer der ›Gründe‹, weshalb es mir heute nicht mehr wohl ergeht. Genieße den Augenblick, das gelingt dir sonst auch sehr gut, denke ich. Nichts wiederholt sich im Leben und wer weiß, wie es beim nächsten Mal ist. Es kann so viel geschehen. Erlaube dir, glücklich zu sein, auch wenn es die Gesellschaft » überheblich « nennt. Das hast du und das hat auch er verdient.
Du sagtest, dass du mühselig zu ihm gehst, erdrückend beladen, und dir soziale Beziehungen plötzlich schwerfallen. Wie meinst du das? Denkst du, er kommt dir nicht entgegen? Und von welchen Beziehungen sprichst du? Zeit ist immer endlich, Liebes. Das hat positive wie negative Aspekte. Vergiss das nicht. Geh’ in die Natur, rede mit Carl und, um Himmels Willen, genieß’ die Zeit. Atme und lebe! Sprich doch mit Anna, sie hat sicherlich immer ein offenes Ohr und einen guten Rat für dich. Du bist nicht alleine, das verspreche ich dir. Aber auch du, denke ich, musst solche Erfahrungen machen. Das muss jeder, Sasett hat das auch alles erlebt. Ich denke, wichtig ist, dass du dir treu bleibst und dein Leben nicht nach ihm ausrichtest. Ich weiß, wenn man verliebt ist, ist das alles viel schwerer und kaum in Worte zu fassen. Aber erinnere dich: er liebt dich und du ihn, das ist ein Wunder, das ist Glück, das ist die Glückseligkeit, die du verdient hast. Und es muss dir auch nicht unangenehm sein, ›viel‹ von dir zu schreiben. Mach es, bitte, sonst wird das nicht gut für dich enden. Das wird dir nicht gut tun. Sprich dich aus, es gibt nichts, wofür du dich schämen musst oder etwas, was dir unangenehm sein sollte.
Euer Zusammentreffen am Wochenende habe ich übrigens auf Photographien gesehen, die deine Frau Mama mitgebracht hat, als wir uns getroffen haben. Es ist so schön, dass ihr alle zusammensitzt und miteinander reden könnt. Das ist viel wert. Darauf kommt es im Leben an.
Zu deinem zweiten Abschnitt: Ist denn meine Liebe so sehr anders? Verhält sie sich so ungleichmäßig zu anderen, dass ich deshalb zum Arzt gehen muss? Bin ich so komisch, dass ich wegen der Art meiner Liebe behandelt werden sollte? Klingt das nicht auch für dich seltsam? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe so vieles nicht.
Ich musste über deine Worte schmunzeln: » Nicht genug sein, daneben stehen, und im Gegensatz dazu alles nehmen, was möglich ist, stolz machen und am Ende trotzdem unglücklich ankommen. « Ja, ja, verdammt, genauso fühlt es sich an. Es ist immer dasselbe, überall. Du hast gefragt, woher ich die Kraft habe? Ich denke, es ist Gewöhnung. Es ist nicht so, dass ich das nicht kenne. Du kannst dir vorstellen, wie oft ich versucht habe, Freunde zu finden, geliebt zu werden. Glaubst du, das ist möglich bei mir? Eine ›normale‹ Familie? Das wird nicht funktionieren, es funktioniert nicht. Ich werde das, was ich mir über Jahre erträumt habe, nicht erreichen. Es wird nicht geschehen. Das setzt mir sehr zu. Glaubst du, es gab jemals eine Person, die gedacht hat: » Jim ist attraktiv «? Glaubst du, es gab auch nur eine Person, die mir hinterher gesehen hat und den Blick nicht abwenden konnte? Ich glaube es auch nicht. Man gewöhnt sich daran, bestimmte Dinge nicht mehr zu erwarten. Irgendwann habe ich deshalb aufgehört, mich anzustrengen. Ich habe aufgehört, mich um mich selbst zu kümmern, wieso auch nicht, es gibt ja keinen Grund, es zu tun. Warum sollte ich um etwas kämpfen, das für andere eine Selbstverständlichkeit ist? Warum? Dazu fehlt mir die Kraft und es macht mich wirklich, wirklich kaputt. Das Schlimme daran ist: Ich wollte immer ›anders‹ sein, individuell, das war mir immer so wichtig gewesen. Doch heute habe ich nichts mehr. Ich habe keine Zugehörigkeit. Ich bin alleine, weil ich ein so ›spezieller‹ Mensch geworden bin. Jeder sagt dir immer: sei bloß du selbst, die anderen existieren schon, und eben so weiter. Aber, verdammt, nein, das sollte man nicht machen. Zumindest nicht so, wie ich es getan habe. Ich bin anders und habe nichts, womit ich mich verbunden fühle. Ich habe keinen Halt, weil ich einfach komisch bin. Mich verbindet nichts mehr, weil ich so ›individuell‹ bin. Und dann gibt es Leute, die öffentlich sagen, sie seien wie ich, anders, individuell, während sie sich vor Freunden und Beziehungen kaum retten können. Liegt der Fehler bei mir oder denken solche Leute wirklich, sie seien speziell, nur weil sie zwei verschiedene Paar Schuhe tragen? Aber vielleicht sollte ich mir diese Frage auch gar nicht stellen. Es ist eine Beleidigung. Ich glaube, viele Menschen verstehen das nicht. Sie verstehen mich nicht und jeden, dem es wie mir ergeht. Ich schäme mich so sehr dafür, ›ich‹ zu sein. Ich hasse mich und niemand versteht es. Ich bin so hässlich. Ich bin nicht so, wie man sich mich wünscht. Wieder bin ich es, der jemanden enttäuscht.
Aber keine Sorge, ich werde mich niemals derart aufgeben, dass ich mich für andere verändere. Das werde ich niemals tun. Ich werde mit diesem ›Schiff‹ untergehen. Denn im Endeffekt ist es immer dasselbe: Wie soll mich jemand lieben, wenn ich es selbst nicht kann? 43 sind es. 43 Narben zeigen mir, wie sehr ich mich nur hassen kann. Wie es jeder tut, wie es so viele getan haben. Das Leben ist sicherlich nicht fair. Ich habe mit alldem damals begonnen, weil ich dachte, dass mir der gemeinsame Hass auf meine Person Freunde bringen würde. Aber danach fragt keiner, daran denkt niemand. Keiner denkt, dass ein Junge derartig zerbrechen kann. Jungs geschieht sowas nicht. Ein Indianer kennt schließlich keinen Schmerz und wer weint, ist ein Mädchen. Jungs nehmen auch schließlich keine Tabletten, um abzunehmen. Jungs sind nicht so. Sei glücklich, dass du ein Mädchen bist. Scheinbar muss man noch entdecken, dass auch Männer keine Bollwerke sind. Die Zeit ist dafür aber vielleicht noch nicht reif genug.
Es ist so widerlich, was ich alles getan habe, um dazuzugehören, um dünn, um schön zu sein. Ich wollte so wie die sein, die sie angehimmelt haben. Ich wollte begehrt werden, ich wollte jemand sein, der geliebt wird. Ja, danach habe ich wohl schon immer gesucht. Und weil es nicht so war, weder bei Fremden, noch bei meiner Familie, habe ich angefangen zu fragen: Warum? Warum war es so, warum musste es geschehen, warum ich? Und schließlich kam ich dazu, dazu kommen wohl die meisten, zu fragen: » Warum bin ich so? « Nicht nur, dass mein Vater mir das oft genug vorgeworfen hat, war es auch für mich selbst viel zu schlimm, weil du dafür keine Begründung hast, du findest keine Antwort. Und das macht dich fertig, du findest keine plausible Erklärung. ›Warum‹ führt so viele Menschen dazu, sterben zu wollen. Glaubst du, irgendeiner hat das verdient? Ganz gleich, ob es hier um mich geht oder nicht: Wie kann man sowas zulassen, ein Gott, andere Menschen? Wie kann sowas passieren? Ich bin kein Einzelfall und doch fühlt es sich so an.
Und ja, ich habe versucht, das alles auszudrücken, zu sagen, was mir zusetzt und wie es mir ergeht. Aber außer: » Dann wehre dich! « habe ich nie eine Antwort bekommen. Plötzlich war alles still. Plötzlich waren Vorwürfe der Anker meiner Persönlichkeit, an den ich mich geklammert habe. Man hat mir niemals zugehört und niemals gezeigt, dass ich es wert bin, beschützt zu werden. Diese Achtlosigkeit war schlimmer als alles, was geschehen ist. Nicht zu spüren, es wert zu sein, davor geschützt zu werden, ist der Dolch, der sich in dein Herz rammt und sowas merkst du dir. Das vergisst du nicht. Verdammt, das vergisst du nicht. Deshalb habe ich auch irgendwann nicht mehr gesprochen, vielleicht, um nicht mehr enttäuscht zu werden und als ›schwach‹ zu gelten. Und du siehst: Es interessiert keinen. Denkst du, jemand fragt danach und interessiert sich dann wirklich dafür? Warum sollten sie auch? Es gibt so viel, das ich ihnen vor den Kopf werfen könnte. Ich muss meinen Wert finden. Ist es das, was man ›Egoismus‹ nennt?
Du erkennst hier zwei Seiten von mir: die, die dir alles erzählt und sehr dankbar dafür ist, dass du ihr zuhörst, die sich hier die Seele ausweint im Wissen, dass sich doch nichts ändert und stets die Angst haben muss, dass du das alles falsch verstehst. ›Selbstmitleid‹ ist die Erfindung einer Gesellschaft, die sich um nichts und niemanden kümmern möchte. Menschen wie wir werden nicht geliebt. Die Aufgabe, die wir haben, die uns alle eint, ist die Begrenzung unseres Schadens. ›Wir‹ verlieren — seit Anbeginn der Zeit. Am Ende all jener Verluste, der Freunde, des Glücks, der Liebe, stehen wir. Schlussendlich werden wir uns verlieren. Jeder auf seine ganz eigene Weise.
Die zweite Seite wirst du bei den Gästen des Festes stehen sehen: ich lächele und sage, es gehe mir gut. Menschen wie ich haben das perfektioniert. Nicht, weil wir das witzig finden, sondern weil ›wir‹ keine Lust darauf haben, falsches Interesse zu beantworten. Für ›uns‹ interessiert sich keiner, schon gar nicht an Tagen wie diesen, wo alle glücklich sein wollen. Es ist Dank genug, dabei zu sein, schließlich hat jeder sein eigenes Päckchen zu tragen und niemand ist deshalb etwas besonderes. Und ja, vielleicht hast du Recht, vielleicht platzt das alles irgendwann. Aber wenigstens hört man dann noch etwas von mir. Ich habe schon immer große Auftritte bevorzugt. Sei dir sicher, auch ›wir‹ haben Träume.
Bei deinem letzten Absatz habe ich wieder lachen müssen: Ja, ich glaube dir, ich glaube es dir sofort, dass sie für dich eine große Stütze waren. Das mussten sie vermutlich auch sein. Eine arbeitende Familie mit zwei Kindern wird kaum Zeit haben, sich um alle zu sorgen. Deshalb verstehe ich, dass du so denkst und gebe dir Recht. Sie waren eine großartige Hilfe, wenn sie dich an deinem Geburtstag besucht haben und bei deinen Wettkämpfen dabei gewesen waren, dir Theaterkarten und Haustiere geschenkt haben. Ich glaube es dir wirklich. Und ja, die Frage kann ich dir beantworten: ich vergleiche mich immer mit dir. Immer. Immer. Denk’ aber niemals, dass ich dir irgendetwas davon nicht gönne. Ich möchte es immer und immer wieder betonen: Du hast so viel Talent und du kannst dich glücklich schätzen, so viel Zeit mit ihnen verbracht zu haben, so viele Erfolge erlebt und so viele Momente geteilt zu haben. Ich war vermutlich einfach nicht der richtige für sie. Vermutlich hatten sie einfach keine Zeit für zwei Kinder gleichzeitig, vielleicht ist das der plausible Grund. Oder glaubst du, dass sie sonst vergessen hätten, dass ich Bücher veröffentlicht habe? Das werde ich ihnen niemals verzeihen. Es gibt so viele Ereignisse, angefangen mit der Postkarte, die natürlich du zuerst bekommen hast (und ja, ich schmunzle auch). Wie kann es sein, dass die eigene Familie vergisst, dass ihr —, dass ich, wie kann man jemanden nur vergessen? Wie? Erkläre es mir. Aber gut, sie haben es nicht einmal gelesen. Was soll ich auch erwarten? Das Wort ›Enttäuschung‹ ist die Aufdeckung, nenn’ es Auflösung, einer Erwartung. Ich setze einfach zu viel voraus. Das war wirklich das Schlimmste von allem, was sie getan haben: mich zu vergessen. Das war das widerlichste, das traurigste und verletzendste. — Davor habe ich so sehr Angst.
Es geht mir auch nicht darum, ob und wie andere auf derselben Stufe standen oder nicht, verdammt, es geht doch darum, dass ich beide gleich gerne habe und um mich gehabt hätte: mit dem gleichen Respekt, mit der gleichen Achtung, wie du es erhalten hast. Du siehst: ich vergleiche mich mit dir, ja, das tue ich. Ja, das war auch schon immer so und das hat niemals aufgehört. » Nicht genug sein, daneben stehen und im Gegensatz dazu alles nehmen, was möglich ist, stolz sein und am Ende trotzdem unglücklich ankommen. « Wieder einmal triffst du ins Schwarze. Ich habe einfach keine Kraft dafür, um etwas zu kämpfen, das für andere selbstverständlich ist.
So vieles tut weh, wirklich, das tut es. Ich war schon immer der Zweite neben dir, immer. Das ist definitiv nicht deine Schuld und dafür kannst du nichts. Aber bitte, schätze es wert. Genieß’ es. Sie sind und waren für mich immer so wichtig gewesen wie für dich. Das ist bis heute so und hat sich seitdem nicht verändert. Deshalb sage ich auch nichts, weil das alles viel schlimmer werden könnte. Davor habe ich große Angst, weißt du. Ich ertrage es lieber, als zu riskieren, dass ich sie nie mehr wiedersehe. Ich bin der Zweite, nicht nur bei ihnen. Das ist so oft der Fall. Damit muss ich mich abfinden. Ich liebe mich nicht, weil meine Familie es nie getan hat, Fremde gesagt haben, dass man mich nur hassen kann. Ich bin hässlich — äußerlich und nun vermutlich auch innerlich.
Ich habe es geschafft, dass sich ein Bild von mir etabliert hat, dass ich faul bin und viel esse. Mehr ›wissen‹ sie anscheinend nicht von mir. Das klärt dann auch, warum wir immer über dich reden. Ich wollte immer so viel mehr sein: ein guter Mensch. Aber den sieht keiner, nicht mal mehr ich selbst. Ich bin eben nur Jim. So ist das. Ich bin der, der viel isst, während du Wettkämpfe bestreitest und gewinnst, da kann ich nicht mithalten. Ich war nie der Junge, den man sich gewünscht hat. Ich war nie der Junge, der ich sein wollte und von dem ich träumte, weil ich lieber ›individuelle‹ Ziele verfolgt habe. Konkurrenz warst du nie, du ranntest schon immer als erste durch das Ziel. Darauf kannst du sehr stolz sein, ich bin es auch.
Vergewissere dich, dass ich diesen Brief schrieb, während ich geweint habe. Das alles tut mir sehr weh und ich wünschte, die Realität wäre anders. Aber das Leben ist nicht fair. Das war es noch nie.
Ich drücke dich, wenn auch nur in Gedanken
STADTGESCHICHTEN
Gewidmet Guben
Ich saß vor dem Fenster und blickte hinaus:
Es war mir wie Winter. Ich erspähte ein Haus
Durch Büsche und Hecken bahnt’ sich ein Weg
» Diese Stadt hat stürmische Zeiten erlebt «
Ich blickte durch Tage des vergangenen Lebens
und fühlte Verlangen, ein starkes Bestreben
die Zeit zu erfassen und in mir zu binden
Ich wollte es machen: ihre Geschichte erfinden!
Zwischen Häusern und Bäumen ganz wenige Worte
von Stuben und Menschen am so schönen Orte
Es gleicht einem Märchen, doch sind diese Zeilen
von mir nur erträumt, sie lang’ nicht verweilen
WARUM?
Kann man sich schätzen
wenn kein and’rer es tut?
Hört man in Sätzen
was in einem ruht?
Kann man sich ehren
an all diesen Tagen?
Man kann sich nicht wehren
— muss alles ertragen
So liebe nur dich, ja du sollst es tun
doch wie soll man’s schaffen?
Niemand sagt es, und nun?
Warum ich mich mag?
Es vergeht kein Tag
an dem ich nicht frag’:
» Warum sollt’ ich es tun? «
ABENDSONNE
Oh, was für ein Glück
zu sehen sie fliegen
Und ich weich’ zurück
erblicke sie siegen
Sie trotzen dem Wind
mit mächtigem Flug
» Seht nur, wie viele! «
Doch niemals genug
Sie steigen nach oben
in die drohende Nacht
Sie zeigen mir Proben
und der Himmel entfacht!
Sie sind stolze Künstler
und präsentieren uns hier!
Die Nacht wird gleich finster
Sie spielen mit mir
Wir stehen und sichten
die Vögel hier siegen
Wir träumen und dichten
mit ihnen zu fliegen
AM HORIZONT DER HIMMEL
ES GLICH EINEM SONDERBAREN WUNDER, einem so schicksalsträchtigen, dass nach all der Zeit die blendende Sonne wieder über dem Horizont ihre warmen Strahlen ausbreitete und das Ende eines schier widerwärtigen Regimes voller widerwärtiger Schandtaten bekundete. Der Lichtschimmer traf dunkle Wolken, erleuchtete ausgebrannte Ruinen, einstige Heimaten, und schien auf die Häupter all jener, die in diesem Moment zu ihm hinaufsahen. Und so monumental dieser Augenblick vielleicht auch wirken vermochte, er von dem ein oder anderen bis heute mythisch verklärt werden kann, war es doch ganz nebensächlich, wer in diesem Moment unter diesem gottesgleichen Lichte stand. Es war egal geworden, welcher Standpunkt vertreten, welche Opfer gegeben wurden, wofür ein jeder gekämpft hatte, durch welche Charakteristiken das eigene Weltbild gezeichnet war. Plötzlich hatten alle Menschen das gleiche Glück, die gleichen Spielbretter, denselben Neuanfang. Ehre und Gewissen standen gleichauf mit Verbrechen und unzähligen Gräueltaten. Es war die legendäre ›Stunde Null‹, in der der Gesamtheit aller Deutschen, die mehrheitlich das System unterstützt und deren Opfer ignoriert hatten, die Unschuld gegeben wurde. Die Ablehnung der kollektiven Schuld diente dem Vergessen, dem Vergessen all jener unmenschlichen Handlungen, die von denen begangen worden waren, die zur selben Zeit in ebenjenen Himmel sahen wie die, die unter ihm einst ihre himmlische Erlösung fanden. Ein Vergessen und Vergeben, damit sowohl die unbestraften Täter als auch die ungesühnten Opfer alles hinter sich lassen konnten. Die Täter wurden beschenkt, die schlimmsten Taten menschlicher Existenz vergessen und erneut wurden Opfer zu Geschändeten. Es wäre auch viel zu viel verlangt gewesen, zu erwarten, dass sich alle ihrem Gewissen vollkommen hingegeben hätten. Doch die, die es dennoch taten, die allen Mut zusammennahmen, die sich in die Gefahr des nahenden Todes brachten, nur um Gerechtigkeit walten zu lassen, ach, die waren es nicht wert, genannt zu werden — vielleicht in einem Nebensatz, als Name einer Parallelstraße und vielleicht mit einem: » Danke «.
Es war ein undefinierbares Glück gewesen, dass nach all den Jahren ein Ende für die Ländereien gefunden wurde, die in erbitterten Schlachten all jene folterten, töteten und verfolgten, die sich gegen das Konstrukt ihrer Ideologie gestellt hatten. Josephine, ihre Mutter und der Sohn überlebten, weil sie sich in einem kalten Luftschutzbunker retten konnten, während so viele andere in ihren Häusern verbrannten, im Keller ertranken und in Räumlichkeiten, die viel näher waren, als man vielleicht zu denken vermag, kläglich erstickten und ihren Schöpfer entgegentraten. Es war mehr als nur ein einziges Mal gewesen, dass sie in der Nacht von den schreienden Sirenen ihrer Stadt geweckt wurde und mit einem kleinen Koffer zur Fichtestraße sechs rannte. Durch die Dunkelheit ihrer Zeit, unter einem feuerroten Himmel, lief sie an umherirrenden Menschen vorbei. Vielleicht würde Josephine ihre Gesichter ein letztes Mal erblicken, bevor entweder sie oder die anderen verkohlt und entwürdigt am Straßenrand lägen.
Einige von ihnen stolperten über kleine Gesteinsbrocken, ehemalige Häuserfragmente, die verstreut auf aufgeplatzten Straßen lagen. Viele husteten und andere blieben liegen. Betagte und Kranke liefen langsam über die Straße, in Decken gehüllt, während sich erste Schatten am Himmel dunkel abzeichneten. Es waren die Deutschen gewesen, die man nun in der Mitte des Geschehens sah. Nun gab es keine Juden mehr, die man bei ihrem Abtransport belächeln konnte, nun waren es keine Demokraten mehr, die von den Deutschen beschuldigt wurden. In einem flammenden Inferno wurde aus einer einst blühenden Metropole das Tor zur Unterwelt. Sodom und Gomorrhas letzten Auswüchsen blickte man entgegen, die Straßen verwandelten sich in den Styx, zu dessen Ufern sich das deutsche Volk bereitwillig versammelte. Die Abgründe der Stadt und ihrer Bewohner brachen auf, selbst für den letzten Blinden war es nun unmöglich gewesen, das Unheil zu übersehen, welches jeder einzelne herbeibeschworen hatte. Zu alledem kam nun auch noch der Bombenhagel, der die ganze Stadt in Trümmer legte. Kein Schritt konnte mehr vor den anderen gesetzt werden, keiner konnte mehr so tun, als würde er nichts wissen. Der Asphalt brach, tiefe Schneisen traten auf, niemand konnte sich dem Übel mehr entziehen. Das Unheil lechzte nun auch nach dem Leben derjenigen, die bis zu diesem Zeitpunkt die Gewinner in dieser Partie gewesen waren. Die schwarze Hand des Schicksals zeigte mit ihren Klauen auf alle — egal, welcher Ideologie und welchem Gewissen sie gefolgt waren. Glühende Feuerbälle hagelten vom Himmel hinab, Häuser stürzten ein und das Geschrei der Täter hallte durch die unendlichen Straßen ihrer selbstverschuldeten Zukunft.
Am Horizont weitete die Sonne ihre Strahlen aus und schien mit ihrer Sorglosigkeit über die vom Krieg zerstörte Hauptstadt. Sie leuchtete genauso hell, genauso erhaben, wie sie es vor den großen Schlachten getan hatte. Ihr Schatten streifte die Hügel und Berge ebenso wie die vollbeladenen Waggons und Heilanstalten. Es war, als hätte sich trotzdem nichts verändert. Es schien, dass dieselben Täter weiterhin in der Politik sitzen würden, die Regierung mitbestimmten, dass die Täter Richter, dass die Täter Bundeskanzler werden könnten. Die fahrlässige Etablierung der Verleumdung unter dem Deckmantel der Demokratie machte es möglich. Denn egal, wie viele Ruinen sich über Leichen häuften und wie viele zerstörte Existenzen sich mit der Angst vor der Zukunft unter sie mischten, alles blieb beim Alten: Die Deutschen lernten nicht dazu.
Unter den Trümmern trat langsam Josephine hervor. Auf ihren Wangen war noch etwas Staub aus vergangenen Zeiten. Ruß bedeckte ihre Haare, mitten auf der Straße stand sie zwischen Trümmern und Scherben. Es zwitscherten einige Vögel, während sich erste Menschen umsahen, was mit den Gebäuden und mit ihrem Leben geschehen war. Ein grau-gemusterter Mantel bedeckte Josephines schmalen Körper, einige Wunden und Narben zierten ihr Gesicht. Sie stand neben unzähligen ausgeräucherten Wohnungen, ausgebombten Häusern und vergasten Existenzen. Es knisterte, als jemand über die Glassplitter der Schaufenster lief. Und doch war es ruhig. Hinter ihrem Rücken brannte ein letztes Haus aus, die standhaftesten Bäume, die umgefallen waren, wurden mühsam an den Straßenrand geschafft, wo sie keiner mehr erblicken sollte. Inmitten der aufgeplatzten Wege aus Teer lagen verstümmelte Leichen, zum Teil verkohlt, viele waren sehr dünn. Unter ihnen befanden sich kleine Kinder, junge Männer, die in den letzten Kriegstagen alles für den Führer aufgegeben hatten, für den Heilsbringer, für den, der über den ›Lebensraum im Osten‹ philosophierte, für den, der zwischen den ›Seinen‹ und den ›Anderen‹ unterschied. In ihren Träumen, die sie mit ganz vielen anderen noch jahrelang teilen würden, rennen sie ihm weiterhin hinterher, kämpfen für ein reinrassiges Deutschland, die Eugenik und den industriellen Massenmord. Sie erhoffen sich andere Dinge.
Ein dunkelblaues Halstuch mit brauner Kordel zierte die Helden des Führers. Am Straßenrand waren sie jedoch nur wenige von vielen dieser Tage, mehr blieb ihnen nicht übrig. Ihre blutverschmierten Gesichter blickten ebenso wie das von Josephine hinauf in den wolkenlosen Himmel. Es war still, im Hintergrund ertönten keine Geschosse mehr. Die Patronen ihrer Mauser-Karabiner waren aufgebraucht, kein Panzer rollte mehr durch die Straßen mit den riesigen Löchern, die durch Granaten verursacht worden waren. Einige Menschen hatten metallene Eimer in den Händen, irgendwo stürzte ein Haus ein, jemand schrie. Die Hoffnung von Josephine glich in diesem Moment jeder anderen. Sie alle teilten sich eine Einstellung: Sie hatten daran keine Schuld gehabt.
Die Zeitung hatte es berichtet. Das Tageblatt schrieb, der Krieg sei vorbei. Nach wochenlangen Kämpfen, in denen junge Männer für ihr Vaterland ihr Leben ließen, hätte man die letzten Barrikaden und Stützpunkte durchbrochen, die Flagge der Sowjetunion auf den Trümmern der deutschen Ideologie freudig gehisst. Mehr noch, man hisste sie auf dem ersten Opfer seinerzeit, auf einem Bauwerk, das für seine demokratischen Werte weltberühmt gewesen war. Auf den Eckpfeilern des Reichstagsgebäudes erstrahlte die rote Flagge der sowjetischen Befreier. Die Alliierten hatten gewonnen, der Gedanke an Vergeltung leitete ihre Schritte. Die Siegesgöttin triumphierte mit mahnendem Gesichtsausdruck, während sie die Liste all jener Opfer in den Händen hielt, denen in diesen Tagen unschuldig das Leben genommen wurde. Es sind die Namen derer, die in diesen Tagen verstümmelt, gefoltert und massakriert wurden, während alle, so viele andere, nur zusahen und lieber schwiegen, als sich dagegen aufzurichten: Die, die ihre Freunde und Familie verrieten, die Nachbarn und Menschen, die sie gar nicht kannten, ihnen allen sollte der Prozess gemacht werden. Haben sie das Ganze nicht beäugt, dann waren sie die Täter und gingen mit den Mitteln der Umsetzung konform. Die Siegesgöttin blendete die Schuldigen mit ihren Taten. In ihren Augen strahlte das Licht der Wahrheit, während sie die Namen der Märtyrer vorlas. Lediglich die wenigen einzelnen, die so sehr gegen die Entwürdigung des Menschen gekämpft hatten, sollte der Stolz und der ewige Ruhm zuteil werden. Doch ihr Andenken verstummte.
Das erste Opfer entblößte sich nun als größter Sieger. Es waren jene jungen Männer, die die neue Flagge hissten, deren Familien, Freunde und Bekannte in Scheunen gesperrt und angezündet wurden, während die Täter nur zusahen und zu den Todesschreien lachten. In Rage kämpften die Krieger; ohne Rücksicht auf Verluste. So war es ganz egal geworden, ob die Gefallenen auf der gegnerischen Seite oder in der Heimat zu beklagen waren. Denn je mehr jede Nation opfern musste, desto größer war der Hass und die Zerstörungswut auf seine Gegner. Blut ergoss sich nicht nur in den weiten Feldern der Smolensker Höhen, wo man hungernd und frierend auf dem erkalteten Boden lag, nein, auch in den Städten aller Welt stapelten sich die Toten über die Erfolge des Heeres. Es war ein Krieg der Völker, ein Wettkampf der Stärkeren, die Schlacht der Rassen, die von der schwächsten begonnen wurde und dazu verdammt war, zu verlieren. Die Soldaten waren nicht mehr als Marionetten, Spielfiguren, die ihren Zug beendeten und anschließend geschlagen wurden. Kriegsfelder wurden zu Spielbrettern, Soldaten zu einfachen Bauern. Wer Grenzen überschritt, der starb. Wer das Spielfeld verließ, wurde disqualifiziert. Sie kämpften außerhalb großer Städte, zur Belustigung und Unterhaltung, als Machtinstrument weniger Obrigkeiten. In der Kälte gaben sie ihr Leben den Schüssen. Es war ein Krieg der Ungerechtigkeit und der bloßen Zerstörungswut. Noch nie hatte die Welt so viel Schande ertragen. Es war ein Krieg, der unendlich viele Tote forderte, weil unendlich viele Menschen ihre Arroganz nicht unter Kontrolle halten konnten.
Heute stehen die Opfer über ihren Mördern, über denen, die ihnen so viel Unrecht angetan hatten. Doch der Himmel blickte über alle, egal, welchen Standpunkt sie vertraten. Alle genossen das Licht der aufgehenden Sonne. Sie hatten daran keine Schuld gehabt.
Josephine verlor in diesen Tagen ihren Mann. Ihr Gatte war ebenfalls in den russischen Weiten verschwunden, in den Kriegswirrungen und Irrungen. Er habe für sein Vaterland sein Leben gegeben, so schrieb man ihr. Bis heute hat man seinen Körper nicht gefunden. Bis heute spiegelt er das Schicksal vieler junger Männer wider, die ruhelos und ohne Grab entschwanden. Ein nationales Staatsbegräbnis für den ›stolzen Volksheld‹ gab es allerdings nicht. Er war nur einer von vielen gewesen, niemand interessierte sich für den gefallenen Tribut, der anfänglich noch so sehr geschätzt und umworben wurde.
Es war ein offizieller Brief gewesen, den man Josephine übergab, ein Brief mit dem eisernen Kreuz und den Eichenblättern auf der rechten Seite des Briefkopfes. Er kam als Einschreiben an. Der Postbote hatte es gesehen, lange bevor Josephine es tat. In diesem Moment schluckte er und wischte sich mit einem alten Taschentuch die Perlen von der Stirn. Diesen Tod hatte er sicher nicht gewollt, als auch er die Partei mit dem so authentischen Mann wählte, weil er ihnen so vieles versprach. Einfache Lösungen in schwierigen Zeiten. Ein faschistischer Halt in einer Welt voller Demokraten und Gemeinschaften, die im ›Bund der Völker‹ zusammenkamen. So sah die Lösung des Postboten aus, einem ganz normalen Mann, der von gar nichts wusste, nichts hinterfragte und sein Leben einsam und alleine lebte. Seine Freunde verbrachten die Tage in vollen Zügen und er genoss es, zur ausgewählten Rasse zu gehören. Den Brief wollte er nicht übergeben; nicht Josephine, nicht ihrem Sohn und auch nicht ihrer Mutter. » Das Überleben der Rasse erfordert Opfer «, erinnerte er sich dann. Er hatte daran keine Schuld gehabt, er war nur Postbote.
Es waren ungeklärte Umstände gewesen, in denen Josephines Mann in der Stille der Zeit verschwand. Lieber sollte man mutig als lebendig sein, lieber für das deutsche Volk sein Leben geben, als egoistisch an sich selbst zu denken. Man hatte nicht weiter forschen können, er war dann eben nicht mehr lebendig, dieser ›Tote Volkskörper‹. Vielleicht traf ihn eine Bombe, vielleicht ein Schuss — aber ganz sicher war es kein Verrat gewesen. Wie hätte man ihn auch hintergehen können, wenn er doch sein Todesurteil selber wählte? Auch er schenkte Kreuz, Herz und Verstand den Faschisten bei den Reichstagswahlen 1933.
In der russischen Hügellandschaft wurde schließlich seine komplette Kompanie aufgerieben, keiner überlebte die Rache der Geschändeten. Aus Furcht vor weiteren Toten hörte Josephine später, dass Friedrich Paulus, Oberbefehlshaber des sechsten Bataillons, in Stalingrad mit seiner Brigade zum Gegner übergelaufen sei. Die Armee war sodann nicht mehr als Hitlers Soldaten, dumpfe Bauern, sie trugen keine Namen mehr, sie hatten keine Geschichte, kein Gewissen, sie waren einfach nur wie Spielfiguren auf einem Schachbrett in schwarz-weiß. Wer ausbrach, der starb; wer kämpfte, entkam nicht. » Paulus hat sich ergeben «, schrieb der Stürmer; genauso, wie er davon schrieb, welch’ Hochverrat es am Vaterland gewesen sei, dass man sich dem bolschewistischen Gegner hingab, ohne zu kämpfen: ein Verrat an der Rasse, ein Verrat an Josephines Mann, ein Verrat an der Ideologie. Wie egoistisch konnte es nur sein, dass man den Drang hatte, sich dem Tode zu entziehen? Das Volk war viel wichtiger als man selbst. Das Volk war es, welches ›Ja‹ schrie, als man es fragte, den ›totalen Kriege‹ zu beginnen. Sie wollten es so, die, denen man glaubte, dass sie dann später angeblich nichts gewusst hatten. Den Tätern schenkte man die Unschuld, den Opfern das Vergessen. Und die, die dagegen sprachen, die verstummten mit den Tagen und Wochen, mit den Jahren immer mehr. Sie waren nicht mehr geschützt, sie waren nicht dem Volk zugehörig, sie waren staatenlos, staatenlose Bürger und Bürgerinnen in einem determinierten Stück Land diesseits des Rheins. Wer hatte auch überhaupt das Recht, sich gegen das Volk, gegen sich selbst, gegen die gewählte Politik zu richten? Warum sollte man davon ausgehen, dass sich Menschen verändern, die schon vor Jahren die gleiche mentale Reife erreichten? Schließlich wählt man nicht so lange, bis allen das Ergebnis passt.
Unermesslich viele Kritiker und sonstige Intellektuelle wurden gefangen genommen, unabsehbar viele deportiert, verschleppt in weite Orte, in Orte fern der Heimat. In stundenlangen Fahrten standen sie neben Kindern und Betagten, die sich in Decken hüllten, bevor ihre Kraft abhanden kam und sie vor Erschöpfung starben. Es waren nicht nur Rudolf Breitscheid und die Familie Frank gewesen, es war auch Jenny Cohn, Drogistin deutscher Staatsangehörigkeit aus der Königsstraße 18. Sie, die von Millionen Kugeln getroffen wurde und in sich zusammensackte, während das Blut aus ihrem Körper und die Träne aus ihrem Auge lief. Die Massenerschießungen überlebte sie nicht. Es war der deutsche Arzt Arno Philippsthal, ein Widerstandskämpfer, der am 21. März aus seiner Arztpraxis abgeholt wurde und unter Beifall der Zusehenden in das Auto der SA-Männer stieg. Er sollte die Oberfeldstraße in Berlin nie wieder betreten. Wer weiß schon, wen die Familie Fischl in den letzten Minuten ihres Lebens noch kennenlernen durfte. Sie kamen am 4. März 1943 mit dem 34. Osttransport im Vernichtungslager Auschwitz an. Nicht mal ein Todesdatum erinnert mehr an die Mutter, an ihre Töchter, ihren Sohn und seine Frau. Wer kann es nachempfinden, wie es sich anfühlt, in der nächsten Minute Bekannte sterben zu sehen, weil ihre Körper nicht von Nutzen sind? Die verschiedenen Konzentrations- und Vernichtungslager mit ihrem industriellen Massenmord im neuen Lebensraum östlich der Oder brannten sich jedoch nicht so sehr in das Gedächtnis der Bevölkerung ein wie die Bombenangriffe auf unschuldige deutsche Städte oder die unschickliche Behandlung, die den meisten nach der Kapitulation zuteil wurde. Dass Emil Roth bei der Daimler-Benz AG in Marienfeld zwangsverpflichtet war und einen Stundenlohn von 76 Pfennig erhielt, bevor er und seine Frau Emilie im 14. Osttransport das Generalgouvernement Polen erreichten und dort getötet wurden, wird wohl in keiner Erinnerung mehr lebendig sein. Auch, dass seine Nachbarin Hedwig Metzen im Ghetto Piaski ihr Leben verlor, die fünfköpfige Familie Plaut nach Riga verschleppt und am dortigen Blutsonntag ermordet wurde, ist wohl nicht mehr von Bedeutung. Hermann Jakob Bier kämpfte im Ersten Weltkrieg für das deutsche Vaterland und erhielt für seinen heldenhaften Einsatz das eiserne Kreuz, doch es schützte ihn nicht vor seinem Tod im Lager Westerbork.
Josephine blickte in den Himmel und fragte sich, was nun wohl alles auf sie zukommen würde. Sie hatte das Bild des Führers schon lange aussortiert, sein Buch im Ofen verbrannt, als die Rote Armee hinter Fürstenwalde ihren Weg in die Hauptstadt einschlug und die letzten wehrfähigen Soldaten unter sich begrub. Ungeachtet dessen war der Führer immer noch präsent gewesen. Sein Bild lag zerbrochen in ausgebombten Zimmern, im Justizpalast der Richter, bei Ärzten und bei den Bürgern. Irgendwo fand es sich immer: im Regal, auf dem Kamin, ganz offensichtlich oder in einer kleinen Ecke, die niemand mehr betrachten wollte. Es sollte die Deutschen noch jahrelang erinnern, wie gut diese Zeiten gewesen waren, was es alles unter ihrem Führer nicht gegeben hatte. Alles war so glorreich gewesen, denn endlich bekamen die Deutschen, was sie verdienten.
Als die Soldaten aus dem Osten die Stadt erreichten, sah man plötzlich viele weiße Fahnen aus den Fenstern hängen. Zuerst kamen sie von denen, die mit Leib und Seele von einem Krieg der Rassen sprachen und meinten, es gäbe genetische Unterschiede zwischen jenen und anderen. Sie waren die ersten, die ihre Fahne dem Wind angepasst hatten. Sie wurden weder in den Krieg eingezogen, sie verloren nicht ihr Leben, kämpften nicht für ihre Ideologie, sondern saßen in verschiedenen Ministerien, schützten sich und die Familie, bekamen das Geld und den Erfolg der Soldaten zugesichert. Während Millionen Menschen um sie herum starben, lachten sie und aßen ihren Kaviar. Wahrlich, dieses Leben musste glorreich sein. Das war es wohl, was die Deutschen als preußische Tugend verstanden und sie derart überlegen machte.
So wurde es schließlich stiller, die Angst vor Veränderung und Gerechtigkeit zog durch die Straßen. Wie die Strahlen der Sonne erfasste das Urteil jedes einzelne Haus, jedes einzelne Fenster, jeden einzelnen Menschen — mochte er auch noch so tief in seinem Keller gesessen haben. Einige üppige Hausfrauen hörte man schließlich im Laden schimpfen: » Das haben wir nicht gewollt «. Dann gingen sie in ihren Pelzmänteln und ihren Einkaufstaschen zurück nach Hause, sangen das Deutschlandlied und wiegten sich in Unschuld. Sie waren mit Sicherheit nicht diejenigen, die sich diesem Kriege zu verantworten hatten. Sie hatten daran keine Schuld gehabt.
Josephines Jungen teilte man mit, er habe es seinem Vater nun auch gleichzutun. Er habe sein Land zu verteidigen, die Stadt, in der er aufwuchs — alles für den Führer. Er habe es seinem Vater gleichzutun: zu kämpfen und zu sterben. Er sollte eine Schachfigur werden. Er sollte sein Leben für die Ideologie eines Mannes opfern, der schon vor mehreren Tagen sein Dasein zwischen Betonwänden in neun Metern Tiefe beendete; zusammen mit einem anderen Mann, seiner Gattin und ihren sechs Kindern. Kleine Jungs sollten vor großen Panzerabwehrkanonen üppige Damen schützen, die sich keiner Schuld bewusst gewesen waren. Sie sollten für die Verteidigung jener Frauen sterben, die in der Metzgerei einkauften, um schließlich dem tapferen Enkel zu sagen, wie wichtig es doch sei, was er für das Vaterland täte. Er war ihr ganzer Stolz, während sie mit dem Kriege nichts zu tun hatten; außer dem Regime ihre Stimme zu geben. Plötzlich, als er dann an ihre Türe klopfte, wollte niemand mehr Krieg. Schließlich verweigerte Josephines Sohn den Befehl und seine Mutter entschloss sich, in den Untergrund zu gehen. Sie tat es jenen gleich, die sie einst verachtete, deren Tod sie einst bejubelte, die in ihren Augen Feinde der arischen Rasse waren. Menschen hatten einen unterschiedlichen Wert — daran glaubte Josephine noch lange. Das Modell von ›Gut und Böse‹ war ein einfaches System, wenn man auf der falschen Seite stand. Nun war die Zeit gekommen, in der schließlich sie das Opfer wurde und erst dann verstand, aus ihrem eigenen Egoismus heraus, wie schandhaft plötzlich dieser Hass gewesen war. Erst als sie selbst realisieren musste, wie sie andere behandelte, konnte sie nachvollziehen, was sie eigentlich verbrochen hatte.
Wie in Trance setzte sie Schritt für Schritt zittrig über die aufgeplatzten Wege aus Teer. Sie lief durch die Straßen und sah ihren alten Krämer, der vor wenigen Jahren die erträglichsten Verkäufe ihres Bezirks machte. Heute stand er mit einem Reisigbesen auf der Straße, kehrte den Staub und die vielen kleinen Glasscherben ein, die aus seinen Fenstern gebrochen waren. Josephine blickte in Häuser und Gesichter, die vor vielen Monaten noch so unschuldig ausgesehen hatten, die an einen Endsieg glaubten und all ihre Angehörigen dafür verloren. Sie standen gemeinsam mit Josephine am Straßenrand und sahen sich an. Sie sahen auf die kaputte Kirche, das eingefallene Gerichtsgebäude, die ausgebrannten Theater und schwiegen über die vielen Leichen, die sie allesamt umgaben. Schließlich stieg Josephine über die Trümmer, fiel beinahe, doch sah hinauf zu ihrem Himmel. Es war ihr ganz privater, ihr ganz eigener Augenblick, den sie sich nun genommen hatte — zusammen mit den ganzen anderen, die, jeder für sich, verantwortlich dafür gewesen waren, was mit ihnen geschah. Welches Glück mussten sie gehabt haben, diesen Tag noch zu erleben. Sie waren keine Opfer einer Bombe geworden, sie waren keine Opfer der Gerichtsprozesse unter Roland Freisler. Sie waren nicht das Opfer einer Untergrundbewegung gewesen, die für Gerechtigkeit wie Gewissen einstand und deshalb verfolgt wurde. Josephine war kein Opfer einer falschen Religion, einer falschen Herkunft oder einer falschen Sexualität geworden. Sie gab sich allem Unrecht hin und der Dank dafür war, dass sie überlebte. Sie erhielt die Freiheit derjenigen, die sich gegen Josephines Ideologie aufbegehrten, die den Mut hatten, zu kämpfen. Plötzlich standen Führer und Widerstandskämpfer auf annähernd gleicher Ebene. Josephine würde sie alle als ›stolze Deutsche‹ betiteln.