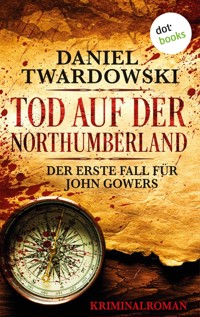Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wer kann dich retten, wenn du niemandem trauen kannst? "Fluch des Südens" von Daniel Twardowski jetzt als eBook bei dotbooks. Neuseeland 1867: Der amerikanische Privatdetektiv John Gowers verfolgt einen skrupellosen Mörder über Australien bis ans Ende der Welt. Doch in Neuseeland gerät Gowers zwischen die Fronten der blutigen Maorikriege, die das Land auf grausame Weise verwüsten. Die Ureinwohner wehren sich erbittert gegen die europäischen Siedler, die mit aller Brutalität um die Vorherrschaft kämpfen. Als Gowers einen Gefangenenaufstand unterstützt, wird er plötzlich mit seiner eigenen düsteren Vergangenheit konfrontiert … "Fluch des Südens" ist der dritte Teil einer packenden historischen Kriminalserie voller Spannung, Intrigen und Verrat. Die Presse über Daniel Twardowskis Kriminalserie: "Twardowski zeichnet ein höchst buntes Bild der damaligen Zeit, glänzend recherchiert wie fabuliert. Sein Roman entwickelt einen wunderbaren Sog." Focus Online "Spannende, mitreißende Unterhaltungsliteratur mit historischer Tiefe." Bestsellerautorin Anne Chaplet Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Fluch des Südens" von Daniel Twardowski. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 873
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Neuseeland 1867: Der amerikanische Privatdetektiv John Gowers verfolgt einen skrupellosen Mörder über Australien bis ans Ende der Welt. Doch in Neuseeland gerät Gowers zwischen die Fronten der blutigen Maorikriege, die das Land auf grausame Weise verwüsten. Die Ureinwohner wehren sich erbittert gegen die europäischen Siedler, die mit aller Brutalität um die Vorherrschaft kämpfen. Als Gowers einen Gefangenenaufstand unterstützt, wird er plötzlich mit seiner eigenen düsteren Vergangenheit konfrontiert …
„Fluch des Südens“ ist der dritte Teil einer packenden historischen Kriminalserie voller Spannung, Intrigen und Verrat.
Die Presse über Daniel Twardowskis Kriminalserie:
„Twardowski zeichnet ein höchst buntes Bild der damaligen Zeit, glänzend recherchiert wie fabuliert. Sein Roman entwickelt einen wunderbaren Sog.“ Focus Online
„Spannende, mitreißende Unterhaltungsliteratur mit historischer Tiefe.“ Bestsellerautorin Anne Chaplet
Über den Autor:
Hinter dem Autorennamen Daniel Twardowski steht der Literatur- und Medienwissenschaftler Dr. Christoph Becker, geboren 1962. Er lebt als freier Schriftsteller in Marburg und erhielt u. a. den Förderpreis zum Literaturpreis Ruhrgebiet, ein Daimler Chrysler-Stipendium der Casa di Goethe in Rom, den Oberhausener Literaturpreis und den Deutschen Kurzkrimipreis für Nachtzug.
Die Website des Autors: http://www.twardowski-autor.de/
Bei dotbooks erscheinen außerdem Tod auf der Northumberland und Das blaue Siegel, Band eins und zwei der Kriminalreihe um John Gowers.
***
Neuausgabe August 2015
Copyright © der Originalausgabe 2012 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von thinkrstock/istock/CreativeFire
ISBN 978-3-95824-203-6
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Fluch des Südens an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
http://instagram.com/dotbooks
Daniel Twardowski
Fluch des Südens
Der dritte Fall für John Gowers
Kriminalroman
dotbooks.
Here’s stout stuff, for woe to work on!
Melville, Moby Dick
Teil eins
1. Kapitel
Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass die kleine Effie Afton, eigentlich Post- und Paketboot auf dem unteren Mississippi, beinahe in zwei Teile zerrissen wurde. Ihre Schornsteine knickten ab wie Streichhölzer, und – was schlimmer war – ihre Kessel barsten. In unheimlicher Geschwindigkeit breitete sich Feuer über das ganze Schiff aus. Der Besatzung, die sich ausnahmslos in die Boote rettete, blieb nur die Genugtuung, dass die Flammen binnen Minuten auch den Gegner der Kollision erfassten und zumindest die hölzernen Teile jener gigantischen Brücke der Chicago & Rock Island Railroad schneller verschlangen, als diese Gesellschaft ihren Namen in Chicago, Rock Island & Pacific Railroad ändern konnte.
Die Bewohner von Davenport/Missouri und Rock Island/Illinois standen am Morgen dieses 6. Mai 1856 also schon wieder mit offenem Mund an den Ufern des Mississippi; denn das Feuer, das diese über fünfhundert Meter lange erste Eisenbahnbrücke über den Vater der Flüsse verschlang, war ein mindestens so grandioses Schauspiel, wie es ihre feierliche Einweihung am 22. April gewesen war. Damals, vor gerade zwei Wochen, hatten die Zeitungen des Ostens, etwa das Philadelphia Bulletin, triumphierend geschrieben, dass der Weg der Zivilisation von Ost nach West unwiderruflich beschritten sei und bald der glückliche Tag kommen werde, »an dem einer von uns ein Billett erster Klasse für einen Blitzzug Richtung Pazifikküste lösen wird«.
Diesmal verbreitete sich das Triumphgefühl eher von Nord nach Süd, und die ganzen tausendfünfhundert Meilen den Mississippi hinunter ließen die Kapitäne freudig ihre Dampfpfeifen ertönen. Selbst auf dem Ohio entrollte – eigenartigerweise noch am gleichen Tag – die Mannschaft eines Raddampfers ein riesiges Transparent mit der Aufschrift: »Mississippibrücke zerstört – Lasst alle frohlocken!«
Der Eigner der Effie Afton beeilte sich, die Eisenbahngesellschaft auf Schadensersatz zu verklagen, und eine Expertenkommission aus Kapitänen, Lotsen und Schiffseignern aus St. Louis und New Orleans kam zu dem wenig überraschenden Ergebnis, dass die Brücke ein ernsthaftes Hindernis für die Schifffahrt sei und nicht wieder aufgebaut werden dürfe. Politiker des Südens legten dem amerikanischen Kongress sogar flugs einen Gesetzentwurf vor, der den Bau von Brücken über schare Flüsse grundsätzlich verbieten wollte.
Spätestens jetzt wurde jedem nüchternen Beobachter klar, dass es nicht um Erwägungen zur Verkehrssicherheit, sondern um das Frachtmonopol ging; um Mais, Weizen, Schweinefleisch, Holz, den Reichtum des Mittleren Westens. Würde er weiterhin über die Flüsse nach Süden, nach New Orleans gelangen oder mit der Eisenbahn nach Osten, um in Chicago und New York umgeschlagen zu werden? Auch eine noch zukunftsweisendere Frage stand schon seit einigen Jahren im Raum: Sollte die früher oder später unvermeidliche transkontinentale Eisenbahn von den Nord- oder den Südstaaten ausgehen?
Kaum hatte jedenfalls die Chicago & Rock Island Railroad Company vor zwei Jahren ihre Pläne zum Brückenbau bei Rock Island, also im Norden, publik gemacht, scharten sich die Männer des Südens um den einflussreichsten Fürsprecher ihrer Interessen, um den amerikanischen Kriegsminister Jefferson Davis{i}. Davis untersagte daraufhin kurzerhand die Errichtung des Bauwerks, da Rock Island früher einmal militärisches Territorium gewesen war, und erst ein umständlicher Gerichtsprozess führte zu dem Ergebnis, dass Eisenbahnen, ähnlich wie Flüsse und Kanäle, Verkehrsstrafen geworden seien und dass keiner der beiden Transportwege ein dauerndes Hindernis für den anderen werden dürfe.
Unter Berufung auf genau dieses fortschrittliche Urteil und den eindrucksvollen Unfall der Effie Afton forderten deshalb die Schiffseigner des Südens den sofortigen Abriss der Brücke, respektive ihrer Ruine. Für den Schadensersatzprozess, mehr als zehn Monate später, verpflichtete die beklagte Eisenbahngesellschaft einen Rechtsanwalt aus Springfield/Illinois; einen Mann, der sich mit der Flussschifffahrt gut auskannte, weil er in seiner Jugend selbst Flöße nach New Orleans gesteuert hatte. Sein Name war Abraham Lincoln{ii}.
In den ersten Prozesstagen hatte dieser Anwalt, dem ein düsterer Backenbart und einige tiefe Gesichtsfalten eine gewisse Ähnlichkeit mit einem melancholischen Gorilla verliehen –jedenfalls in den Augen seiner Gegner –, hauptsächlich mit seinem Taschenmesser an einem Stück Holz herumgeschnitzt. Aber danach stellte Mr. Lincoln in schneller Folge so viele unangenehme Fragen, dass die euphorische Stimmung der Kläger rasch umschlug.
Was die Effie Afton, die doch gewöhnlich zwischen New Orleans und Louisville verkehre, eigentlich auf dem oberen Mississippi gesucht habe? Warum das Steuerbordrad des Dampfers zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in Betrieb gewesen sei? Welche Fracht in so kurzer Zeit einen so verheerenden Brand habe auslösen können?
Als diese klugen Fragen beziehungsweise die unzureichenden und schließlich ganz ausbleibenden Antworten die öffentliche Meinung immer stärker zugunsten der beklagten Eisenbahngesellschaft beeinflussten, beschlossen die Schiffseigner, die allgemeine Aufmerksamkeit auf ein anderes Ereignis zu lenken, und entschieden sich für eine Sensation, die seit dreißig Jahren das Interesse der Menschen auf beiden Seiten des Mississippi zuverlässig von allen anderen Dingen abzog: für ein Rennen! Ein Wettrennen der beiden schnellsten Dampfer auf dem Fluss, von New Orleans nach St. Louis.
2. Kapitel
Die Ankündigung, dass zwei wegen ihrer Geschwindigkeit berühmte Schiffe es auf einer Strecke von zwölfhundertachtzehn Meilen ausfechten würden, versetzte regelmäßig nicht weniger als zehn der Vereinigten Staaten von Amerika – die, die an den großen Flüssen lagen – in helle Aufregung. Waren die Namen der Kontrahenten einmal bekannt gegeben, wurde der Klatsch über sie wochenlang zu einem festen Bestandteil der Zeitungen. Die Politik, das Wetter, die Sklaven- oder die Indianerfrage, die Erweiterung der Union, die Lage in den Territorien, selbst sporadische Gold- oder Silberfunde waren von da an nur mehr zweitrangige Themen in den Saloons und Läden, auf den Straßen, Feldern und Veranden aller Ansiedlungen entlang des Mississippi, Ohio, Missouri und Arkansas.
Es bildeten sich Parteien, es wurden Wetten abgeschlossen, jedermann hielt sich für einen Experten auf dem Gebiet der Dampfschifffahrt, und die Kapitäne der Sultana, der J. M. White, Belle of the West, Old Natchez oder Edward Shippen wurden kurzzeitig zu Helden, die den Vergleich mit Hektor und Achill, dem starken Ajax oder dem listenreichen Odysseus nicht scheuen mussten. War der angekündigte Zeitpunkt da und das mindestens viertägige Rennen einmal gestartet, zog der Mississippi Zuschauer aus allen Teilen des Landes magisch an. In den Städten und Dörfern am Fluss vermieteten findige Hausbesitzer ihre Fenster, ja sogar Sitzplätze auf ihren Dächern und verkauften Erfrischungsgetränke oder Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Auf dem Land, den Plantagen wurde das Ufer des großen Stroms Ziel von Ausflügen, Picknicks, und selbst den Sklaven erlaubte man, ihre Arbeit niederzulegen, um den Wettkampf der riesigen, aber ebenso filigranen schwimmenden Maschinen zumindest einige Stunden lang zu verfolgen.
Weiter im Norden entstanden mitunter kleine Zeltstädte, in denen Zuschauer aus den entfernteren Gegenden die Vorüberfahrt der Dampfer beobachten konnten. Barfüßige Burschen auf Ackergäulen versuchten, den Schiffen zu folgen, so weit es ging. Andere hatten eher Augen für die von überall her angereisten jungen Damen, Farmerstöchter in ihren besten Kleidern. Mancher Mann lernte bei dieser Gelegenheit eine Frau kennen, der er sonst vielleicht nie im Leben begegnet wäre, und wenn die Kinder solcher Verbindungen Zweitnamen wie Magnolia, Princess, Belle Key oder – armer Bursche! General Quitman trugen, verdankten sie ihre Existenz gemeinhin einem Rennen der gleichnamigen Schiffe.
Ein Rennen führte stets flussaufwärts, sodass die Schnelligkeit eines Dampfers wesentlich von der Stärke und Qualität seiner Maschine abhing. Immer wieder waren Heizkessel explodiert und ganze Schiffe in die Luft geflogen, weil die Maschinisten beides überschätzten. Seit ein Bundesgesetz den zulässigen Dampfdruck pro Quadratzoll begrenzte, waren es allerdings andere Faktoren, die über die Geschwindigkeit eines Schiffes entschieden. Das war natürlich das Wetter – aber die Rennen fanden stets im zuverlässigsten Sommer statt, wenn auf Wochen hin keine Wolke am Himmel stand und kein plötzlicher Sturm das Wasser zu Flutwellen aufstaute.
Das war natürlich das Gewicht, also die Fracht – aber für ein Rennen wurde die Fracht sorgfältig so tariert, dass problemlos die beste Wasserlage gehalten werden konnte. Wusste man also etwa, dass ein Schiff bei einem Tiefgang von fünfeinhalb Fuß vorn und fünf Fuß achtern am schnellsten lief würde es nach Erreichen dieses Optimums nicht einmal mehr eine Schachtel mit homöopathischen Pillen an Bord nehmen. Auch die Trimmung spielte eine wichtige Rolle, weshalb man irgendwann aufgehört hatte, bei einem Rennen Passagiere mitzunehmen. Denn Passagiere, gleich welchen Alters, liefen ständig von backbord nach steuerbord, je nachdem, auf welcher Seite es gerade etwas zu sehen gab, während ein echter Dampfschiffer sich an Bord bewegte wie die Luftblase in einer Wasserwaage.
Die Feuerung war entscheidend; Holz oder Kohle – eine Glaubensfrage – denn Kohle war schwerer, hielt aber länger vor, während Holz sich schneller verbrauchte, aber unterwegs leichter zu laden war. Für ein Rennen wurde die Feuerung vorbestellt und entlang der Strecke bereitgehalten. Flachboote mit irrwitzigen Holzstapeln oder tief im Wasser liegende Kohlenprahme wurden in den Strom gerudert, in voller Fahrt an die Schiffe angehängt und längsseits gehievt. Während allerdings unglaubliche Mengen an Holz schneller an Bord verstaut wurden, als man »Mississippi« buchstabieren konnte, wirkten die schwerfälligen Kohlenprahme wie Schleppanker, und das entsprechende Schiff verlor erheblich an Fahrt.
Bei einem Rennen war also von entscheidender Bedeutung, wie viel Feuerung man verbrauchte, und das wiederum hing davon ab, welchen Kurs der jeweilige Dampfer steuerte. Je weiter er in der Flussmitte – also der Gegenströmung – fuhr, desto mehr fraßen die Kessel. Je geschickter er sich im flachen Kehrwasser der Ufer hielt, desto geringer war der Widerstand der Strömung, und desto länger hielt die Feuerung vor. Das ahnungslose Publikum, jubelnd und Fähnchen schwenkend, wenn das riesige Schiff mit einer Geschwindigkeit von fast fünfzehn Meilen in der Stunde eine Uferböschung so elegant passierte, dass der Barbier an Bord die gereckten Hälse der Zuschauer hätte rasieren können, hielt dieses Wunder der Steuerung und Navigation immer für eine Leistung der Kapitäne. Aber jeder, der sich mit dem Fluss und seinen Schiffen näher beschäftigt hatte, wusste natürlich, dass dies die hohe Kunst der Lotsen war.
3. Kapitel
Von einem Mississippilotsen wurde erwartet, dass er den Fluss auswendig kannte – und das hieß nicht nur, dass er jederzeit anhand der Points, also der Orientierungspunkte und Landmarken der Ufer, wissen musste, wo genau sich sein Schiff befand, wo die jeweilige Fahrrinne verlief wie hoch das Wasser stand und wie die dortigen Untiefen sich verschoben hatten, falls dies geschehen war, sondern dass er auf einer Strecke von rund anderthalbtausend Meilen tatsächlich jeden einzelnen Baumstamm kannte, der im Wasser lag, und sogar im Voraus sagen konnte, ob es ein Snag oder ein Sawyer war.
Ein Sawyer war ein unruhiger Kunde; ein »junger« Baumstamm, der sich zwar irgendwo in einer Untiefe verkeilt, aber seinen Platz noch nicht gefunden hatte und je nach Strömungsverhältnissen und Wasserstand auf- und abwippte oder nach rechts und links ausschlug wie der Schwanz eines ungezähmten Pferdes. Bei Hochwasser oder Sturm konnte sich ein Sawyer sogar wieder losreißen, und man tat gut daran, diese unberechenbaren Gesellen weiträumig zu umfahren. Ein Snag hingegen war zur Ruhe gekommen, steckte metertief in seinem Grund und häufte nun Treibgut, Pflanzen und Sediment um sich an, die ihn eines Tages zu einer neuen Uferböschung, einer Insel oder einem Riff machen würden.
Der alte Mississippi arbeitete in diesen Dingen so unablässig, als wäre er der Ansicht, dass das Land noch nicht fertig sei. Zu den Besonderheiten dieses Flusses gehörte es, dass er Sand, Schlamm und Geröll nur zu einem verhältnismäßig geringen Teil in den Golf von Mexiko spülte. Das meiste verlor er unterwegs wieder, riss also an einer Stelle eine Uferböschung mit sich, um an einer anderen eine Untiefe daraus zu bauen, und änderte so noch in den Zeiten der Dampfschifffahrt fortwährend seinen Lauf Auf den Landkarten sah es so aus, als würde der Fluss ständig über den sinnvollsten Weg zum Meer nachdenken.
Tatsächlich verkürzte er sich mit der Zeit; gab eine dreißig Meilen lange Flussbiegung, die er mit genügend Sediment gefüllt zu haben glaubte, kurzerhand auf und durchschnitt stattdessen bei Hochwasser die dazugehörige Landenge. War ein Mann also in einem Jahr noch stolzer Besitzer einer Plantage mit zwei eigenen Anlegestellen, saß er vielleicht schon im nächsten auf dem Trockenen und musste darüber nachdenken, wie er seine Ernte zu dem inzwischen meilenweit entfernten Fluss bekam. Ein Märchen, das die Schwarzen im tiefen Süden gerne erzählten, handelte von einem Feldsklaven namens Tip. Der legte sich eines Abends auf einer Landzunge in Missouri und am Westufer des Mississippi schlafen und erwachte als freier Mann in Illinois, auf dem Ostufer. Ob das wirklich geschehen war, wusste niemand, aber es war möglich; denn der Fluss bildete an dieser Stelle die Grenze zwischen dem Sklaven haltenden und dem freien Staat.
Für die Lotsen hieß all das, dass sie sich den gesamten Flusslauf die Fahrrinnen, Inseln, Sandbänke und das übrige Groß und Klein nicht einmal, sondern einmal im Monat einprägen mussten. Das war nur möglich, indem sie ihn wieder und wieder befuhren, flussaufwärts, flussabwärts, bei Hoch- und Niedrigwasser, bei Tag und bei Nacht. Eines der ältesten Gesetze auf dem Mississippi sah deshalb vor, dass jeder Lotse kostenlos auf jedem Schiff mitreisen konnte, um sich den Fluss anzusehen. So kam es, dass auf beinahe jedem Dampfer – vor allem auf denen, die für ihre gute Küche bekannt waren – neben den angeheuerten und bezahlten Lotsen noch zwei oder drei ihrer Zunftbrüder mitfuhren, die dabei scheinbar nichts anderes taten, als über den Fluss und ihre früheren Fahrten auf ihm zu plaudern.
Tatsächlich aber, und ohne dass sie diesen Prozess bewusst steuerten, registrierten diese Männer jede einzelne der sechs- bis achttausend Lotungen an Bug und Heck, Backbord und Steuerbord. Und wenn man ihnen auf der Reise statt ihrer Schiffergeschichten das Alte Testament vorgelesen hätte, hätten sie am Ende der Fahrt genau gewusst, dass man im Buch Josua, Kapitel sieben bis zweiundzwanzig, die Trockenbarre Nr. 10 oberhalb von New Madrid passiert hatte und dass die Lotungen an Backbord im Kapitel neunzehn, Vers dreiundzwanzig folgende, zweimal hintereinander nur twaineinviertel statt twaineinhalb betragen hatten – was nur bedeuten konnte, dass die alte Sandbank sich nach Südwesten zu verlängern begann.
Hatte er aus den Augenwinkeln gesehen, dass die Wurzeln einer großen Pappel an einer bestimmten Uferböschung bei Millikens Bend nicht, halb oder völlig zu sehen waren, wusste ein erfahrener Lotse, dass die Sandbänke vor Bayou Sarah, sechshundert Meilen weiter südlich, leicht, schwer oder gar nicht passierbar waren. Mit einem Wort: Die Mississippilotsen waren die vielleicht bemerkenswertesten Gedächtniskünstler des 19. Jahrhunderts – ohne es allerdings zu wissen, denn ihr Gedächtnis arbeitete nicht nach irgendwelchen ausgeklügelten Systemen, sondern irgendwo unter ihrer Bauchdecke, zwischen Milz und Zwerchfell. Mit einer Ausnahme.
4. Kapitel
Neuseeland war nicht nur die letzte der pazifischen Landmassen, die, irgendwann im Hochmittelalter, von Menschen besiedelt wurde, es war auch, wie in einer zweiten Reflexion auf seine abgeschiedene geografische Lage, der letzte Winkel der Welt, den die Europäer gut fünfhundert Jahre später kolonisierten. Was die dabei geführten »neuseeländischen Kriege« von allen anderen kolonialen Auseinandersetzungen des Britischen Empires unterschied, war vor allem der Gegner, mit dem die Engländer es zu tun hatten.
Die Maori waren ein junges Volk, unruhig, kriegerisch, aggressiv, letzter Spross im weit verzweigten Stammbaum der Tangata Whenua, kühner pazifischer Seevölker. Ihre Vorfahren kamen von den Marquesas, den Society- oder Cookinseln, und schon der Name, den sie dem neuen großen Land im Süden gaben, zeigt, dass seine Entdeckung und Besiedlung kein reiner Zufall war: Aotearoa – die lange weiße Wolke.
Die aktiven Vulkane der Nordinsel schleuderten Asche und Staub bis in die Stratosphäre, der stetige Westwind trug sie Tausende von Meilen über den Pazifischen Ozean, und die Bewohner weit entfernter Inseln, über denen diese Asche irgendwann niederregnete, mussten sich nur noch sagen, dass, wo Staub herkommt, auch Land sein muss. Nicht auszuschließen ist auch, dass irgendwelche von Stürmen verschlagenen Fischer die gigantischen Rauchsäulen selbst am unbekannten südlichen Himmel entdeckten und dem Ursprung der »langen weißen Wolke« auf den Grund gingen.
Die Landnahme war von erheblicher Aggressivität geprägt. Pflanzen und Tiere, die sich in Jahrmillionen ungestört entwickelt hatten, wurden binnen zweier Menschenalter ausgerottet, vernichtet, abgeholzt. Die Einzigen, die dabei noch rücksichtsloser vorgingen als die Menschen, waren die Ratten, die sie in den Tahis, ihren riesigen Auslegerbooten, unfreiwillig mitgebracht hatten. Die Gesellschaft, die die Ankömmlinge bildeten, war sehr kriegerisch; die verschiedenen Stämme, die ihre Namen von den einzelnen Kanus der Auswandererflotte herleiteten, überzogen einander mit Gewalttaten und Blutrache. Die Starken trieben die Schwachen vor sich her, über die gesamte Nordinsel, auf die Südinsel und von dort weiter nach Stewart Island und auf die Chathams.
Auch die Begegnung mit den ersten Europäern war kriegerisch. Als Abel Tasman 1642 zu landen versuchte, töteten die Maori vier seiner Matrosen, die Holländer flohen und hinterließen nichts als den europäischen Namen: Neuseeland. Ein spanisches Schiff verschwand schon vorher mit Mann und Maus vollständig aus der Geschichte, nur blutige Legenden überlebten, und noch 1772 wurde der französische Entdecker Marion Du Fresne getötet und gegessen, weil er unwissentlich ein Tabu gebrochen hatte. Nur den Wal- und Robbenjägern gestatteten die Maori später den gelegentlichen, saisonalen, Anfang des 19. Jahrhunderts dann sogar ganzjährigen Aufenthalt an ihren Küsten, um von ihnen begehrtes Handelsgut, Tran, Kleidung und – Waffen einzutauschen.
Lange Zeit fragten sich die Europäer, wie die Maori ohne Seekarten, Sextanten und europäische Hochseeschiffe Neuseeland überhaupt gefunden hatten, und favorisierten wieder einmal die schwachsinnige Idee, dass es sich bei ihnen um einen der verlorenen Stämme Israels handeln müsse, dem Jehova persönlich dieses unzugängliche Exil zugewiesen habe. Es ist jedoch bezeichnend für das Selbstbewusstsein der Ureinwohner, dass sie sich diesen ursprünglich ja diskriminierenden Gedanken sofort zu eigen machten. Einige nannten sich selbst tatsächlich Tiu, Juden, reklamierten eine besonders enge Verbindung zu Gott dem Herrn für sich und brachten eigene Propheten hervor, die im Glauben des einfachen Volkes gleichberechtigt neben Moses, Jeremia, Ezechiel und so weiter standen.
So hielten es die Maori mit allem, was die Pakeha, die Europäer, brachten; eigneten sich Kenntnisse und Fertigkeiten in Landbau, Handel und Handwerk an, die ihnen nützlich waren, fügten sie ein in ihre Weltvorstellung, sahen sie aber nicht als großzügiges Geschenk der weißen Herren an, sondern als ein Recht, das ihnen zustand. All das hieß: Diese Menschen ordneten sich ganz einfach nicht unter, betrachteten sich nicht als Schüler und Untertanen einer überlegenen Rasse, sondern bezeichneten die weißen Siedler, die sie in ihr Land ließen, im Gegenteil als »unsere Weißen«. Einzelne Stämme schrieben sogar an den englischen König und baten um mehr Weiße – ziemlich ungewöhnliche Dokumente der britischen Kolonialgeschichte.
Die folgenreichste Übernahme europäischer Technologie bestand jedoch in der Einführung der doppelläufigen Muskete. Jahrhundertelang hatten die Stämme einander bekriegt, ohne dass das pro Jahr mehr als zwei oder drei Dutzend Menschenleben gekostet hätte. Die Muskete, die die Krieger der Nordinsel sehr bald meisterlich zu handhaben wussten, änderte das und brachte die Maori in einem fast vierzigjährigen Bürgerkrieg an den Rand des Untergangs. Ganze Landstriche entvölkerten sich und wurden von lachenden Dritten, den Pakeha, also den weißen Siedlern, besetzt.
Die »Musketenkriege« endeten 1840 und führten dazu, dass nur wenige Stämme sich den immer größeren Einwanderungswellen der Pakeha wirksam entgegenstellen konnten oder wollten. Paradoxerweise machten sie deren Widerstand aber auch hocheffektiv: Zum ersten Mal standen die Briten Eingeborenen gegenüber, die genauso gut bewaffnet waren und schießen konnten wie sie selbst. Und selbst als die Zahl der Pakeha Anfang der 1860er-Jahre die der Maori erstmals überstieg, half das _ den Weißen nur wenig, denn in einem entscheidenden militärischen Punkt waren die Eingeborenen ihnen weit überlegen: in ihren Verteidigungsanlagen.
Das Pa, das befestigte Dorf oder Lager der Maori, war mit seinen Grabensystemen, gestaffelten Holzpalisaden, Unterständen, Schießscharten so geschickt angelegt, dass es an Widerstandskraft vielleicht erst von den Schützengräben an der Westfront des Ersten Weltkriegs erreicht oder übertroffen wurde. Mit den Angriffswaffen, sogar der Artillerie des 19. Jahrhunderts, war gegen ein solches Bollwerk wenig auszurichten. Zwanzig bewaffnete Männer in einem Pa von strategischer Bedeutung, etwa über einem Flusslauf oder einem Pass, konnten eine ganze Armee aufhalten.
Insbesondere Riwha Titokowaru, geboren und aufgewachsen zur Zeit der Musketenkriege, war eines der Genies auf dem Gebiet des Fortifikationswesens. Nächtliche Überfälle, kurze Raubzüge gegen einzelne Farmen und kleine Siedlungen mit anschließendem raschem Rückzug in die unzugänglichen Berg-, Fluss- und Urwaldbefestigungen waren seine Spezialität, der die Pakeha wenig entgegenzusetzen hatten.
Nur in offener Schlacht, in halbwegs gangbarem Gelände konnten die Briten in den Kriegen von 186o bis 1866 die Maori besiegen, und Titokowaru, klug geworden in diesen Kämpfen, gedachte nicht mehr, ihnen solche Schlachten zu liefern. Noch aber schmiedete er an einer schwierigen Allianz der verschiedenen Stämme rund um den großen Vulkan Taranaki, die die Ngati Tama, Te Ati Awa, Ngati Ruanui und Ngarauru unter seinem militärischen Kommando vereinigen sollte.
5. Kapitel
Der berühmteste Lotse auf dem Mississippi war der legendäre Isaiah Seilers, der den Fluss schon mit allem befahren hatte, was irgendwie schwamm. Er war definitiv vor dem ersten Dampfboot da gewesen und somit gut zwanzig Jahre älter als die erfahrensten Lotsen, die ihrem Handwerk in den 1850er Jahren nachgingen. Es hieß, er habe die Fahrt St. Louis – New Orleans über siebenhundert Mal in beide Richtungen gemacht, was einer Lebensreise von eins Komma sieben Millionen Meilen und einem Tagesdurchschnitt von etwa neunzig Meilen entsprach.
Seine Erinnerungen reichten so weit zurück, dass er im Grunde über einen anderen Fluss sprach, wenn er über den Mississippi redete, und um seine Kollegen ja recht fühlen zu lassen, was für grüne Jungen sie im Vergleich mit ihm waren, pflegte er solchen Erzählungen mit Einleitungen wie: »Als Louisiana noch am Missouri lag« die letzte Würze zu geben.
Obwohl jeder wusste, dass seine Verpflichtung auf der A. L. Shotwell mehr oder minder symbolischer Natur war und die eigentliche Arbeit von den Lotsen George Ealer und Jeb Smith getan werden würde, erhöhte – zumindest den Zeitungsberichten zufolge – der Name Sellers die Chancen der Shotwell im bevorstehenden Rennen ganz erheblich. Ihr Gegner, die etwas kleinere, etwas leichtere Eclipse konnte jedenfalls nicht mit derartigen Berühmtheiten aufwarten, sodass die Wetten bald drei zu eins gegen sie standen, obwohl sie ihre zumindest gleichwertige Geschwindigkeit schon mehrfach unter Beweis gestellt hatte.
Kaum war das Rennen jedoch am 30. Juni 1857 gegen siebzehn Uhr in New Orleans gestartet, schienen sich die Berichte zu bestätigen und die geballte Erfahrung der Sellers-Ealer-Smith auszuzahlen. Die Shotwell schwenkte als Erste in die schmale Fahrrinne bei Carrolton Bend ein und lag fünf Stunden später bei Einbruch der Nacht und vor Donaldsonville bereits gut fünfhundert Yards in Führung.
In dieser ersten Nacht stand ein leuchtender weißer Vollmond am wolkenlosen Himmel des tiefen Südens, und deshalb waren die Ufer des Mississippi bei Baton Rouge auch weit nach Mitternacht noch von zahllosen Zuschauern bevölkert. Mütter weckten ihre schlafenden Kinder auf, Betrunkene steckten ihre Köpfe in Wassertonnen, damit sie den Anblick der großen Schiffe nicht versäumten, die tiefschwarze Linien in die ungeheure Fläche aus flüssigem Silber schnitten, in die der Mond den großen Strom zu verwandeln schien. Die Distanz war nicht wesentlich größer geworden; wie ein Schatten folgte die kleinere Eclipse dem Kielwasser der majestätischen A. L. Shotwell, wie ein Echo klang das Aussingen ihrer Lotgasten zum dunklen Ufer hinüber.
Bei Red River Landing erfolgte bei Sonnenaufgang der erste ernsthafte Angriff des kleineren Schiffes. Während die Shotwell zum Ostufer herüberkreuzte, um den gefürchteten Sandbänken auszuweichen, die der Red River hier weit in den Mississippi schob, verließ sich die Eclipse offenbar auf ihren geringeren Tiefgang, blieb auf der Westseite des Stroms und jagte mit viel Glück über die unberechenbaren Untiefen hinweg. Da die Strömung hier entsprechend stärker war, erreichte sie dadurch allerdings nicht allzu viel.
Den ganzen folgenden Tag über belauerten die Schiffe einander; wartete die Eclipse auf irgendeinen Fehler der Shotwell, um an Engstellen an ihr vorbeizuziehen, legte die Shotwell Volldampf vor, wenn sie nach dem Kreuzen in eine breitere Fahrrinne kam, und gewann so der Eclipse, die das Gleiche natürlich erst Minuten später tun konnte, Meter um Meter ab.
Als sie nach vierundzwanzig Stunden Vicksburg erreichten, lag die Shotwell fast eine Meile in Führung. Hier geriet der Eclipse plötzlich ein Floß mit begeisterten – böse Zungen behaupteten später: extra dafür bezahlten – Zuschauern ins Gehege, und die Folge war ein Ruderschaden, der sie vier Stunden aufhielt. Vier Stunden – das waren fast fünfzig Meilen. Ein nahezu uneinholbarer Vorsprung, wenn kein Wunder geschah oder die Shotwell gleichfalls Pech hatte.
In der zweiten Nacht, deutlich dunkler als die erste, holte die Eclipse zwar wieder einiges von ihrem Rückstand auf passierte Helena, also die Hälfte der Strecke, aber dennoch erst knapp drei Stunden nach der Shotwell. Das Rennen schien gelaufen.
6. Kapitel
Titokowaru, Häuptling der Ngaruahine vom Stamm der Ngati Ruanui in der Provinz Taranaki, erwachte in völliger Dunkelheit, schweißgebadet. Er hatte wieder mit der Frau geschlafen in seinem Traum; einer Frau, die er nicht kannte und nie gesehen hatte. Seit er Keuschheit gelobt hatte für die große Aufgabe, die vor ihm lag, träumte er in fast jeder Nacht von der Frau.
Keuschheit gehörte eigentlich nicht zu den üblichen Traditionen der Maori. Titokowaru hatte dieses Mittel der Selbstdisziplinierung in seiner Zeit als Schüler methodistischer Missionare kennengelernt. Sie hatten ihn auf den Namen Hohepa Otene oder Joseph Orton getauft und sich viel von dem hochintelligenten und vielseitig begabten jungen Mann versprochen. Er hatte das Wissen beider Welten studiert, sprach die Sprachen beider Völker, konnte lesen und schreiben und war als Methodistenlehrer ebenso ausgebildet wie als Tohunga, als Maoripriester. Aber seine eigentliche Berufung war der Krieg.
Sein Vater, ein Unterhäuptling der Ngaruahine, hatte ihn schon als Elfjährigen mit in die zahllosen Kämpfe gegen die anderen Stämme genommen: gegen die Wanganui im Süden, die Tuwharetoa im Osten und die furchtbaren Waikato-Stämme des Nordens. Titokowaru hatte sich darin als ebenso kühner wie kühler, nämlich vollkommen furchtloser Krieger erwiesen. In den Taranaki-Kriegen gegen die Engländer hatte er unter anderem den Angriff auf New Plymouth angeführt und den britischen Kommandeur William King persönlich getötet, war aber auch selbst schwer verwundet worden.
Eine Kugel kostete ihn das Sehvermögen des rechten Auges, und eine scheußliche Narbe entstellte seither sein ohnehin nicht ansehnliches Gesicht. Ein englischer Soldat beschrieb ihn jedenfalls als »den hässlichsten und dunkelhäutigsten Eingeborenen, den ich je sah«. Mittelgroß, für einen Maori eher mager, hatte Titokowaru außerdem die exzentrische Angewohnheit, in einem europäischen Anzug und mit dem typischen Hut eines britischen Gentlemans in die Schlacht zu ziehen. Er galt als exzellenter Damespieler und war weder dem Alkohol noch den Frauen abgeneigt. Das wurde auch zu seinem größten Problem, denn in einem Fall gehörte Keuschheit eben doch zu den Traditionen der Maori: wenn ein Kampf bevorstand.
Titokowaru warf die Decke ab und stützte sich auf den rechten Ellenbogen. Seine Kleider klebten am Leib. Er strampelte sich wütend frei und versuchte aufzustehen, aber ein scharfer Schmerz im Bereich der Lendenwirbel zwang ihn zuerst auf die Knie. Mit gekrümmtem Rücken bewegte er vorsichtig Schultern und Hüften, fast wie eben in seinem Traum. Verlagerte dann sein Gewicht von einem Knie auf das andere, bis die Schmerzen erträglich waren. Dabei hatte er das Gefühl, dass die durchgeschwitzten Kleider tonnenschwer waren und ihn zu Boden drückten. Umständlich zog er sie aus, bis er so nackt war, wie ein Krieger, der das Whakapapa in Form von Tätowierungen auf nahezu allen Teilen seines Körpers trug, nur werden konnte.
Das Whakapapa war nicht nur eine Genealogie, die Reihe der Ahnen. Es bezeichnete auch die Herkunft des Kriegers aus dem Land selbst; die Geschichte der Landschaft, in der er geboren wurde, seinen ersten Schrei ausstieß, das erste Mal tötete, liebte, seine Kinder der Sonne entgegenhielt. Das Whakapapa war das Leben selbst, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in dem der einzelne Mann nur eine vorübergehende Rolle spielte.
Schließlich erhob sich Titokowaru aus seiner kauernden Stellung und spürte, wie gut das Spannen und Strecken beim Gehen seinen kräftigen Muskeln gefiel. Er trat in die Nacht hinaus, und der Wind trocknete seinen Schweiß, ließ ihn frösteln. Er fühlte, wie sein Glied in der Kälte zusammenschrumpfte, seine Hoden sich an den Körper zogen, aber er blieb nicht stehen, bis er die Palisade und ihre Wächter erreicht hatte. Die Männer starrten auf ihren nackten Häuptling, wagten aber nicht, ihn anzusprechen, denn ein seltsamer, tiefer Zorn lag auf seinem Gesicht. Er verließ das Pa, sein befestigtes Dorf Te Ngutu o te Manu, den »Schnabel des Raubvogels«, und erstieg eine Anhöhe, bis er die vertraute Silhouette des Taranaki zweieinhalbtausend Meter hoch in den Himmel ragen sah, eine Spur dunkler als die Nacht.
Hier blieb er stehen, hob beide Arme zu den unsichtbaren Wolken empor und murmelte in den schneidenden Wind die Worte: »Ich bin ihr, und ihr seid ich.« Titokowaru beschwor seine Ahnen um Hilfe bei dem, was vor ihm lag, nannte langsam ihre Namen, einen nach dem anderen; Männer, die er nie gesehen hatte, aber die in seinem Blut lebten. Immer weiter zurück reichte die Kette der Namen, der Häuptlinge und Krieger, bis zu Turi, dem legendären Kapitän des ersten Kanus, das auf Aotearoa landete, und noch weiter hinaus, zu den Tangata Whenua, den großen Seefahrern.
Tausend Jahre reichte Titokowarus Erinnerung zurück: »Ich bin ihr, und ihr seid ich.« Und als erden letzten Namen nannte, sah er, dass der Himmel über dem Taranaki allmählich grau wurde.
7. Kapitel
Wie so oft, wenn er Goethe las, blieb Manu-Rau, der Vogel, der überall fliegt, bereits nach wenigen Sätzen hängen; nicht weil sie ihn zum Nachdenken reizten, sondern weil sie ihn auf eigene Gedanken brachten, die mit Goethe nichts mehr zu tun hatten. Auf diese Weise war er in seinen fast vierzig Jahren im Faust nie auch nur bis zum dritten Akt gekommen, es sei denn, er huschte darüber hin. Aber dann huschte er eben darüber hin, und Goethe brachte ihm überhaupt nichts. An die großen Dramen und Menschheitsentwürfe wagte er sich schon gar nicht mehr heran. Die Gedichte gefielen ihm, denn Gedichte blieben, trotz aller Gedanken, die sie womöglich auslösten, auch in sich selbst überschaubar. Als er die Gedichte überhatte, suchte Manu-Rau deshalb gezielt die kürzeren Dramen aus Goethes Gesammelten Werken heraus. Proserpina hatte er vorher durchgeblättert und kurz genug gefunden, um ein Tänzchen mit der Dame zu wagen.
Zum Schlafen war er zu unruhig gewesen, hatte eine Weile auf den Atem von Emilia und seinen drei Kindern gelauscht und sich dann, lange vor der Morgendämmerung, schon wieder erhoben. In der gemütlichen Wohnküche, dem größeren ihrer beiden Räume, entzündete er eine Paraffinlampe, stellte sie ins Fenster und setzte sich gemeinsam mit Goethe an den Tisch davor. Manu-Rau gefiel die Vorstellung, dass der neue Tag, der irgendwo in der achttausend Kilometer weiten Wasserwüste des Südpazifiks geboren wurde, zuallererst ihn sehen würde: in seinem Blockhaus auf der Coromandel Range, über dem Meer, Goethe lesend. Und nun hatte ihn dieser Kerl schon wieder erwischt, schon im vierten Vers:
»Und was du suchst, liegt immer hinter dir.«
War das so? Was lag hinter ihm? Und hatte er irgendetwas davon gesucht, abgesehen von dem verfluchten Gold, das sich immer vor ihm zu verstecken schien?
Manu-Rau war der Ehrenname, den seine Feinde, die Maori, ihm gegeben hatten, und er trug ihn mit Stolz. Aber geboren wurde er unter dem Namen Gustav Ferdinand von Tempsky in Braunsberg an der Mährischen Pforte, und das Whakapapa der Mährischen Pforte war mächtig in ihm. Auf diesem Weg waren sie alle gezogen, die Goten, Vandalen, die Hunnen und Langobarden, Bogumilen und Katharer. Hier, zwischen Riesengebirge und Hoher Tatra, war das Einfallstor aus den endlosen Ebenen des Ostens in die reichen alten Kulturgebiete des Südens und Westens: Süddeutschland und Frankreich, Italien und Griechenland. Durch die Mährische Pforte mussten sie alle: Attila und Alarich, Subotai und seine Mongolen – und es war ihre Unruhe, die Gustav Ferdinand von Tempsky um die ganze Erde getrieben hatte.
Früh fiel auf, dass der Junge vor nichts Angst hatte. Schon der Zehnjährige bestieg völlig allein den großen Schneeberg, hoch über die Baumgrenze, wo nur noch Krummholz wuchs, auf der Suche nach Rhiozagel, dem Dämon des Riesengebirges, ihn zu bekriegen. Als eben Achtzehnjähriger und nach seiner Ausbildung zum Offizier der preußischen Armee verließ er Deutschland, Europa und kolonisierte die Mosquito Coast in Zentralamerika. Den Einundzwanzigjährigen lockte das Gold nach Kalifornien; Reisen durch Mexiko, Guatemala, San Salvador folgten. Mit dreißig schürfte er auf den Goldfeldern von Bendigo in Australien; vier Jahre später der kurze Goldrausch auf der Coromandel Range und ein neues, das letzte Land.
Da er nie nennenswerte Mengen an Edelmetall fand, tat Gustav Ferdinand von Tempsky das, was er als preußischer Offizier am besten konnte: Er bildete Soldaten aus und kämpfte in zahllosen kleinen Kolonialkriegen für Kultivierung und Urbarmachung, für Fortschritt und Zivilisation. Hufschläge rissen ihn jetzt aus seiner Vergangenheit und Goethes Proserpina; draußen war die Sonne aufgegangen, und ein Reiter kam den langen, gewundenen Passweg hinauf, der nach Thames und Auckland führte. Von Tempsky trat ohne Angst, barfuß und in Hosenträgern vor sein kleines Haus.
»Morgen, Sir«, sagte der blutjunge Bursche mit der herzhaften Zwanglosigkeit, die kein Drill der Welt den britischen Kolonisten je austreiben würde. »Colonel McDonnell lässt Sie grüßen: Es wäre mal wieder so weit!«
Die meisten preußischen Offiziere hätten auf eine in dieser indiskutablen Form vorgetragenen »Kriegserklärung« mit Wutausbrüchen bis hin zum Schlagfluss reagiert, aber Manu-Rau ließ den Mann einfach stehen, ging bis zur Felskante und schaute über die See hinaus. »Colonel McDonnell« – sein Freund Tom hatte es weit gebracht seit den Waikato-Kriegen, in denen er, von Tempsky, noch McDonnells Vorgesetzter gewesen war. Diesmal würde es also umgekehrt sein, und er überlegte kurz, ob er das aushalten könnte.
Ein Geräusch ließ ihn herumfahren, und er sah, wie Emilia, Louis, Randall und sogar die kleine Lina, von der Ankunft des Reiters geweckt, verschlafen aus der Tür schauten. Seine Familie hatte weiß Gott Besseres verdient als die Armut, in die er sie geführt hatte. Emilia, nur im Nachthemd, barfuß und mit gelösten Haaren, kam ihm entgegen. Er liebte sie, das hatte er immer getan, seit er sie zum ersten Mal gesehen hatte; aber er liebte auch die schöne Wilde, Takiora, die in den Jahren des Buschkrieges sein bester Scout und seine Geliebte gewesen war und schon auf ihn warten würde.
Doch es war nicht der Gedanke an Takiora, nicht das herrliche Leben im Feld und auch nicht die Aussicht auf eine gute Bezahlung, die ihn seine Entscheidung treffen ließen: Es war der Kampf selbst, auf den Manu-Rau sich freute.
»Sagen Sie Colonel McDonnell, ich werde kommen!«
8. Kapitel
Te Kooti lag an dem fremden Strand und sah die Eidechse auf dem sandigen Boden umherhuschen, auf dem er schlief. Schlief er? Seine Augen waren offen, das Tier Wirklichkeit. Eine gezackte schwarze Linie lief wie ein breiter Blitz über den glänzenden, gelbgrünen Leib, endete in der zuckenden Schwanzspitze. Langsam kroch die Eidechse auf seinen Kopf zu, auf seinen Mund, seine Augen. Te Kooti presste die Lippen zusammen, denn Whiro, der Geist alles Bösen, nahm, wie es hieß, gern die Gestalt einer Eidechse an, drang in den Körper der Menschen ein, die die alten Götter strafen wollten, und fraß von innen heraus ihre Lebensfunktionen auf.
Er glaubte nicht mehr an den alten Unsinn, er war getauft; aber die Angst blieb, und die Augen konnte er nicht abwenden. Die Eidechse stand jetzt dicht vor Te Kootis Gesicht, deutlich sah er den Glanz in den bösen kleinen Augen, und da war etwas Seltsames, Furchterregendes: Immer wenn sie den Kopf bewegte, bewegte sich auch Te Kootis Kopf, und nach einer Weile begriff er, dass er in einen Spiegel sah. Er selbst war die Eidechse.
Der Spiegel begann jetzt, sich zu bewegen wie Wellen auf einer Wasserfläche, und wurde zu einem wogenden Meer, in dem Te Kooti schwamm. Er schwamm nicht wie ein Mensch, denn er war kein Mensch, fühlte einen Schwanz auf das Wasser schlagen und sah seine eigene Zunge vor seinem Gesicht hin und her schnellen: rot, schmal, an der Spitze gespalten. Er hörte eine ferne Brandung, hob den Kopf und sah, dass es Aotearoa, die lange weiße Wolke, war, auf die er zuschwamm; das Land, das er zuletzt so gesehen hatte, langsam am Horizont versinkend, als die Pakeha ihn auf Befehl der Regierung in Wellington deportierten.
Erst als er näher herankam, sah Te Kooti, dass er sich getäuscht hatte. Was er für die steilen, glatten Ufer eines Fjordes gehalten hatte, waren in Wirklichkeit die Beine eines Weibes, einer weißen Frau, die mit gespreizten Schenkeln in der Brandung lag. Die Wellen spülten ihn gegen den warmen Sumpf ihres Geschlechts, seine Zunge stieß vor, seine Zähne packten ihr Fleisch, aber sie rührte sich nicht. Te Kooti wand sich, drehte sich wie eine Schlange in ihren dunklen Leib, fühlte, wie sie seinen Kopf, seinen Körper umschloss. Irgendwann stieß er auf ihre Gebärmutter und begann, gierig zu fressen.
Dann sah er die Flamme, ein wunderbares weißes Licht. Er kroch darauf zu, hob die Hand und durchstieß die Flamme. Sie brannte nicht. Flackerte, leuchtete heller als alle Feuer, die er in seinem Leben gesehen hatte, aber sie brannte nicht. Da wusste er, dass er nicht mehr in dieser Welt, sondern in der Taha wairua war, wie die Maori das Universum des Geistes nennen. Dann traf ihn etwas.
»Aufstehen, du faules schwarzes Aas!«, brüllte Hauptsergeant Michael Hartnett, und der Speichel tropfte durch seine fauligen Zähne. Noch einmal trat er mit seinem schweren Stiefel in Te Kootis Seite, und der große Maorikrieger kam zu sich, als wäre er weit fort gewesen.
Er fühlte sich sehr schwach, hatte Fieber, aber er wusste jetzt wieder, wo er war. Er lag an einem Strand der Insel Wharekauri, die die Weißen Chatham nannten. In der Bucht von Waitangi, wo man ihn gemeinsam mit fast dreihundert anderen Deportierten, angeblichen und tatsächlichen Hauhau-Rebellen, ausgeschifft hatte; Männern, Frauen und Kindern, für die die Kolonialregierung noch nicht einmal Hütten errichtet hatte. Jenseits des Strands, hinter einer niedrigen Hügelkette im Landesinneren, erklang ein unheimliches Geräusch, das sie nun für den Rest ihres Lebens hören sollten: die Schreie von einigen Millionen erwachender Seevögel, die in der riesigen Lagune von Te Whanga ihre Fischgründe hatten.
Te Kooti erhob sich schwankend und fühlte dabei, dass das Fieber tief in ihm steckte. Er war in einer fremden Welt, fünfhundert Meilen entfernt von seiner Heimat Aotearoa, das die Weißen Neuseeland nannten.
9. Kapitel
Das Rennen war gelaufen. Die letzten Nachrichten, am frühen Morgen per Telegraf in New Madrid eingetroffen, besagten, dass die Shotwell Memphis gegen zweiundzwanzig Uhr verlassen hatte, während die Eclipse erst nach Mitternacht eingetroffen war.
Zwar war die Nacht stockfinster gewesen, der Mond versteckt hinter den dichten Nebeln, den die hier liegenden Wälder in der schwülen sommerlichen Finsternis zuverlässig ausatmeten. Zwar war die Strecke zwischen Memphis und New Madrid durch zahllose Inseln und die daran hängenden Untiefen, Sandbänke, Re die am meisten gefürchtete auf dem ganzen Fluss. Zwar hatte die Shotwell deshalb sicherlich ihre Geschwindigkeit gedrosselt, aber dennoch war Major John W. Cannon an diesem herrlichen Morgen sicher, seinen Nachbarn, Freund und ewigen Rivalen Major Thomas P. Knox wieder einmal ausgestochen zu haben.
Sie wetteten nie um viel Geld. Gelegentlich um einen Nigger, wenn es die Sache wert war; ja, sie hatten eines Tages lachend festgestellt, dass ein großer schwarzer Dummkopf namens Ramses schon zweimal zwischen ihnen hin- und hergegangen war wie ein Wanderpokal. Meist aber ging es in den Wetten zwischen Major Cannon und Major Knox – beide hatten nie einen militärischen Rang bekleidet und trugen ihre Ehrentitel nur als zahlende Mitglieder der Kentucky-Miliz – lediglich um die Ehre, den »richtigen Riecher« zu haben.
Den hatte in der Mehrzahl der Fälle Major Cannon gehabt: Seine Plantage war größer, seine Ernten besser, seine Sklaven zahlreicher. Auch in Bezug auf Söhne lag er im Rennen des Lebens klar, nämlich mit sieben zu vier, vorn – aber nur, weil Henrietta Petulia Knox, die große Liebe seiner Jugend, seinem in diesem schmerzlichen Fall siegreichen Rivalen Tom in den ersten Jahren nur Mädchen geboren hatte.
Gegen zehn Uhr dreißig bestieg der gesamte Cannon-Clan Kutschen und Wagen, um auf Sassafras Ridge die Ankunft der Dampfer mit einem Siegespicknick zu feiern. Dort traf etwa eine Stunde später auch die fast ebenso große Familie Knox ein, deren Patriarch über die Vorkommnisse auf dem Fluss durch den Telegrafen natürlich ebenso gut unterrichtet war wie sein Konkurrent.
»Nun, alter Knabe, wieder mal auf dem falschen Dampfer gewesen, wie? Was?«, begrüßte John Cannon mit einem jovialen Grinsen seinen Nachbarn, aber dann stockte ihm der Atem, denn Rebecca Olivia Knox, die älteste Tochter des Freundes, sprang leichfüßig noch vor ihrem vergrämten Vater aus dem vordersten Wagen.
»Musst du Papa immer so ärgern, Onkel John?!«, sagte sie mit einem halb spöttischen, halb tadelnden Gesichtsausdruck, von dem sie durch viele Blicke in ihren Ankleidespiegel wusste, dass er ihr sehr gut stand.
Cannons alte Augen begannen zu leuchten. Rebecca war wahrhaftig das lebende Abbild des herrlichen Mädchens, dem er in jenem fernen Sommer .vor zweiundzwanzig Jahren so heftig den Hof gemacht hatte und das noch immer durch seine Träume ging Er stieß seinen Sohn James in den Rücken, und dieser lange Tölpel schaffte es tatsächlich, zwei Schritte vorwärtszustolpern und den Strauß Feldblumen, den er nervös in der Hand hielt, vor Becky Knox auf den Boden zu werfen.
Das Mädchen versteckte ihr helles Lachen hinter einem Fächer, während der junge Mann sich vor ihr bückte, um die Blumen aufzuheben, und dabei seinen Hut verlor. Jimmy bekommt wahrhaftig schon eine Glatze, dachte Rebecca und beschloss, ihn und seinen so unerträglich siegesgewissen Erzeuger noch mindestens einen Sommer lang zappeln zu lassen.
»Möchte wetten, du hast diese Flößer-Burschen in Vicksburg bezahlt, Cannon«, knurrte in diesem Moment statt einer Begrüßung der wohlbeleibte Major Knox und schälte sich aus seiner Kutsche.
»Man sollte meinen, du hättest vom Wetten erst mal wieder die Nase voll, Tom«, antwortete Cannon gut gelaunt, um steif und mit aller Würde eines Gentlemans des alten Südens hinzuzufügen: »Die Ware dabei?!«
Knox deutete auf einen etwa achtzehn Jahre alten Farbigen, der auf diesen Blick hin sofort von der Ladefläche eines der hinteren Wagen sprang. »Und selbst?«, knurrte er dann. »Noch habe ich nämlich nicht verloren!«
»Ich weiß ja, dass du ein gläubiger Mann bist, Tom Knox«, erwiderte Cannon sarkastisch, »aber manchmal übertreibst du ein bisschen mit deinem Gottvertrauen!«
»Keine Scherze mit Jesus, Cannon!«, mahnte Knox, jetzt ganz Vorbeter ihrer gemeinsamen evangelikalen Gemeinde.
Major Cannon nickte scheinbar schuldbewusst und winkte dann nachlässig seinen schwarzen Kutscher herbei. Er war schon seit Stunden so siegesgewiss, dass er sich nicht die Mühe gemacht hatte, irgendeinen speziellen seiner Nigger auszusuchen, und nahm nun den nächstbesten als Wetteinsatz. »Du kennst meinen Cornelius«, sagte er, und der Kutscher machte eine tiefe Verbeugung: »Massa Knox, wünsch ein schön Tag, Sir!«
»Aber wer ist das?«, fragte Cannon und wandte sich direkt an den jungen Mann, der, den Strohhut in der Hand, sichtlich aufgewühlt vor ihm stand. »Wie heißt du, Junge?«
»Bo, Sir, Massa Cannon«, stotterte der Sklave.
»Guter Feldarbeiter«, warf Major Knox ein. »Stark wie ein Bulle und wächst immer noch. Nicht wie der alte Conny hier. Wie alt bist du jetzt, Conny?«
»Bin um die vierndreißig herum, Massa Knox«, antwortete der Kutscher dienstbeflissen und flocht fröhlich einen kleinen Scherz an: »Wenn stimmt, was meine Mama gesagt hat.«
»Dafür kann er gut mit Pferden, das weißt du genau, Knox. Der ist seine zwei Feldarbeiter wert«, sagte Major Cannon verärgert.
»Und hat eine Frau, nicht wahr?«, erwiderte Knox und sah den Kutscher fragend an. »Und zwei Kinder?«
»Zwei Jungs, ja, Massa, Sir. Danke, dass Sie sich erinnern«, sagte Cornelius.
»Die will ich alle haben, wenn ich gewinne, Cannon. Wär unchristlich, ‘ne Familie auseinanderzureißen!«
»O danke, Massa Knox, sind ein wahrer Christ, Sir, wirklich!«
»Das will ich meinen, Conny«, sagte Knox wie selbstverständlich. »Also, Cannon, traust du dich oder kneifst du?!«
»Vier Nigger, darunter ein Kutscher vor dem Herrn«, entrüstete sich Major Cannon trotz all seiner Zuversicht. »Und all das für den da?!« Er trat zu dem jungen Feldarbeiter. »Mach mal den Mund auf, Junge!«
»Herrgott, Cannon! Nicht vor den Frauen.« Knox winkte die kleine Gruppe verärgert hinter die inzwischen abgeladenen Wagen, obwohl der Rest der Gesellschaft an dem ganzen Vorgang so wenig Interesse nahm wie an einem Pferdehandel.
»Machen wir’s richtig«, sagte Cannon, nachdem er dem Jungen hinter den Wagen ausführlich in den Mund gesehen hatte. »Zieh deine Sachen aus, Bo!«
Der junge Schwarze blickte ungläubig zu seinem Herrn und Meister, der aber nur verächtlich nickte. »Mach schon, Junge. Major Cannon hält uns sonst für Betrüger!«
Mit zitternden Händen ließ Bo seinen Hut fallen, zog sein Hemd aus und nestelte dann umständlich an seiner Hose. Fünf Sekunden später stand er nackt auf Sassafras Ridge, mitten in einer Picknickgesellschaft und nur eine Wagenbreite von dem fröhlichen Treiben entfernt.
»Heb die Arme!«, befahl Cannon. »Ja, so. Jetzt dreh dich um!« Mit einem wohlwollenden Nicken betastete er die Schultern und die eindrucksvolle Rückenmuskulatur des jungen Sklaven. Vor allem das Fehlen jeglicher Narben ließ ihn die Augenbrauen hochziehen.
»Ja, da guckst du, Johnny«, freute sich Major Knox. »Meine Schwarzen brauchen keine Peitsche! Alles brave Jungs, gute Christen!«
»Halleluja!«, sagte Bo leise, aber so prompt, wie es ihn achtzehn Jahre auf der Knox-Plantage gelehrt hatten. Cannon klatschte ihm hart auf die kräftigen Hinterbacken wie einem Ackergaul. »Bück dich, Junge!«
Unter dem Wagen, zwischen den Radspeichen hindurch, sah Bo, dass die weißen Frauen und Mädchen sich auf den mitgebrachten Decken niedergelassen hatten und die jungen Männer die Damen bedienten, ihre Gläser mit Wasser und Limonade füllten, ihnen Hähnchenschenkel und Obst reichten, während die kleineren Kinder am Hang des Hügels nach Schmetterlingen und Raupen jagten.
Major Cannon hatte inzwischen festgestellt, dass Bo weder Läuse noch Würmer bei sich trug, und ein prüfender Blick auf seine prallen, runden Hoden hatte ihm außerdem gesagt, dass er nicht nur einen guten Feldarbeiter, sondern auch einen erstklassigen Zuchtnigger bekommen würde. Nur pro forma, weil es eben zur Vollständigkeit der Prozedur gehörte, ließ er den Jungen dann noch einige Male auf- und abhüpfen, wobei Bo nicht verhindern konnte, dass sich infolge der Bewegung, der Anwesenheit der weißen Frauen und seiner ganzen achtzehnjährigen Aufgeregtheit binnen weniger Sekunden sein Glied versteifte.
Die Gentlemen störte das jedoch so wenig, als wenn er ein Esel wäre, und Major Cannon sagte nur belustigt: »Mit dir werden meine schwarzen Kühe viel Spaß haben, Bo!« Dann wandte er sich mit ehrlicher Anerkennung an seinen Rivalen. »Du hast zwar keine Ahnung von Dampfschiffen, Tom Knox, aber wie man Nigger züchtet, das hast du raus.« Nach einer kleinen Kunstpause fügte er hinzu: »Und deine Wettschulden zahlst du wie ein Gentleman!«
Major Knox ließ sich durch diese Komplimente zu einem verkniffenen Lächeln hinreißen, und mit einem kurzen, festen Händedruck war der Handel oder zumindest die Wette besiegelt.
»Sie kommen, sie kommen!«, riefen in diesem Moment die Kinder, die am Hügelgespielt und zum Mississippi hinabgeblickt hatten. Mit wehenden Rockschößen folgten die beiden Gentlemen den Stimmen zum Fluss, und Bo, zu Tränen beschämt, überlegte, ob es ihm wohl erlaubt sei, zumindest seine Hose wieder anzuziehen.
Oben auf Sassafras Ridge stand seit Stunden die Sonne zwischen den hohen, duftenden Bäumen, waren die Grasbüschel so trocken wie Stroh und einzelne flache Steine so heiß, dass man Eier darauf hätte braten können. Aber gerade als hätte die Sonne alle Feuchtigkeit aus dem Land, den Feldern, den Hügeln in den weit unten liegenden Flusslauf geschoben, schwebten über dem Mississippi noch immer einzelne Nebelschwaden. Stromabwärts, aus der großen, fast vierzig Meilen langen Flussschleife von New Madrid herauskeuchend, löste sich jetzt ein einzelnes Dampfschiff aus diesem leichten Dunst.
Noch war kein Name auszumachen, auch durch die Fernrohre nicht, die die beiden zahlenden Anführer der Kentucky-Miliz natürlich keinen Moment aus der Hand gaben, sosehr ihre Kinder auch darum bettelten. Aber nach etwa zehn Minuten, als das Schiff nicht mehr in einem so spitzen Winkel auf die Beobachter zuhielt, murmelte Major Knox: »Jesus, Maria und Josef! Es ist die Eclipse!«
»Du träumst, Knox!«, sagte Major Cannon in den nächsten Minuten noch mehrmals, während er immer stärker erblasste. Schließlich konnte keinerlei Zweifel mehr bestehen, und er ließ das Fernrohr sinken. Unter ihnen lief die Eclipse unter Volldampf nach Norden.
Der eben noch so beherrschte, würdig-rundliche Major Knox hatte das jetzt nutzlose Fernrohr längst an seine Nachkommen weitergegeben und hüpfte herum wie ein Gummiball. »Die Eclipse!«, schrie er. »Ein Hurra der Eclipse! Jesus! Jesus!« Er warf seinen Hut in die Luft, riss sich den Rock vom Leib – wobei mehrere Knöpfe absprangen und später im hohen Gras nicht mehr gefunden werden konnten – und schwenkte ihn dann begeistert über seinem Kopf herum wie eine Flagge.
Als Antwort auf diesen spontanen, gut sichtbaren Freudenausbruch ließ die Eclipse ihre Signalhörner aufheulen, und der Jubel des Knox-Clans durchbrach daraufhin alle von der menschlichen Vernunft gesetzten Grenzen. Ihr wohlbeleibter Häuptling lag schließlich japsend und keuchend auf dem Rücken wie ein Maikäfer und weinte Freudentränen.
»Zieh deinen Nigger aus, Cannon!«, seufzte er schließlich, als er sich wieder ein wenig gefasst hatte.
Major John W. Cannon aber schickte der Eclipse, die jetzt die riesige Sandbank vor Big Oak Tree passierte, einen gotteslästerlichen Fluch hinterher und sagte dann: »Sie muss einen Lotsen haben, der im Dunkeln sehen kann!«
10. Kapitel
Im Nordwesten von Melbourne erstreckte sich noch im Jahr 1867 über viele Quadratmeilen eine eigenartige, wüste Landschaft, zehn-, zwölfmal größer als die Stadt selbst. Es waren, schier endlos und von Horizont zu Horizont reichend, die Reste primitiver menschlicher Behausungen, eingefallene Bretterverschläge, Fetzen von Zeltleinwand, rostiger Schrott, mumifizierter Abfall. Es waren Zehntausende kleiner Gruben, manchmal nur aufgekratzte, hastig ausgehobene Löcher, manchmal aber auch kleine Stollensysteme, die erstaunlich weit in die Erde reichten. Hier und da die Ruinen eines vor fünfzehn Jahren rasch aufgemauerten Vorratshauses, dessen hölzerne Dachkonstruktion längst eingefallen war.
Der große Goldrausch von 1852 hatte binnen weniger Monate mehr Menschen nach Australien gespült als acht Jahrzehnte Deportation und Auswanderung zusammengenommen. Aber so schnell, wie sie gekommen waren, waren sie auch wieder verschwunden, die Heuschrecken des Goldes, weitergezogen in rastloser, unruhiger Hoffnung, nach Südafrika, nach Neuseeland, und hatten der Provinz Victoria und der Stadt Melbourne nur diese große, offene Wunde hinterlassen.
Dem unbedarften Wanderer konnte es geschehen, dass hier unversehens der Boden unter seinen Füßen nachgab, weil die alten Stützbalken in der Tiefe moderten, brachen, und dann fand er sich drei, fünf, manchmal zehn Meter tief in der losen, nachbröckelnden Erde wieder. Blieb der Mann unverletzt, mochte er sich philosophisch fragen, wie in den niedrigen, schwarzen Gängen, die sich überall vor ihm öffneten wie in einem Insektennest, überhaupt Menschen gelebt hatten; brach er sich jedoch ein paar wichtigere Knochen und war er allein unterwegs, konnte er nur noch beten.
Immer wieder, seit mehr als zehn Jahren, verschwanden gelegentlich Menschen in dem riesigen Labyrinth der ehemaligen Goldfelder von Melbourne. Neugierige kleine Jungen, Betrunkene, abenteuerlustige Trottel, die auf ein liegen gebliebenes Körnchen Gold hofften, oder Pärchen, die nach einem Ort für ungestörte Zweisamkeit suchten. Selbstverständlich bildete das wüste Gelände auch eine natürliche Zuflucht für Mörder, Räuber, Diebe, entlaufene Sträflinge, Schuldner, die Hefe der jungen Kolonialgesellschaft, und wann immer ein größeres Verbrechen geschah, schrie die Stadt, schrien Politiker, Geschäftsleute, Bürger nach der Einebnung und Nutzbarmachung des unüberschaubaren Areals. Das aber erwies sich regelmäßig als zu teuer und wurde meist nach wenigen schwachen Versuchen, etwa vonseiten der Kirchengemeinden, wieder aufgegeben.
Das Problem löste sich erst in den 1870er-Jahren, als eine gewaltige neue Einwanderungswelle auch Melbourne traf; die Stadtväter beschlossen, jedem willigen, fleißigen Immigranten den Grund und Boden zu schenken, auf dem er aus eigener Kraft ein Haus bauen und bewohnen würde. So verschlang die Stadt allmählich das große vernarbte Geschwür an ihrem Rand und dem ihrer Gesetze. 1867 aber wagten sich die Ordnungshüter der Victorian Police nur ungern in diesen menschengemachten Dschungel. Diese Arbeit überließ man privaten Ermittlern.
11. Kapitel
John Gowers jagte fast nur bei Nacht, weil sein außergewöhnliches Sehvermögen ihm dann einen Vorteil gegenüber seiner Beute verschaffte. Aber noch zwei andere Dinge machten die apokalyptische Wildnis der riesigen Geisterstadt für ihn durchschaubar: zum einen sein systematisches Gedächtnis, zum anderen die Tatsache, dass er sie nie bevölkert gesehen hatte. Keine Erinnerung an Gebäude, Straßen, Wege und die Orte, zu denen sie führten, stand zwischen ihm und der Wirklichkeit. Er bewegte sich ganz im Jetzt, fast wie ein Tier.
Wie immer, wenn er in das Labyrinth eindrang, hatte er den Tag über nicht geraucht. Das machte ihn nervös und gereizt, schärfte aber andererseits seine Sinne und erleichterte die Jagd. Die meisten der armen Teufel da draußen in den Ruinen rauchten, was ihnen in die Hände fiel, und so konnte er sie riechen, lange bevor er sie hörte oder sah. Joseph Clarke würde kaum eine Ausnahme bilden, obwohl seine Akte nicht verriet, ob er Raucher war. Noch immer hatten die Strafverfolgungsbehörden nicht begriffen, wie wichtig eine solche Information war, ja, seit die Häftlinge routinemäßig fotografiert wurden, verzichtete man sogar auf eine detaillierte Personenbeschreibung. Anscheinend glaubte die Polizei, dass ein einmal fotografiertes Gesicht sich nicht mehr verändern ließ.
Gowers witterte. Rechts, vorn, vielleicht achtzig Meter. Mindestens vier, vielleicht sechs, sonst hätte er sie nicht so stark riechen können. Leise stieg er auf einen kleinen Hügel festgetrampelten Abraums und sah in einer kleinen Mulde, vielleicht einem Graben, das schwache Glimmen eines Feuers. Er schlich näher heran, wich vorsichtig einigen eingesunkenen Schächten aus und zählte schließlich drei, fünf, sechs dunkle Gestalten, die ihre Gesichter der jämmerlichen Quelle nächtlicher Wärme zugekehrt hatten. Gowers lauschte.
Unwahrscheinlich, dass Joe Clarke unter ihnen war, denn der war erst drei Tage zuvor ausgebrochen und würde sich hüten, eine so große Gesellschaft unbekannter Landstreicher zu suchen. Es gab zu viele Spitzel, zu viele Leute, die für eine warme Mahlzeit Freunde und Brüder verraten hätten. Eine Flasche kreiste, und was immer sie rauchten – Tabak war es jedenfalls nicht. Vielleicht Tee, drei-, viermal aufgekocht, in den sie zur Erhöhung des Genusses trockenen Pferdemist gemischt hatten.
Ihr Gespräch war recht einsilbig; Flüche über die Kälte, ein kurzer Gedankenaustausch über die Mülleimer einer bestimmten Wohngegend, Prahlerei über exorbitante Betteleinnahmen in einer anderen. Einer der Männer schlief bereits, zusammengerollt wie eine Schlange, die Füße in den durchlöcherten Schuhen beinahe im Feuer. Sein Schnarchen regte die anderen jetzt zu einem Disput über die Frage an, ob man besser mit dem Gesicht oder dem Rücken zum Feuer schlafen sollte.
»Ein gesundes Kreuz ist wichtig«, sagte ein erfahrener alter Tramp. »Ihr grünen Jungs wisst das noch gar nicht zu schätzen, ein gesundes Kreuz. Deshalb immer mit dem Rücken ans Feuer, Jungs, immer mit dem Rücken!« Die Männer nickten, als hätte der Alte soeben den kategorischen Imperativ neu formuliert.
»Und mit dem Arsch«, pflichtete einer von ihnen ernsthaft bei. »Gibt nichts Besseres wie ‘nen warmen Arsch.«
»Doch«, sagte der Jüngste in der Runde und grinste breit. »Doch!«
»Was?«, fragte der andere so gereizt, als sei seine Autorität durch den bloßen Widerspruch infrage gestellt worden. »Was? Was gibt’s Besseres wie ‘nen warmen Arsch?«
Der Junge gluckste vor Vergnügen, weil sein älterer Genosse ihm auf den Leim gegangen war. »Einen warmen Frauenarsch!« Gelächter antwortete ihm und gab ihm die Kühnheit oder auch nur das jämmerliche Verlangen, diesem wärmenden Gedanken noch ein paar Glanzlichter aufzustecken. »Hinten ‘n Feuer und vorn ‘nen warmen Frauenarsch!« Wieder lautes Gejohle.
Gowers schlich weiter. Das entsprach in etwa seiner Überlegung darüber, was Joseph Clarke suchen würde.
12. Kapitel
Poll Hunleys Arbeitsplatz waren die Gräben rings um einen ehemaligen Speicher, dessen Mauern noch schwarz und angebrannt in den Nachthimmel ragten. Sie verteidigte dieses Revier mit Zähnen und Klauen, und dass das wörtlich zu nehmen war, konnten einige der anderen Huren mit tiefen Kratzspuren in ihren aufgedunsenen Gesichtern bezeugen. Der Platz war so gut, weil er an der Kreuzung gleich dreier ehemaliger Hauptwege lag und man sich in den Trümmern des Speichers bei Bedarf schnell und leicht verstecken konnte, wenn die Schmiere, also die Polizei, oder ein rabiater Freier einen dazu nötigte. Außerdem gab es da einen kleinen Keller, den man mit ein paar losen Balken leicht verkeilen und absperren konnte. Hier schlief sie, unter einem selbst gebastelten Drahtgestell vor den Ratten geschützt.
John Gowers kannte Polls Höhle; er hatte das arme Geschöpf dort sogar schon in seinem Schlaf gesehen, ohne dass sie es ahnte. Die meisten Huren der Geisterstadt arbeiteten zu zweit oder zu dritt, um einander notfalls beistehen zu können, aber Poll war jünger, kräftiger, hübscher und hatte deshalb keine Lust, ihre entsprechend höheren Verdienste zu teilen. Obwohl es schon nach Mitternacht war, ging sie auf der halbwegs freigeräumten Straße vor ihrem Speicher auf und ab und trug einen armseligen Hut mit einer schwankenden Feder, um anzuzeigen, dass ihr Geschäft geöffnet sei.
Tatsächlich war die Nacht im Dschungel noch jung, und Gowers, der sich lautlos bis ins Innere des Gemäuers geschlichen hatte, sah durch eine der ausgebrannten Fensteröffnungen, wie Poll die kleinen Gruppen heimkehrender oder ausrückender Diebe, Einbrecher, Bettler ansprach, ohne einen Erfolg zu erzielen. Erst ein einzelner älterer Mann schien Interesse, aber kein Geld zu haben, denn es entstand ein längeres Palaver, in dessen Verlauf man sich offenbar auf Teile eines wo auch immer gestohlenen kalten Brathuhns einigte. Die Parteien betraten dann die dunkle Ruine des Speichers, wo der Mann gleich die Hosen herunterlassen wollte.
»Erst das Huhn«, sagte Poll, und Gowers, keine sechs Meter entfernt im Schatten, hörte, wie der Freier das fettige Bratwerk aus seiner Manteltasche zog und es knackend in zwei Teile zerbrach.
»Du weißt doch, dass ich dich nicht bescheiße«, murmelte der Mann scheinbar beleidigt.
»Die größere Hälfte«, verlangte Poll, ohne auf den stillen Vorwurf einzugehen, »und dein Vogel darf in den Käfig.« Beide lachten über diese geistreiche Bemerkung. Mit der größeren Hälfte des Hühnchens in den Händen beugte sich die Hure dann so über einen Balken, dass ihr Oberkörper bequem darauf liegen konnte. Der Kunde hob ihr die Röcke, und Gowers konnte trotz der Entfernung Polls Geschlecht riechen. Der Mann rückte dichter an sie heran, fand aber offenbar nicht gleich, was er suchte, bis sie beherzt hinter sich griff und ihn auf den richtigen Weg brachte.
Erstaunlich lange Zeit hörte man nur das Rascheln des Kleids und das asthmatische Keuchen des Freiers, ohne dass sie ihn zur Eile drängte oder seine Bemühungen verbal anspornte. Gowers, der das auch aus besseren Bordellen anders kannte, bemerkte jedoch lächelnd, dass Poll sich seelenruhig über das Huhn hergemacht hatte, als ginge sie die andere Hälfte ihres Körpers nichts an.
Als beide gesättigt waren, zog der Mann seine Hosen hoch und empfahl sich mit einem höflichen »Danke schön!«.
»Danke auch«, sagte Poll und geleitete ihn ebenso höflich aus der Ruine. Sobald er verschwunden war, wandte sie sich jedoch wieder zurück, raffte die Röcke und trippelte geradewegs auf Gowers’ Ecke zu, um sich zu erleichtern. Er räusperte sich und sah belustigt, wie die hartgesottene Hure vor Schreck gut eine Handbreit vom Boden abhob. Sie fing sich jedoch erstaunlich schnell wieder.