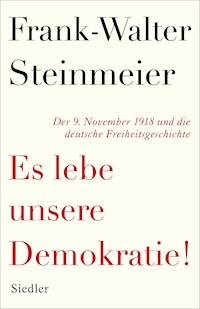9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Wir leben in turbulenten Zeiten. Internationale Krisen häufen sich, und sie rücken näher an Europa heran. An die Deutschen richten sich wachsende Erwartungen, zur Lösung internationaler Konflikte beizutragen, und sie nehmen sie ernst. Frank-Walter Steinmeier, einer der erfahrensten Außenpolitiker unseres Landes, steht als Diplomat, Vermittler und Krisenmanager für diesen Wandel. In seinem Buch gibt er Einblick in den Alltag des deutschen Ausßenministers in Krisenzeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
»Deutschlands Rolle in der Welt verändert sich. Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen – nicht aus Kraftmeierei, sondern weil sie uns zuwächst.«
Frank-Walter Steinmeier
Wir leben in turbulenten Zeiten. Internationale Krisen häufen sich, und sie rücken näher an Europa heran. An die Deutschen richten sich wachsende Erwartungen, zur Lösung internationaler Konflikte beizutragen, und sie nehmen sie ernst. Frank-Walter Steinmeier, einer der erfahrensten Außenpolitiker unseres Landes, steht als Diplomat, Vermittler und Krisenmanager für diesen Wandel. In seinem Buch gibt er Einblick in den Alltag des deutschen Außenministers in Krisenzeiten.
Der Autor
Frank-Walter Steinmeier, geboren 1956, Bundesaußenminister von 2005 bis 2009 und erneut seit 2013. Während der Kanzlerschaft Gerhard Schröders war er von 1999 bis 2005 Chef des Bundeskanzleramts. 2009 wurde er Kanzlerkandidat der SPD, nach der verlorenen Wahl SPD-Fraktionsvorsitzender. Als Chefdiplomat hatte er jüngst großen Anteil am Zustandekommen des Atomabkommens mit dem Iran, an den Minsker Vereinbarungen zum Ukraine-Konflikt und dem Wiener Format zur politischen Lösung des Syrien-Konflikts.
Frank-Walter Steinmeier
FLUGSCHREIBER
Notizen aus der Außenpolitik in Krisenzeiten
Propyläen
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1427-3
© by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Titelfoto: © Thomas Imo/photothek.net
Umschlaggestaltung: Morian & Bayer-Eynck, Coesfeld
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
VORWORT
Dieses Buch erzählt vom Reisen und vom Reden. Außenpolitik ist zwar sehr viel mehr als das. Aber Reisen und Reden sind Gutteil meines Alltags als Außenminister, und von beiden handelt auch dieses Buch. Denn im Reisen wie im Reden spiegelt sich eine Erfahrung wider, die sich wie ein roter Faden durch meine Jahre als Außenminister zieht: Deutschlands Verantwortung wächst.
Überall auf der Welt, in unzähligen Begegnungen und Diskussionen spüre ich die wachsenden Erwartungen an unser Land. Viele Menschen wünschen sich, dass Deutschland sich stärker für Frieden und Konfliktlösung, für Freiheit und Wohlstand engagiert. Davon erzähle ich in diesem Buch.
Wie aber sollen wir die Erwartungen erfüllen? Was kann deutsche Außenpolitik leisten – und was nicht? Viele der Gedanken, die ich mir über diese Fragen gemacht habe, habe ich in Reden formuliert. Zehn ausgewählte Reden sind in diesem Buch wiedergegeben. Sie wurden redaktionell vereinheitlicht, gelegentliche Überschneidungen wurden stillschweigend eliminiert.
Die wachsende Verantwortung Deutschlands und die Neuverortung deutscher Außenpolitik, die damit einhergehen muss, fallen in wahrlich turbulente Zeiten. Ich habe in meiner gesamten politischen Laufbahn nie so viele, so komplexe und so gefährliche Konflikte erlebt wie derzeit. Eigentlich beschreibt das Wort »Krise« einen Ausnahmezustand, doch in der Außenpolitik ist Krise zum Normalfall geworden. Und diese Krisenhäufung ist kein Zufall, sondern Ausdruck von fundamentalen weltpolitischen Umwälzungen. Die Krisen sind wie Erdbeben, in denen sich tiefer liegende Verschiebungen und Verwerfungen der internationalen Ordnung entladen.
Dass Deutschland in diesen globalen Veränderungen eine neue Rolle zufällt, haben wir uns nicht ausgesucht. Es ist die Folge von veränderten Machtbalancen. Die Nachkriegsordnung, die von zwei Weltmächten dominiert war, existiert nicht mehr. Die geopolitischen Einflusszonen der USA und Russlands sind geringer geworden. Neue Mächte streben auf, die die bestehende Ordnung in Frage stellen und neue Ordnung mitgestalten wollen. Ein Vierteljahrhundert nach Ende des Kalten Krieges ist die Welt nicht mehr bi-polar und (noch) nicht multi-polar, sondern non-polar. Wir leben in einer Welt auf der Suche nach neuer Ordnung. Und wo traditionelle Pfeiler der Ordnung ausfallen, schauen umso mehr Augen auf uns, auf stabile Mittelmächte wie Deutschland, die bereit sind, auch jenseits des eigenen Tellerrands Verantwortung zu übernehmen.
Zu Hause in Deutschland werde ich oft gefragt: Was können wir schon ausrichten? Was ist überhaupt die Rolle von Diplomatie in einer Welt, in der so viele, gefährliche, unberechenbare Kräfte am Werk sind? Vielleicht lässt sich diese Rolle schöner in einem Beispiel beschreiben als in grauer Theorie.
Im Sommer 2015 haben die Vereinten Nationen angefragt, ob Berlin nicht einen Beitrag leisten könne, um die chaotischen und vielfach brutalen Zustände in Libyen zu entschärfen. Dort, nur wenige Seemeilen südlich der italienischen Küste, haben wir es mit einem Nachbarn Europas zu tun, der als Staat fast völlig zerfallen ist. Wir wissen von rund einhundert verschiedenen bewaffneten Gruppierungen, die einander bekämpfen, während staatliche Institutionen im Chaos versinken, sich islamistische Terroristen breitmachen, sowie Schlepper ihr schmutziges Geschäft treiben und Menschen auf die lebensgefährliche Überfahrt nach Europa schicken. In dieser Situation haben wir im Auswärtigen Amt gesagt: Lasst uns versuchen, die wesentlichen Konfliktparteien aus Libyen an einen Tisch zu bekommen und wenigstens den Einstieg in Gespräche und mögliche Verhandlungen zu suchen. Und so haben wir erst einmal die wesentlichen Gruppen identifiziert, dann die Anführer aufgespürt, kontaktiert und schließlich zu Gesprächen nach Berlin eingeladen. Wir haben sogar ein Flugzeug der Luftwaffe nach Tripolis geschickt, um sie abzuholen. Doch da gingen die Probleme los: Es standen nun Leute am Flughafen von Tripolis, die bisher nie miteinander geredet, sondern nur aufeinander geschossen hatten. »Mit denen steigen wir nicht ins selbe Flugzeug!«, riefen sie. Mein Handy klingelte – ich war gerade in Brüssel –, und ich hörte, dass die Vertreter der unterschiedlichen Konfliktgruppen je ein eigenes Flugzeug forderten. Ich überlegte kurz und sagte: »Extra Flugzeuge gibt’s nicht. Wenn ihr diesen Test nicht besteht, brauchen wir erst gar nicht anfangen.«
Widerwillig kletterten die Delegationen die Gangway hoch und flogen nach Berlin. Abends, nach der Landung in Tegel, wollten alle Gruppen umgehend in ihr Hotel verschwinden – jede Gruppe in ein anderes, versteht sich. Doch unser Empfangskomitee am Flughafen sagte: »Wir wollen Sie zum Abendessen einladen!« – »Klingt gut«, hieß es, »wir haben Hunger.« Daraufhin sagten unsere Leute: »Prima. Es wird ein Essen zum Kennenlernen!« Erwiderung: »Wir wollen die anderen aber gar nicht kennenlernen. Die kennen wir gut genug! Das sind unsere Feinde!«
Was tun? Wir hatten eine kleine Überraschung vorbereitet: Das Abendessen gab’s nicht etwa in einem Berliner Restaurant, sondern auf einem Spreedampfer. Da kann niemand weg! Und so haben wir die verfeindeten Delegationen mehrere Stunden lang die Spree hoch und runter geschippert, bis sich alle schließlich an den Esstisch setzten und Fühlung aufnahmen. Am Ende des Abends war das Eis gebrochen, und am nächsten Tag konnten politische Gespräche im Auswärtigen Amt beginnen.
Ich erzähle die Geschichte nicht, um zu sagen, wenn es beruflich mal kracht, empfehle ich das Mieten eines Ausflugsdampfers … Sondern ich erzähle das, weil in dieser Anekdote etwas von dem steckt, was unsere Diplomatie im Kern ausmacht: der Versuch, Menschen an einen Tisch zu bringen, die sonst nie an einen Tisch kämen. Der Versuch, die Spirale der Eskalation zu durchbrechen, die Dynamik vom Schlachtfeld an den Verhandlungstisch zu lenken und Gesprächsbedingungen herzustellen, unter denen Lösungen möglich werden. Dies zu schaffen ist in verhärteten Konflikten alles andere als trivial. Es braucht den gesamten Instrumentenkasten der Außenpolitik, von Stabilisierungsmaßnahmen vor Ort bis manchmal auch hin zu politischem Druck, um die Parteien am Tisch zu halten oder sie an den Tisch zurückzudrängen und um Lösungsansätze überlebensfähig zu machen. Aber im Zentrum müssen politische Lösungswege stehen, nur in den seltensten Fällen können in modernen Konflikten militärische Antworten wirkliche Fortschritte bringen.
Auf der Suche nach politischen Lösungen bin ich als Außenminister unterwegs, an die 400000 Kilometer jedes Jahr. Dieses Buch gibt einen kleinen Einblick in den »Flugschreiber« dieser Reisen und in den Alltag deutscher Außenpolitik in Krisenzeiten.
Der Flugschreiber: Redevorbereitung auf dem Weg nach Bratislava, Oktober 2016
© Thomas Köhler / photothek.net
WIR SUCHEN UNS DIE VERANTWORTUNG NICHT AUS – DIE WELT FORDERT SIE EIN
Begegnung in der demilitarisierten Zone – Kindersoldaten in Kolumbien – Fußgängerampeln in Manhattan – Rückkehr ins Auswärtige Amt
Es ist früh am Morgen, als wir am zweiten Tag unserer Reise nach Südkorea in die demilitarisierte Zone fahren. Die Fahrt von Seoul dauert keine Stunde, die Grenze zwischen Nord- und Südkorea liegt im Dunstkreis der Hauptstadt mit ihren zehn Millionen Einwohnern.
Das Sperrgebiet ist vier Kilometer breit. Wir passieren verschiedene Wachposten und mehrere Abfolgen von Stacheldrähten, folgen dann einer schnurgeraden Straße an einem Fluss entlang, links und rechts dichter Wald, ab und an eine Wiese in einem fast moorartigen Gebiet. Die Natur ist traumhaft schön und nahezu unberührt. Jahrzehntelang konnte sie vor sich hin wuchern und sich zum Reservat für seltene Vögel entwickeln.
Es ist eine Natur, die darüber hinwegtäuscht, dass jenseits dieser schmalen Straße eine Million Landminen vergraben liegen. 300000 Soldaten sind in unmittelbarer Nähe dieser Zone stationiert, die nordkoreanischen in Gefechtsbereitschaft, und natürlich die vielen Raketen auf beiden Seiten der Grenze. Formal ist der Koreakrieg bis heute nicht beendet, beide Länder befinden sich im Status eines Waffenstillstands. Nach dem Krieg wurde eine demilitarisierte Zone rund um die Grenzlinie vereinbart, die bis heute von schwedischen und schweizerischen Soldaten als Teil der sogenannten Überwachungskommission neutraler Nationen überwacht wird.
Anfang November 2014, für mich ist es der zweite Besuch in der demilitarisierten Zone. Und es ist, ich kann es nicht anders sagen, gespenstisch. An der Kontaktlinie stehen seit dem Krieg die berühmten blauen Baracken, es sind die einzigen Orte der Begegnung zwischen Nord- und Südkoreanern. Wenn es etwas zu verhandeln gibt, dann trifft man sich hier. Die Bezeichnung Baracke trifft auf diesen Raum ganz gut zu, er hat die Größe eines Zimmers, kahl, die Decke ist niedrig, in der Mitte steht ein Tisch, und mitten durch diesen Tisch verläuft die Grenzlinie. Die Hoheit über diesen Raum wechselt stündlich. In der einen Stunde wird der Raum von südkoreanischen Soldaten bewacht, und die nordkoreanischen stehen vor der Baracke, in der nächsten Stunde ist es umgekehrt. Die Atmosphäre ist angespannt. Man spürt es schon an der Körperhaltung der Soldaten: Stramm und mit geballten Fäusten stehen sich nord- und südkoreanische Soldaten seit fünfzig Jahren gegenüber. Sie starren sich an, großgewachsene junge Männer, in ihren Gesichtern ist keinerlei Regung zu sehen. Da reift die Vorstellung, was Kalter Krieg ist, auch bei denjenigen, die den Kalten Krieg nicht mehr miterlebt haben.
Jetzt ist die Stunde der Südkoreaner. Also dürfen wir als westliche Delegation ins Innere der blauen Baracke. Von draußen schauen nordkoreanische Soldaten hinein, und man weiß nicht genau, wer eigentlich das beobachtete Objekt ist, wir hier drinnen oder die da draußen. Als ich ans Fenster trete, zückt auf einmal einer dieser jungen Soldaten, ein Zwei-Meter-Kerl, einen Fotoapparat und macht Fotos von uns – aus allernächster Nähe starrt mich sein Objektiv an. Ein skurriler Moment.
Es gibt immer wieder Zwischenfälle an diesem spannungsgeladenen Grenzort, von nordkoreanischer Seite wird herübergeschossen, was gar nicht so selten passiert. Einer meiner Mitarbeiter lässt seine Aktentasche in der blauen Baracke liegen, er merkt es erst beim Aufbruch, als die Delegation schon wieder in ihre Fahrzeuge steigt, und sprintet zurück, zum Glück gerade noch rechtzeitig, bevor wieder die nordkoreanische Stunde anbricht. Wenigstens unser Besuch geht also ohne Zwischenfall vonstatten.
Zäune, Stacheldraht, Sperrgebiet, Selbstschussanlagen – das alles ist auch Teil der deutschen Vergangenheit. Es ist diese Erfahrung, die wir mit den Koreanern teilen, die uns verbindet und deswegen auch Erwartungen an uns Deutsche weckt. Korea ist das einzig verbliebene Land auf dieser Erde, das nach wie vor geteilt ist. Und wie wir Deutschen jahrzehntelang über die Wiedervereinigung nachgedacht haben, ist die Wiedervereinigung natürlich auch in Südkorea ein Thema. Am Tag bevor wir in die demilitarisierte Zone fuhren, gleich nach unserer Ankunft in Seoul, habe ich mich mit der südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye zu einem Gespräch getroffen. Sie befragte mich intensiv nach unseren Erfahrungen mit dem Wiedervereinigungsprozess. »Wie habt ihr das gemacht?«, will sie wissen, und: »Wie könnt ihr uns unterstützen?« Schon seit einiger Zeit begleitet nun eine Expertengruppe aus Ost- und Westdeutschen, die den deutschen Vereinigungsprozess mitgestaltet haben, die Sehnsucht nach der Wiedervereinigung im fernen Korea.
Park Geun-hye ist nicht die Einzige, die in Gesprächen mit mir konkrete Erwartungen an Deutschland formuliert hat. Ganz im Gegenteil. Diesen Erwartungen begegne ich auf meinen Reisen seit den vergangenen Jahren immer häufiger. Die steigende Verantwortung unseres Landes suchen wir Deutsche uns nicht aus, sondern die Welt richtet ihre Erwartungen an uns.
Selbst in weit von uns entfernten Weltgegenden, in Ländern, die nicht zu Deutschlands nächsten und eingespielten Partnern in der Außenpolitik gehören, begegne ich diesen Erwartungen. Ich denke zum Beispiel an Kolumbien. Bogotá ist eine spannende, lebenslustige Stadt. Viele Diplomaten in meiner Delegation wären gern noch ein bisschen länger geblieben, als ich dort im Februar 2015 zu Besuch war. Aber Bogotá ist auch Hauptstadt eines Landes, das unter enormen inneren Konflikten leidet. Jahrzehntelang fochten FARC-Rebellen, Paramilitärs, Drogenkartelle und Regierung einen blutigen Bürgerkrieg. Hunderttausende Menschen starben, Millionen wurden Vertriebene im eigenen Land. Noch vor zwanzig Jahren war die Hauptstadt Bogotá auf dem Weg in die Unbewohnbarkeit, Morde und Geiselnahmen waren an der Tagesordnung. Heute pulsiert hier das Leben.
Wir besuchten ein unauffälliges Gebäude, das mitten in Bogotá ein Reintegrationszentrum beherbergt. Vor der Tür verkaufen Straßenhändler frische Mangos, drinnen sitzen 18- und 19-Jährige an Werkbänken in einer Ausbildungsstunde. Für uns wirkt das auf den ersten Blick wie eine ganz normale Fachoberschule. Doch vor wenigen Jahren noch haben diese Jugendlichen auf gegnerischen Seiten des Bürgerkriegs gekämpft, als Paramilitares oder bei den FARC-Rebellen. Einige von ihnen waren Kindersoldaten. Ihren Eltern entrissen und von den FARC an die Waffen gezwungen, mussten sie andere Menschen töten, Menschen aus ihren eigenen Heimatdörfern.
Im Haus sitzt mir eine junge Frau gegenüber. Sie stammt aus der Region Meta, nicht weit von Bogotá. Als 13-Jährige war sie in die Hände der FARC geraten, jahrelang musste sie mit den Rebellen leben, ständig in Angst, ständig in Bewegung, von Camp zu Camp. Viele Nächte, erzählt sie mir, musste sie auf dem Waldboden schlafen, nur mit Plastikfetzen und ein paar Blättern der Bäume bedeckt. Nach sechs Jahren konnte sie fliehen, kam in die Hauptstadt. Das Reintegrationsprogramm der Regierung stand ihr offen, wie Zehntausenden anderen ehemaligen Kämpfern im ganzen Land. Mittlerweile ist die junge Frau Mutter geworden. Sie trägt ihr Baby auf dem Arm und sagt zu mir: »Ich habe Angst vor meiner Heimat, Angst vor der Rache der FARC, aber auch Angst vor meiner Familie. Am liebsten will ich einfach untergehen in der Anonymität der Großstadt.«
So tief sind die Wunden in der kolumbianischen Gesellschaft. Kaum eine Familie ist verschont geblieben von den Auswirkungen dieses Konflikts. Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos will die Wunden in einem Prozess der Versöhnung schließen. Und seine Hoffnung richtet sich auch an Deutschland. Zunächst sprach ich in Bogotá ausführlich mit dem Beauftragten des Präsidenten für den Friedensprozess, Sergio Jaramillo, einem erfahrenen Diplomaten, der – wie wir erstaunt feststellten – perfekt deutsch sprach, in Heidelberg promoviert hatte und bereits vieles über die deutsche Vergangenheitsbewältigung wusste. Später dann, im offiziellen Amtszimmer, befragte mich der Präsident selbst über die Erfahrungen aus unseren Versöhnungsprozessen, nicht nur dem deutsch-deutschen, sondern auch dem, der notwendig war, um die Folgen unserer nationalsozialistischen Vergangenheit zu bewältigen. Eine ganze Reihe von konkreten deutsch-kolumbianischen Projekten ist aus diesem Gespräch entstanden – von Reintegration bis zur Übergangsjustiz. Ich habe den renommierten Menschenrechtspolitiker der Grünen, Tom Koenigs, zu meinem Persönlichen Beauftragten für den Friedensprozess ernannt, und er ist in Kolumbien ein gefragter Ansprechpartner geworden. Denn es geht auch dort um die schwierige Balance aus Bestrafung und Wiedergutmachung und gleichzeitig der Möglichkeit von Neuanfang und Zusammenleben – eine Balance, nach der wir Deutschen nach dem Krieg und nach der Einheit in ähnlicher Weise suchen mussten. Im Juni 2016 endlich einigten sich Regierung und FARC auf einen Waffenstillstand und die Entwaffnung der Rebellen, im August unterzeichneten sie in Havanna das Friedensabkommen. Der letzte bewaffnete Konflikt der westlichen Hemisphäre ist heute beendet.
Ein dritter Schauplatz der Außenpolitik, von dem ich erzählen will, ist New York City. New York ist Hauptsitz der Vereinten Nationen, und einmal im Jahr herrscht der Ausnahmezustand – sogar für die Verhältnisse einer Stadt, in der ja eigentlich immer alles außergewöhnlich ist. Zur einwöchigen Generalversammlung rücken die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt an. Die Hotels sind nicht nur ausgebucht, sondern ziehen noch mal kräftig ihre Zimmerpreise an. Wann kann man schon mal seine Präsidentensuiten an so viele buchstäbliche Präsidenten vermieten? Chaotisch wird es da fast immer.
Schon mein erstes Jahr als Außenminister bei der Generalversammlung beginnt holprig: Auf dem Weg zu einem diplomatischen Empfang in einem der berühmten New Yorker Hotels rumpelt unser Fahrstuhl – und bleibt stecken. Wir drücken den Notknopf, eine Stimme meldet sich und fragt nach unseren Problemen. Ich sage: »Hier ist der deutsche Außenminister. Wir sind im Fahrstuhl stecken geblieben.« Die Stimme antwortet: »Und ich bin der Kaiser von China.« Die Stimme – so erfuhren wir im weiteren Gespräch – gehörte zu Jeff. Jeff war gut gelaunt und zugewandt, und die Zeit verging mit Feixen wie im Flug, bis jemand zum Schacht kam und uns herausholte. Ob Jeff mir geglaubt hat, wer ich bin, weiß ich bis heute nicht.
Noch komplizierter wird es, wenn der US-Präsident eintrifft. Wenn seine Kolonne ins Waldorf Astoria fährt, wird die Park Avenue der Länge nach lahmgelegt, keiner darf mehr über die Straße. »Freeze« nennen die Amerikaner das. Und beim Freeze darf auch der deutsche Außenminister nicht über die Straße. Im letzten Jahr stand ich mit dem Außenminister eines befreundeten Landes vor dem Hotel, in dem unsere beiden Delegationen untergebracht waren. Der Freeze war gerade vorüber, und die Passanten setzten sich wieder in Bewegung. Ich winkte hinüber zu einigen Mitarbeitern aus meiner Delegation, die noch an der Straße standen, und da sagte mein Kollege zu mir: »Frank-Walter, eigentlich mag ich euch Deutsche: Fußball, Autos, Bier … Aber eines verstehe ich nicht, und das wollte ich dich schon lange mal fragen: Ihr Deutschen geht bei Rot nicht über die Straße, selbst wenn weit und breit kein Auto kommt! So viel Ordnungssinn hat bei uns niemand – aber wozu auch?«
In der Anekdote steckt auch ein Funken Außenpolitik. Es stimmt: Wir Deutschen setzen uns für internationale Ordnung ein – für Regeln im Umgang zwischen Staaten, für Völkerrecht und Menschenrechte, für multilaterale Institutionen wie die UN, die OSZE, die EU. Aber wir müssen auch sagen, wofür wir es tun! Regeln sind – auch in der Außenpolitik – kein Selbstzweck. Wir müssen deutlich machen, welche Werte und Ziele unsere Vorstellung von internationaler Ordnung verfolgt. Das ist heute umso wichtiger, wo die Welt aus den Fugen zu geraten scheint, wo ein neues Ringen um die zukünftige Ordnung ausgebrochen ist, und selbstbewusste Akteure wie China auf die Weltbühne treten und ihre Vorstellungen durchsetzen wollen; wo Armut und die Ungleichheit zwischen Staaten und Kontinenten immer noch viel zu groß sind und immer mehr Menschen fragen: Was bringt diese sogenannte Globalisierung uns eigentlich? Deshalb müssen wir Deutschen deutlich sagen: Wir wollen eine internationale Ordnung für Frieden und Gerechtigkeit. Denn heute gilt doch umso mehr, was Willy Brandt schon 1979 in seiner visionären »Nord-Süd-Kommission« erkannt hat: Es gibt keinen dauerhaften Frieden ohne Gerechtigkeit, und keine Gerechtigkeit ohne Frieden. Das sind die Ziele deutscher Außenpolitik, und für diese Ziele wird unser Engagement von vielen auf der Welt wertgeschätzt und sogar eingefordert.
Und so spüre ich nicht zuletzt auf der großen weltpolitischen Bühne von New York, wie sich Deutschlands Rolle über die Jahre verändert hat. Heute sitzen wir mit am Tisch, wo wir früher nicht am Tisch saßen. Heute wird unsere Stimme gehört, wo sie früher nicht gehört wurde. Heute wird unser Handeln erwartet, wo es früher niemand erwartet hat. Vor 16 Jahren war ich in Begleitung von Bundeskanzler Schröder zum ersten Mal bei der Generalversammlung in New York. Wir haben damals an vielen interessanten Themen gearbeitet, aber Zeit für einen Galeriebesuch war durchaus drin. Bei der letzten Generalversammlung hingegen war jeder Tag im Halbstundentakt mit brenzligen Sitzungen gefüllt: Wie bringen wir Iraner und Saudis an einen Tisch, um den Syrien-Konflikt zu entschärfen? Wie organisieren wir das dringend notwendige Geld für die Flüchtlingshilfswerke? Wie überwachen wir den Waffenstillstand in der Ostukraine? Oftmals werden wir Deutschen in den Kreis der sogenannten P5, der permanenten Mitglieder des Sicherheitsrates – USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien – hinzu gebeten. Und als wir 2015, erschöpft nach einem dichtgefüllten Tag voller Verhandlungen und Krisentreffen, abends um zehn in die Sessel in unseren Hotelzimmern plumpsten, bekamen wir eine SMS von den Amerikanern: »Wir haben die verfeindeten Vertreter aus Libyen zu einem Treffen überredet. Frank, komm bitte dazu.« Und so zog sich eine weitere Verhandlung in einem weiteren Wolkenkratzer bis tief in die Nacht hinein.
Es ist also nicht so, dass die wachsende Verantwortung Deutschlands ein Wunschtraum von deutschen Diplomaten ist. Es ist vielmehr die Welt, die sie von uns Deutschen einfordert. Deshalb sprach ich auch vom Begriff der Verantwortung, kurz vor Weihnachten 2013, als ich zum zweiten Mal als Außenminister in das Auswärtige Amt am Werderschen Markt in Berlin einzog und meine Antrittsrede hielt. Damals, als ich vor vielen altbekannten Gesichtern im Weltsaal, unserem großen Konferenzraum, stand, da meinte ich »Verantwortung« nicht nur als hochtrabende politische Kategorie, sondern da hatte dieser Begriff auch eine sehr persönliche Dimension für mich. In jenem Weltsaal hatte ich mich vier Jahre zuvor von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes verabschiedet. Niemals im Leben hätte ich mir damals träumen lassen, dass ich noch einmal in dieses Amt zurückkehren würde. Für mich persönlich markiert jene Zeit im Jahr 2009 einen sehr schmerzhaften Moment, den Tiefpunkt in meiner politischen Laufbahn. Ich hatte mich als Bundeskanzler zur Wahl gestellt und die Wahl verloren. Am 22. September 2009 fuhr die SPD23 Prozent der Stimmen ein, ein historisch schlechtes Ergebnis. Die ersten Hochrechnungen, die Kameras, die grellen Scheinwerfer, all das fuhr mir am Wahlabend, wie vielen anderen Mitstreitern im Willy-Brandt-Haus, tief in die Magengrube. Aber auch an jenem Abend ging es am Ende um Verantwortung – die Verantwortung für eine Partei, die mich seit meinen Jugendtagen, als Willy Brandt Kanzler wurde, politisch geprägt hat. Es war nach der Wahl 2009 schwer genug, mit der Niederlage persönlich umzugehen. Aber das war eben nur der eine Teil. Ich hatte die Niederlage ja stellvertretend für die Partei erlitten, und ganz unmittelbar für die Bundestagsfraktion. 76 Bundestagsmandate waren in dieser Wahl verlorengegangen, 76 Abgeordnete und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten auf einmal keinen Job mehr. Ich war verantwortlich dafür, dass eine Volkspartei historisch schlecht abschnitt. Und wer am Tiefpunkt Verantwortung trägt – so dachte ich am Wahlabend –, muss zumindest mithelfen, den Stein wieder hochzurollen.
Ich wurde wenige Wochen später zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, und es begann eine harte Zeit. Du kämpfst mit einem Scherbenhaufen in dir selbst und bist gleichzeitig Vorsitzender einer Fraktion, die gemeinsam vor einem Scherbenhaufen steht. Ich hatte damals keine Ahnung, ob wir das kitten würden. In meinem Brandenburger Wahlkreis sagte in jener Zeit mal jemand zu mir: »Das Wichtige an Träumen ist nicht der eine, große Lebenstraum. Das Wichtige ist, die Kraft für neue Träume zu finden, wenn ein Traum zerbricht.« Bundeskanzler bin ich nicht geworden. Aber ich bin froh und dankbar, dass ich mit der Bundestagsfraktion der SPD so manchen Stein – vielleicht nicht alle Steine – den Berg hochrollen konnte, und dass wir dabei, politisch wie menschlich, zueinandergefunden haben. Und ich bin dankbar, dass mich der Weg von der Fraktion noch einmal ins Auswärtige Amt geführt hat – in einer stürmischen Zeit, in der es mehr denn je auf verantwortliche deutsche Außenpolitik ankommt.
So kam ich Ende Dezember 2013 zurück ins Auswärtige Amt. Dort empfing mich Guido Westerwelle, der sowohl mein Amtsnachfolger als auch Amtsvorgänger war. Zwei Jahre nach Ende seiner Amtszeit ist Guido Westerwelle verstorben, viel zu früh. An jenem Tag der Amtsübergabe standen wir gemeinsam im Ministerbüro im zweiten Stock, und er sagte zu mir: »Sehen Sie, Herr Steinmeier: Alles ist so geblieben!« In der Tat waren Schreibtisch, Regale und so weiter dieselben wie in meiner ersten Amtszeit. Doch dann fiel unser Blick auf die vielen zeitgenössischen Kunstwerke, die Westerwelle privat gesammelt hatte und auf die er zu Recht stolz war. Und da sagte er: »Meinen Kunstkram nehme ich mit – dann passt da auch Ihre Willy-Brandt-Statue wieder hin!«
Beim Blick in das vertraute Büro fiel mir ein Gegenstand besonders ins Auge, der einen Ehrenplatz auf Westerwelles Schreibtisch hatte und der irgendwie herausstach zwischen den Immendorf-Gemälden und den Kunstmagazinen: eine kleine quietschgelbe Uhr aus Plastik in Form einer Micky Maus. Ich zeigte darauf, und Westerwelle lächelte. Die Uhr, erzählte er mir, stammt aus dem Gaza-Streifen. Eine seiner ersten Außenminister-Reisen hatte ihn dorthin geführt. Nach schwierigen politischen Terminen gab es einen kurzen Besuch an einer Mädchenschule. Doch Westerwelle blieb länger als nur fürs Foto. Er kam in ein lebhaftes Gespräch mit den sieben- und achtjährigen, fein rausgeputzten Mädchen, dort mitten im Kriegsgebiet. Irgendwann trauten sich die Mädchen, zogen eine Plastiktüte hervor und gaben ihm das Geschenk, für das sie zusammengelegt hatten: diese Uhr. Später beim Sicherheitscheck am Flughafen fragten die israelischen Soldaten, ob die Delegation etwas aus dem Gaza-Streifen mitgebracht hätte, und Guido Westerwelle antwortete offenherzig: »Ja, man hat uns eine tickende Uhr geschenkt.« Nach mehrfachem Durchleuchten der Micky Maus hat er sie schließlich mit an Bord nehmen dürfen – ausdrücklich auf eigenes Risiko. Voller Freude hat Guido Westerwelle mir diese Geschichte erzählt – nicht wegen der Uhr, sondern weil die Mädchen ihn begeistert hatten. Auch Guido Westerwelle haben Begegnungen wie diese als Außenminister geprägt, Begegnungen mit Menschen, deren Hoffnungen inmitten von Not und Unfrieden sich an uns Deutsche richten. In solchen Begegnungen erspürt man die Erwartungen an Deutschland, und es wächst ein Gefühl für die Verantwortung, die deutsche Außenpolitik heute trägt.
Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, New York, Oktober 2015
© Thomas Köhler / photothek.net
In der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea, November 2014
© Wolfgang Silbermann
Während der UN-Generalversammlung in New York, September 2016
© Thomas Imo / photothek.net
ZWEITER AMTSANTRITT
17. Dezember 2013
Weltsaal im Auswärtigen Amt, Berlin
Etwas mehr als vier Jahre ist es her, dass ich zum letzten Mal hier in diesem Saal gesprochen habe. Ich erinnere mich noch wie heute an Ihren überaus freundlichen Abschied. Die letzten Worte meiner Abschiedsrede waren: »Ich gehe, aber ich gehe nicht aus der Welt.«
Nun, ich bin nicht aus der Welt gegangen! Mit Europa und Außenpolitik hatte ich auch als Fraktionsvorsitzender viel zu tun. Den einen oder anderen von Ihnen habe ich in den letzten Jahren wiedergesehen. Hier in Berlin, in Kabul, in Kairo, in Tel Aviv, in Abu Dhabi und an vielen anderen Plätzen in der Welt. Nie in meiner schon längeren politischen und beruflichen Laufbahn bin ich allerdings dorthin zurückgegangen, von wo ich kam. Der Grundsatz war gut und hat getragen. Wenn ich heute damit breche und nach vier Jahren zurückkomme, dann, weil es Ehre und Auszeichnung ist, ein weiteres Mal das Amt des deutschen Außenministers zu übernehmen. Es geht nicht nur darum, das Land zu repräsentieren, sondern auch die Chance zu haben, an Dingen weiter zu schmieden, an die man schon mal Hand angelegt hat. Lieber Herr Westerwelle, ich danke Ihnen für das, was Sie in den letzten Jahren für unser Land getan haben! Sie haben in Ihrer Verantwortung von hier aus dazu beigetragen, dass Deutschland auch in der Krise der letzten Jahre europapolitisch in der Spur geblieben ist. Das war, wir wissen das beide, keine Selbstverständlichkeit. Es bleibt richtig, was Hans-Dietrich Genscher gesagt hat: »Europa bleibt unsere Zukunft, eine andere haben wir nicht.« Das ist unsere gemeinsame Auffassung in einem Umfeld, in dem es an der Tagesordnung ist, herablassend-leichtfertig über die Rolle Europas zu urteilen.
Sie haben an der »Kultur der militärischen Zurückhaltung« festgehalten. Das hat Ihnen nicht nur Lob eingebracht – auch in Deutschland gibt es wieder einige, für die – ausschließlich und nur – Androhung und Einsatz militärischer Gewalt der Lackmustest für außenpolitische Glaubwürdigkeit ist. Daraus spricht nicht nur Missachtung kluger Diplomatie zur Krisenlösung und -entschärfung. Es lässt auch in Vergessenheit geraten, dass wir Deutsche – mit Blick auf unsere Geschichte – besondere Verantwortung für die Erarbeitung von Alternativen zur militärischen Lösung tragen. Selbst wenn wir auch solche für die Vergangenheit nicht völlig ausgeschlossen haben und für die Zukunft nicht immer ausschließen können.
Sie alle werden kein Verständnis haben für die Frage, die mir gleichwohl mehrfach in den letzten Tagen gestellt worden ist: »Warum willst du denn eigentlich noch einmal ins Auswärtige Amt?« Dabei ist die Antwort darauf von den Wissenden so einfach! Weil dies nicht ein Ressort wie jedes andere ist. Und weil ein Land wie Deutschland gute Außenpolitik braucht!
Die gibt es nicht ohne Professionalität, kreatives Denken und Mut, den Eigenschaften, die einen guten Diplomaten auszeichnen. Solange diese drei Eigenschaften hier in diesem Haus zu finden sind, ist es um die Zukunft des Auswärtigen Amtes nicht allzu schlecht bestellt. Dennoch verändert sich etwas! Natürlich sind auch die anderen Ressorts heute stärker als früher unterwegs im internationalen Geschäft. Was würden wir klagen, wenn es anders wäre! Natürlich gibt es eine stärkere mediale Konzentration auf die Staats- und Regierungschefs. Gipfel sind wichtig. Aber jeder weiß auch: Außenpolitik findet in der Substanz nicht auf den Gipfeln statt, sondern dazwischen und davor. Was nicht seriös vorbereitet ist, lässt Gipfelbemühungen scheitern, die Beweise dafür füllen Bibliotheken! Deshalb werden außenpolitische Profis nicht weniger, sondern mehr gebraucht. Die Vergipfelung von Politik ersetzt nicht Außenpolitik, sondern setzt sie voraus. Form und Inhalt werden da oft verwechselt. Auch der Europäische Auswärtige Dienst ist noch ein Stück entfernt davon, außenpolitisches Denken und Handeln in den europäischen Hauptstädten überflüssig zu machen.
Gute deutsche Außenpolitik braucht auch in Zukunft ein gutes Auswärtiges Amt – mit Mut, mit Kreativität und Professionalität! Professionalität, das ist mehr als Fremdsprachenkenntnisse und sicheres Auftreten auf internationalem Parkett. Professionalität, das ist auch die Fähigkeit, in langen, historischen Linien zu denken. Wir alle wissen um die Abgründe unserer deutschen Geschichte und auch, wie präsent diese Geschichte fast überall in der Welt noch ist.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.