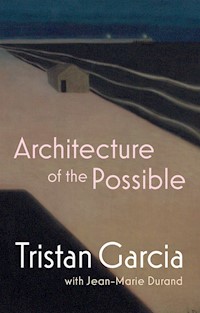27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Wir« zu sagen, ein »Wir« zu bilden, ist die politische Handlung par excellence. Wie aber konstituiert sich ein politisches Subjekt? Wie funktioniert diese Identitätsbildung? Und wie hat sie sich historisch in den letzten zwei Jahrhunderten entwickelt? Das sind die Fragen, denen Tristan Garcia in seinem neuen hochaktuellen Buch nachgeht. Eine fulminante Analyse der Identitätspolitik.
Der »Kampf der Kulturen«, die Debatte um »den« Islam, um Geflüchtete, Rassismus, Feminismus oder »politisch korrekte« Sprache, um die Rechte der Tiere – immer geht es darum, im Namen eines »Wir« zu sprechen, sich abzugrenzen oder zu inkludieren, sich zu mobilisieren und zu organisieren. Die Intensität dieser Wir-Bildungen nimmt wieder enorm zu. Garcia tritt einen Schritt zurück und entwirft ein allgemeines Modell, das anhand von Mechanismen der Konturierung, Überlappung und Priorisierung zeigt, wie solche Wir-Identitäten gebildet werden. Und er erzählt die Geschichte ihrer Dynamik, ihrer Kontraktionen und Extensionen: eine Geschichte von Herrschaft und Widerstand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
3Tristan Garcia
WIR
Aus dem Französischen von Ulrich Kunzmann
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Buch
I
Bildschichten
Die erste Person Plural
Alles-wir-ich
Drei Einwände
Jedes »Wir« ist ein Einteilungssystem
Einteilungskonflikte
Das Modell der Intersektion
Das Modell der Bildschichten
Die Konturen
Die Überlappung
Transparenz und Undurchsichtigkeit
Die Überdeckung
Die Grundlage
Buch
II
Zwänge
1. Kapitel Die Grundlage des »Wir«
Art
Gender
Rasse
Klasse
Alter
Allgemeine Erzählung des Auflösungsprozesses
2. Kapitel Dynamik
Das idealistische Versprechen
Die christliche Verheißung
Die kommunistische Verheißung
Evolutionärer Optimismus
Die realistische Bestandsaufnahme
Geschichtliche Bestandsaufnahme
Politische Bestandsaufnahme
Aggressivität unter Nachbarn
Die Dynamik der Ausdehnung und der Intensität
Wir sind niemals mit uns selbst deckungsgleich
3. Kapitel Herrschaft
Asymmetrie
Gleichheit in der Ungleichheit
Sie im Wir
Notwendigkeit der Herrschaft
Notwendigkeit der Befreiung
Reale Herrschaft, Wirkungen der Herrschaft und Herrschaftsgefühl
Strategische Minderheit
Herrschaftsgeschichte als Schlachtfeld
Der Krieg des »Wir« gegen das »Wir«
4. Kapitel Das Ende des »Wir«
Dank
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
291
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
Buch I
7Bildschichten
9Die erste Person Plural
Erkennen wir es an: »Wir« ist das Subjekt der Politik.
Die Besonderheit der ersten Person Plural besteht darin, dass sie im Gegensatz zur ersten Person Singular einen ständigen Wechsel des Geltungsbereichs ermöglicht, denn sie kann ebenso »dich und mich« wie die Gesamtheit des Lebendigen und mehr als das bezeichnen. Denken wir uns einen Kreis, den wir den »Kreis des Wir« nennen wollen, und stellen wir uns vor, dass er sich äußerst eng um unsere nahen Angehörigen, unsere Familie, unseren Klan, unseren Stamm, unsere Gemeinschaft zusammenzieht oder dass er sich im sozialen Raum stattdessen auf die Gesamtheit der empfindenden Wesen, der Tiere, ja sogar mancher Pflanzen, ausweitet. Jedem Durchmesser dieses sich vergrößernden oder verkleinernden Kreises entspricht ein gegebener Zustand des »Wir«. Somit gibt es ebenso viele politische Subjekte wie Zustände von »Wir«, das heißt mögliche Ausdehnungen dieses imaginären Kreises.
»Wir« ist diese ektoplasmatische Form der meisten menschlichen Sprachen, die nacheinander alles umfassen kann, was sich zwischen mir und der übrigen Welt befindet und wodurch sich mehrere Subjekte positionieren, sich abgrenzen und aushandeln, was sie an Identischem und Unterschiedlichem haben und womit sie Politik machen.
Wie stark ausgeprägt auch unser Engagement, unsere 10Verbindung und unser Lager ist, ob wir professioneller Aktivist oder bloßer Sympathisant sind, skeptischer Staatsbürger mit schwankenden Überzeugungen, Sozialist, Sozialdemokrat, LGBTI-Aktivist, takfiristischer Wahhabit, Trotzkist der Internationalen Kommunistischen Organisation, Unabhängigkeitskämpfer, Pablist, Interessenvertreter der Dritten Welt, Neokonservativer, Autonomer, Indigenist, Antikolonialist, Unberührbarer der Bahujan Samaj Party, Republikaner, Baathist, Nationalpatriot, Faschist, Apolitischer, Christdemokrat, Mormone, Befürworter des Dritten Weges, Tierschutzaktivist, zionistischer Jude, Panafrikanist, Deep Ecologist, der sich zur Ökosophie-T bekennt, Suffragette, Bolivarier, Anarchist, Neonazi, Homonationalist oder Femonationalist, Labour-Anhänger, Befürworter einer Wachstumsrücknahme, libertärer Liberaler, konstitutioneller Monarchist, Anhänger des Black Nationalism, Menschewik, Buddhist der Soka Gakkai, Abolitionist, Bürgerrechtler, sunnitischer Dschihadist, Reformer, Pro-Life-Aktivist ‒ wir können nicht umhin, »wir« zu sagen.
Und der Wesenskern des politischen Diskurses besteht in der Definition dessen, was wir unter diesem »Wir« verstehen, was unsere Rechte sind, unsere legitimen Ansprüche, unsere Vorstellung von der Gesamtgesellschaft, doch auch darin, diejenigen als Negativ zu identifizieren, die sich gegen uns stellen, die Feinde, die wir mit »ihr« oder »die« bezeichnen. Bemühen Sie sich einen Augenblick, nicht zwischen allen möglichen Vereinigungen oder Bruderschaften zu unterscheiden, denen Sie sich nahe fühlen, und denen, die Ihnen allzu weit entfernt, beinahe exotisch scheinen. Berücksichtigen Sie nicht mehr die kollektiven Identitäten, die Sie als fundiert, universell und bedeutsam ansehen, und die Gemeinschaften, von denen 11Sie meinen, dass sie lediglich irrationale, lächerliche oder gefährliche Haltungen vertreten. Halten Sie Ihr moralisches Urteil zurück. Versuchen Sie also, gedanklich eine Art von imaginärem Plan aufzustellen, anhand dessen Sie ebenfalls, jedoch auf andere Weise, alles beachten könnten, was in unserem Namen spricht. Nun machen Sie die Übung ‒ da ja alles, was »wir« sagt, dieselbe Person benutzt ‒, diese Person zu sein, selbst wenn eine Ihren Prinzipien widersprechende Identität Sie irritiert, anwidert oder empört. Sagen wir zusammen mit ihnen »wir«. Nehmen wir diese Schwindel erregende Vielfalt und diese Kakophonie von Ansprüchen, uns zu vertreten, die den größten Skeptikern als ein Zeichen des Fanatismus oder als Beweis für das fantasievolle Wesen aller identitären Proklamationen scheinen kann, gemeinsam ernst. Wetten wir, dass die starke Vermehrung von divergierenden oder widersprüchlichen »Wir« gleichwohl nicht irrational ist und dass sie einen edlen Zug der Subjektivität veranschaulicht: ihre Neigung, sich politisch zu organisieren.
Was geschieht, sobald wir »wir« sagen? Dank der gnädigen Sprache, die es uns erlaubt, dieses Pronomen zu übernehmen, können wir beanspruchen, nacheinander auf allen Seiten zu stehen, selbst auf der unseres heftigsten Gegners. Nichts von dem, was im Namen eines »Wir« geäußert wird, ist uns vollkommen fremd. Allerdings bedeutet »wir« auch unser »Wir«, das nicht das eurige ist. Wir wissen, dass ihr »wir« sagt, aber ihr sagt es nicht wie wir. Wir wissen es durch unsere andersartigen Erfahrungen, Gewohnheiten und Ideen. Genau das heißt »Wir«: die Möglichkeit, alle zu sein, die vage sprachliche Verheißung einer allumfassenden Zugehörigkeit und zu12gleich die konkrete Zuordnung zu einer besonderen Identität, zu dem, was wir sind und was ihr nicht seid, selbst wenn ihr auf eure Art »wir« sagt.
Dieses »Wir« ist eine Art von plastischem Subjekt,1 das anpassungsfähig genug ist, um von Wesen aller Art übernommen zu werden, jedoch ausreichend verpflichtend wirkt, damit man Lager unterscheiden kann, je nachdem, wer das Wort benutzt und wie er es benutzt. Man darf nicht so naiv sein, zu glauben, alle sich auf das »Wir« berufenden Menschen verstünden darunter etwas Gleichbedeutendes ‒ andererseits geht es deshalb nicht darum, anzunehmen, dass »wir« ein bedeutungsloses Wort sei, mit dem jeder verbinden könne, was er wolle, oder ein bloßer indexikalischer Begriff, ein Spiegelwort, das lediglich auf seine Äußerungsbedingungen verweisen würde, auf diejenigen, die es sagen, wo und wann sie es sagen. Das stimmt: Selbst wenn es nur ein einziges Wort gibt, um es zu sagen, gibt es nicht nur ein einziges »Wir«; aber es gibt auch nicht so viele unterschiedliche »Wir« wie Anwendungen dieses Begriffs. Um nicht in die eine oder andere dieser zwei symmetrischen Fallen zu geraten, sollte man das »Wir« eher als eine zugleich freie und bestimmte Form ansehen, die nicht nur Sprache ist, sondern auch den Geist dessen strukturiert, der sie benutzt und ihre Anwendung in eine bestimmte Richtung lenkt, ohne ihr ganz und gar Zwang anzutun. »Man kann von ›wir‹ in Bezug auf eine ganz kleine Personenzahl sprechen« ‒ oder in Bezug auf beinahe alle. Etwas in diesem »Wir« ‒ eine Art von innerem Widerstand dieser ektoplasmatischen Form ‒ richtet sich nach einer Logik. Doch nur wenn man sehr viele Erscheinungsformen abwechselnd benutzt, tritt diese Logik zutage. Damit man versteht, was »wir« be13deutet, muss man also ‒ im Widerspruch zu allen methodischen Empfehlungen in der Soziologie ‒ auf gleiche Weise von der Horde oder dem Staat sprechen.
Je größer die Zahl von »Wir« ist, deren Existenz wir anerkennen, desto deutlicher zeigen sich uns ihre gemeinsamen Züge, wenn man von der Besonderheit jedes einzelnen Gebrauchs der ersten Person Plural absieht. Um zu verstehen, was »wir« im Allgemeinen bedeutet, ist nichts weiter als eine moralische Qualität erforderlich: eine gewisse Empathiebereitschaft, die es einem ermöglicht, die Festigkeit seiner Überzeugungen und Prinzipien in seinem Innern zu verringern, um seine Fähigkeit zu erweitern, sich gedanklich an jeder beliebigen Gemeinschaft zu beteiligen. Dann genügt es, rund um sich alles zu hören, was gesagt wird, und sich in aller Unschuld jedes Mal vorzustellen, dass wir »unsere Brüder«, »die Unsrigen« oder »unsere Genossen« hören, dass wir uns ihnen anschließen und ihre Vorstellungen und Identität teilen, zusammen mit ihnen ein Ganzes bilden könnten. Aber wo soll man beginnen? Zeichnen wir einen ersten Kreis um uns und verändern wir hierauf seinen Umfang, zerschneiden wir ihn in Teilmengen und verschieben wir deren Grenzen, damit wir die größtmögliche Menge von Identitätsmanifestationen in der jüngeren Geschichte ermitteln.
Wenn wir zunächst um alle Menschen eine imaginäre Linie ziehen, verfügen wir über eine unermesslich große, mehr oder weniger kreisförmige Ausgangsfigur, und wir wissen genau, dass sich in ihrem Innern die Kreisausschnitte vervielfachen. Der bedeutendste Kreis, auf jeden Fall der mit der größten Fläche, der in politischen Diskursen am meisten vorkommt, ist der, der wie in Woyzeck »wir arme Leut« sagt,2 der der Landlosen oder Enterbten, der 14Proletarier, Werktätigen, Ausgebeuteten, kleinen Leute. Der Name ändert sich, und je mehr er sich wandelt, desto weniger ist der Kreis noch ganz derselbe. Dem größten und grundsätzlichen Kreis entspricht das »Wir« des Slogans der Occupy-Bewegung: »Wir sind die 99%.«3 Dies ist das namenlose »Wir«, das »Wir«, dessen Zahl sich der winzigen, die wirtschaftlichen Reichtümer der Welt besitzenden Minderheit entgegenstellt. Dieses quantitativ bestimmte »Wir« verwischt die Unterschiede zwischen all denen, die nicht »die Herren« oder »die Chefs« sind, und in der Geschichte des Marxismus ist es die Hauptperson. Die berühmten Strophen der Internationale feiern seinen Namen: »Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger. / Alles zu werden, strömt zuhauf!«4
Doch dieses »Wir« der Zahl, dem das Recht zukommt, alles zu beanspruchen, dieses unermesslich große »Wir« all derer, die fühlen, dass man ihnen die wirtschaftlichen Mittel, das Erbe, die Geschichtsschreibung und die Herrschaft über die Kultur, den Gebrauch des Gesetzes und des Staatsapparats genommen hat ‒ dieses »Wir« ist schwach bestimmt. Es müsste das demokratische Geschichtssubjekt sein. Doch kaum will man es benennen und einkreisen, da teilt es sich in eine Vielzahl von etwas spezifischeren »Wir«, die sich manchmal überschneiden und manchmal gegeneinanderstellen, sich meistens überlagern und überlappen. Der Kreisdurchmesser verkleinert sich, oder vielmehr ändert sich die Kontur und wird immer schwerer vorstellbar.
Im Jahre 1913 erklärte die Suffragette Emmeline Pankhurst in einer berühmten Rede: »In unserem Krieg gegen die Regierung könnt ihr uns nicht ausfindig machen. Wir tragen kein Kennzeichen. Wir gehören zu allen Klassen; 15wir dringen in alle Klassen der Gemeinschaft ein, von der höchsten bis zur niedrigsten […]. Ihr könnt uns nicht ausfindig machen, und ihr könnt uns nicht aufhalten.«5 Nun verstand sie aber unter diesem »Wir« nicht die Besitzlosen im Allgemeinen, sondern ein geschlechtlich differenziertes »Wir«: »wir Frauen«. Ihr kam es so vor, als wirkte dieses »Wir« wie ein Querschnitt durch alle sozialen Klassen: Unter den 99% wie in der kleinen Gruppe von 1%, innerhalb des Proletariats und der Bourgeoisie, in den kolonisierten Ländern und den kolonisierenden Ländern gibt es Frauen. Sie sind nicht gleichmäßig auf alle Klassen und alle Stellungen verteilt, doch ihre Identität lässt sich auch nicht auf Klassenbegriffe reduzieren: Eine Frau ist kein Teil der unteren Gesellschaftsklassen. Was ist sie dann? Pankhurst entreißt allen sozialen Untergruppen ein sie transzendierendes »Wir«, eine universelle weibliche Identität, und bezeichnet mit »wir« ein Prinzip, das sich der Klassenzuordnung entzieht: In allen gesellschaftlichen, kulturellen oder ethnischen Gruppen findet man Frauen. Wenn man »wir« sagt, um sie zusammenzuführen, so erzeugt man eine andere Einteilung, ordnet das Ganze neu, zeichnet einen anderen Kreis, der über die üblichen Grenzen, Kasten, Stämme oder Großfamilien hinausgeht, um nicht mehr die Proletarier aller Länder, sondern die Frauen aller Länder und aller Klassen zu vereinigen.
Die Geschichte des Feminismus ist die Geschichte der Herausbildung dieses »Wir«.6 Dies ist die lange Geschichte der Entstehung eines neuen Kreises der Menschheit, der nicht mehr nach Klassen, sondern nach Geschlechtern getrennt, also zweigeteilt ist, und der verlangt, dass die zwei Teile dieser Figur gleich sein sollen. Dieses »Wir« ist das 16Subjekt der berühmten Erklärung Carrie Chapman Catts: »Wir Frauen verlangen gleiches Stimmrecht. Wir geben uns nicht mit weniger zufrieden.«7 Wir verlangen, wir selber sein zu können, nicht mehr und nicht weniger als ihr. Das ergibt sich auch aus dem von Simone de Beauvoir verfassten »Manifest der 343 Schlampen«: Beauvoir eröffnet die Erklärung mit einer Tatsachenfeststellung in der dritten Person (»Eine Million Frauen treiben jedes Jahr in Frankreich ab. […] Diese Million Frauen schweigt man tot.«8). Im weiteren Text sagt sie dann »ich« (»Ich erkläre, dass ich eine von ihnen bin.«). So kann sich jede Unterzeichnerin dazu bekennen, dieses »Ich« zu sein. Und zum Schluss sagt sie: »Wir fordern die freie Abtreibung.« Auf einigen Zeilen ist dies ein Miniaturmodell der Herausbildung einer politischen Person: zuerst die unpersönliche Tatsache, dann die isolierte subjektive Erfahrung und schließlich die Forderung nach einem Recht, die im Namen von uns allen Frauen vorgetragen wird.
Dieses vom Feminismus konzipierte »Wir« wurde nun auch in Abschnitte zerlegt. Es war gewiss immer geteilt und von Anfang an von Widersprüchen durchzogen: Da es die Klassen-, Rassen- oder Sexualitätsunterschiede überdeckte, wurde es auch von diesen Unterschieden überdeckt und hin- und hergerissen. Je aufmerksamer man auf diese Überdeckungseffekte achtet, desto mehr verlagern sich die Grenzen. Als zum Beispiel die sexuellen Minderheiten mit ihren Forderungen hervortraten, haben andere »Wir«, wie etwa das der Homosexuellen, das weibliche »Wir« zwischen lesbischen und heterosexuellen Frauen aufgespalten, wobei es einen Teil des männlichen »Wir«, seinen Gay-Teil, einbezog. Diese Verlagerung lässt sich an den militanten Texten Monique Wittigs ablesen. Sie er17klärt in La Pensée straight (»Das straighte Denken«): »Wenn wir Lesben und Homosexuellen uns weiterhin als Frauen und Männer bezeichnen und begreifen, tragen wir zum Fortbestand der Heterosexualität bei.«9 Wenn man »wir Frauen« sagt, heißt das nämlich, dass man die Trennung der Geschlechter für die Begründung des Diskurses aufrechterhält, der die Heterosexualität normiert und naturalisiert (also des als straight bezeichneten Diskurses), und deshalb haben die homosexuellen Frauen ein Interesse daran, sich zuerst als Homosexuelle und nicht als Frauen darzustellen. Sehr zutreffend analysiert Claire Michard den strategischen Diskurs Wittigs: »Die Autorin konstruiert eine privilegierte Solidarität mit den Lesben, doch sie entsolidarisiert sich nicht von den Feministinnen, den homosexuellen Männern oder den Unterdrückten im Allgemeinen. Wenn die Solidarität der Autorin durch das ›Wir‹ bezeichnet wird, so gibt es keine derartige Verbindung mit den Verkündern der straighten Diskurse. Diese werden ausschließlich in der dritten Person, das heißt als Nichtsubjekte des Gesprächspartners vorgestellt, und die Autorin schließt sich ihnen nie an.«10 Da es Wittig ablehnt, jemals »wir« zu sagen, wenn die minoritäre Identität überschritten wird, vertritt sie eine neue politische Einteilung des »Wir«, die über die traditionellen, marxistischen wie auch feministischen Einteilungen hinausgeht. Man weiß, welche Rolle der Gebrauch dieser als Querschnitt verlaufenden Einteilung bei der Affirmation des homosexuellen Stolzes spielt, und Slogans wie: »We're here, we're queer. Get used to it« (»Wir sind hier, wir sind queer. Ihr müsst euch dran gewöhnen«11) haben das kämpferische Engagement für das Recht der Minderheiten geprägt, von dem man annehmen kann, dass es im Wesentlichen darin 18bestand, »wir« aussprechen zu lernen und dieses Wort im öffentlichen Raum ertönen zu lassen.
Dieses mit Stolz geäußerte »Wir« verwirklicht den Wunsch, den die Kämpfer gegen die Diskriminierung von Behinderten geäußert haben: »Nichts wird ohne uns für uns getan werden.«12 Anders gesagt: Wir wollen nicht nur, dass ihr uns verteidigt; wir wollen, dass wir uns selbst verteidigen können. Während gut der Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand und wuchs dieses Bewusstsein unter verschiedenen als Minderheit behandelten Menschengruppen, dass sie fähig waren, für sich selbst zu sprechen. Und während dieser ganzen Zeit hing die Politik mit dem Zugang zum Wort zusammen. Dies war eine Zeit des Enthusiasmus. Das »Wir« konnte als so etwas wie eine wunderbare Lösung, wie eine Zauberformel für eine spontane Politik erscheinen: Dass man »wir« zum Ausdruck brachte, hieß schon, sich zu emanzipieren. »Wir« zu sagen, hieß, es zu werden. Es bedeutete, einen Kreis zu zeichnen, der das Unsichtbare in Sichtbares verwandelte: »wir Frauen«; »wir alleinerziehenden Mütter«; »wir Juden«; »wir Kolonisierte«; »wir Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit«; »wir Senioren«.
Nun aber wissen wir: Dieses »Wir« der Minderheiten oder der Subalternen, die Zugang zum Wort und zu einer sichtbaren Identität erlangen, ist nicht einfach und auch kein Zauberkunststück. Nach dem Vorbild aller anderen wird es von Widersprüchen oder vielmehr von Schnittlinien durchzogen, die es aufspalten. Die Kreise sind ineinander verschachtelt. Unter den politisch aktiven, besonders den homosexuellen schwarzen Amerikanerinnen hat das Bewusstsein, dass Rassenunterschiede zu Barrieren zwischen all denen führten, die sich um »wir Frauen« 19oder »wir homosexuelle Frauen« zusammenschlossen, unzählige Gewissenskonflikte heraufbeschworen: So bekennen etwa Patricia Haden, Donna Middleton und Patricia Robinson im Jahre 1970, sie seien sich im Unklaren, welche Bedeutung sie dem »Wir« geben könnten, wie es der jeweiligen privilegierten Identität entspreche, die sie vertreten oder die man ihnen vorschreiben möchte. Zusammen mit ihren feministischen Weggefährtinnen definieren sie sich als »wir Frauen«, »doch wir schwarzen Frauen lieben und brauchen in unserem tiefsten menschlichen Innern schwarze Männer, und darum zögern wir, gegen sie zu revoltieren und uns auf uns selbst zu verlassen«,13 sodass sie sich manchmal als »wir Schwarze« darstellen, sich dann jedoch nicht als Frauen wahrgenommen fühlen. Dieses Problem hat sich für die homosexuellen schwarzen Aktivistinnen noch verkompliziert: Sie stellten fest, dass zu dem inadäquaten Verhältnis zwischen ihrer Geschlechtssolidarität und ihrer Rassensolidarität die Diskrepanz zwischen ihrer sexuellen Gemeinschaft und den beiden anderen hinzukam: Sie hatten sich mit mehrheitlich weißen und den Mittel- oder Oberschichten entstammenden homosexuellen Frauen zusammengeschlossen, und deshalb empfanden sie auch innerhalb ihrer sexuellen Minderheit ein gewisses Unverständnis und sahen, dass sich Bruchlinien abzeichneten, die das vereinte und von ihnen herbeigesehnte »Wir« schwächten.
Unmerklich geraten wir so vom Kreis der Geschlechter zum Kreis der Rassen. Die Schnittlinie ist nun überhaupt nicht mehr dieselbe, aber man errät gewisse Analogien.
Wie Emmeline Pankhursts »wir Frauen« hat das »wir Schwarze« vor allem während des Kampfes um Bürgerrechte in den Vereinigten Staaten die ergreifende Entde20ckung einer Identitätsstruktur sprachlich unmittelbar ausgedrückt, die sich nicht auf andere Identitätsschnittlinien reduzieren lässt: Es gab schwarze Männer und Frauen, schwarze Arbeiter und Bourgeois, amerikanische Schwarze und afrikanische Schwarze. Dennoch gab es durchaus eine offensichtliche Verbindung zwischen der schwarzen Identität und den am stärksten benachteiligten Klassen der amerikanischen Gesellschaft, sodass sich das schwarze Wir zugleich vom proletarischen Wir oder vom Wir der sozial Schwachen unterschied, ohne von ihnen ganz unabhängig zu sein. Dies sind die Schnittpunkte mehrerer unterschiedlicher, wenn auch korrelierter Kreise, und das genaue Maß dieser Korrelation wird weiterhin in unzähligen soziologischen Untersuchungen behandelt. Damit das schwarze »Wir« ein politisches Subjekt wurde und kein bloßes soziologisches Thema blieb, musste es sich jedoch verselbstständigen.
Ralph Ellison, der Autor von Der unsichtbare Mann, ist seit den fünfziger Jahren führender Kritiker des marxistischen Universalismus, wobei er sich von Auffassungen leiten ließ, die denen des New Liberalism nahekommen: »So haben sie die Schwarzen verloren. Die Kommunisten erkannten keine Interessenpluralität an.«14 Die Aufspaltung in Klassen vernichtet alle übrigen Aufteilungen der gesellschaftlichen Welt. In seinem Roman erweist sich, dass die »Bruderschaft« ‒ sie steht für die KPUSA (die Kommunistische Partei der USA) ‒ eine entmutigend starre Haltung bei ihrer Sichtweise der Identitäten einnimmt und den Protagonisten zwingt, sich als »farblos« anzusehen. Und ohne seine Hautfarbe wird er unsichtbar. In einer ersten Phase musste man tatsächlich »wir Schwarze« sagen und darunter alle Schwarzen verstehen 21können, ganz gleich, wie ihre Klassenzugehörigkeit war, um hierauf den Schnittpunkt zwischen »wir Armen« und »wir Schwarzen« zum Vorschein zu bringen. Wie in Curtis Mayfields Song »We the people who are darker than blue«15 musste man seine Hautfarbe bestimmen. In den sechziger Jahren ist dies das Thema mehrerer großer Hits von James Brown (»Say it loud ‒ I'm black and I'm proud«16), Nina Simone (»Four women«17) oder Syl Johnson (»Is it because I'm black?«18). Sie alle haben ein Subjekt in Szene gesetzt, das bestätigt, dass es stolz ist, sich mit seiner Hautfarbe zu identifizieren, und das sich nicht mehr schämt, mit ihr identifiziert zu werden. Es ging nicht mehr darum, dass man sich wie der Erzähler von Der unsichtbare Mann in der Gesellschaft unsichtbar fühlte: »Ich bin ein Mensch, den man nicht sieht. Nein, das hat nichts mit diesen Gespenstern gemein, die Edgar Allan Poe heimsuchten; ebenso wenig hat es etwas mit diesen Ektoplasmen eurer Hollywoodproduktionen zu tun. Ich bin ein wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut, Fasern und Flüssigkeiten ‒ man könnte sogar sagen, dass ich Verstand habe. Ich bin einfach deshalb unsichtbar, versteht ihr, weil sich die Leute weigern, mich zu sehen. Wie bei den körperlosen Köpfen, die man manchmal in den Schaubuden der Jahrmärkte sieht, ist es so, als wäre ich von stark verzerrenden Glasspiegeln umgeben. Wenn die Leute an mich herankommen, sehen sie nur meine Umgebung, sich selbst oder Gebilde ihrer Fantasie ‒ tatsächlich alles und irgendwas, nur mich nicht.«19 Im ganzen Roman versucht der Erzähler, den seine Hautfarbe paradoxerweise unsichtbar macht, der Hölle dieses »Ich« zu entkommen, das es ihm nicht erlaubt, in der Gesellschaft zu existieren und endlich »wir« sagen zu können.
22Im 20. Jahrhundert haben alle ethnischen Minderheiten gelernt, ihr »Wir« nach diesem Modell der Konstruktion eines von Stolz und Sichtbarkeit geprägten sozialen Kreises zu äußern, und man könnte den Standpunkt vertreten, dass der wichtigste Teil der modernen Politik der Erarbeitung und Äußerung dieses »Wir« gewidmet wurde: Dies gilt etwa für die »native Americans«, deren Losung »We native Americans were here!«20 seit den achtziger Jahren manche überraschende Orte in Amerika schmückte, als sollte sie an eine vergessene Wahrheit erinnern und es den indianischen Stämmen erlauben, die Kriege, die sprachlichen und kulturellen Unterschiede, die sie stets getrennt hatten, zu überwinden und ihre Zugehörigkeit zu einem einzigen »Wir« auszudrücken, das lange vor der Ankunft der Europäer auf dem amerikanischen Kontinent anwesend war.
Manchmal vereinen sich das »Wir« der Hautfarbe, das ethnische »Wir«, das territoriale »Wir« und das nationale »Wir« auf ‒ wenigstens scheinbar ‒ beinahe harmonische Weise, und manchmal überschneiden sie sich gegenseitig. In diesem Gewirr von Kreisen lassen sich die meisten kolonialen Situationen entschlüsseln. Die Menschen, die für Unabhängigkeit oder Befreiung kämpfen, gehören zwar zu einem umfassenderen nationalen Kreis, zeichnen indes andere Kreise, die in die nationalen Grenzen einbezogen sind oder sich an deren Rändern befinden, womit sie die Existenz von bestimmten »Wir« bestätigen, die sich vom »Wir« der Metropole unterscheiden; dabei sind sie jedoch gewaltsam und aus der Ferne in einer Gesamtheit eingeschlossen, die sie als unecht beurteilen.
Aus diesem Grund war die richtige Bezeichnung »unseres Namens« oft der erste Schwerpunkt der Auseinan23dersetzungen zwischen antikolonialistischen politischen Formationen. Sollte man für die Rechte eines besonderen »Wir« innerhalb des von Siedlern und Ureinwohnern zugleich bevölkerten Landes kämpfen? Oder sollte man vielmehr im Namen eines neuen nationalen »Wir« sprechen und die Siedler allen Ernstes ausschließen? Und dann: Wie sollte man zwischen Klassenzugehörigkeit und nationaler Zugehörigkeit vermitteln, da ja viele Aktivisten in Europa studiert hatten und gefühlsmäßig zu einer aufsteigenden Bourgeoisie gehörten, die sich der Mittelklasse der Kolonialmächte annäherte? Während die Mitglieder der AEMNA (Association des étudiants musulmans nord-africains ‒ »Verband der muslimischen nordafrikanischen Studenten«) sich zunächst als »Studenten«, also als Vertreter einer gebildeten Elite, definierten, markiert die Erklärung ihres Kongresses von 1935 einen entscheidenden politischen Kurswechsel, indem sie dieses »Wir« durch ein »Wir Kolonisierten« ersetzt, um ihre vorrangige Solidarität mit denen zu bekunden, die in ihrem Geburtsland nicht studiert haben. Das »wir Kolonisierte« ist nunmehr maßgeblicher und geht dem »wir Studenten oder Gebildeten« voran: »Wir gebildeten Kolonisierten müssen unsere Möglichkeiten und unsere Zeit dafür einsetzen, die Interessen unserer Vaterländer zu verteidigen.«21
Diese Entscheidungen über die Priorität zwischen den unterschiedlichen »Wir« erklären beinahe jede Politik: Auf welche Art der Einteilung soll ich mich zuerst berufen, wenn ich »wir« sage? Gehöre ich zuerst zu uns Menschen? Oder sogar in einem weiteren Sinne zu uns, den empfindenden Wesen? Den natürlichen Wesen? Oder verlangt die Situation vielmehr größere Genauigkeit: »Wir 24Frauen«? »Wir Schwarzen?« »Wir Weißen?« »Wir arabischen Muslime?« »Wir, die Nachkommen der großen indischen Kultur?« (Man denkt an Nehru, der bei seiner USA-Reise erklärt haben soll: »Ihr Amerikaner seid so jung. Wir Inder sind ein altes Volk mit einer jahrtausendealten Kultur.«22) Oder soll man sich vielleicht zuerst mit seiner wirtschaftlichen Identität identifizieren: »Wir ausgebeuteten Proletarier?« Sklaven, Peones, Lohnarbeiter? Welchen Namen soll man sich geben, wenn man auf seine Zugehörigkeit zu der Klasse eingeht, die man als beherrschte einschätzt? Prekär Beschäftigte? Unterdrückte? Untergebene? Subalterne? »Wir Kolonisierten und Gedemütigten«, wie es den Reden Nkrumahs oder Lumumbas entspricht?23
Hierbei handelt es sich nicht um eine sprachliche Subtilität, sondern um eine äußerst fein abgestufte, heikle und schwierige Wahl, mit der sich all jene, die auf politischem Gebiet einen Standpunkt eingenommen haben, auseinandersetzen mussten, und die all jene, die es abgelehnt haben, einen Standpunkt einzunehmen, erduldet haben: Wo verläuft der Kreis?
Der in El Bidar geborene Jacques Chevallier war während des Algerienkrieges eine der großen ‒ und heute vergessenen ‒ als »Vermittler« wirkenden Persönlichkeiten. Er befürwortete den Plan eines »föderalen Algerien«, stand Messali Hadj nahe und bemühte sich bis zum Schluss, die Verbindung mit dem Front de Libération Nationale (FLN, der Nationalen Befreiungsfront) und der Organisation Armée Secrète (OAS, Organisation der Geheimen Armee) aufrechtzuerhalten. 1958 veröffentlichte er im Verlag Calmann-Lévy das Buch Nous, Algériens (»Wir Algerier«). Chevallier sagte »Wir Algerier«,24 wobei er sich als fran25zösischer Siedler in dieses »Wir« einschloss, weil er in dem Land geboren war, und wobei er auch die Indigenen in dieses »Wir« einbezog. Das letztgenannte »Wir« wurde sowohl von den Pieds-Noirs (Algerienfranzosen), die das Hinzurechnen der Araber nicht ertragen konnten, als auch von den Unabhängigkeitskämpfern als »unannehmbar« abgewiesen, denn diese hielten den Wunschtraum einer Zugehörigkeit von solchen Pieds-Noirs wie Chevallier zum »Wir« Algeriens für unrechtmäßig, sollte dieses »Wir« doch ausschließlich den indigenen Bevölkerungen zustehen.
Dieses »Wir« einer gemeinsamen Zugehörigkeit existierte gewissermaßen im leeren Raum, an einem politischen Nicht-Ort, den keines der einander gegenüberstehenden Lager anerkennen wollte oder konnte. Es verschwand mit der Unabhängigkeit Algeriens.
Während der kolonialen, aber auch der postkolonialen Geschichte findet eine Konfrontation mehrerer ineinandergeschachtelter »Wir« statt, denn das »Wir« der Kolonisatoren konstruiert, wie Edward Saïd schrieb, »die Kolonisierten als das Andere«.25 (Simone de Beauvoir verwendete in Das andere Geschlecht denselben Ausdruck in Bezug auf die Frauen.26) Aber es beansprucht zugleich, das kolonisierte Andere in die gesamte Menschheit und den Fortschritt der Zivilisation einzubeziehen, sodass das »Wir« für die Kolonisierten eine manipulierte Sprachstruktur ist: Wenn sie sich auf »uns, die universalistischen Menschen« berufen, um gleiche Rechte zu fordern, so beziehen sie sich auf einen Universalismus, den man ihnen genommen hat und in dessen Namen sie als niedrigere Wesen angesehen wurden, die hinter dem Zug der Geschichte, des Fortschritts und der Kultur zurückgeblieben seien; 26und das bedeutet, sich der Gefahr auszusetzen, seine besondere Identität als Kolonisierter zu neutralisieren, indem man alle Menschen als einen einzigen, die falschen Unterschiede beseitigenden Block darstellt. Doch wenn man »wir Indigenen« oder »Kolonisierten« im Gegensatz zu ihnen, den weißen universalistischen Menschen, sagt, so heißt das, dass man sich auf eine besondere Gemeinschaft beschränkt und sich der Gefahr aussetzt, sich von sich selbst auszuschließen und sich zu rassifizieren, also die ganze Arbeit des Kolonisators an seiner Stelle zu leisten.
Ganz offensichtlich ist kein »Wir« eindeutig: Im Namen unserer Humanität haben manche die Kolonisation bekämpft, und andere haben sie verteidigt.
Ein und dasselbe Wort wird zum Gegenstand eines Kampfes zwischen mehreren Lagern, und das »wir Republikaner«27 der Reden Jules Ferrys in der französischen Nationalversammlung, das die zivilisatorische Mission der Kolonisierung befürwortete, wurde bereits von manchen Pazifisten infrage gestellt, so etwa von Marie-Isabelle Destriché, die 1896 in dem Artikel »Die Vereinigten Staaten von Europa und der Frieden« erklärte: »Die Abessinier und die Kubaner zeigen Mut. Was wollen sie? Sich verteidigen oder ihre Unabhängigkeit erringen, die ihnen die Monarchien streitig machen. Wir, die Französische Republik, wir müssen ihren Erfolg wünschen.«28 Danach verglich sie den nationalbewussten Kampf der Franzosen, um Elsass-Lothringen von Deutschland loszureißen, mit den Kämpfen der kolonisierten Völker Afrikas und Asiens.
Aber die Unabhängigkeit dieser Länder hat das koloniale Dilemma nicht beendet, ganz im Gegenteil. Jede po27litische Erklärung, die sich als postkolonial darstellt, ist eine Übung darin, das »Wir« neu zu definieren, und in ihrem Rahmen zählt jedes Wort: »WIR, Nachkommen von Sklaven und verschleppten Afrikanern, Töchter und Söhne von Kolonisierten und Einwanderern, WIR, Franzosen und in Frankreich lebende Nichtfranzosen, an den Kämpfen gegen Unterdrückung und die von der postkolonialen Republik bewirkten Diskriminierungen beteiligte AktivistInnen …«,29 so verkündet der »Appell der Indigenen der Republik«.
Gegen das »Wir« der Französischen Republik möchte eine solche Organisation am Beginn des 21. Jahrhunderts ein »Wir« hervortreten lassen, das sich über die Einteilungssysteme des sozialen Raums hinwegsetzen kann. Sie hofft, die Einwanderer aller Generationen und die Nachkommen von Bevölkerungen zu vereinen, die Frankreich in Schwarzafrika, im Maghreb oder auf den Antillen kolonisiert hatte. Wenn man die Existenz eines solchen »Wir« bestätigt, setzt dies voraus, dass man glaubt, was sie zusammenführe ‒ selbst wenn dies manchmal lediglich das Gefühl der Diskriminierung sei ‒, werde stärker als das bleiben, was sie trenne (beispielsweise Gender, Beruf, Religion). Nun ist dies stets, was eine Politik verspricht: das benennen zu können, was wir an Stärkerem als das uns Trennende haben.
Die Französische Republik hat lange beansprucht, dieses allen Unterteilungsprinzipien in Bezug auf Rasse, Gender oder Klasse überlegene »Wir« zu sein, aber es ist bemerkenswert, dass die Französische Republik in ihren aufeinanderfolgenden Verfassungen nie »Wir« gesagt hat. Sie spricht in der dritten Person von den »Franzosen«, vom »französischen Volk« und »seinen Vertretern«.30 Man 28könnte beinahe eine politische Geschichte Frankreichs konzipieren, die sich ausschließlich für die Wiederaufnahme »in der ersten Person« der in der dritten Person geäußerten republikanischen Prinzipien durch Gruppen, Parteien oder Verbände interessieren würde. Vielleicht ist die republikanische Idee in ihrer entkörperlichten Verfassung immer unpersönlich und unfähig geblieben, sich durch eine oder mehrere konkrete Subjektivitäten zu äußern. Mehrere Erklärungen der Pariser Kommune verwenden das »Wir«, doch es ist gewiss das von Sylvain Maréchal verfasste Manifest der Verschwörung der Gleichen, das diese Tradition des »Protestes der Franzosen in der ersten Person« eröffnet, indem es sich der unpersönlichen Grundsätze der Republik bemächtigt und ihre tatsächliche Anwendung fordert. Auf die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die formuliert, dass »alle Menschen« frei und gleich geboren werden und bleiben, antwortet Sylvain Maréchal: »Wir sind alle gleich, nicht wahr? […] Wir streben von nun an danach, gleich zu leben und zu sterben, wie wir gleich geboren sind: Wir wollen die wirkliche Gleichheit oder den Tod; das ist es, was wir brauchen.«31 Die Gleichen stellen den Inhalt der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte nicht infrage, sondern nehmen sie beim Wort, und dann werfen sie ihr im Grunde vor, dass sie unfähig sei, ihn durch die Verwendung eines »Wir« zum Ausdruck zu bringen.
In anderen Nationen, wie etwa den Vereinigten Staaten, gibt es diese Spannung nicht, oder vielmehr verlagert sie sich, denn die Verfassung selbst erklärt in der Präambel: »Wir, das Volk« (»We, the people«).32 Besonders aus diesem Grunde erfolgen politische Proteste oft im Namen der Verfassung, zum Beispiel des ersten Zusatzarti29kels, und nicht gegen sie. Da sie von vornherein das »Wir« einschließt, ist sie eine als demokratisch angesehene Waffe gegen autoritäre Fehlentwicklungen, während in Frankreich die Formulierung der Verfassungsgrundsätze selbst dem Vorwurf ausgesetzt ist, niemals »wir« gesagt zu haben und in niemandes Namen oder vielmehr von niemandes politischem Standpunkt aus zu sprechen (die Republik ist alle und niemand, doch sie ist nicht wir).
»We, the people« ist dieses amerikanische »Wir«, das angeblich über die Unterschiede zwischen uns Männern und uns Frauen, uns Armen und uns Reichen, uns Schwarzen und uns Weißen, uns Christen und uns Juden, uns Muslimen und uns Buddhisten hinausgehen soll. Nun weiß man aber, dass dieses sehr inklusive Wir auch das ist, was es in Augenblicken nationaler Einigkeit ermöglicht, eine Bevölkerung gegen einen gemeinsamen Feind zu mobilisieren. »In der Unterhaltung sprach Madame Verdurin, um diese Neuigkeiten mitzuteilen, immer nur per ›wir‹, wenn sie Frankreich meinte«,33 schreibt Proust knapp, um den Aufschwung des Chauvinismus und Deutschenhasses in den Pariser Salons während des Ersten Weltkriegs zu veranschaulichen.
Bekannt ist auch die Bedeutungsverschiebung, die es Stalin in seiner großen Rede von 1941 erlaubt, vom »wir Kommunisten« zum »wir Russen« überzugehen, um die Landesverteidigung gegen den Angriff der Nazis vorzubereiten. Der Kreis des idealen neuen »Wir« ist durch die Macht der Gewohnheit und die Autorität Stalins zum Kreis des alten patriotischen »Wir« geworden, denn die Partei glaubte, ohne diesen den deutschen Heeren nicht widerstehen zu können. Stalins Rede beginnt so: »Genossen Rotarmisten und Matrosen der Roten Flotte, Komman30deure und politische Funktionäre, Arbeiter und Arbeiterinnen, Kollektivbauern und Kollektivbäuerinnen, Kopfarbeiter, Brüder und Schwestern im Hinterland unseres Feindes, die ihr vorübergehend unter das Joch der deutschen Räuber geraten seid, und ihr, unsere ruhmreichen Partisanen und Partisaninnen, die ihr die rückwärtigen Einrichtungen und Dienste der deutschen Eindringlinge zerstört!«34 (Es kommt auf die Reihenfolge der Begriffe an.) Und bevor er sich unter das Banner Lenins stellt, beendet er seine Ansprache mit: »Es lebe unsere ruhmreiche Heimat, ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit!« »Unsere Heimat«, ein von Lenin geächteter chauvinistischer und großrussischer Begriff, der an den Zaren Iwan und den Kampf gegen die Bojaren erinnert, ist nun wieder der spezifische Kreis, mit dem Stalin definiert, was »wir« sind.
Ein bedeutender Teil der politischen Geschichte des 20. Jahrhunderts beruht auf diesen ungeheuer großen »Wir« der Geopolitik oder der Geostrategie, die alle anderen Identitäten überwältigen. »Entweder wir ‒ oder sie« (»It's either us or them«):35 Churchills Kernsatz bezeugte den totalen Krieg zwischen den Alliierten und dem nazistischen Feind. Der Kalte Krieg war vielleicht nur der Übergang von der Disjunktion (»oder«) zur erstarrten Konjunktion (»und«), die Koexistenz und irreduziblen Unterschied bezeichnete: »Wir und Die« (»Us and them«),36 dies wurde der Leitspruch der amerikanischen Doktrin in der Auseinandersetzung mit den Kommunisten. Als das Sowjetregime zusammenbrach, kamen andere große »Wir« und andere große »Die« erstmals oder wieder zum Vorschein, die »Wir« der Weltreiche, wie im »Kampf der Kulturen« Samuel Huntingtons,37 der seine Zukunftsaussichten mit der Feststellung des »gesunden Menschen31verstandes« fundiert, dass die Völker stets versucht seien, sich in »wir« und »die«, in die »Ingroup« und »die anderen«, in »unsere Zivilisation hier« und »die Barbaren dort« einzuteilen. Huntington äußert schon 1993 die Hypothese, dass die zukünftigen Konfliktlinien keine ideologischen oder wirtschaftlichen, sondern kulturelle »Wir« und »Die« einander entgegenstellen werden, sodass es »Wir« der Kulturkreise (wie etwa das »umfassendste Wir« des Westens oder das arabisch-muslimische »umfassendste Wir« und innerhalb dieses »umfassendsten Wir« die kleineren sunnitischen und schiitischen »Wir«) sind, die nunmehr die Teilungs- und Konfliktlinien definieren.
Diejenigen, die Huntingtons Analysen widersprachen,38 haben ihm selten vorgeworfen, völlig unrecht zu haben, vielmehr erklärten sie, er verdecke mit einem hauptsächlichen Deutungsmuster als »sekundär« angesehene Unterschiede oder Konflikte. Bei alldem geht es um die Priorität der einzelnen Kreise: Obwohl man einen Konflikt zwischen verschiedenen Kulturkreisen und Auseinandersetzungen zwischen Kreisen von sozialen Klassen anerkennt, besteht die wesentliche Entscheidung darin, auszuwählen, welches von diesen Bruchliniensystemen den Vorrang vor dem anderen hat.
Wenn man die Welt in erster Linie nach Kulturkreisen zurechtschneidet, so heißt dies, dass man die ideologischen Kreise oder die Reiche und Arme trennenden wirtschaftlichen Kreise als zweitrangige oder nachgeordnete Kreise ansieht; indem man einen klaren Blick für bestimmte, die Welt durchquerende und einteilende Linien gewinnt, bedeutet dies zwangsläufig, dass man für andere, kaum markierte und schlecht kontrastierte Linien blind wird.
Wenn man in der Realität den Verlauf der »Wir« der so32zialen Klasse oder der »Wir« des Genders hervorhebt, heißt dies auch, dass man die realen Bruchlinien zwischen den kulturellen oder religiösen »Wir« undurchsichtig oder unkenntlich macht, und das führt dazu, diese systematisch zu unterschätzen. Nun zeichnen die religiösen »Wir« aber auch Kreise, die an der Oberfläche der sozialen Welt wieder auftauchen und die Individuen zusammenschließen und trennen, nachdem der moderne Blick, der an die Laizisierung, Säkularisierung und tendenzielle Entzauberung der Gesellschaft glaubte, sie vernachlässigt hatte. Der regelmäßige Gebrauch des schiitischen »Wir« und des sunnitischen »Wir« zeichnet zum Beispiel im Kreis der muslimischen Welt ein Polarisierungssystem, ohne das Konflikte, Bündnisse und Gegenbündnisse unverständlich werden: Wenn ein irakischer Imam, wie etwa Rafie al-Rifai, meint, den Islamischen Staat zu bekämpfen würde bedeuten, den Iran zu stärken, so setzt er voraus, dass es einen größeren Abstand zwischen »uns Sunniten« und »euch Schiiten« als im Rahmen von »uns Sunniten« zwischen ihm und den Kräften des Islamischen Staates gibt, und er nimmt eine Priorisierung zwischen religiösen »Wir« vor: »Wir Sunniten sind nicht so idiotisch, den Islamischen Staat im Irak und in der Levante zu bekämpfen, damit uns die Schiiten später unterjochen.«39
Die religiösen »Wir« waren stets Systeme von Kreisen, die von inneren Trennungen durchzogen wurden; diese können zum Schisma führen, was so etwas wie eine Mitose des religiösen Kreises bedeutet. Zu anderen Zeitpunkten schließen sich die zerstreuten Zugehörigkeitskreise wieder zu einem einzigen höheren »Wir« zusammen, das oft durch einen Sinn der Brüderlichkeit wiederbelebt wird. »Wir Brüder« ist die stärkste Intensität, die man einer po33litischen Person geben kann. »Unsere Brüder« spielen wie »unsere Genossen« oder »unsere Freunde« eine pastorale Rolle: Wenn man den Kreis eines »Wir« des Glaubens, der Ideen und Werte nachzeichnet, muss man in einen gemeinsamen Schoß zurückbringen, was sich in individuellen Identitäten und partikularen Sekten zerstreut hat.
Das 1936 veröffentlichte Fünfzig-Punkte-Manifest des Verbandes der Muslimbrüder (Jam'iyat al-Ikhwan al-Muslimin) von Hassan al-Banna40 wendet sich an »uns, die wir das Ziel verfolgen, alle Muslime in einer einzigen Umma mit einer einheitlichen Scharia zu vereinigen«, um so eine politische Person mit starker muslimischer Erscheinung neu zu schaffen, die durch den Verfall des Kalifats, die Hegemonie des Osmanischen Reichs und danach die politische und kommerzielle europäische Herrschaft aufgelöst worden war. Mit dem Text »Unsere Mission«41 wendet sich al-Banna an seine »Brüder« und fragt: »Liebe Brüder, was wollen wir?« Nach seiner Analyse des »Materialismus der europäischen Zivilisation« scheint ihm offensichtlich, dass Wissenschaft und moderne Industrie, die Reichtümer unter der Bevölkerung verbreitet haben, zu einem Ausschluss des Religiösen aus dem Staat, dem Recht oder der Erziehung führten. Die Völker seien nicht mehr durch spirituelle Werte, sondern durch materielle Güter geeint. In der Anfangszeit der Organisation betont al-Banna Solidarität und Altruismus bei der Verbreitung des Islam (Sammeln und Verteilen der Zakat, Bau und Reparatur der Moscheen, Gründung von Koranschulen, Sozialarbeit bei den Bedürftigsten), um den ägyptischen Arbeitern das Verständnis ihrer gemeinsamen Zugehörigkeit zu einer vergessenen Brüderlichkeit zurückzugeben. Oft 34rät er seinen Brüdern, denen zu antworten, die sie beschuldigen, Politik zu machen, dass »der Islam keine derartigen Unterscheidungen kennt«.42 Al-Bannas ausdrückliches Ziel besteht darin, die von der modernen Zivilisation aufgerissenen Gräben zwischen Klassen und Rassen (seltener erwähnt er die biologischen oder sozialen Geschlechtsunterschiede) durch die Identität des muslimischen »Wir« zu überbrücken: »Der Islam ist für alle gleich und erhöht niemanden zum Nachteil der anderen aufgrund von Unterschieden durch Herkunft, Armut oder Reichtum. Dem Islam zufolge sind alle gleich […].«43 Er präzisiert: »Was die Talente und die natürlichen Begabungen betrifft, so ist die Antwort gleichwohl ja. Der Wissende steht über dem Unwissenden […]. So sehen wir, dass der Islam das System der gesellschaftlichen Klassen nicht gutheißt.«44 Also werden die »Wir« der Klasse oder Rasse vom muslimischen »Wir« überbrückt, das unter uns Gleichheit und Rangordnung artikuliert und dabei nur auf dem Wissen beruhende Autoritätsunterschiede voraussetzt. Nach und nach hat dieses politische muslimische »Wir« im 20. Jahrhundert neu Gestalt gewonnen.
Ausgehend von Theodor Herzls Erklärung zum Ersten Zionistenkongress, der 1897 in Basel stattfand, wurde einige Zeit früher ein jüdisches »Wir« neu erarbeitet, das sich bei manchen zu einem politischen zionistischen »Wir« entwickelt hat. In seiner Grußbotschaft erklärt Herzl vor allem: »Mit den inneren Zuständen unserer Vaterländer beschäftigen wir uns weder auf dem Kongress noch anderswo in einer gemeinsamen Weise.«45 Das nationale »Wir« wird somit in Klammern gesetzt. Herzl spricht von »unserem Volk«, doch bei den aufeinanderfolgenden Kongressen beendet er seine Grußbotschaften meistens mit 35der Vision von »unserer Teilnahme am Fortschritt des ganzen Menschengeschlechts«. Herzl sagt sicher nicht »wir Zionisten«, während ein radikaler Aktivist wie Jabotinsky etwas später die Beziehung zwischen dem allgemeinen Interesse der menschlichen Spezies, den Klasseninteressen, dem jüdischen Interesse und der zionistischen Idee anders interpretiert: Obwohl er Sozialist ist, stellt er sich nicht vorrangig als einen klassenbewussten Politiker, sondern als einen nationalen Politiker (einen kol-yisroel-Politiker46) dar und erklärt, dass die allgemeinen nationalen Interessen heute beinahe überall die besonderen Klasseninteressen in den Schatten stellen. »Da seine Bewegung über oder jenseits der Klasse stand, hatte sie das Recht und die Pflicht, die Führung der Politik der nationalen Einheit zu übernehmen«, stellt Jonathan Frankel fest, und er zitiert Jabotinsky: »Wir Zionisten betrachten uns nicht als eine Partei, sondern als die Vertreter des ganzen jüdischen Volkes.«47 Man sieht, wie sich dieses neue politische »Wir« konstituiert, indem es die klassenmäßigen und parteilichen Unterschiede überbrückt. Eine neue Einteilung des politischen Raums führt nun dazu, dass sich Polarisierungen der sozialen Frage (Revolutionäre gegen Konservative) und Polarisierungen der religiösen Frage (Juden gegen Antisemiten) überlappen, an deren Schnittpunkten man revolutionäre Juden und jüdische Revolutionäre (alles ist eine Frage der Priorität), konservative Juden und jüdische Konservative findet ‒ und das Gleiche gilt für die Antisemiten.
In Frankreich ist das antisemitische »Wir« seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in den Schriften von Drumont48 zu einem politischen Subjekt geworden. Es wird von Regnard oder Marchand49 aufgenommen und weitergeführt, 36gewinnt klarere Konturen, stellt Übereinstimmungen mit anderen politischen Identitäten fest und wird auf diese Weise zum Beispiel zu »wir revolutionären Antisemiten …«. Nach der russischen Revolution werden sich Aktivisten in der Ukraine äußern, die sich vielmehr als »antisemitische Revolutionäre« definieren.
Diese Prioritätsordnung (zwischen der sozialen Frage und der antisemitischen Frage) wird oft Auseinandersetzungen in den faschistischen Bewegungen zugrunde liegen. Das ist eine der Bruchlinien, die zwischen der Basis der Münchener SA und der von Ernst Röhm geleiteten, der norddeutschen Arbeiterlinken nahestehenden Richtung verlief. Mussolini wollte es vermeiden, zwischen den möglichen Bestimmungen dessen, was er unter »wir Faschisten« verstand, entscheiden zu müssen, und zog es deshalb oft vor, sich auf ein offenes »Wir« zu berufen, das angeblich keine A-priori-Doktrin vermittelte: »Wir Faschisten haben keine vorgefasste Doktrin, unsere Doktrin ist die Tat.« Weiter sagte er: »Wir Faschisten haben stets unsere völlige Gleichgültigkeit gegenüber jederlei Theorie zum Ausdruck gebracht. […] Wir […] sind Aristokraten und Demokraten, Revolutionäre und Reaktionäre, Proletarier und Antiproletarier, Pazifisten und Militaristen.«50 In Pasolinis Film Die 120 Tage von Sodom, der das Ende des Regimes darstellt, erklärt der Anführer sogar: »Wir Faschisten sind die einzig wahren Anarchisten.«51 Das faschistische »Wir« schwankte somit fortwährend zwischen einem autoritären »Wir« und einem offenen »Wir«, so etwas wie einem vitalen »Wir«, das die Hoffnung vermittelte, allen alten Selbstkategorisierungen, allen korrupten Mächten zu entgehen.
»Warum haben wir uns als Faschisten bekannt?«, frag37te sich der französische Schriftsteller Lucien Rebatet, ein Kollaborateur. »Da wir die parlamentarische Demokratie, ihre Heuchelei, Unfähigkeit und Feigheit verabscheuten […], verkörperte der Faschismus Bewegung, Revolution und Zukunft […]. Um die politischen Sekten abzuschaffen, wollten wir die Einheitspartei.«52