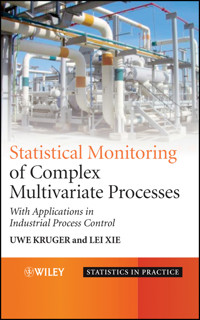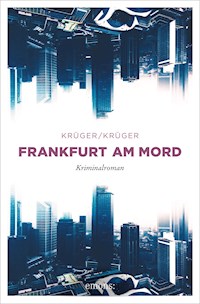
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Bahnhofsviertel bis zum Kühkopf: Krüger & Krüger zeigen die Mainmetropole in all ihren Facetten. Ein Toter im Rotlichtviertel: Was für Hauptkommissarin Karola Bartsch als einfacher Fall beginnt, entwickelt sich zu einem gnadenlosen Katz-und-Maus-Spiel. Verzweifelt wendet sich Karola an ihren Bruder Karsten, der als naturverbundener Ex-Bulle mit seiner Kneipe eigentlich genug Probleme am Hals hat. Die Spuren führen nicht nur mitten hinein ins kriminelle Milieu der Großstadt, sondern auch hinaus ins Grüne, wo ein maskierter Mörder sein Unwesen treibt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Uwe Krüger, geboren und aufgewachsen in Frankfurt am Main, studierte Zoologie, Hydrologie und Mikrobiologie an der Goethe-Universität. Lange Zeit arbeitete er bei einem weltweit agierenden Großhandel für Aquarienfische, bevor er als Marketingmanager zu einem internationalen IT-Unternehmen wechselte. In seiner Freizeit sucht er seltene Pflanzen und Tiere und Ideen für den perfekten Mord.
Näheres über den Autor unter: www.frankfurterkrimis.de
Jonas Torsten Krüger kam ebenfalls in der Goethe-Stadt zur Welt, studierte dort und in Marburg Germanistik, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und Botanik. Nach der Veröffentlichung eines Lesebuchs ökologischer Literatur wandte er sich der Belletristik zu und entlässt seit 2002 Kinder- und Jugendbücher, Fantasy- und historische Romane aus der Druckerpresse. Er lebt mit seiner Frau in Berlin.
Mehr Infos auf www.einbuchwiekingsturm.wordpress.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Cristian Todea/Arcangel Images
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Carlos Westerkamp
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-538-1
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Wir widmen dieses Buch allen, die sich mit Sanftmut, Humor und Empathiegegen die Tyrannei der Dunklen Triade stellen.
Und allen Leserinnen dieser Welt, ganz besonders
Es gibt kein richtiges Leben im falschen.
Theodor W. Adorno, »Minima Moralia«, Aphorismus 18
Wer sich zur Taube macht, den fressen die Falken.
Deutsches Sprichwort
Prolog
Der Kühkopf schmiegt sich an das Ufer des Rheins und atmet aus: Wolken von Stechmücken, Myriaden von ihnen, schweben auf seinen Wangen. Herbstgelb brennen die Bäume und Sträucher im Dämmerlicht, frisch und sumpfig quatschen die Auen, genährt von den ersten heftigen Regengüssen nach dem Sommer. Der Kühkopf, er streckt seinen schmalen Schädel weit in das Wasser hinein. Der Fluss umarmt ihn, die kleinen Wellen kühlen ihn. Manche Menschen dachten, dass der Kühkopf ein Berg sei. Unfug. Dumme, kurzlebige Zweibeiner. Lange Zeit war er eine Halbinsel gewesen, gebildet von einer weit geschwungenen Schlaufe des Rheins. Eine rundliche, schlanke Halbinsel, die an einen Kopf erinnerte: daher sein Name. Namen geben, das konnten sie immerhin, die Menschen. Später war ihnen die Fahrt auf dem Rhein zu lang geworden, wahrscheinlich ob ihrer Kurzlebigkeit, und sie hatten eine Abkürzung ersonnen, einen Stichkanal gegraben, den Kühkopf vom restlichen Land abgeschnitten. Kopf ab, bildlich gesprochen.
Und aus der halben Insel wurde eine ganze.
Lautlos und langsam verschwindet die Sonne, lässt ihr farbiges Echo noch lange, sich verschattend und kräuselnd, am Himmel stehen: orangegelb, tiefrot, ernstlila, nachtschwarz.
Das Licht versickert wie übers Ufer schäumendes Wasser im Sand. Der Kühkopf lauscht dem Herbst, lauscht der einbrechenden Nacht. Hört das hundertfache Gezwitscher der Stare, die sich zu Schwärmen zusammenfinden in den ersten Septembertagen, bis sie wie Wolken aus Federn und Fleisch am Himmel tanzen. Der Kühkopf hört zu. Lauscht dem traurigen Flöten eines Rotkehlchens, dem letzten Schrei eines Schwarzmilans, oben im fast dunklen Himmel einen Kreis schwebend. Er lauscht dem Wind, dem dröhnenden Hupen einer Rohrdommel, dem raschelnden Klatschen des Schilfrohrs.
Zusammen mit dem vergehenden Licht verstummt das Pfeifen und Kreischen. Der Wind, der eben noch das Schilf streichelte. Stille schleicht sich heran und kommt näher. Stille, das war nicht die Abwesenheit von Klang, sondern etwas Eigenes, eine Entität der Nacht, ein lebendiges Ding. Der Kühkopf erfreut sich an ihr. Lauscht. Wundert sich, als die Dämmerruhe unterbrochen wird. Stampfende Schritte und lautes Sprechen. Zweibeiner, ja, und sie streiten sich. Ungewöhnlich. Nicht der Streit, oh nein, für den Kühkopf streiten sich Menschen nur dann nicht, wenn sie ihn allein bewandern. Aber die Zeit. Die ist ungewöhnlich. Frühe Nacht, da bleibt er sonst meist von Zweibeinern verschont. Sie nähern sich seinem Ufer. Brüllen jetzt, lauter und lauter werdend. Noch lauter …
Ein Schlag. Ein leises Platschen.
Und wieder Stille.
Wie kurzlebig die Zweibeiner doch sind.
Atemwolken aus Fliegen, Schnaken und Mücken, Myriaden von ihnen, hüllen den Kühkopf ein. Inseln können nicht lachen, aber lächeln, das schon – der herbstgraue Bart aus Schilfrohr wiegt sich spöttisch. Mondlos und kalt wird die Nacht, und die wimmelnden Chitinwesen verschwinden.
Der Kühkopf schläft.
1
Erster Tag
Kriminalhauptkommissarin Karola Bartsch wachte mit Bauchschmerzen auf: jenes Ziehen im Unterleib, das alle Frauen der Welt zu erdulden hatten. Ein guter alter Bekannter, der ihr mit Krämpfen im Bauch sagte: Nein, auch aus diesem Ei wird keine kleine Karola Bartsch, kein kleiner Mirko Fink.
Dann halt beim nächsten Mal.
Karola schnupperte, atmete die regenverheißende Luft, die sich durch das gekippte Fenster zwängte. Sie lauschte, blinzelte in die Dunkelheit und widerstand der Versuchung, einen Blick auf den Funkwecker zu werfen. Beobachtete lieber die im Luftzug hin- und herpendelnden Bastrollos mit aufgedruckten japanischen Lotusblüten. Unser Kompromiss, dachte Karola und musste lächeln. Wie lange hatten sie sich darüber gestritten? Karola hatte – ganz klassisch und weil es sie an ihre Oma erinnerte – Vorhänge am Fenster gewollt, Mirko fand Jalousien praktischer und moderner. Die Bastrollos mochten beide ein bisschen. Manchmal fragte sie sich, ob Kompromisse überhaupt Sinn machten. Hätte nicht einer für den anderen auf seinen Wunsch verzichten sollen?
Egal, Hauptsache, sie hatten eine Lösung gefunden. Einen Kompromiss. Ob das ein Merkmal für eine funktionierende Beziehung sein mochte?
Karola schnupperte noch einmal. Das frische Laken roch nach Seife und Mirko. Jedenfalls nicht nach Waschmittel. Nach Farbe? Nein, das musste aus ihrem Schlaf herübergeschwebt sein. Sie hatte von Flo geträumt, von Florian Funke, ein von den Medien gefeierter, aber leider illegal agierender Sprayer. Dessen zum Glück unbekannt gebliebene Partnerin sie selbst gewesen war. Noch jetzt lief Karola ein Schauer über den Nacken, wenn sie daran dachte, wie schnell und unrühmlich ihre Karriere als Kriminalistin zu Ende gegangen wäre, hätte man sie erwischt. Das war damals, dachte sie, auch eine Art Kompromiss gewesen: Abbitte für einen Fehler.
Karola Bartsch seufzte lautlos. Und fixierte jetzt endlich die roten Ziffern des Weckers: sechs zu zehn. Meistens gewannen die Minuten, die waren ja auch in der Überzahl. Nur noch dreihundert Sekunden bis zum Aufstehen. Da blieb nicht mehr viel Zeit. Oder doch? Sie drehte sich auf die andere Seite, zum höhlenwarmen Körper neben ihr. Mirko Fink war wach und, ja, blinzelte ihr etwas entgegen. S-O-S? Nein. Dreimal kurz für »S«, okay, das stimmte, aber dann? Einmal kurz, das war ein »E«. Und abschließend: einmal lang, zweimal kurz, einmal lang – wenn das mal kein »X« war …
Karola grinste, stellte sich dumm und funkte einen anatomischen Rhythmus, ein visuelles Oktogon aus acht kurzen Augenaufschlägen zurück. Das Morsezeichen für »Irrtum«.
Mirko wechselte die Kommunikationsform. »Guten Morgen, geliebtes Karöttchen«, sagte er. Morgens war er oft ziemlich albern.
»Morgen, Morse-Mirko«, entgegnete Karola und formte einen Kussmund.
»Schlecht geträumt?«, fragte er, und ihr Lippenkreis platzte. Diese Frage wollte sie weder hören noch beantworten. Karola fuhr ihm mit der Hand durch seine dichten Locken, die sie immer an Merinoschafe erinnerten. »Hat Mann das gemerkt?«
»Deiner schon!« Mirko betonte das Possessivpronomen. »Du hast geächzt und gestöhnt wie Louis de Funès nach einem fast tödlichen Zusammentreffen mit Fantomas.«
Sie lächelte. »Ganz so lustig war’s nicht.«
Mirko drückte seinen Ellbogen in die Matratze, stützte den Kopf auf die Handfläche. Musterte sie neugierig. Ein bisschen wie ein Bernhardiner, dachte Karola. Sein täglicher Umgang mit sensiblen Hündchen musste ja irgendwann auf ihn abfärben. Vielleicht war aber auch diese Sensibilität der Grund dafür, warum Mirko Fink als einer der erfahrensten und besten Hundestaffel-Ausbilder der hessischen Polizei galt.
»Habt ihr denn einen neuen Fall?«, fragte er. »Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass diese Träume dich seit ein paar Monaten seltener heimsuchen.«
Das stimmte. Der Traum, der sie an den jungen Florian Funke gebunden hatte, jener Alp, der zu einem festen Bestandteil ihres Lebens geworden war, der war zwar noch nicht völlig verschwunden, seine Präsenz aber nur noch ein schwacher Schatten. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Schandfleckenprojektes – hundert Graffitis, gesprüht an für die Stadt Frankfurt beschämenden Plätzen – schenkte der Schlaf ihr endlich wieder traumlose Nächte. Karola wusste, dass sie dieses gute Gefühl erstens dem Umstand verdankte, dass sich Florians Leben endlich eingerenkt hatte – schließlich lebte er seinen gestalterischen Drang mittlerweile zur Zufriedenheit seiner Professoren an der Städelschule aus. Und zweitens Mirkos Geduld. Verständnis. Vertrauen: Er hatte sie nie mit Fragen bedrängt, ihre Alptraumzeit wie eine vorübergehende Krankheit ertragen. Und Karola getragen. Für genau dieses umarmende Schweigen liebte sie ihn.
Jetzt legte er seine Hand auf ihre Brust. Kräftig und warm.
Sie rutschte an ihn heran, knabberte an seinem Ohrläppchen. »Mirkoschatz?«, hauchte sie. »Machst du mir den Hund?«
Mirko antwortete mit einem Stöhnen und rückte näher. »Klar, meine Oberunterüberallkommissarin …«
»Nein, nein Liebster. Nicht so einen kleinen spritzigen Foxterrier, sondern …«
»Yep, alles, was du willst.«
»Wirklich alles?«, fragte sie.
»Ja«, flüsterte er und streichelte ihre Brustwarze.
Sie kicherte. Natürlich war er auf etwas ganz anderes aus als sie.
»Bitte den Bernhardiner!«, sagte Karola und kuschelte ihren monatlichen Schmerz ganz dicht an Mirkos Oberschenkel, verweilte dort für ein paar Herzschläge und sprang aus dem Bett. Als sie Mirkos enttäuschtes Gesicht sah, beugte sie sich hinab, strubbelte ihm die Wolle und grinste.
Tapfer kroch auch er aus dem Bett. »Bernhardiner, ausgerechnet. Die Lebensretter mit ihrem um den Hals gebundenen Fässchen.«
»Genau«, bestätigte sie und schlappte Richtung Bad.
Mirko dagegen trottete in die Küche. Das Lebenselixier für Karola Bartsch hieß nun mal Kaffee. Und der war in der Dose. Da brauchte er an diesem Morgen gar kein Fass aufzumachen.
***
Karsten ließ sich treiben. Kurz vor der Staustufe mit dem viereinhalb Meter hohen Walzenwehr nahm der begradigte, eingezwängte Fluss wieder Fahrt auf, fast so, als wollte er Anlauf nehmen, um die in sein Bett getriebene Schwelle besser überwinden zu können. Das Wasser war trübe, aber das war es fast immer, und so verdreckt wie in den siebziger Jahren war der Main schon lange nicht mehr, sondern immerhin so sauber, dass man sich gefahrlos darin erfrischen konnte. Man musste das Wasser von Papa Main ja nicht gleich zum Zähneputzen verwenden – obwohl Karsten Bartsch das auch schon gemacht hatte. Und die Kopfschmerzen am nächsten Tag waren damals wohl eher dem letzten Glas Äppler geschuldet, das wie immer eines zu viel war. Schon seltsam, dass H2O so ganz anders wirkte, wenn zwei oder drei Kohlenstoffatome zusätzlich mitspielten. Im Grunde war das Universum so einfach gestrickt wie die Farbtafeln im Baumarkt. Die Welt bestand aus rund hundert Farben: That’s it. Der Trick bestand in der Kombination dieser Elemente. Wahrscheinlich hatte Gott seine hundert Farben auf ein paar Würfel geklebt, in einen Becher gesteckt und sich sechs Tage lang köstlich über die Ergebnisse amüsiert.
Der Fluss zerrte an ihm. Ein Stück Treibholz, das es über die Wehrstufe zu wuchten galt. Und mit dem Hochwasser im Rücken war das nicht schwer: Die ganze letzte Augustwoche hatte Wetter-Petrus seine Kübel ausgekippt, die kleinen Bäche aus Spessart und Fichtelgebirge in Wildwasser verwandelt und so den trägen Main abgefüllt und angeschoben, dass man schon froh sein konnte, wenn die Uferwege trocken blieben.
Karsten stieß die Luft aus und schwamm Richtung Wildnis, vierhundert Meter Dschungel mitten in der Stadt, ausschließlich erreichbar mit Boot oder Badehose. Die Halbinsel war einer jener vergessenen Orte, die sich nur noch selten in Großstädten finden ließen: ein weißer Fleck auf Frankfurts Stadtplan. Ein Unort. Nicht einsehbar, nicht bewohnt, nicht für die Öffentlichkeit. Das Treiben und Wirken der Natur an diesem Ort wurde von den Stadtplanern toleriert, weniger aus Einsicht oder Naturschutzgründen, sondern weil das Stadtsäckel nicht ausreichend gefüllt war für einen fachgerechten Rückschnitt dieses naturnahen Auenwaldes zwischen Griesheim und Schwanheim.
Karsten Bartsch war froh darüber. Genoss das Privileg, sich in sommerlicher Hektik eine kleine Auszeit auf dem zu gönnen, was er »seine« Insel nannte. Robinson mit Rückfahrticket, Freiheit für ein rares Stündchen.
Er tauchte unter einem ins Wasser hängenden Vorhang aus silbernen Weidenblättern hindurch, ertastete das Ufer und kletterte durch eine Lücke des aus uralten Sandsteinblöcken gebauten Inselfundamentes an Land. Unter dem Schattenhalbkreis der herabhängenden Äste wucherte die Vegetation weniger dicht als auf der Südseite der Insel, rings um den mächtigen Baumstamm hatten die Hochwasser vergangener Jahrzehnte die Kieselsteine des Mutterbettes freigelegt. Karsten wusste aus langer genießerischer Erfahrung, dass hier genau zu dieser Tageszeit ein Spot Nachmittagssonne durch die Lücke im Baumdach fiel und den Boden wärmte. Er hockte sich hin, legte die langen Arme wie einen Ring um die angezogenen Knie und starrte durch die Blätter hindurch auf das lehmbraune Wasser des Mains.
Wenn der Wind die Backen dick machte, funkelten die Wellen im Nachmittagslicht wie Rubine zwischen dem Weidenvorhang. Heute hatte der Fluss dagegen hochwasserfestes Rouge aufgelegt. Bartsch musste an seinen Lieblingssatz aus der Odyssee denken: »Segelnd auf weindunklem Meer hin zu Menschen anderer Sprache.« Nicht, dass er Homer gelesen hätte, abgesehen von der Reader’s-Digest-Version der »Sagen des klassischen Altertums« vom alten Schwab. Nein, Bartsch kannte das Zitat vom Eisernen Steg her, der beliebten Frankfurter Brücke über den Main. Dort hatte in den Neunzigern der Mühlheimer Künstler Hagen Bonifer diesen Satz hingebildhauert – in griechischen Buchstaben. Das hatte Karsten damals genervt, bis er die Übersetzung raushatte: Segelnd auf weindunklem Meer hin zu Menschen anderer Sprache. Als Ebbelwoi-Trinker wurde das sofort zu seinem Lieblingszitat. Und dem einzigen, das er kannte von Homer. Jedenfalls passte der Spruch ganz wunderbar als literarischer Brückenschlag, wenn die Spaziergänger über den Eisernen Steg von Hibbdebach nach Dribbdebach flanierten. Oder – wohl auch näher an der eigentlichen künstlerischen Intention – als weltoffener Gruß an die Touristen aus aller Herren und Frauen Länder. Aufpolierung des Images: Bankfurt, das Mainhatten in Hessen, hatte lange genug unter einem schlechten Ruf gelitten.
Karsten blinzelte im vormittäglichen Sonnenspot. Genau so schimmerte die dunkle Brühe des Flusses heute: wie dünner Rotwein. Und genau so, wie Odysseus sich an fremden Ufern gefühlt haben musste, so fühlte sich der Ex-Drogenfahnder und ehemalige verdeckte Ermittler Karsten Bartsch. Hier auf dieser versteckten Insel im Großstadtdschungel.
Er nickte dem funkelnden Schwanken des Wassers zu und schloss die Augen, lauschte den sich abwechselnden Geräuschen: links das Grollen der stürzenden Endloskaskade am Wehr, weit weg die startenden Flugzeuge im Süden Frankfurts. Am gegenüberliegenden Ufer der blubbernde Motor einer Möchtegern-Yacht der Griesheimer Wassersportfreunde. Und ganz nah, ganz leise, das Klatschen eines Fisches im Wasser. Ein Springen und Plätschern. Doch kein Fisch? Dann Schmatzen, Schnalzen, Schnurren. Ein vorwitziger Kormoran? Karsten unterdrückte den Impuls, die Augen zu öffnen. Mit den Ohren wollte er das Wesen identifizieren – so wie es sich für einen Orni gehörte. Karsten war schließlich nicht nur ehemaliger Bulle, sondern auch Vogelliebhaber seit der Kindheit, seit seinem ersten Wellensittich namens Trolli. Und ornithologische Ohren musste man stets schulen, schließlich sah man nur selten die kleinen Singvögel im Gebüsch. Des Birders Lauscher waren seine wichtigsten Werkzeuge, und wie jedes Werkzeug galt es, sie regelmäßig zu schärfen. Am lebenden Objekt natürlich. Also, welcher gottverdammte Vogel war das? Karsten hörte ein nasales Trompeten, ein Knarzen und Muhen, ein anschwellendes … Wiehern?
Gänse, dachte er. Irgendwelche blöden Gänse.
Dann wieder ganz nah: ein Knirschen, Hopsen, Watscheln. Das Tier schien an Land gesprungen zu sein. Doch kein Vogel? Vielleicht ja ein Nutria, das Wasserschwein am Main? Oder gar ein Biber? Was auch immer, das Viech kam direkt auf ihn zu. Unmöglich konnte Bartsch die Augen jetzt noch länger verschließen.
Er machte sie auf und blickte in das Gesicht von Zorro. Dem Zorro unter den Tieren. Keine zwei Meter vor ihm stand ein Pinguin und musterte ihn mit einem unübersehbaren Grinsen zwischen dem Schnabel.
Es schien so, als hätte Robinson Bartsch seinen Freitag gefunden.
2
Franz Komtschewski rieb sich die wenigen verbliebenen Haarstängel auf dem rundlichen Schädel. Normalerweise hatte er nichts gegen Leichen, schließlich bezahlten sie seine Miete, waren sein täglich Brot. Aber ausgerechnet hier? Warum wurden die Toten nicht auch mal im Bankenviertel entsorgt oder wenigstens im Nordend? Bis auf etwas Blitzgewitter und Medienrummel wären die Auswirkungen dort eher gering. Passierte so etwas aber hier in einem der sozialen Brennpunkte, dann hieß es gleich: »Musste ja so kommen.« Und zukünftige Investitionen wurden wieder in »sicheren« Vierteln getätigt.
Komtschewski taxierte das, was er vom Toten sah. Viel war’s nicht. Ja, ganz eindeutig ein Rückschlag in der öffentlichen Wahrnehmung des Viertels. Seines Viertels, des Bahnhof-»Quartiers«, wie man jetzt sagte. Ein Kapitalverbrechen gerade in dieser Phase urbaner Entwicklung gab knisternden Brennstoff für die Lobbyisten, die das ganze Gebiet inklusive Bewohner am liebsten abreißen, platt planieren und mit modernen Eigentumswohnungen à la Osthafen aufwerten wollten. Schon klar, was die Spekulanten dabei unter »Aufwertung« verstanden.
»Chef, sollen wir anfangen?«, holte ihn ein junger Mann aus seinen Gedanken, der plötzlich wie aus dem Pflaster gewachsen neben ihm stand und eine Handkamera vor sich hertrug.
Komtschewski quälte sich ein Lächeln ab. »Jaja, aber erst mal nur sichern und dokumentieren. Mit dem Toten warten wir noch, bis sich die Damen und Herren aus dem Präsidium herbemüht haben. Sonst haben wir nachher wieder alles falsch gemacht.«
»Jawoll«, antwortete der Kerl etwas zu zackig. Komtschewski konnte sich nicht an den Namen erinnern. Irgendwas Nordisches. Ein Wikingername, der zu diesem blonden Typen sogar passte. Thor? Nein, verflucht. Wurde er schon senil und vergesslich? »Aber bitte«, sagte er, »sperr zuerst den Fundort ab! Hier rennen ja Hinz und Kunz rum.«
Sein neuer Mitarbeiter mit Kamera und nordländisch klingendem Namen – vielleicht Sven? – nickte. Zumindest sah sein Kopfwackeln für Franz Komtschewski, den obersten Leiter der kriminalistischen Spurensicherung in Frankfurt, so aus.
Nur Fundort oder auch Tatort?, fragte er sich. Normalerweise folgte er stur seiner Routine, beschränkte sich aufs Handwerk und überließ die eigentliche Ermittlung den Frauen und Männern der Mordkommission. Normalerweise. Aber hier ging es eben um sein Viertel.
Missmutig starrte er auf die mit den Sohlen zum Frankfurter Morgenhimmel zeigenden Wanderschuhe des Toten. Auf die braunen Socken und die helle Hautfarbe des Unterbeins. Mehr gab’s nicht zu sehen, der Rest des Torsos versteckte sich unter Wasser. Reizend, ganz reizend. In seiner Verdopplung durch das Spiegelbild fast irreal. Oder surreal. Oder subreal.
Franz Komtschewski hasste Spiegel. Und dieses spezielle Spiegelbild ohnehin: ein Kleeblatt aus Männerbeinen. Den restlichen Körper verbarg eine Blechtonne, die so verbeult aussah, als würde sie schon seit der Gründung der Stadt hier herumstehen.
»Hmmm«, brummte er.
Bis zum Rand war die Tonne mit Wasser gefüllt, etwa einen Meter über ihr endete ein Regenrohr. Wozu brauchten die denn im Rotlichtviertel Regenwasser? In welchem Film spielte er hier eigentlich mit? Er kniete sich hin, legte die zur Faust geformten Finger auf den Boden direkt neben der Tonne. Die Erde war feucht, das Wasser musste übergelaufen sein, als der Körper hineingelegt worden war. Oder hineingefallen war? Komtschewski zuckte mit den Schultern. Was, wenn der Mann aus Versehen … einfach besoffen, den Kopf in das Wasser stecken, um wieder nüchtern zu werden, und zack … Vielleicht ist dem auch die Brille von der Fuselnase ins Wasser gerutscht. Beim Fischen in der Tonne verliert der das Gleichgewicht und kopfüber, plumps, in die Röhre gerutscht. So was war ja schon oft genug vorgekommen. Dann wär’s ein Unfall gewesen.
Quatsch. Wahrscheinlichkeit ging anders.
Komtschewski stand wieder auf und reckte sich, ignorierte den bedenklich knackenden Rücken. Wer wohl die Polizei gerufen hatte? Und hatte eigentlich schon jemand den Tod des Mannes offiziell festgestellt? Was – zum Henker – wenn der Typ noch gelebt hatte, als die ersten Schupos hier eintrafen?
Komtschewski unterdrückte das starke Bedürfnis, den Mann sofort und unter Missachtung sämtlicher kriminaltechnischer Maßnahmen aus seinem nassen runden Blechsarg zu zerren. Stattdessen beugte er sich über die Tonne und legte seinen handschuhbeschützten Zeige- und Mittelfinger auf die linke Wade, oberhalb des Knöchels. Fühlte natürlich keinen Puls, fühlte nur nasse, kalte Haut. Und ein Ziehen im Bauch.
Eine schwere Hand legte sich auf seinen Rücken. Komtschewski keuchte erschrocken und fuhr herum. »Mann, Günter. Musst du dich so anschleichen?«
Günter Lambrecht, Chef der Frankfurter Gerichtsmedizin, stand da wie ein vergessener Osterhase und zwinkerte ihm vertraulich zu. »Bist doch sonst nicht so schreckhaft«, meinte er und klopfte Komtschewski beruhigend auf die Schulter. »Hast du was ausgefressen?«
»Von wegen. Und was machst du hier? Kannst es nicht erwarten, mal wieder an ’ner Leiche herumzuschnippeln? Jetzt kommen die Corpi nicht zu dir, sondern du zu ihnen?«
»I wo. Karola hat mich informiert – morgens eine App und der Tag ist dein Depp! Da ich seit ein paar Wochen mit der Bahn zur Arbeit fahre, liegt das hier praktisch auf dem Wege. Solltest du auch machen.«
»Was denn?«, knurrte Komtschewski, der sich immer noch über seine Schreckhaftigkeit ärgerte. »App-Deppen? Der Spruch mit ›Joint‹ und ›Freund‹ ist mir lieber.«
»Mit der Bahn fahren. Schneller und entspannter. Übrigens wird dein Tatort gerade verunreinigt …«
Komtschewski folgte mit den Augen Lambrechts ausgestrecktem Zeigefinger. Fühlte sich plötzlich sehr alt und ausgelaugt. Manchmal schaffte ihn das Leben aber so was von: Ein Dutzend Japaner, vielleicht waren’s auch Chinesen, stürmte gerade den Hinterhof des Bordells. Einzelne Satzfetzen verstand er sogar auf diese Entfernung: »This is a typical redhouse in Frankfurt downtown« und »The source of sex and sin«. Bevor noch einer der Schutzpolizisten, Lambrecht, Komtschewski oder der Kameraträger reagieren konnten, tapste einer dieser Touristen dicht an die missbrauchte Regentonne heran, betrachtete die dort steckenden Beine und sagte mit hoher Fistelstimme: »Ah, you ale doing a new ›Tatolt‹ movie hele. This is vely intelesting. Ale you an actol? May I take a pictule with you?«
Komtschewski spitzte die Lippen wie ein junger Kuckuck. Sollte er lachen? Sollte er weinen? Nein, einfach fluchen: »No, never ever! Verpiss you and make you from the Acker! Ich glaub’s ja nicht. Warum ist dieser Fundort immer noch nicht abgesichert? Wo sind wir denn hier? Hey, schrecklicher Sven, oder wie immer du heißt, mach dich gefälligst mal nützlich! Zum Teufel und Beelzebub! Wie soll ich … Ah, na endlich. Da kommt ja auch das Dreamteam von der Moko. Morgen, Fräulein Ahrens, Morgen, Herr Holzmann! Und, wo bleibt die Chefin?«
***
Karola Bartsch trat in die Pedale. Die Wolken hatten sich verzogen, die Sonne spielte wieder mit Lust Spätsommer. Konrad Gisselberg – Faktotum kurz vor der Rente, der meist Telefondienst und Bereitschaft für die dritte Mordkommission übernahm – hatte den Anruf kurz vor neun durchgestellt: Leichenfund im Rotlichtviertel. Das roch nach Schlagzeilen in der Boulevardpresse und viel Stress.
Karola sauste auf zwei Rädern durch die Stadt. Vom Präsidium aus fuhr sie Richtung Zentrum, durchquerte den winzigen Holzhausenpark mit seinem barocken Wasserschlösschen, lenkte ihren Chromhengst in den Oeder Weg und hügelabwärts bis zum Eschenheimer Tor. Sie querte die Kreuzung, tauchte in das herrlich dichte Grün der Bockenheimer Anlage ein, strampelte vorbei am Hilton samt künstlichem Teich, an dem manchmal Graureiher wie erstarrte Kunstobjekte nach Goldfischen zielten. In den Sechzigern war das hier der städtische, teilweise sogar nationale Treffpunkt der Drogenszene gewesen. Heute, im Zeitalter von Aids, dem gezähmten Monster, hatte sich das Drogenproblem verlagert, eher ins Private hinein. Obwohl gerade ihr Ziel, das Bahnhofsviertel, nach wie vor im kriminalsoziologischen Jargon als »sensibler Ort« eingestuft wurde. Wie wohl so ziemlich jedes Großstadt-Bahnhofsviertel dieser Erde.
Leicht keuchend erreichte Karola den Opernplatz mit seinem kreisrunden Lucae-Brunnen, einem Springbrunnen wie ein Degengriff mit Glocke, wobei der Strahl aus Wasser dem Stahl der Klinge entsprach. Hundertzwanzig Tonnen Reinersreuther edelgelber Granit. Frankfurt, die Bankenstadt der Superlative eben.
Weiter. Slalom um Touristen, Einkaufsbummler und Bänker. Fahrradfahrer wurden von den Behörden in der Fußgängerzone nicht gern gesehen, aber in den letzten Jahren meist toleriert. So nutzte auch Karola Zeil und Freßgass – die Achse des Wohlstands, die beiden beliebtesten Einkaufsstraßen der Mainstadt – für ihre Nord-Süd-Passage durch die Stadt.
Und außerdem, dachte sie lächelnd, war sie ja schließlich dienstlich unterwegs. Blaulicht auf dem Fahrrad, das hätte schon was.
Auf Florian Funkes Rad übrigens. Ein Geschenk an Karola und seine Art, Danke zu sagen, vor allem aber: »Es ist gut so, wie es ist: Unser gemeinsamer Alptraum ist zu Ende.« Das abgeschlossene Schandfleckenprojekt setzte Punkt und Ausrufezeichen hinter ihr altes Leben – das neue wartete bereits.
Auf sie beide.
Fliegend, fast beschwingt, radelte Karola Bartsch durch die Frankfurter Straßen. Genoss den Moment, die Fahrt auf dem Drahtesel, den schönen Tag Anfang September. Passierte ihr selten genug. Viel öfter rutschte ihre waagschalige Balance zwischen Work und Life dauerhaft auf die Seite der Arbeit. Eigentlich seit sie zur damals jüngsten Leiterin der Kriminalinspektion 03-10 ernannt worden war. Oder doch schon vorher, als sie auf den Spuren ihres großen Bruders wandelte und die Ausbildung bei der Polizei begann?
Egal.
Karola musste scharf bremsen, das Hinterrad rutschte rechts an ihr vorbei, ein halber Dreher und nur knapp konnte sie den Sturz auf das Frankfurter Pflaster verhindern. Sie sprang vom Sattel. Der Typ war plötzlich und ohne vom Smartphone aufzublicken aus dem Schatten des Schiller-Denkmals in der Taunusanlage getreten. Kopfschüttelnd schaute er Karola an und hastete weiter, die Augen schon wieder am Handy klebend.
Der grün angelaufene Bronze-Schiller von 1864 blickte stoisch-heroisch in die Ferne.
Arschlöcher, dachte die Kommissarin. Beide.
Und sagte gleich drauf Sorry, weil die Rechtslage eindeutig war: Sie durfte hier nicht fahren, er jedoch hatte alles Recht der Welt, sich seine Whatsapp-Nachrichten oder die neusten Internet-Meme auf dem Weg zur Arbeit anzusehen. Karola schüttelte den Kopf. Über sich selbst und die Welt.
Schiller stand immer noch da. Auf den wuchtigen Sandsteinsockel hatte jemand ein Graffiti gesprüht, das einen auf den Kopf gestellten Dichterfürsten zeigte mit der Unterschrift »put this clown … upside down«. Karola grinste und gab sich grünes Licht. Hievte sich zurück in den Sattel und fuhr weiter – die Finger jetzt sicherheitshalber noch enger an der Handbremse –, bis sie endlich die Kaiserstraße erreichte. Wahrlich ein nobler Name für das Puffzimmer der Region, das Tor zum Rotlichtviertel. Die Politiker wurden nicht müde zu betonen, dass es im Bahnhofsquartier im Vergleich zu früher viel gesitteter zuging. »Geregelter Verkehr«, witzelten ein paar Mandatsträger. Sogar Führungen für Touristen gab es hier mittlerweile, inklusive einem voyeuristischen Besuch im gerade angesagten Puff – samt Verhaltenskodex: »Bitte nur gucken, nichts anfassen!« Selbst einen eigenen Eintrag auf Wikipedia hatte sich das Frankfurter Rotlichtviertel mittlerweile ergattert.
Wie großartig, furchtbar und unglaublich die Vernetzung der Welt war, überlegte Karola, die Informationsflut und ständige Erreichbarkeit. Der Polizeipräsident schimpfte seit Jahren mit Karola, weil sie keinen Facebook-Account und keine Twitter-Seite hatte. Verrückter WeltWeiterWitz.
Egal. Zumindest hatte sich das Bahnhofsviertel gemausert. Und die Mieten waren – natürlich – gestiegen.
Frankfurt, dachte die Kommissarin seufzend, verdient eben an allem doppelt. Schießereien gab’s hier höchstens noch ein-, zweimal im Jahr. Eine Leiche hatten sie dort schon ewig nicht mehr gesehen.
Karola machte sich an den Endspurt und suchte den Horizont. Der Himmel war blau, die Sonne wärmte, aber der Wind blies schon herbstlich durch die Häuserschluchten. Sie flitzte durch die Straße, dann sah sie endlich das leuchtend rote Herz an der Hausfassade kleben. Das elektrische Licht pulsierte in den Leuchtröhren und verhieß Lebendigkeit, Lust und Erfüllung. Aber keiner, der hierherkam, suchte nach Liebe.
Die gab es nämlich nur umsonst.
***
Die üblichen Verdächtigen begrüßten Karsten Bartsch johlend. Immerhin rutschte der, noch in Badehose und triefend vor Nässe, über die Dielen der »Strandfurt« und fuchtelte mit den Armen. War die versteckte Insel im Main sein Rückzugsort, war die Strandfurt sein Leben. Abgesehen von seiner privaten Ebbelwoi-Kelterei, die er nebenan betrieb. Nach Karstens unfreiwilligem Ausscheiden bei der Frankfurter Kripo hatte er sich tatsächlich als Treibholz gefühlt, das ohne Richtung den Lebensfluss hinabtrudelte. Er hatte sich eingeschweißt in alten Schmerz, hatte zu viel gesoffen, war mit steigender Geschwindigkeit Richtung Sozialer-Abstieg-Wasserfall getrieben, hinter dem ein Abgrund aus Armut und Suizid wartete. Erst kurz vor Schluss hatte er den Anker werfen können. Einen Anker in Form dieser Hütte hier, der Strandfurt: einer Mischung aus Kiosk, Kneipe und Sozialstation für gescheiterte Existenzen und Drogis.
Karsten Bartsch tapste, Fußspuren aus Mainwasser und Sand hinterlassend, auf die Theke zu.
Claydermann sprang auf und nestelte an seiner Fliege: »Kasti, kann ich dich mal was fragen?«
»Später, Pianist, erst muss ich euch was erzählen.«
»Nämlich?«, fragte Claydermann schüchtern. Natürlich war das nicht sein richtiger Name. Den kannte hier keiner.
»Gleich.« Karsten erreichte den Tresen, fischte Bembel und Geripptes hervor. »Vorher brauch ich ’nen Schluck.«
Seufzend ließ er sich an einem der runden Holztische nieder. Pressholz. Seine nasse Badehose quietschte. Karsten goss das Glas randvoll, schlürfte die ersten beiden Schlucke ab und fing an: »Ihr glaubt nicht, was ich gerade gesehen habe.« Er grinste über das ganze kantige Gesicht, leerte sein Glas, goss nach und hielt es in die kleine Runde.
»Mensch, Kasti, du machst es ja spannend«, empörte sich Claydermann.
»Mensch, Chef, du machst hier ja alles nass«, sagte Spotti lachend. Karstens Nummer eins der Strandfurt. Ein ehemaliger Hardcore-Abhängiger, auf den sich Karsten verlassen konnte wie auf niemanden sonst.
»Mensch, Leute, hört doch mal zu.« Karsten kannte seine Pappenheimer. »Es ist einfach unglaublich!«, setzte er nach.
»Ja, genau«, gab Spotti zurück. »Du bist einfach unglaublich.« Er kratzte sich an seiner vernarbten Wange – übermäßiger Meth-Konsum hinterließ eben Spuren. Tiefe Spuren.
»Im Main schwimmt …«, sagte Karsten unbeirrt und machte eine theatralische Pause. Blickte seinen Freunden ins Gesicht. »Ein Pinguin«, ließ er endlich die Katze oder eben den Vogel aus dem Sack. Und rülpste. »Wahrscheinlich ist’s ein Humboldt-Pinguin.«
Quatsch, dachte Spotti und schaute zum Spiegel über der Bar. Betrachtete sein bleiches, vernarbtes Gesicht.
»Du spinnst«, kommentierte Claydermann. »Eher verwandelt sich das Mainwasser in einen Blauen Portugieser.«
»Das auch, mein lieber Piano-Man.« Karsten kicherte und füllte Glas Nummer drei. »Kannste sogar auf dem Eisernen Steg nachlesen: Auf weindunklem Wasser hin zu Vögeln völlig anderer Sprache«, intonierte er mit seinem besten Vibrato-Bariton.
Jetzt ist er völlig übergeschnappt, dachte Spotti, sieht keine weißen Mäuse, aber Pinguine im Main. Einen noch dümmeren Spruch konnte selbst Kasti nicht mehr bringen.
Aber er schaffte es locker.
»Wir müssen ihn fangen«, sagte Karsten Bartsch.
3
Karola schloss ihr Rad an und betrat den Hinterhof des Bordells. Charlotte und Jannik aus ihrem Team waren schon da – gut. Außerdem Günter Lambrecht, der Gerichtsmediziner, und Komtschewski mit seiner Truppe. Der Leiter der Spusi hatte ein hochrotes Gesicht, und Karola wusste sofort, dass heute nicht sein Tag war.
»Na so was«, knurrte er und kratzte an einsamen Haarstängeln herum. »Dann können wir ja endlich unseren Job erledigen. Auf den Staatsanwalt warte ich jedenfalls nicht mehr.«
»Morgen, Franz. Morgen, Dr. Lambrecht«, sagte Karola betont freundlich und winkte ihren direkten Mitarbeitern ein Hallo zu. »Mit Wollbricht habe ich bereits telefoniert. Er lässt sich entschuldigen und wartet auf unseren Bericht.«
»Auf den deinigen, meinst du wohl«, blaffte der Spusi-Chef.
Wer oder was, fragte sich Karola, ist unserem Kommt-Chef-auf-Ski wohl über die Leber getrampelt? »Warum so ungehalten, lieber Franz?«, formulierte sie diplomatischer.
»Warum? Na, siehst du das nicht?«
Karola blickte sich um. Der Hinterhof war zu beiden Seiten von unverputzten Hauswänden begrenzt, die Rückseite von einer löchrigen Bretterwand abgeschirmt. Dahinter versteckten sich ein paar sommermüde Ligustersträucher und – die Kommissarin staunte nicht schlecht – ein kleiner Garten mit Schnittblumen und Tomaten. In der Ecke stand eine Regentonne, darüber ein Abflussrohr. Und aus der mit Wasser bis zum Rand gefüllten Tonne ragten zwei Menschenbeine, offensichtlich männliche. An der Hauswand des Bordells eine offene Tür, die ins Treppenhaus des Etablissements führte. Dort drängte sich ein halbes Dutzend Personen – wie es aussah, die Damen des Hauses und ein paar Ganovengesichter im Sonntagsanzug. Die ganze Bande glotzte zu ihnen herüber. Einige hatten sogar ihr Smartphone gezückt und machten damit – Karola zuckte zusammen – Foto- oder, noch schlimmer, Filmaufnahmen.
»Der Tatort ist nicht gesichert«, sagte sie lapidar.
Komtschewski schlug die Hände zusammen und murmelte ein Halleluja. »Wenigstens eine Person mit Verstand.« Mit diesen Worten drehte er sich um, schnappte sich das rot-weiße Absperrband und holte die versäumte Arbeit eigenhändig nach.
Karola wandte sich an Jannik. »Kannst du bitte die Personalien unserer Zuschauer aufnehmen und die üblichen Fragen stellen?«
»Na, ob die mit uns reden wollen …« Kriminalkommissar Jannik Holzmann hatte da so seine Zweifel.
»Deshalb schicke ich ja dich«, erklärte Karola. Jannik sah aus ihrer ganzen Truppe noch am harmlosesten aus.
»Schon gut, Karo.« Nach einer Pause fügte Jannik hinzu: »Wir sind auch gerade erst angekommen und mussten eine Gruppe asiatischer Touristen verjagen, die das hier für einen Drehort hielten.«
»Drehort, schön wär’s«, antwortete Karola. »Mir dreht sich auch schon alles. Apropos: Überwachungskameras?«
»Leider nicht. Was hier draußen hängt, sind alles Attrappen.«
»Wäre ja auch zu schön gewesen. Egal. Habt ihr schon mit diesem Radu gesprochen?«
»Der, der die Polizei informiert hat?«
»Exakt. Laut Gisselberg kennt dieser Mensch sich aus. Hat nicht einfach die 110 gewählt, sondern gleich die Durchwahl des zuständigen Kommissariats. Woher auch immer er die hatte …«
Jannik gestattete sich ein Lächeln. »Vielleicht ist das ja ein alter Bekannter. Wir kümmern uns darum.«
Karola nickte: Ja, tut das. Wie erwartet begleitete Lotte ihren schüchternen Holzmann zur Zeugenbefragung. Fehlt nur noch, dass sie sich bei ihm unterhakt, dachte Karola. Irritiert wandte sie sich wieder an den Chef der Spurensicherung, der sein Absperrwerk vollendet hatte.
»Um alles muss man sich selbst kümmern«, maulte Komtschewski und zwängte sich in einen der Tyvek-Anzüge, unter den Kollegen auch Ganzkörperkondome genannt. Oder Schlachterschürzen. Bullen hatten schon einen seltsamen Sinn für Humor.
»Hier!«, brummte Komtschewski. »Wenn ihr zugucken wollt, rein in die Füßlinge.« Er hielt Karola und Dr. Lambrecht zwei Paar Plastikpantoffeln vor die Nasen. »Und für die Hände natürlich auch Schuhe!«, ergänzte er übellaunig.
Der Gerichtsmediziner Lambrecht griff zu. »Mensch, Franz. Hast du deine Tage, oder was?«
»Und wieso bist du eigentlich hier?«, versuchte es Karola mit einem Themenwechsel. »Die Dokumentation am Fundort übernimmt doch normalerweise dein Team. Der oberste Spusi-Chef hat doch keine Zeit für derartige Feldarbeit.«
»Jaja. War die Idee vom alten Gisselberg. Die erste Grippewelle des Jahres hat meine halbe Belegschaft erwischt, und ich wohn ja um die Ecke.«
»Du wohnst hier?«, staunte Karola.
»Dank meiner Eltern.«
»Du hast Eltern?«
»Willst du die Geschichte hören oder nur Witzchen machen?«
»Schieß los!«
»Dafür seid doch ihr zuständig.« Komtschewski grunzte. »Also, wegen der Wohnung … Meine Eltern sind alte Frankfurter, so wie ich. Damals konntest du noch mit achtundfünfzig oder so in den Vorruhestand gehen. Und Immobilien hießen da noch Eigenheime. Jedenfalls, die haben ihre Moneten zusammengekratzt und sich auf die Suche gemacht. Noch per Zeitungsannonce, nix mit Makler oder immodigitalis dot com.«
Karola hoffte, dass Komtschewski bald zu Potte kommen würde.
»Jedenfalls Bornheim oder Nordend, das konnten sich meine werten Erzeuger nicht leisten. Da hätten noch meine eigenen ungeborenen Kinder bis ins nächste Jahrhundert abbezahlen müssen. Und damals waren die Zinsen bei den Banken ja eher was für Sparbuchanleger.«
»Franz«, drängte Karola. »Da steckt einer in der Tonne.«
»Du hast gefragt. Jedenfalls, in den seriösen Stadtvierteln war also nichts Bezahlbares zu finden, und das Bahnhofsviertel hatte damals zwar einen miesen Ruf, aber niedrige Quadratmeterpreise. Noch in D-Mark. Nicht zu verachten die Nähe zum Hauptbahnhof, meine Eltern, ja, das waren überzeugte Bahnfahrer.«
»Sympathisch«, warf Lambrecht ein, der interessiert zuhörte.
»Jaja. Und dann noch die urigen Kneipen, wo man ein gepflegtes Pils zu arbeiterfreundlichen Preisen zischen konnte. Ebbelwoi trank man hier weniger.«
»Und deshalb«, versuchte Karola ihn vorwärtszuführen, »haben sich deine Eltern hier zur Ruhe gesetzt?«
»Jepp. In einer Sechs-Zimmer-Altbauwohnung mit Balkon in der Kaiserstraße. Für das gleiche Geld würdest du heute hier kaum noch die Jahresmiete zahlen können.«
»Und dann?«, fragte Karola.
»Dann sind sie eingezogen.«
Komtschewski schwieg.
»Und?«, fragte Karola.
»Ei, dann haben sie es sich halt doch wieder anners überlegt und sind nach Mallorca. Ausgewandert. Die Wohnung haben sie vermietet. Damals reichte das noch, um sich die spanische Sonne leisten zu können.«
»Und warum genau sind sie aus Deutschland weg?«, hakte Karola nach, weil sie spürte, dass da noch etwas anderes hinter Komtschewskis Geschichte steckte.
Er zupfte an seinen Haarstängeln herum. »Das … erzähle ich vielleicht ein andermal. Hier wartet eine Wasserleiche auf uns.«
»Erst gackern und dann nicht legen«, nörgelte Doc Lambrecht.
Karola zuckte mit den Schultern und wollte gerade Komtschewski zur Tonne mit dem Toten folgen, als sie aus den Augenwinkeln eine Bewegung registrierte. Da stimmte etwas nicht. Lautes Lamentieren aus der Ecke, jetzt zornig werdend. Ein breitschultriger Kerl mit schmalem Spitzbart und rotseidenem Einstecktaschentuch gestikulierte viel zu dicht vor Lotte und Jannik herum.
Der hat sich nicht unter Kontrolle, dachte Karola. Im Hauseingang entdeckte sie die Umrisse eines weiteren Mannes, der die Szene im Hof zu beobachten schien, lauernd, nervös, auch nicht der ruhigste. Sie fragte sich nicht zum ersten Mal, warum sie regelmäßig zum Schießtraining ging, wenn sie ihre Heckler & Koch sowieso nie mitnahm.
Lotte deutete auf Karola. Der Bartträger blickte kalt und abschätzend zu ihr herüber. Karola erkannte Wut in seinen dunklen Augen. Der Typ gab sich einen Ruck und war mit ein paar schnellen Schritten bei ihr. Wütend, oh ja.
Shit, dachte Karola, als seine Hand in der ausgebeulten Innentasche des Jacketts verschwand. Das rote Seidentüchlein wackelte. Die Kommissarin spürte das Adrenalin durch ihren Körper fluten. Sie winkelte die Arme an.
Und erwartete den Angriff.
***
»Aber wenn ich’s euch doch sage: Da war ein Pinguin. Auf der Vogelinsel vor der Staustufe.«
»Wer’s glaubt«, meinte Spotti lapidar.
Immer noch saßen sie in der Strandfurt, blickten auf den Main und leerten den Bembel. Karsten Bartschs Erklärungsversuche waren bis jetzt so erfolglos gewesen wie Landungsversuche der NASA auf dem Pluto.
»Nein«, versuchte er es weiter. »Ja. Ihr wisst doch, ich schwimm da oft rüber. Und da hab ich ihn gesehen. Ein kleiner war’s. Also wohl kein Kaiserpinguin. Sondern eben ein Humboldt.«
»Oder einfach ein junger«, meinte Claydermann.
»Mensch, Kasti«, brummte Spotti und schüttelte den Kopf. »Der erste April ist doch schon lange vorbei.«
»Depp«, sagte Karsten.
»Und du weißt schon, dass Pinguine mehr so auf der südlichen Halbkugel leben?« Spotti kratzte sich an der vernarbten Wange. »Also mehr so ganz im Süden, im Süden vom Süden sozusagen.«
»Mensch, Leute«, fragte Karsten, »warum eigentlich so skeptisch?«
Spotti und Claydermann warfen sich einen wissenden Blick zu.
»Weil«, erklärte Spotti weise, »du uns erst vor ein paar Monaten verrückt gemacht hast mit deinem Wiedehopf, den du angeblich gesehen hast. Zwei Stunden sind wir durch den Uferschlamm gekrabbelt. Und was war? Dein vermeintlicher Exot entpuppte sich als ausgebüxtes Appenzeller Spitzhaubenhuhn vom Hellerhof.«
»Na ja«, druckste Karsten herum. »Aber geschwindelt habe ich nie!«
»Von wegen«, meldete sich jetzt Claydermann. »Du hast mir weisgemacht, dass mein, äh … also, dass der, der richtige Clayderman einer der größten lebenden Komponisten ist.«
Karsten hob die Hände. »Stimmt doch auch.«
Spotti brach in homerisches Gelächter aus und verschüttete ein paar Tropfen Apfelwein. Er wandte sich an den ehemaligen Konzertpianisten, der sein Lampenfieber zu lange mit Downern bekämpft hatte. »Echt jetzt? Du kanntest Richard Clayderman nicht? Das klingt jetzt noch unwahrscheinlicher als Kastis Pinguin. Das ist dein Spitzname, Mann!«
Karsten winkte ab. »Richard Clayderman ist ein wunderbarer Komponist, dessen Platten sich millionenfach verkauft haben.«
»Von wegen!« Claydermann schnaubte. »Nichts mit berühmter Musiker. Das war ein Schnulzenpianist, der kein einziges brauchbares Lied geschrieben hat. Im Radio sagte mal einer über den: ›Es gibt Frisöre, und es gibt Pianisten. Der Franzose Richard Clayderman ist ein Pianör.‹«
»Fies«, fand Spotti.
»Wer hat denn das behauptet?«, fragte Karsten nach.
»Die, ähm, also, die Griesheimer Mediathek.«
»Ich bin beeindruckt«, sagte Karsten. »Seit wann gehst du in die Bücherei?«
»Das heißt heute anders: Me-di-a-thek. Und eben nicht in die zentrale …« Claydermann suchte nach Worten.
»Sondern«, half Karsten freundlich aus.
»Sondern in die Stadtteil-Mediathek. Hier in Griesheim eben. Gleich hinter der S-Bahn-Station.«
»Wow.« Karsten Bartsch war wirklich überrascht. Las Claydermann jetzt etwa Bücher, oder interessierte ihn nur die Abteilung Audio? Oder hatte jemand dem unschuldigen Claydermann das mit seinem Vorbild gesteckt? Hier galt es mit Fingerspitzengefühl vorzugehen – schließlich kannte Karsten seine Strandfurter. Die erzählten am ehesten etwas, wenn man so tat, als interessierte einen das Thema einen Scheiß. Oder aber nach dem fünften Gerippten, insbesondere wenn es Karstens Selbstgekelterter war. Der schweigsame Claydermann – mit seinen schlotternden Gliedern die lebendig gewordene Franz-Liszt-Karikatur – hatte hier und heute schon mehr gesagt als die ganze letzte Woche.
Deshalb hakte Karsten nicht nach, sondern meinte nur: »Wir fangen den Vogel.«
»Häh?«, riefen Spotti und der Pianist simultan.
Bartsch sprang auf, huschte hinter die Theke und hämmerte auf die Tastatur seines Uraltcomputers. Seit ein paar Monaten hatte er endlich Highspeed-Internet, nachdem es die Telekom geschafft hatte, aus ihrem glasfaserigen Kraken ein winziges Ärmchen hinunter zu seiner Strandfurt wachsen zu lassen. Jetzt war er immerhin drin – und das schnell. Bei einem anderen, viel größeren Kraken tippte er die Worte »Lebendfalle« ein und studierte die präsentierten Suchergebnisse. Nur Maus- und Rattenfallen – und die waren eindeutig zu klein.
»Welches Tier ist größer als eine Ratte und lebt in Deutschland?«, rief er den beiden Freunden zu.
»Hund?«, antwortete Spotti.
»Katze?«, schlug Claydermann vor.
»Wo bleibt eure Phantasie, Leute?«, fragte Karsten. »Wir brauchen eine Falle für ein wildes Tier.«
»Wolf«, probierte es Spotti noch einmal.
»Wild…katze«, stotterte Claydermann.
»Na ja«, meinte Karsten, klickte die nächste Seite der Linklisten an und fand tatsächlich, was er suchte: »Leute, eine Waschbärenfalle! Das brauchen wir. Ich bestell das Ding, und wir fangen den Pinguin. Und dann werdet ihr mir glauben müssen.«
Spotti trat hinter Karsten und ließ sich die Falle zeigen: ein fast zwei Meter langer, kaum kniehoher Metallkäfig mit offenen Enden. In der Mitte wurde der Köder platziert, der auf einer Druckscheibe lag. Krabbelte ein Waschbär, Fuchs, Marder, Biber oder bei Gott ein Pinguin hinein und patschte nach dem Köder, fielen die Klappen. »Da kannste gleich noch ein Floß mitbestellen«, brummte Spotti. »Wie sollen wir das Trumm sonst auf die Insel kriegen?«
»Stimmt.« Karsten nickte. »Aber ein Boot wäre doch besser. Und ich kenn da jemanden, der mir bestimmt eins leiht.«
»Und ich besorg die Köder. Okay?«, fragte Claydermann.
Karsten nickte noch einmal. Der Pinguin musste gefangen werden. Wer wusste schon, von wo das Tier ausgebüxt war und wieso und warum. Klar, er konnte auch den Zoo anrufen. Aber ob die ihm glauben würden, stand auf einem anderen Blatt. Außerdem reizte Karsten die Jagd. Wie lange war es jetzt her, dass er auf der Pirsch gewesen war? Spuren suchen und Fallen stellen? Yeah, endlich wieder Jäger sein. Die Sache begann ihm – so schräg sie auch sein mochte – richtig Spaß zu machen. Vielleicht stimmte es ja: einmal Bulle, immer Bulle. Selbst wenn der Festgenommene nur ein watschelnder Zooflüchtling im schwarzen Frack sein mochte.
»Super.« Er hielt Claydermann den gehobenen Daumen hin.
»Und was fressen die am liebsten?«, fragte der.
»Fisch natürlich«, erklärte Karsten. »Kannst du welchen besorgen? Hier ist ein Zwanziger, müsste reichen.« Er öffnete sein Portemonnaie und drückte Claydermann den Schein in die Hand. Der sprang auf, griff sich das Geld und stürmte die Strandfurt hinaus.
»Was ist mit dem Vogel eigentlich los?«, fragte Spotti.
»Pinguin oder Claydermann?«
»Letzterer.«
»Mal schaun«, überlegte Karsten laut. »Wenn Frühling wäre, würde ich sagen, unser guter Claydermann hat seine romantischen Gefühle entdeckt.«
Reiner Marvin Spottke lachte heiser. Seine grauen Zahnstümpfe – auch sie Überbleibsel und Brandmal seiner Meth-Sucht – hüpften rauf und runter. Eine Art Trampolin.
»Wenn das wahr ist, fress ich den Fisch für den Pinguin selbst auf.«
»Die Wette gilt«, sagte Karsten. »Aber wahrscheinlich bringt Claydermann sowieso nur Thun in der Dose mit.«
»Für zwanzig Euro?«, grinste Spotti. »Du bist echt großzügig, Kasti.«
***
Keine zwei Meter vor ihr. Groß. Bedrohlich. Nah. Die Hand immer noch in der Innentasche des Jacketts. Karola hob die Hände schützend vors Gesicht, verlagerte ihr Gewicht auf ein Bein. Sollte sie sich nach links oder rechts werfen, um dem Schuss auszuweichen? Aus den Augenwinkeln nahm sie die anderen wahr. Auch sie hatten die Gefahr erkannt: Komtschewskis Mund stand so weit offen wie der gierige Höllenschlund, auf Lottes Gesicht las Karola eine Mischung aus Staunen und Spannung, Jannik griff seinerseits zeitlupenlangsam Richtung Achselhalfter, in dem er seine P30 trug.
Er wird, dachte Karola, das Ding nicht rechtzeitig ziehen können. Shit, shit, shit, sie würde den ersten Angriff allein bestehen müssen. Ihr Körper verwandelte sich in eine überspannte Feder, Muskulatur und Nerven bereit für den Impuls, die Spannung zu lösen und in blitzartige Bewegung umzusetzen.
In dem Sekundenbruchteil, in dem sich Karola zum Sprung entschied, zog der Mann, enervierend langsam, spöttisch, kontrolliert, seine Hand hervor, wickelte den herausgezogenen Kaugummi aus seiner Staniolpapierhülle, steckte sich das Ding in den Mund – und lächelte.
Der Mann hatte Nerven.
Als wäre nichts gewesen, reichte er der Kommissarin die Hand. »Ich bin Alexandru und hier für die Ordnung zuständig.«
Angenehme Stimme. Spöttische Augen.
»Meine Freunde nennen mich Andru.«
Karola schluckte und schlug ein. »Bartsch, Kripo Frankfurt, Herr …« Langsam kehrte das Blut in ihre Wangen zurück. Mehr fiel ihr im Moment nicht ein. Sie konnte ihn ja schlecht fragen, ob er, wenn er doch für die Sicherheit zuständig, auch für die Leiche in der Tonne verantwortlich war.
Zum Glück baute sich Lotte hinter dem Mann auf. »Das ist Herr Radu. Alexandru Radu. Der Geschäftsführer.«
Karola nickte und hielt dem Mann, etwas zu spät, ihre Dienstmarke hin. »Haben Sie die Polizei verständigt, Herr Radu?«
»Ja. Heute Morgen, kurz vor neun. Als wir den Toten in der Tonne fanden.«
»Gehört Ihnen dieses …« Karola suchte nach einem neutraleren Wort für Puff, Freudenhaus, Etablissement und entschied sich dann für das unverfängliche »Unternehmen«.
Der Mann zauderte. »Eigentümer vom ›Roten Herzen‹ ist Slobodan …« Er stockte.
Karola hakte nach: »Hat der Mann auch einen Nachnamen?«
»Slobodan Micek.«
»Und wo ist der?«
»Im Roten Herz.«
»Soso.« Die Hauptkommissarin blickte Alexandru Radu in die spöttischen Augen, bis er sie endlich niederschlug. Die Augen.
»Und warum, bitte schön«, fragte sie, »ist der Herr Micek nicht hier, wo die Kacke am Dampfen ist?«
Radu zögerte, fuhr sich über den Spitzbart. Sein Blick zuckte zum Türeingang. »Der … hat keine Zeit. Hat immer viel zu tun, verstehen Sie?«
Karola fixierte ihrerseits die Tür, aber der Schatten von vorhin war verschwunden. Sie wandte sich an Lotte: »Habt ihr schon mit diesem Micek gesprochen?«
»Nein«, antwortete Kriminalkommissarin Charlotte Ahrens, wie immer mit gefärbten Strähnchen in den kurzen Haaren. Diesmal in einem schillernden Blau. »Sollen wir?«
»Bitte.« Karola drehte sich wieder zu dem Gummibeißer. »Sie sagten eben: ›Wir‹ fanden den Toten in der Tonne. Wer genau ist dieses Wir?«
»Eva und Angel.«
Künstlernamen, dachte Karola. Das wird anstrengend. »Mit den beiden«, erklärte sie, »müssen wir auch sprechen.« Sie mussten mit allen sprechen, die etwas zu sagen hatten. Die etwas gesehen hatten. Selbst die Asiaten der Touristengruppe würden sie suchen müssen. Irgendjemand war immer dabei. Irgendeiner, irgendeine hatte immer etwas gesehen. Aber wer das im Einzelnen war, würden sie nur quälend langsam herausbekommen. Polizeiarbeit war manchmal langwieriger und langweiliger als ein Puzzle mit fünfzigtausend Teilen.
»Und jetzt, Herr Alexandru Radu, mal Klartext. Wir können nicht ausschließen, dass der Tote in Ihrer Regentonne einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist – nach einem Unfall sieht mir das keineswegs aus. Und wenn Sie nicht wollen, dass wir Ihren Laden für die Dauer der Untersuchung dichtmachen, sollten meine Kollegen alle und jede Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Habe ich mich deutlich ausgedrückt?«
Der Mann wechselte die Kauseite und blähte ungerührt die Backe: »Klaro«, schmatzte er. »Sie sind der Chef.«
Karola nickte. Du weißt ja gar nicht, dachte sie, wie recht du damit hast. Und wenn du nicht spurst, dann mache ich aus deinem rosaroten ein blutendes Herz. Gott, sie hasste diese Zuhältertypen.
Mit einem Ruck drehte sie sich zu Komtschewski, schnappte sich die Plastikpantoffeln, die der nach wie vor in seiner Hand hielt, und hakte sich bei ihm unter. »Komm, Schatzi«, sagte sie zu dem völlig verdutzten Leiter der Spurensicherung und zog ihn mit zur Tonne. »Lass uns an die Arbeit gehen.«
4
»Ei, isch glaab’s net, da beehrt misch doch glatt die Konkurrenz! Was führt disch denn her, Strandfurtler?« Der Wirt vom »Flachen Ball« legte den Kopf schief und beäugte misstrauisch den Kerl, der da – mit dem rechten Fuß die schmale Tür offen haltend – einen Bollerwagen mittenrein in die Kneipe zerrte. Auch die Trinkermannschaft am Stammtisch schielte neugierig herüber, ragte doch aus dem Wagen ein großes weißes, offensichtlich mit Flüssigkeit gefülltes Plastikfass hervor.
»Haste den ersten Mai verpennt oder schiebste jetzt Kindergartengören durch die Gegend?«, witzelte der Wirt.
»Weder noch.« Karsten Bartsch ächzte und streckte seine Hand über den rot-schwarz-weiß bemalten Tresen. »Grüß dich, Michi. Wie geht’s, wie steht’s?«
»Ei, wie’s ’nem ollen Wirt halt scho geht. Hier, am Arsch der Welt.«
»Jaja, unser kleiner Stadtteil bräuchte wirklich mal ’nen frischen Anstrich.«
Der Wirt grunzte. »Als ob’s damit getan wär. Mehr Kohle müsste her.«
»Stimmt. Aber nicht die aus den Griesheimer Alpen.«
»Ei nee, Gott bewahre.« Und nach einer Pause. »Willst ’n Pils?«
Karsten nickte und betrachtete die Pokalsammlung auf den Regalen. Vergoldete Aluminium-Imitate, die an die wichtigsten Erfolge der Frankfurter Eintracht erinnern sollten. Vielleicht kämen jetzt endlich auch mal wieder ein paar Pokale hinzu. Dazwischen entdeckte er das gerahmte Foto eines Steinadlers, der auf einer lederbehandschuhten Faust thronte und majestätisch, wie das Adler eben machten, seine Schwingen ausbreitete.
»Ist das der Attila?«, fragte Karsten.
»Ei freilisch. Cooles Foto, gell? Hab isch selbst gemacht.«
»Echt? Respekt.« Karsten trat näher und betrachtete das Bild genauer. Der Adler – offizielles Maskottchen des Frankfurter Fußballvereins – blickte stolz und gelassen zurück. Im Hintergrund war eine Holzvoliere zu erkennen, dahinter Kiefernstämme. »Das haste aber nicht im Waldstadion aufgenommen?«, fragte er den Wirt vom Flachen Ball.
Michi grunzte. »Nee, des war in der Fasanerie bei Hanau. Da zeischt der Attila manchmal seine Kunststücksche.«
»Kann der denn auch Fußball spielen?«
»Blödmann.« Michi schob ein frisch Gezapftes über den Tresen. »Bitte ’n bisschen mehr Respekt, gell!«
»Auf dein Wohl, Michi«, sagte Karsten und ließ seinen Adamsapfel hüpfen.
»Der Attila is ja noch net ma en Hesse«, meldete sich einer aus der stammtischenden Tafelrunde zu Wort.
»Na und?«, meinte sein Gegenüber. »Der Boateng ja aach net.«
Die Runde kicherte.
»Sondern?«, fragte Karsten nach.
»Ei, der iss in Bayern aus’m Ei geschlüpft. Irschendwo bei Nürnbersch.«
»Da hätt sich die Eintracht ja aach ne Kuckucksuhr als Maskottsche nehme könne …« Der dritte Stammtischler kicherte und machte einen runden Mund. Dafür erhielt er von seinem Nachbarn einen Stoß gegen die Seite. »Du Dummbabbler hast ja kaa Ahnung.«
»Der Attila ist mehr als e Maskottsche«, grunzte Michi. »Ohne den Adler wär die Eintracht schon längst wieder abgestiege. Des Tier hat was an sisch, das der Mannschaft, ei, wie soll isch sache, Mut und Zuversicht verleiht.«
»Schon möglich«, bemerkte Karsten. »Der Attila war ja so ’n Hunnenkrieger. Also beinahe ein Hesse. Das passt schon.«
»Genau«, bestätigte die Stammtischrunde mit sich hebenden Biergläsern. »Auf’n Attila! Auf die Hunne! Auf die Hesse!«
Glas klirrte, und Michi zapfte vorsorglich schon mal die nächste Runde. Er kannte den Durst seiner Stammmannschaft. Und wusste auch, dass bei denen jetzt die Zeit gekommen war, um Kristallkugelgedanken zum nächsten Bundesligaspiel auszutauschen.
»Ei, sach mal, Karsten, warum fährste denn jetzt mit dem ollen Bollerwagen durch die Gegend?«
»Hab schon gedacht, du fragst gar nicht mehr«, entgegnete der. »Das hier ist der erste frisch gekelterte Äppler der Saison!« Bartsch zwirbelte mit den Fingern und schnalzte genießerisch mit der Zunge. »Ein Gedicht, sag ich dir.«
»Aha«, meinte der Wirt. »Und warum schleppste das Zeusch hierher und säufst es net drübbe in der Strandfurt mit deine … äh … mit dene …«
»Weil ich dich um einen Gefallen bitten möchte.«
Sie schauten sich an. Attila auf dem Foto schaute die beiden an.
Das Stammtischtrio schaute lautstark in seine Glaskugeln.
»Ei so«, brummte Michi schließlich, »dann schieß mal los.«
»Du hast doch« begann Karsten vorsichtig, »noch dein Ruderboot im Yachthafen liegen?«
»Logo, des Bötsche is ja mein einzisches Vergnügen, des isch mir gönn, wenn isch hier mal rauskomm.«
»Und würdest du mir vielleicht dein, hm, Bötsche mal für ein paar Tage ausleihen?«
»Isch waas net. Was haste denn vor damit?«