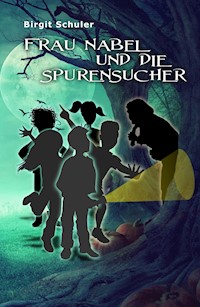
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tobias, Jane, Nele, Bertie und Hannes können sich über Langeweile im abgelegenen Dörfchen Friedenkirchen weiß Gott nicht beklagen. Wer hat die Bank an der Bushaltestelle zersägt? Wer schoss am frühen Morgen im Garten einer Nachbarin in den Spiegel? Ist das Lackieren eines Autos mit lila Farbe nur ein böser Streich? Als plötzlich Wertsachen im ganzen Dorf verschwinden, führen alle Hinweise auf den Friedhof. Hat die merkwürdige Frau, die im abseits gelegenen Häuschen eingezogen ist, etwas mit einem verborgenen Schatz zu tun? Und wer ist der mysteriöse Fremde hinter der Maske? Als schließlich ein Tatverdächtiger ins Labyrinth flieht, sind die Freunde in Gefahr … Wo kniffelige Fälle auf eine Lösung warten, sind das Spurensucherteam und auch ihre Freundin, die unerschrockene 78-jährige Frau Nabel, nicht weit! Bei der Suche nach dem Täter spitzt sich so manches Mal die Lage zu. Spannend, witzig und modern werden hier die Abenteuer von fünf Kindern, einer quirligen Dame und ihrem mit trockenem Humor gesegneten Freund erzählt. Auf Mord und Totschlag wird bewusst verzichtet, denn kleinere Delikte, die überall passieren können, sorgen für genug Aufregung und Nervenkitzel. In die Geschichten fließen aber auch Themen wie Achtsamkeit, Zusammenhalt, Naturschutz, Mitgefühl, soziales Engagement mit ein. So wird z. B. ein Gnadenhof bewohnbar gemacht oder von einem Schicksal erzählt, das sich durch Freundschaft und Hilfe leichter (er-)tragen lässt. Spannende lustige Geschichten für junge und jung gebliebene Krimifans ab 9 Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
BIRGIT SCHULER
***
FRAU NABEL UND DIE SPURENSUCHER
© 2019 Birgit Schuler
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7497-5348-2
e-Book:
978-3-7497-5370-3
Lektorat, Korrektorat: Gisela Polnik
Umschlaggestaltung: Christian Common
Illustrationen Innenteil: shutterstock.com, istockphoto.com
Bildmaterial Umschlag: Hintergrund: istockpho-to.com/de/foto/halloween-design; Silhouetten: stock.adobe.com
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Frau Nabel und die Schnecken – eine (un)gewöhnliche Frau stellt sich vor
Die zersägte Bank
Blattschuss im Gemüsebeet
Da ist was im Busch!
Sachverschönerung?
Der Weihnachtsdieb
Der Schatz von Friedenkirchen
Frau Nabel verreist
Zur Erinnerung an meine Urgroßtante Barbara Hirt Tante Bette – ich glaube, Frau Nabel würde dir gefallen.
Frau Nabel und die Schnecken – eine (un)gewöhnliche Frau stellt sich vor
An einem schönen Sommermorgen kniete Bernadette Nabel, 78 Jahre jung, um 6 Uhr in der Früh in ihrem Salatbeet und sammelte Schnecken in eine große Schüssel. Vorsichtig nahm sie jedes Tier hoch und setzte es genauso vorsichtig in dem Plastikgefäß ab. Dabei sprach sie leise und in beruhigendem Tonfall zu jeder einzelnen Schnecke. Merkwürdigerweise rollten sich die meisten Tiere nicht, wie gewöhnlich, in sich zusammen, sondern schienen die alte Dame mit ihren Stielaugen anzusehen und ihr aufmerksam zuzuhören. Es gab gar nicht so viele Schnecken in Frau Nabels Salatbeet. Und so stand die alte Dame schon recht bald auf, nahm die Schüssel und trug sie den Kiesweg entlang. Sie passierte Gemüsebeete, Kräutergarten, Blumengarten, Obstwiese, bis sie schließlich in eine vor sich hin wuchernde Wildnis, bestehend aus Büschen, Bäumen und Rasen, trat. Dort standen auch zwei Komposthaufen und bei einem davon setzte Frau Nabel die Schnecken wieder aus. Schnecken mögen Blätter, die nicht mehr ganz frisch sind.
„So, hier könnt ihr bleiben“, sagte sie mit warmer Stimme zu den Tieren, „hier ist euer Reich!“
Einen Moment sah sie zu, wie die Schnecken sich in ihrer neuen Umgebung orientierten, dann machte sie sich auf den Weg zurück zu ihrem kleinen Häuschen. Dabei rieb sie Daumen und Zeigefinger ihrer rechten Hand aneinander, um den Schneckenschleim abzurubbeln. Nie wäre Bernadette Nabel in den Sinn gekommen, einem Tier etwas zuleide zu tun oder in ihrem Garten Gift zu spritzen. Seit vielen Jahren lebte sie in trauter Gemeinschaft mit all den winzigen und auch größeren Wesen ihrer Umgebung und es hatte sich so ein natürliches Gleichgewicht eingestellt. Auch die Schnecken hatten über Jahre auf geheimnisvolle Weise verstanden, wo ihr Platz war, und nur selten fanden sich, wie heute, einige davon in Frau Nabels Salat. Warum das so war, darüber machte sich die alte Dame wenige Gedanken – es schien einfach ganz normal!
Im Haus wusch Bernadette die Schüssel aus, kochte sich Wasser für ihren Kaffee und setzte sich dann gemütlich vor das Fenster, von dem sie einen Blick auf die Straße hatte. Eine ganze Weile blätterte sie in der Zeitung, dann sah sie aus dem Augenwinkel Toby, den zehnjährigen Nachbarssohn, mit seiner Schultasche zur Bushaltestelle laufen. Im Vorbeigehen hob er lässig die Hand in Frau Nabels Richtung und Frau Nabel winkte genauso freundlich zurück und fuhr sich dann unwillkürlich mit der Hand durch die Haare. Erst kürzlich war sie beim Friseur gewesen und hatte sich ihre lange füllige, aber etwas eigenwillige Pracht, die sie immer zu einem festen Knoten gesteckt hatte, abschneiden lassen. Das Ergebnis war nicht unbedingt das, was Frau Nabel angestrebt hatte: Etwas wirr und unbändig standen ihr die weißen Haare nun vom Kopf ab. So war sie in etwas gedrückter Stimmung vom Friseur gekommen und hatte prompt Toby, der eigentlich Tobias hieß, getroffen.
„Oh“, hatte er nur gesagt und sie angestarrt.
„Ja, ich weiß“, hatte sie geanwortet. „Der Kopfgärtner hat mich wohl ziemlich verunstaltet, was?“
„Na ja“, hatte Toby zögerlich erwidert und nach Worten gesucht. Aber nachdem sie ihm aufmunternd zugenickt und ihn aufgefordert hatte, nur ehrlich seine Meinung zu sagen, hatte er ihr trocken zur Antwort gegeben: „Sieht aus wie ein geplatztes Sofakissen.“
Frau Nabel hatte es gelassen genommen und zu Hause einen alten Haarreif aus der Kommode rausgekramt und ihn in die wirren Locken geschoben. Dieser kleine Vorfall kam ihr nun in den Sinn und ließ sie ein wenig vor sich hin schmunzeln.
Frau Nabel und Toby verstanden sich gut. Auch wenn seine Freunde ihn manchmal fragten, warum er immer zu der Alten gehe. Er sagte dann, Frau Nabel sei nicht alt, nur zu früh geboren. Manchmal hatte er auch schon einen Freund zu ihr mitgenommen. Und danach hatte keiner von ihnen mehr Witze über sie gemacht, denn Frau Nabel konnte tolle Sachen erzählen und mit ihr konnte man jede Menge Spaß haben.
Tobias teilte auch Frau Nabels Liebe zu den Schnecken. Er verstand überhaupt nicht, dass so viele Leute sie nicht mochten. Sollten sie doch ihren Teil aus dem Garten haben, schließlich war das auch ihr Lebensraum und nicht nur der von den Menschen. Die Schnecken hatten doch genauso das Recht, hier zu sein, und ihren Platz auf dieser Welt. Und außerdem waren Schnecken unheimlich interessant. Und Tobias sagte das auch jedem, egal, ob er’s hören wollte oder nicht. Leider machten viele Leute Witze darüber oder reagierten mit Kopfschütteln. Aber Toby wusste es besser!
Eines Nachmittags war er bei Frau Nabel gewesen und hatte ihr ein wenig im Garten geholfen und sich so ein paar Euro verdient. Und damals hatte er dann so ganz nebenbei viel über die kriechenden Gartenbewohner erfahren. So wusste er jetzt zum Beispiel, dass es unheimlich viele verschiedene Arten von Schnecken auf der Erde gibt. Ganz, ganz winzige, die man kaum mit dem Auge sehen kann, und auch große, die sogar bis zu 75 cm lang sind, welche mit und welche ohne Häuser – aber das hatte er natürlich schon gewusst.
Schnecken sind alle langsam, aber das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Das wusste Tobias aus eigener Erfahrung, war er doch im letzten Jahr zu schnell mit dem Fahrrad gefahren und in einen Bauzaun gerauscht. Danach hatte er ins Krankenhaus gemusst und der Arm war wochenlang in Gips gekommen. Das hatte ziemlich wehgetan – und an die dummen Bemerkungen seiner Schulkameraden wollte Tobias schon gar nicht denken. Und der unfreundliche Nachbar, der zwei Häuser weiter wohnte und der nach Tobias Meinung zum Lachen in den Keller ging, hatte ihm groß und breit die Verkehrsregeln erklärt. Als wüsste er das alles nicht selbst!
Also, die Schnecken fand Tobias toll. Seitdem hatte er sich viel mit ihnen befasst und sie genau beobachtet. Er unterhielt sich gern mit Frau Nabel über die Tiere. Er wusste, dass man die Unterseite des Schneckenkörpers Sohle und den sichtbaren Körper, abgesehen vom Kopf, Fuß nennt – weil er eben ein bisschen wie ein Fuß aussieht und die Schnecke sich mit ihm fortbewegt. Schnecken bestehen also aus einem Kopf und einem Fuß. Die Augen einer Schnecke befinden sich vorne an den Stielen. Außerdem befinden sich vorn am Kopf noch zwei Fühler. Also insgesamt vier Fühler, zwei davon mit Augen. Das ist praktisch, sie können nämlich so die Augen viel besser bewegen als wir. Trotzdem können sie nicht so gut sehen. Sie verlassen sich vor allem auf ihre Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinne. Schnecken kriechen auf einem Schleimteppich, den sie selbst produzieren, deshalb sind sie auch so schleimig, das schützt sie vor Verletzungen. Der Schleim ist aber gar nicht so schlimm, wenn man sich mal getraut hat, ihn anzufassen. Man kann ihn zwischen den Fingern trocken rubbeln, dann geht er auch ganz leicht wieder ab. Mit Wasser funktioniert das nämlich nicht. Ganz toll sind die Zähne. Schnecken haben nämlich direkt an der Zunge unheimlich viele Zähne, mit denen sie ihre Nahrung raspeln. Wenn Schnecken Angst haben, dann ziehen sie sich in ihr Schneckenhaus zurück, falls sie eines haben. Ansonsten rollen sie sich zusammen. Die Schnecken können ihr Haus sogar verschließen – mit Schleim, na klar, mit was sonst. Viele Schnecken fressen Pflanzen, aber sie fressen oft auch Fleisch, Reste von toten Tieren zum Beispiel. Wenn Schnecken sich nicht wohlfühlen, wenn sie nicht genügend Nahrung finden oder das Wetter zu schlecht ist, dann schlafen sie sehr tief, so ähnlich wie in einem Winterschlaf. Dabei schlägt ihr Herz ganz langsam und sie verbrauchen nur wenig Sauerstoff. So können sie schlechte Zeiten überstehen. Das alles hatte Frau Nabel ihm erzählt.
„Die sind ganz schön anpassungsfähig“, hatte Toby gestaunt. „Ja, viel besser als wir Menschen“, hatte Frau Nabel geantwortet. Und sie hatten beide ein Gefühl von Hochachtung für die kleinen Kriechtiere verspürt.
Und seit Tobias so viel über Schnecken wusste, hatte er auch geholfen, sie zu beschützen. Zum Beispiel hob er immer Schnecken von der Straße auf, ganz vorsichtig, und setzte sie irgendwo aus, wo sie nicht in Gefahr waren, von einem Auto überfahren oder von einem Fußgänger zertreten zu werden. Außerdem bezeichnete er sich seit Neuestem als „Schneckenexperte“ und sammelte in den Gärten der Nachbarn Schnecken aus dem Gemüsegarten, trug sie dorthin, wo sie keinen Schaden anrichten konnten, und legte ihnen ein paar Blätter hin. Salatblätter, die seine Mutter aussortiert hatte, weil sie nicht mehr so schön waren zum Beispiel – natürlich nur von ungespritztem Salat –, solche essen Schnecken nämlich am liebsten, diese sind ihnen viel lieber als die ganz frischen. Manchmal brachte er ihnen auch ein Stück Champignon mit. Und beobachtete, wie die Schnecken erst daran rochen und sich dabei ihre Fühler aufgeregt in alle Richtungen bewegen.
Toby hatte natürlich noch andere Freunde in seinem Alter hier am Ort. Die Kinder lebten gern hier mitten in der Natur. Es gab jede Menge Abenteuerspielplätze in der Gegend: Große Gärten mit all ihren Bewohnern, Wildbäche, durch die man waten konnte, alte halbverfallene Scheunen, Wiesen mit Obstbäumen, auf die man klettern und wo man im Winter Schlitten fahren konnte, und dann noch die Umgebung der alten Burg mit dem sagenumwitterten Turm.
Friedenkirchen lag bzw. liegt in einer Senke zwischen Hügeln und Wäldern, es gab (und gibt immer noch) nur ein paar wenige Straßen, einen Tante-Emma-Laden, der aus einem Zimmer im Haus von Frau Wirth bestand. Hier konnte man das Allernötigste kaufen. Und was es nicht gab, konnte man fast immer bestellen. Der Laden diente den Bewohnern Friedenkirchens aber nicht nur dazu, ihre Vorräte aufzufüllen und ihre Brötchen zu kaufen, sondern vor allem dazu, Neuigkeiten aus der Umgebung auszutauschen. Und so etwas ist unglaublich wichtig für die Menschen in einem kleinen Dorf.
Es gab (und gibt immer noch) sogar einen winzigen Dorfplatz mit einer alten Eiche, einem Dorfbrunnen, einer Bushaltestelle mit Bank und einer alten, zugegebenermaßen sehr kleinen Kirche, nebst Pfarrhaus und dem kleinen alten Friedhof, die etwas höher lagen.
Und dann gab es, und gibt es wohl noch, die alte Burg. Sie liegt etwas abseits vom Dorf auf einem Hügel in einer kleinen Waldlichtung. Nur ein Feldweg führt hinauf. Die Bewohner, eine reiche Unternehmerfamilie – Zugezogene –, hielten sich genauso abseits vom Dorfleben wie ihre Burg. Natürlich führte das immer wieder zu wilden Spekulationen und zu reichlich Nahrung für Erzählungen, Mutmaßungen und Gerüchten. Wie es halt so ist!
Auch Bernadette Nabel war eigentlich eine Zugezogene. Allerdings wohnte sie schon sehr lange im Dorf, sodass sie inzwischen dazugehörte und sich selbst zu den Einheimischen zählte. Früher hatte sie in einem Antiquitätenladen ihren Lebensunterhalt verdient und dort alte Möbel, Bücher, Gemälde und auch manchmal Schmuck verkauft. Sie hatte diese Arbeit in dem kleinen Laden in der Nähe der Bad Emser Promenade geliebt. Liebevoll hatte sie jedes einzelne Stück verwaltet und gepflegt – abgestaubt, zurechtgerückt und die Kunden, oft Kurgäste, mit Fachverstand und noch mehr Herz bedient und beraten.
Ebenfalls zugezogen war Herr Singer, der weiter unten an der Hauptstraße wohnte. Herr Singer war früher Lehrer gewesen und stammte aus dem Schwabenland. Aber von dort war er, damals mit seiner jungen Ehefrau, schon zu Beginn seiner schulischen Laufbahn fortgezogen, ebenfalls in die Bad Emser Gegend. Als seine Frau Elisabeth jedoch unerwartet gestorben war, hatte er sich nach Friedenkirchen zurückgezogen. Und erst dort hatten sich der stille Witwer und die quirlige unverheiratete Frau Nabel kennengelernt und mit der Zeit angefreundet. Nun war Herr Singer – mit Vornamen Albert – längst pensioniert, und so hatte er sein einstiges Hobby ausgebaut: Er fertigte Holzarbeiten mit Verzierungen und schnitzte wundervolle Holzfiguren, die er manchmal sogar an Feriengäste verkaufte.
Darüber hinaus verschönerte er das Dorf mit seinen Werken: hier eine Gartenfigur, dort ein Zierstück für ein Haus, eine Gartenbank oder ein verziertes Gartentor.
Sein größter Auftrag war die Herstellung einer Krippe mit Figuren für die Kirche gewesen, die an jedem Weihnachtsfest neben dem Altar aufgestellt wurde. Und die alte Bank an der Bushaltestelle hatte er erst kürzlich mit vielen Schnitzereien versehen, sodass diese eine Zierde war, die jedem Besucher von Friedenkirchen sogleich ins Auge fiel, wenn er aus dem Bus ausstieg. Und in der Mitte prangte, für immer in der oberen Leiste der Rückenlehne verewigt, das Antlitz einer wunderschönen Frau: Elisabeth.
Natürlich gab und gibt es noch viele andere Menschen in und um Friedenkirchen. Und im Sommer kamen und kommen auch noch die Touristen dazu. Sie kommen hierher, weil die Gegend so schön und die Luft so gut ist, und so hatte sich im Laufe der Zeit eine kleine Feriensiedlung am Rande des Orts erschlossen. Es ist ein ruhiger und etwas abgelegener Ort – aber langweilig ist es in Friedenkirchen nicht …
Die zersägte Bank
Als Bernadette Nabel, einen Einkaufskorb im Arm, um 9 Uhr in die Haupt- und Durchfahrtsstraße des winzigen Örtchens Friedenkirchen einbog und geradewegs den kleinen Lebensmittelladen von Frau Wirth ansteuern wollte, bemerkte sie eine Menschenmenge, die sich auf dem Dorfplatz versammelt hatte. Einige schüttelten die Köpfe, andere redeten, teilweise wild gestikulierend und aufgeregt, aufeinander ein. Manche standen einfach nur ratlos da und richteten ihren Blick auf die kleine Bushaltestelle. Nach einer kurzen Überlegung siegte Frau Nabels unstillbare Neugier. Anstatt zum Laden zu gehen, lenkte sie ihre Schritte zu dem kleinen Menschenauflauf. Und sogleich offenbarte sich ihr der Stein des Anstoßes: In der Rückenlehne der Bank, die dort stand und liebevoll von Herrn Singer, dem Freund von Frau Nabel – oder sagen wir besser einem Freund, denn sie waren kein Liebespaar –, mit einer wunderschönen Schnitzerei verziert worden war, klaffte ein großes v-förmiges Loch. Auf dem Boden lagen einige Holzspäne, Kratzspuren waren über die ganze Bank verteilt. Das wunderschöne Rundelement mit der Verzierung war fort! Herr Singer hatte dort das Porträt einer wunderschönen Frau in die Mitte der Bank hineingeschnitzt. Die Frau war seine Frau Elisabeth, die vor einigen Jahren gestorben war.
Herr Singer hatte, wie schon erwähnt, so manche Schnitzarbeit gefertigt, ab und zu verkaufte er kleine Stücke an Touristen, manchmal restaurierte er in der kleinen Kirche die Bänke oder eine der Figuren und auch sonst verzierte er mit seinen Schnitzereien und Holzarbeiten das Dorf oder beglückte mit seinen Arbeiten seine Mitmenschen. Unter Herrn Singers geschickten Händen entstanden Verzierungen an Zäunen, Wandbilder an oder in Häusern, Tür- und Namensschilder, Tierfiguren, kleinere Gebrauchsgegenstände und sogar Kinderspielsachen. Das Bild der schönen Elisabeth jedoch war sein Meisterwerk. Und dort an der Rückenlehne der Bushaltestelle mitten im Ort hatte es jeder sofort gesehen, der diesen kleinen Ort besuchte.
Als wenig später zwei Polizisten den Tatort besichtigten, standen immer noch einige Bürger des kleinen Dörfchens um die Bank herum. In dieser kleinen Gemeinde war die Welt bisher noch in Ordnung gewesen – wer und warum schändete jemand die Bank an der Bushaltestelle, das Kunstwerk, auf das man schon ein wenig stolz war? Schließlich war dieser Ort auch Ferienort und echte liebevolle Handwerkskunst gab es ja nicht mehr überall in der heutigen Zeit. Dies war zwar ein kleiner unbedeutender Landschaftsflecken, aber so Kleinigkeiten machen eben auch was aus. Und außerdem waren die Leute hier ein Völkchen, das seinen Heimatort liebte und darauf bedacht war, dass alles immer gepflegt war.
Bernadette tippte dem Größeren der beiden uniformierten Männer auf die Schulter. „Was werden Sie unternehmen?“, fragte sie den Mann, der sie, nachdem er sich umgedreht hatte, etwas herablassend ansah.
„Nun, wir werden alles erst mal aufnehmen, ein paar Leute befragen, sehen, ob sich Zeugen melden, Spuren sichern“, und dabei wies er mit dem Kopf auf seinen Kollegen, der mit einer Art Klebeband Abdrücke von der Bank nahm. „Aber, ganz ehrlich – ich denke, das wird zu nichts führen. Es ist ja auch niemand verletzt worden. Alles in allem nur ein kleiner Sachschaden. Mehr können wir da nicht tun!“ Und mit einem etwas schiefen Lächeln wandte er sich seinem Kollegen zu: „Fred, bist du fertig?“
Bernadette Nabel blickte sich um. Die Menge löste sich langsam auf, die Menschen gingen ihrer Wege. Kleiner Sachschaden – Herrn Singer würde es das Herz brechen! Frau Nabel seufzte: Das war ungeheuerlich!
Schließlich kam es tatsächlich so: Die Polizei befragte noch ein paar weitere Leute, aber bald wurden die Ermittlungen eingestellt. Frau Nabel war damit überhaupt nicht zufrieden – ganz und gar nicht. Und die Kinder am Ort: Bertie, Hannes, Tobias, Jane und Nele auch nicht. Die fünf mochten Frau Nabel, vielleicht gerade deswegen, weil sie ein bisschen schrullig war, und ab und zu besuchten sie die alte Dame, tranken bei ihr Kakao oder Limonade und aßen Kuchen und Frau Nabel erzählte alte Geschichten von früheren Zeiten oder zeigte ihnen etwas Interessantes. Und manchmal half sie ihnen sogar bei den Hausaufgaben.
Und so saßen nun die fünf Kinder und die beiden Erwachsen, Frau Nabel und Herr Singer, in Frau Nabels gemütlicher Küche, aßen frischen Apfelkuchen und schimpften ein bisschen über die Polizei, die sich nicht um dieses Verbrechen, wie sie es nannten, kümmern wollte. Natürlich regten sie sich auch über den Übeltäter auf, der dies zu verantworten hatte. Die Kinder bemühten sich, Herrn Singer, der sehr traurig war, weil irgendwer seine Arbeit einfach zerstört und das Bild gestohlen hatte, ein wenig aufzurichten. Jane versuchte Trost mit einem Lob und einer Erklärung zu spenden: „Ach, ich glaube, das hat jemandem so gut gefallen, dass er es einfach haben wollte.“
In Frau Nabels Küche wurde diskutiert, was man tun, überlegt, wer für diese Tat verantwortlich sein könnte. Waren es einfach Fremde, die in wilder Zerstörungswut etwas kaputt machen wollten und zufällig ihre üble Laune und Aggression an der Bank ausgelassen hatten? Oder war es jemand, dem das Bild so gut gefiel, dass er es einfach herausgesägt und an sich genommen hatte – vielleicht ein Tourist, der es als Andenken haben wollte? Oder war es jemand vom Ort oder aus der Umgebung, der etwas ganz Bestimmtes im Sinn gehabt hatte? Und wenn das so war – was steckte dahinter?
Wenn es ein Fremder gewesen war, gäbe es wohl tatsächlich keine Chance, den Täter dingfest zu machen, außer der Zufall würde ihnen zur Hilfe kommen. Aber wenn es irgendein Motiv gab, das mit dem Dorf oder der Bank oder mit Herrn Singer zu tun hatte, dann vielleicht … Und schon gab es sieben selbst ernannte Kriminalisten im kleinen Dorf Friedenkirchen, die sich mit der großen Erfahrung von zahllosen gesehenen Fernsehkrimis, dem Lesen mehrerer Kriminalromane und vor allem einer Riesenportion Eifer und Motivation daran machten, diesen Fall zu lösen: Wer zersägte die Bank an der Bushaltestelle?
Die sieben gingen die Leute vom Dorf nacheinander in Gedanken durch und wogen das Für und Wider für eine mögliche Täterschaft ab: Da war z. B. der merkwürdige Mann in der kleinen Wohnung bei Frau Huber, der nie grüßte und immer missmutig guckte. Niemand kannte den wirklich, er wohnte auch erst seit Kurzem hier. Man würde ihn wohl ein bisschen beobachten müssen, dachte sich Bertie und schrieb Frau Hubers Mieter auf einen Zettel, auf dem er die Tatverdächtigen sammeln wollte. „Im Prinzip kommt jeder in Frage“, meinte Hannes mit sehr ernster Miene.
„Ja, aber wir müssen zuerst mal die verdächtigsten Personen aussortieren, sonst wird es zu viel“, entgegnete Bertie wichtig. Und Tobias nickte: „Genau!“
„Also gut“, sagte Frau Nabel. „Wer kommt noch in Frage?“
„Die Leide aus dr Feriensiedlung! Die sollde mir gnauer beobachde“, meinte Herr Singer in schwäbischem Singsang, der es gar nicht mochte, dass sich im Dorf Touristen aufhielten. Er war sehr misstrauisch, was Zugereiste oder Fremde anging. Dass er selbst auch ein Zugereister war, vergaß er gern. Herr Singer lebte schon lang im Westerwald, genau genommen seit er seine erste Stelle als Lehrer hier angenommen und mit seiner Frau Elisabeth hergezogen war. Aber ursprünglich stammten er und Elisabeth aus einer kleinen Stadt im Schwäbischen – aus Wendlingen bei Stuttgart –, was sein immer noch durchkommender Dialekt verriet. Die Kinder schmunzelten über viele Worte aus dem Schwabenland, die über Herrn Singers Lippen kamen, besonders wenn er sich aufregte. So manchen Ausdruck aus seiner Heimat konnte und wollte er sich einfach nicht abgewöhnen, und wenn er Nein sagte, dann klang das wie Noi (oder gar ha noi für „aber nein“). Vielen Bezeichnungen wurde eine verniedlichende Endung gegeben, wie das im Schwabenland üblich ist: So hieß die Katze das Kätzle, das Land das Ländle und das große Wasserfass in Frau Nabels Garten wurde von Herrn Singer hartnäckig als Fässle bezeichnet.
Auch Frau Nabel war keine echte Einheimische, wenngleich sie aus dem nicht sehr weit entfernten Bad Ems kam und erst seit ihrer Pensionierung hier im Dörfchen wohnte. Beide fühlten sich aber inzwischen so mit der kleinen Ortschaft verbunden, dass sie sich mehr oder weniger zu den Einheimischen zählten.
„Die Burgleute“, warf Jane ein.
Die Burgleute waren auch Zugereiste. Etwas abseits vom Dorf, aber eben doch dazugehörig, gab es nämlich eine uralte Burg. Vor einiger Zeit hatte eine Fabrikantenfamilie sie gekauft und war eingezogen. Und mit ihnen einige Angestellte, z. B. Inge Dietrich. Sie wohnte nicht in der Burg, sondern im Nachbardorf, kam aber jeden Morgen mit dem ersten Bus und machte sich dann auf den Weg zu dem mittelalterlichen Bauwerk. Im Arm hatte sie immer eine große Tasche und bei jedem Wetter stieg sie zügig den Hügel durch den Wald hinauf, vorbei an dem alten Turm, und gelangte dann geradewegs in den kleinen Burghof. Es war (und ist immer noch) eine ganz kleine Burg, sehr alt, die die Familie, die darin wohnte, vor einigen Jahren restaurieren ließ, bevor sie mit vielen kostbaren Möbeln eingezogen war. Die Leute waren ziemlich reich. Neben dem Hauptgebäude gab es noch ein Nebengebäude mit Ställen für einige Pferde.
Die Burgfamilie selbst bestand aus fünf Familienmitgliedern: Vater Ralf von Stein, Inhaber einer Fabrik, die Gartengeräte und -werkzeuge herstellte: Gartenspaten, Stahlbandspaten, Randspaten, Kinderspaten, Langstielspaten, Deich- und Bewässerungsspaten, Dränierspaten, gezackte Spaten, Wurzelspaten, Standardspaten, Setzspaten, Spatengabeln in allen Variationen, Mistgabeln, Breitgabeln, Eggen, Spitzhacken, Breithacken, Jätgeräte und verschiedene Schaufeln und Schippen – alles sehr gute Qualität. Die gesamte Ware wurde weit über die Landesgrenze hinaus verkauft und bescherte Familie von Stein nicht nur ein finanziell sorgenfreies, sondern auch sehr luxuriöses Leben. Herr von Stein liebte das Landleben, die Burg und die Pferde. Frau von Stein – Gerlinde – liebte alles Teure und Elegante und vor allem den Status, der sich mit Geld kaufen ließ. Sie tat immer sehr vornehm und überheblich. Beide stammten übrigens aus eher einfachen Verhältnissen. Zur Familie gehörten auch zwei Kinder, inzwischen Teenager: Andrea und Michael – 16 und 18 Jahre – und der Vater von Gerlinde: Otto Grün.
Also die Burgleute kamen natürlich auch in Frage. Warum genau, konnte zwar keiner der sieben selbst ernannten Detektive sagen, aber sie kamen auf die Liste.
Die Truppe verbrachte den gesamten Nachmittag damit, diese Liste mit verdächtigen Personen aufzustellen. Über Motive wollte man sich später Gedanken machen, denn niemand fiel dazu etwas ein. Und am Schluss einigte man sich darauf, sich zunächst mit einem „engeren Kreis von Verdächtigen“ zu beschäftigen, wobei das „Sich-verdächtig-Machen“ v. a. darauf beruhte, dass diese Leute wenig bekannt oder wenig beliebt oder beides waren: die Burgleute und die Leute aus der Feriensiedlung. Ansonsten würde man noch ein Auge auf den Mann bei Frau Huber haben und alle Anwesenden wollten alle Augen und Ohren offen halten.
Frau Nabel nahm sich vor, nun öfter zu Frau Wirth in den kleinen Laden zu gehen, weil man dort doch so manches hörte. Frau Wirth wusste fast alles, was hier so vor sich ging, und wenn man die richtigen Fragen stellte, war sie nur allzu gern bereit, ihr Wissen auch zu teilen. Manche Leute – böse Zungen – nannten sie auch die Klatschbase von Friedenkirchen.
Nele wohnte gegenüber der Bushaltestelle. Sie würde ein Auge auf die Leute werfen, die den Bus verließen oder in ihn einstiegen. Außerdem würde der Täter vielleicht zum Tatort zurückkommen. Da konnte es nicht schaden, nach Leuten Ausschau zu halten, die sich in der Nähe der Bank aufhielten oder sich irgendwie merkwürdig benahmen.
Die Zeit verflog. Die Kinder mussten nach Hause, denn ihre Eltern warteten mit dem Abendessen, und so verabredeten die sieben, sich am nächsten Tag noch einmal bei Frau Nabel zu treffen. Bis dahin könnte sich jeder noch mal Gedanken machen – vielleicht fiel ja jemandem noch etwas ein!
Kaum einer von den sieben Detektiven schlief in der folgenden Nacht viel. Herr Singer war eher traurig, weil jemand das Porträt seiner Elisabeth gestohlen oder zerstört hatte. Und die anderen sechs waren aufgeregt und kramten in ihren Köpfen nach der zündenden Idee, mit der sie den Fall lösen würden.
Am nächsten Nachmittag, nachdem die Schule vorüber und die meisten Hausaufgaben erledigt waren, saßen alle wieder bei Frau Nabel bei Saft, Tee, Kakao oder Kaffee und einem Kuchen und überlegten, was als Nächstes zu tun sei. Da niemandem ein plausibles Motiv für die zerstörerische Tat eingefallen war, beschlossen sie, zunächst ihre Umgebung genau zu beobachten. Die Mädchen sollten die Feriensiedlung im Auge behalten, die Jungs wollten sich die Burg vornehmen und Frau Nabel würde sich bei den Dorfbewohnern umhören. Herr Singer wollte einspringen, wo es nötig war. Detektivarbeit war nicht sein Ding, aber er wollte sich nicht ausgrenzen, außerdem war ihm am meisten daran gelegen, dass dieser Fall aufgeklärt wurde. Vielleicht würden sie ja sogar das Bild wiederfinden.
Und so vergingen die nächsten Tage.
Frau Nabel tätigte keine größeren Einkäufe mehr, sondern lief wegen jeder Kleinigkeit zum Laden von Frau Wirth: Einmal brauchte sie eine Tüte Zucker, dann war ihr das Nähgarn ausgegangen, dann benötigte sie Brot und am nächsten Tag blätterte sie stundenlang in den Zeitschriften herum und spitzte ihre Ohren, wenn andere Kunden ins Geschäft kamen und sich unterhielten. Öfter war die Bank an der Bushaltestelle Gesprächsstoff, aber Frau Nabel fand nur heraus, dass alle anderen auch nicht schlauer waren als sie selbst, und niemand äußerte sich verdächtig.
Es war eine Fügung des Schicksals, dass in der Woche darauf die Ferien anfingen und die Kinder den ganzen Tag Zeit hatten.
Die Jungs lungerten ein paar Tage um die Burg herum und versuchten auch, das verrostete Schloss des alten Turms aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Der Turm war unheimlich und die alte Trude, eine uralte Frau, die schon im Dorf geboren war, erzählte, dort würde es spuken. Hannes hatte jedoch festgestellt, dass vor der Tür, dem einzigen möglichen Eingang zum Turm, der nur oben zwei vergitterte enge Fenster hatte, die Brennnesseln und die dichten Schlehenbüsche mit ihren spitzen Dornen so hoch waren, dass sie wohl niemand in der letzten Zeit überwunden hatte. Man hätte Spuren sehen müssen. Es hätte also tatsächlich nur ein Geist ein- und ausgehen können und daran wollte niemand so recht glauben. Zumindest stahlen Geister keine Holzbilder oder zersägten Bänke. Also hielten sie sich in der Nähe der Burg auf, streiften durch die Büsche und lugten einige Male zu den Fenstern hinein – immer darauf bedacht, dass sie nicht gesehen wurden.
Die Bewohner kamen und gingen, Inge Dietrich hängte im Küchengarten hin und wieder Wäsche auf und später wieder ab oder trug den Komposteimer zum Komposthaufen. Die beiden Teenager wurden öfter von Freunden besucht und Opa Otto Grün saß an warmen Tagen auf der Terrasse, die Beine in eine Decke gewickelt und in den Händen ein Buch. Von ihm war außer einem leisen Schnarchen nicht viel zu hören, denn er war ein ruhiger zurückhaltender Mann, der um seine Person wenig Aufsehen machte. Oft verbrachte er die Zeit mit etwas zum Lesen in einem Sessel in seinem Zimmer, der Bibliothek oder eben auf der Terrasse hinter dem Haus oder im Garten, in dem er gern werkelte. Früher einmal war er Gärtner gewesen. Natürlich war für den großen Garten der Familie von Stein ein eigener Gärtner angestellt worden, aber Otto ließ es sich nicht nehmen, selbst Unkraut zu jäten oder die Rosen zu schneiden. Im Moment jedoch plagte ihn seine Schulter, sodass er nicht arbeiten konnte.
Die Jungs beschlossen, das Haus den ganzen Tag und teilweise auch die Nacht über zu beschatten und teilten sich auf, sodass sie immer zu zweit waren. Früh morgens begannen sie ihre Beobachtungen schon, wenn Frau Dietrich das Haus betrat. Gerlinde, die Hausherrin, lag um diese Zeit noch im Bett und Melanie, das Hausmädchen, war noch nicht da. So konnte Frau Dietrich in Ruhe die Küche in Beschlag nehmen, die Kaffeemaschine anstellen, den Einkaufszettel schreiben, das Frühstück für Frau von Stein richten und sich selbst eine Tasse Tee gönnen. Sie liebte diese halbe Stunde und genoss sie ebenso wie Frau Nabel weiter unten im Dorf. Während sie so am Küchentisch saß, in ihre Gedanken versunken, kam Tessa, die rotgetigerte Katze und eigentliche Herrin der Burg, um die Ecke, sprang auf Inges Schoß und rollte sich dort gemütlich zusammen. Frau Dietrichs Hand fuhr dann durch das weiche seidige Fell, ein tägliches, ganz selbstverständliches Ritual, das sich keiner der beiden je entgehen lassen würde. All das hatte Bertie mit dem Fernglas aus dem alten Kastanienbaum beobachtet. Er hatte sogar Frau von Stein oben in ihrem Schlafzimmer bespitzelt, wie sie sich, nachdem sie gegen halb zehn aufgestanden war, die Haare bürstete und schminkte. Die Jungs hatten alle Beobachtungen in ein Buch geschrieben, beinah minutiös alles festgehalten. Aber wirklich Aufregendes oder gar Verdächtiges war nicht passiert.
Die beiden Mädchen machten jedoch eine recht interessante Entdeckung. Im Ferienhaus Nummer fünf war eine junge Frau eingezogen. Sie wohnte dort ganz allein. Jane und Nele hatten gewartet, bis die junge Frau mit dem Auto weggefahren war, und sich dann in den Garten geschlichen. Und vor der Haustür hatten sie eine Säge entdeckt. Und an der hingen noch ein paar Holzspäne, die frisch aussahen. Äußerst interessant!
Schließlich trafen sich die Detektive wieder bei Frau Nabel am Küchentisch, besprachen die Lage und beratschlagten, wie es nun weitergehen sollte.
„Alcho ich gin gafür, gass wir noch ein gichchen gie Gurg geogachken!“ Toby hatte sich gerade ein Stück Kuchen in den Mund gestopft.
„Geht’s auch deutlich?“, fragte Nele.
„Wir wollen noch weiter die Burg im Auge behalten“, übersetzte Bertie.
„Und was machen wir jetzt mit der Frau mit der Säge?“, fragte Jane.
„Natürlich auch weiter beobachten!“, sagten Frau Nabel und Toby, der inzwischen wieder einen leeren Mund hatte, gleichzeitig.
„Vielleicht können wir die Holzspäne mit der Bank vergleichen“, meinte Hannes. „Ob man herausfinden kann, ob das das gleiche Holz ist?“
„Die Polizei könnte das sicher“, meinte Toby. „Wir können es ja zumindest mal versuchen. Vielleicht sieht es ja auch ganz anders aus. Dann wüssten wir zumindest, dass die Säge nichts damit zu tun hat.“
„Wir brauchen eine kleine Plastiktüte!“ Hannes kannte das aus dem Fernsehen. „Die Polizei packt Beweismaterial immer in Plastiktüten, damit keine falschen Spuren daran kommen können.“
Frau Nabel kramte in ihrer Schublade und holte eine Rolle mit Gefrierbeuteln heraus, riss eine Tüte ab und reichte sie Hannes. „Ich denke“, sage sie, „dass das für heute alles ist, oder?“
Die anderen sechs nickten und Frau Nabel blickte etwas besorgt zu Herrn Singer, der betrübt schien. Er hatte sich aus den Diskussionen herausgehalten, aber die Sache beschäftigte ihn sehr. „Will noch jemand Kakao?“, fragte Bernadette Nabel. Und alle nickten – Frau Nabels Kakao war nämlich der allerbeste. Grund dafür war ein selbsterfundenes Geheimrezept, das sie nicht einmal den Kindern verriet.
Die Mädchen schlichen noch einmal in die Ferienhaussiedlung zum Garten Nummer fünf und sammelten ein paar Holzspäne von der Säge, die noch genauso dalag wie am Tag zuvor, und verwahrten sie in der Plastiktüte. Der Vergleich mit dem Holz der Bank ergab kein wirklich sicheres Ergebnis. Aber zwei Tage später beobachtete Frau Nabel zufällig, dass die junge Frau Feuerholz zersägte. Bernadette grüßte freundlich und eröffnete so ein Gespräch, in dem sie erfuhr, dass die Frau die Hütte von ihrer Freundin gemietet hatte und, weil es nachts etwas kühl wurde, Holz für den Ofen benötigte. „Nachdem ich mir letzte Woche mit dem Beil beinah ins Knie gehauen habe, nehme ich jetzt lieber die Säge, auch wenn das ein bisschen mühsam ist.“ Und damit rückte die junge Frau auf der Liste der Verdächtigen erst einmal in den Hintergrund.
Die Mädchen schlichen weiter durch die Feriensiedlung und hielten auch die Bushaltestelle im Auge. Aber niemand verhielt sich verdächtig, nichts passierte. Schließlich schlenderten sie durchs gesamte Dorf, warfen Blicke in Höfe, Einfahrten und Gärten und spähten durch die Fenster der Schuppen und Garagen – aber es schien hoffnungslos. Es gab überhaupt keinen Anhaltspunkt.
Toby hatte inzwischen den mürrischen Mieter von Frau Huber getroffen. Nicht ganz zufällig, denn er hatte ihn einmal abends abgepasst, als er von der Arbeit heimkehrte, und versucht, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Herr Schlehmann – so hieß der Mann, das wusste Toby vom Blick auf das Klingelschild – hatte sich aber sehr abweisend verhalten und ihn abgewimmelt. Seitdem behielt Toby ihn im Visier und hatte inzwischen herausgefunden, dass er abends meistens mit einer Sporttasche wegfuhr. Auf dem Auto klebte der Aufkleber eines Fitnessstudios. Frau Huber hatte dazu bereitwillig Auskunft über ihren Mieter gegeben: Er verbringe wohl seine gesamte Freizeit in der Muckibude, absolviere täglich auch einige Übungen in der Wohnung und arbeite als Installateur. „Mehr schlecht als recht“, wie sie bemerkte. Als sie im Keller neue Leitungen habe legen lassen, hatte er die Zuleitungen vertauscht, sodass jetzt kaltes Wasser aus der Warmwasserleitung floss und umgekehrt. Als Toby das den anderen erzählte, schüttelte er nach Beenden seines Berichts den Kopf: „Was nutzen 5000 Volt, wenn kein Birnchen brennt?“ Frau Huber hatte später noch erzählt, dass Herr Schlehmann eine Freundin in Koblenz hätte, mit der er erst kürzlich zwei Wochen auf Gran Canaria gewesen sei. Und als Toby genauer nachgefragt hatte, erfuhr er, dass dies genau in der Zeit gewesen war, als die Bank zersägt wurde. Herr Schlehmann kam also als Täter leider nicht in Frage.
Inzwischen hatten die Jungs nur noch wenig Lust, den ganzen Tag in der Nähe der Burg herumzulungern. Irgendetwas musste geschehen. Nur abwarten, das wollte niemand.
Und da kam ihnen plötzlich der Zufall zur Hilfe. Die Burgleute hatten sich zwar in keiner Weise verdächtig gemacht, aber irgendwie hatte Toby „so ein Gefühl“. Jedenfalls wollten die Jungs unbedingt mehr über die Leute dort erfahren. Und da stand in der Wochenendausgabe des örtlichen Blättchens eine Anzeige: Die Familie von Stein suchte zwei Schüler oder Schülerinnen oder Studenten oder Studentinnen, die im Garten aushalfen. Die Kinder berieten, ob sie sich alle bewerben sollten, wurden sich dann jedoch darüber einig, dass zunächst zwei von ihnen wegen des Jobs anfragen sollten. Es wurde hin- und herüberlegt, wer von ihnen gehen durfte, bis Herr Singer von fünf Streichhölzern zweien die Köpfe abbrach, sie so in die Hand nahm, dass die ungleichen Enden versteckt in seiner Hand lagen und jeder eins zog. So fiel das Los auf Bertie und Nele.
Die beiden machten sich noch am selben Nachmittag auf den Weg zur Burg. Diesmal gingen sie nicht durch Büsche und auf verborgenen Wegen, sondern die Haupteinfahrt entlang und geradewegs zur großen dicken Holztür, über der eine dicke mittelalterliche Laterne hing. Gerade wollte Nele auf die auffällig moderne und gar nicht passende Klingel drücken, als der Gärtner mit einer Schubkarre um die Ecke bog. Mit ihm würden sie wohl in Zukunft zusammenarbeiten – wenn sie den Job bekamen –, vielleicht wäre es dann sinnvoll, zuerst mit ihm zu reden. Vor allem, wo er doch gerade da war und eigentlich ganz nett aussah, was die Kinder von Frau von Stein nicht gerade behaupten konnten.
Ein kurzes Gespräch mit dem Mann im mittleren Alter – „Ich heiße Alfred“ – informierte die beiden Jobinteressenten zumindest schon mal über die Tatsache, dass der Job noch frei war und sich bisher auch niemand dafür beworben hatte. Alfred musterte die beiden einen Moment und meinte dann „Ihr könnte wohl zupacken“, wobei nicht ganz klar war, ob dies eine Feststellung oder eine Frage war. Jedenfalls lächelte er dabei wohlwollend, nickte den beiden aufmunternd zu und verschwand dann mit seiner Schubkarre hinter dem Haus. Nele drückte auf die Klingel und dann standen die beiden auf der breiten Treppe und warteten. Zunächst tat sich … nichts. Nele drückte ein zweites Mal auf die Klingel und dann endlich hörte man gedämpft Schritte und die Tür öffnete sich: Vor ihnen stand ein schlaksiger Junge, fast schon ein Mann – gut aussehend, wie Nele fand. „Was wollt ihr?“
Nele setzte ihr charmantestes Lächeln auf: „Wir kommen wegen des Jobs.“
„Welcher Job?“ Der Junge blickte etwas überrascht.
„Na, wegen des Gartenjobs!“ Nele lächelte noch immer.
„Ach ja!“ Endlich schien er zu kapieren. Lässig drehte er sich um, brüllte über die Schulter ins Haus: „Maaam! Für dich!“ Er lächelte den Kindern, ohne wirkliches Interesse, kurz zu. „Sie kommt gleich.“ Dann drehte er sich um und war im nächsten Augenblick verschwunden.
Nele verdrehte die Augen. Bertie seufzte.
Endlich erschien Frau von Stein in der Tür. „Was wollt ihr, Kinder?“, fragte sie mit einem Unterton, der unmissverständlich klar machte, dass auch sie kein Interesse an einem Gespräch mit den beiden hatte.
„Wir kommen wegen des Jobs“, sagte Nele nun noch einmal, aber immer noch höflich. „Sie hatten inseriert.“
„Ja, sicher.“ Plötzlich wurde das Gesicht der Frau freundlicher. „Kommt rein.“
Bertie stieß einen zweiten, diesmal lautlosen, Seufzer aus und die beiden folgten Frau von Stein durch die kleine Eingangshalle in einen hohen Raum mit einem alten steinernen Kamin.
„Setzt euch einen Augenblick.“ Die Hausherrin wies auf ein altes Sofa, dessen Bezug abgewetzt war, und setzte sich selbst auf einen dazu passenden Sessel. „Ihr wollt also dem Gärtner helfen?“ Ihr Blick war durchdringend und streng. Bertie wäre am liebsten geflohen. Er hasste es, gemustert zu werden. Nele sagte höflich „Ja“ und die beiden warteten erst einmal ab, was nun kommen würde. Was hätten sie auch noch sagen können?
„Gut“, sagte die Dame des Hauses dann auch sofort. „Es geht darum, dem Gärtner etwas zur Hand zu gehen – Laub zusammenrechen, einige Pflanzen austauschen, Unkraut jäten. So was in der Art. Traut ihr euch das zu? 8 Euro die Stunde. Ich würde sagen, 4 bis 5 Stunden pro Tag. 5 Tage, jetzt in den Herbstferien, werden wohl genügen. Wir werden sehen.“
Das ging ja schneller als gedacht. Bertie und Nele nickten begeistert.
„Gut“, beendete Frau von Stein das Gespräch, bevor noch einer etwas sagen konnte. „Ich stelle euch jetzt schnell Alfred vor, den Rest könnt ihr dann mit ihm besprechen. Könnt ihr morgen anfangen?“
Bertie nickte noch einmal glücklich und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Auf Neles Gesicht dagegen war kein Gefühl abzulesen. Höflich sagte sie einfach: „Ja, danke.“ Und schon wurden sie wieder hinaus komplimentiert. Diesmal zur Hintertür. So wurde wohl bei reichen Leuten das Personal behandelt, kam es Nele in den Sinn. Wie in alten Filmen.
Draußen stocherte Alfred mit dem Unkrautjäter in einem Beet herum. Als Frau von Stein erschien, richtete er sich jedoch sofort auf. Und nachdem er und die Kinder einander nun noch einmal offiziell vorgestellt worden waren, vereinbarten sie den Arbeitsbeginn für den nächsten Morgen um 8 Uhr.
„Vergesst nicht, euch Gummistiefel anzuziehen“, rief ihnen Alfred hinterher, als sie leichten Schrittes die Auffahrt hinuntereilten.
„Das ging ja leichter, als ich dachte“, meinte Bertie.
„Ja, vor allem weil du so gesprächig warst!“, meinte Nele ironisch.
Am nächsten Morgen erschienen die Kinder pünktlich und mit alten Jeans und Gummistiefeln bekleidet im Garten der Burg. Alfred führte sie herum, zeigte ihnen den Garten und das große Gartenhaus, in dem jede Menge Geräte standen und hingen. Natürlich alle aus der Steinschen Gerätefabrik und mit dem Markenwappen. Auf einem langen Regal waren Blumentöpfe gestapelt und in der Mitte standen zwei Pflanztische mit Blumenerde und einige Samentüten. Die Kinder wurden mit Schaufeln und Unkrautstechern ausgestattet und Alfred erklärte ihnen, was sie zu tun hatten. „Nicht dass ihr mir die Pflanzen ausgrabt! Kennt ihr den Unterschied zwischen Gartenblumen und Unkraut?“
Bertie und Nele nickten. Das war nun wirklich kein Problem für sie. Sie kannten sich aus, nicht zuletzt durch viele gemeinsame Gartenstunden mit Frau Nabel.
Eine Weile arbeiteten sie schweigend.
„Und wie sollen wir ins Haus kommen? Bei der Schufterei werden wir kaum Zeit haben, uns hier genauer umzusehen“, maulte Bertie.
„Jetzt wart’s ab. Hab ein bisschen Geduld. Es wird sich schon etwas ergeben.“
Wieder arbeiteten sie eine Weile ohne etwas zu sagen. Dann sah Nele auf und bemerkte mit einem kurzen Nicken in Richtung Terrasse: „Schau mal, wer da kommt. Den werden wir nachher mal ein bisschen ausfragen.“ Und als Bertie in die von ihr gewiesene Richtung blickte, sah er Herrn Grün, der es sich auf einem Gartenstuhl bequem machte und den Kindern kurz zunickte.
Nachdem sie mit der Arbeit fertig waren („Elende Schufterei“ – das war jedenfalls Berties Meinung), nahmen die beiden Schaufel und Unkrautstecher und schlenderten an der Terrasse bei Herrn Grün vorbei. Dieser war, wie fast immer, in ein Buch vertieft, hob aber den Kopf, als die Kinder näher kamen. Mit Blick auf die Gartengeräte meinte er zu den beiden: „Die kommet ins kloane Heusle.“
???
„Die kommen in das kleine Gartenhaus“, übersetzte Herr Grün seine Worte, indem er jede Silbe laut betonte, als würde er zu einem Schwerhörigen sprechen.
„Aha“, meinte Bertie schmunzelnd. Und Nele fügte hinzu: „Sie sind wohl nicht von hier?“
„Ha noi“, brummte Herr Grün und vertiefte sich wieder in sein Buch.





























