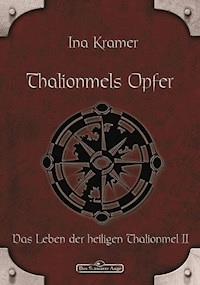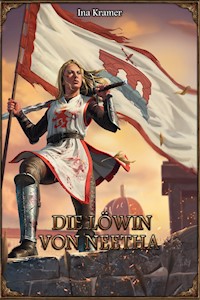Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
1. Im Frühjahr 2007 entdeckt Frau Plaschke ein Ei in ihrem Garten, das wächst und schwillt, bis es an Heiligabend sein unfassbares Inneres offenbart. 2. Zwei Jahre später kommt Frau Plaschke auf einer Italienreise der Liebhaber abhanden und ein trauriger Hund läuft ihr zu, der sie, wieder daheim, nötigt, in eine Plattenbausiedlung zu ziehen. Dort wohnen die Brüder Unkenfurt, drei minderbegabte Zauberer, die aber immerhin in der Lage sind, das Geheimnis des Hundes zu lüften. 3. Nach einem an Höhepunkten armen und an Rückschlägen reichen Leben landen die Brüder Unkenfurt in besagter Plattenbausiedlung, wo sie die Bekanntschaft Frau Plaschkes und ihres Hundes machen. Später lernen sie auch ihren Ex und weitere Personen kennen, und mit vereinten Kräften gelingt es, wiederum an Heiligabend, die Irrungen und Wirrungen der Vergangenheit für die meisten Beteiligten zu einem relativ guten Ende zu bringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ina Kramer wurde in Mülheim an der Ruhr geboren, machte Abitur in Essen, studierte Freie Kunst und Künstlerisches Lehramt an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf, unterrichtete vier Jahre lang Kunst an einem Duisburger Gymnasium, malte und nahm an einigen Gruppenausstellungen teil, assistierte Ulrich Kiesow beim Erstellen des Regelwerks für das Fantasy-Rollenspiel Das Schwarze Auge, trug durch Texte, darunter vier Romane, und zahlreiche Illustrationen zur Ausgestaltung der Spielwelt Auenturien bei, betreute als freie Lektorin diverse Romanprojekte, schrieb Prosa und Gedichte und erhielt 2014 ihren ersten Literaturpreis. Sie lebt und arbeitet in Düsseldorf.
Bisher erschienen:
110 Gedichte
Die Albtraumgruppe und andere Erzählungen
INHALT
Teil 1
Das Wunder vom Holunderweg
Teil 2
Pino
Teil 3
Die Brüder Unkenfurt
1
2
3
4
Teil 1
DAS WUNDER VOM HOLUNDERWEG
Eines Morgens Ende April entdeckte Frau Plaschke das Ei in ihrem Garten. Sie fühlte sich etwas übernächtigt, aber auf ihren Adlerblick konnte sie sich wie gewohnt verlassen. Dass sie immer noch keine Sehhilfe brauchte, weder für die Nah- noch für die Fernsicht, erfüllte sie schon ein wenig mit Stolz, schließlich erwartete sie in wenigen Tagen ihren fünfzigsten Geburtstag. Und genau das war der Punkt: Dieses Datum und die hässliche Zahl hatten sie am Schlafen gehindert. Doch um halb sechs war dann die Entscheidung gefallen: Sie würde das Datum ignorieren und mit frischem Mut wieder bei sechsundvierzig einsteigen.
Das Ei war als solches kaum zu erkennen, und auch Frau Plaschke hielt es trotz ihres Adlerblicks zunächst für eine unreife Stachelbeere, ein verständlicher Irrtum, lag es doch am Fuß des Stachelbeerstrauchs auf der beim letzten Jäten von Vogelmiere und Ackerschmalwand sorgfältig befreiten Erde. Frau Plaschke runzelte die Brauen. Die Beere, grün und offensichtlich unreif, war deutlich größer als die am Strauch verbliebenen, deren Länge sie auf vier bis sechs Millimeter schätzte. Was hatte ihr Wachstum beschleunigt? Was hatte sie vom Strauch fallen lassen? Eine Krankheit? Ein Schädling? Sie hatte noch nie von Stachelbeermaden gehört, aber was wollte das schon besagen?
Frau Plaschke beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen und die Beere in ihrer Küche zu sezieren. Doch noch bevor sie sich gänzlich hinabgebeugt hatte, erkannte sie schon, dass es sich bei dem Objekt unmöglich um eine Stachelbeere handeln konnte. Das Gebilde war überhaupt nicht pflanzlichen Ursprungs, es war ein Ei! Aber welcher Vogel legte solche Eier? So klein, so kräftig grün und, nun sah sie es, mit winzigen leuchtend roten Sprenkeln verziert? Und wieso hatte der Vogel, ein Bodenbrüter offenbar, nicht einmal versucht, etwas andeutungsweise Nestartiges zu bauen.
Er, vielmehr sie hatte sich geirrt, entschied Frau Plaschke. Das dumme, unerfahrene Weibchen würde dieses Ei gewiss nicht bebrüten, sondern an anderer, geeigneterer Stelle ein neues Gelege beginnen. Also könnte es auch nichts schaden, wenn sie, Frau Plaschke, es mit ins Haus nähme, um es anhand ihres Bestimmungsbuches zu identifizieren. An ein Sezieren war natürlich jetzt nicht mehr zu denken. Sie wollte gerade nach dem Ei greifen, da entdeckte sie eine Knoblauchsrauke, die ihr beim letzten Jäten entgangen sein musste. Entschlossen riss sie die Pflanze aus und schleuderte sie Richtung Gartenzaun.
Dass Frau Plaschke, wenn sie sich zur Gartenarbeit hinreißen ließ, was anfallartig (und nicht ganz freiwillig) alle vier bis sechs Wochen geschah, Vogelmiere, Ackerschmalwand und dergleichen mit besonderer Emsigkeit verfolgte, lag nicht etwa daran, dass ausgerechnet diese Kräutlein ihren Zorn erregten, sondern vielmehr an deren Harmlosigkeit. Sie bildeten nämlich weder unterirdisch kriechende Rhizome aus wie die Quecke oder der Giersch noch Wurzeln, die sich wie beim Löwenzahn pfahlartig in den Boden bohrten, ließen sich daher kinderleicht rupfen. Und hin und wieder musste sie eben etwas, das gemeinhin Unkraut genannt wurde, aus ihrem Garten entfernen, wollte sie nicht den Groll beziehungsweise weiteren und heftigeren Groll der Nachbarn auf sich ziehen. Denn erbost waren diese schon genug wegen Frau Plaschkes Weigerung, die Mühen der Giersch-, Quecken-, Brennessel- und Löwenzahnausrottung auf sich zu nehmen. Ihre, Frau Plaschkes, Quecken, Brennesseln und so weiter verseuchten ihre, der Nachbarn, Gärten, hatte sie oft genug zu hören bekommen, sogar von Bewohnern der Siedlung, deren Gärten nicht an den ihren grenzten, woraufhin sie ein Rundschreiben verfasst hatte, des Inhalts, dass Brennesseln notwendig seien für den Erhalt des Tagpfauenauges und der Giersch sich nicht nur als Gemüse oder Suppeneinlage eigne, sondern überdies Stoffe enthalte, die eine Gichterkrankung (Zipperlein) günstig beeinflussen könne — eine gewagte Behauptung, von deren Wahrheitsgehalt sie selbst nicht völlig überzeugt war —, weswegen er im Volksmund auch Zipperleinskraut genannt werde und mithin kein Un-, sondern ein Nutzkraut sei.
Nach diesem Rundschreiben, das sie auf ihrer alten Olympia-Reiseschreibmaschine verfasst, mit Tipp-Ex korrigiert, im Copy-Shop vervielfältigt und anschließend an alle Haushalte des Holunderwegs, des Heckenrosenwegs und des Erlenwegs verteilt hatte (in deren Vorgärten sich Kirschlorbeer und Cotoneaster in ausreichender Menge fanden, aber weder Erlen noch Heckenrosen noch Holunder), wurde sie von den Anwohnern noch misstrauischer beäugt, als bei ihrem Einzug vor zweieinhalb Jahren. Sie hatte das Haus Holunderweg neunzehn, eine Doppelhaushälfte, samt Garten von einer Großcousine geerbt, schulden- und hypothekenfrei und völlig überraschend — sie kannte Großcousine Lohmann kaum —, und nach kurzer Bedenkzeit ihren ersten Impuls, es zu verkaufen, unterdrückt und statt dessen beschlossen, dem Stadtrandleben eine Chance zu geben.
Den Garten im großen und ganzen so zu belassen wie von der Großcousine angelegt, hatte Frau Plaschke sich moralisch verpflichtet gefühlt, und doch sah er nach dieser relativ kurzen Zeitspanne schon völlig anders aus als zu Frau Lohmanns Lebzeiten: Am Zaun wucherten Giersch und Brennesseln, der ehemalige Zierrasen war mit Löwenzahn, Gänseblümchen und, je nach Jahreszeit, Wiesenschaumkraut oder Ehrenpreis übersät, die zwei Sta-chelbeer- und drei Johannisbeersträucher wurden nicht mehr gestutzt (und trugen dennoch prächtig), der Holunder, der sich am Rand der Terrasse angesiedelt hatte, durfte bleiben (passt doch zu Holunderweg, fand Frau Plaschke), und darüber hinaus hatte sie, Großcousine Lohmann würde es wohl verzeihen, einen Teil des Rasens umgegraben und in ein Gemüsebeet verwandelt. Dort baute Frau Plaschke Dicke Bohnen und Mangold an, ihre Lieblingsgemüse.
Schon bei ihrem Einzug hatte Frau Plaschke, wie bereits erwähnt, Misstrauen erregt, und zwar nicht wegen ihrer mangelnden Bereitschaft zur Gartenpflege, von der die Nachbarn damals ja noch nichts wissen konnten (wenn auch der eine oder andere schon diesbezügliche Befürchtungen hegen mochte), sondern aufgrund ihrer Erscheinung, die irgendwie nicht zu einer Verwandten der Verstorbenen passen wollte — Das ist die Nichte von Frau Lohmann? Unglaublich! — und auch nicht zum Holunderweg.
Frau Plaschke gehörte zu den Menschen, die frühzeitig ergrauen. Jetzt, mit fast fünfzig, war ihr Haar völlig weiß, aber immer noch lang und dicht, und sie trug es zu zwei Zöpfen geflochten, die lustig im Fahrtwind flatterten, wenn sie, helmlos, auf ihrem Mofa durch die Siedlung knatterte. Die Zöpfe und die schwarzen Augen unter schwarzen (!) Brauen verliehen ihrem Aussehen etwas Indianerinnenhaftes, ein Eindruck, der durch ihre Kleidung jedoch nicht vertieft wurde. Denn tagein, tagaus, sommers wie winters, sah man sie, sobald sie das Haus verließ, in ihrer abgewetzten dunkelgrünen Bikerjacke mit den für ihren schmächtigen Körper viel zu breiten Schultern. Üblicherweise rundeten recht enge Jeans und Cowboystiefel die Garderobe ab, in besonders übermütiger oder ausgelassener Stimmung zog Frau Plaschke jedoch gelegentlich ihren roten Minirock an.
Seriös wirkte sie also nicht, und die Tatsache, dass sie außer dem Mofa kein weiteres Motorfahrzeug besaß, verstärkte diesen Eindruck in den Augen ihrer Nachbarn noch. Da sie überdies den Garten verkommen ließ und sich somit als des Erbes unwürdig erwies, so die einhellige Meinung, hatte Frau Plaschke bisher keine Freundschaften in der Siedlung schließen, nicht einmal lockere Bekanntschaften knüpfen können, was sie ein wenig bedauerte.
Als sie nun das Ei vorsichtig aufnahm, war sie überrascht von dessen Gewicht. Fünfzig Gramm mindestens, schätzte sie, eher mehr. Wächst also doch ein Küken darin, fragte sie sich. Unfug, entschied sie, denn das würde ja bedeuten, dass Dotter und Fötus schwerer wären als der Vogel, der das Ei gelegt hatte — ein kleiner Singvogel, allerhöchstens zwanzig Gramm -, und das war wohl kaum möglich. Oder doch? Wurde ein Ei eventuell schwerer, wenn der Fötus wuchs? Oder wenn Dotter und Küken in Fäulnis übergingen? Eine zwar eklige, aber nicht völlig auszuschließende Möglichkeit. Von Biologie hatte sie, das musste sie sich eingestehen, herzlich wenig Ahnung, auch wenn sie etliche Pflanzen und Tiere beim Namen kannte. Aber handelte es sich bei der Fragestellung überhaupt um ein biologisches Problem? War es nicht eher ein physikalisches? Oder chemisches? Oder biochemisches, oder chemophysikalisches, falls es so etwas gab …
An dieser Stelle ihres Gedankengangs, sie hatte gerade die Terrasse erreicht, wurde Frau Plaschke plötzlich bewusst, dass sich das Ei irgendwie falsch anfühlte. Nicht wie ein sprödes, zartes, zerbrechliches Gebilde, wie ein Vogelei eben, sondern wie — sie wusste es nicht, verspürte aber einen kurzen heftigen Drang, das Ding wegzuwerfen. Eine Sekunde später erinnerte sie sich schon nicht mehr an diesen Impuls, und nun beeilte sie sich, ins Haus zu kommen; für einen Spaziergang ohne ihre gute Lederjacke war der Morgen doch entschieden zu kühl, außerdem wollte sie endlich wissen, was sie da im Garten aufgelesen hatte.
Es war ein Ei und blieb ein Ei, aber gewiss keines einer heimischen Vogelart, das wusste Frau Plaschke bereits nach der ersten flüchtigen Durchsicht ihres Bestimmungsbuches „Mitteleuropäische Vögel und ihre Nester“. Knapp sechzig Gramm zeigte die Briefwaage an — sie hatte mit ihrer Schätzung also gar nicht so falsch gelegen — ‚ und auch das wollte zu keinem kleinen Vogel passen. Sechzig Gramm wog das Hühnerei, das sie zum Vergleich heranzog! Die Geruchsprüfung ergab nichts, das auf Fäulnis hingedeutet hätte, ein Segen, und plötzlich, als sie, das Fund-Ei mit der Linken wiegend, vor sich hinmurmelte „Ein Ei aus Blei geht nicht entzwei“ wusste Frau Plaschke, wie die Schale aussah und sich anfühlte: weder metallisch noch kalkig wie eine normale Eierschale, sondern irgendwie ledrig.
Seltsam, dachte sie, wie schon mehrfach an diesem Morgen, und nun meinte sie zu erkennen, dass die roten Sprenkel völlig regelmäßig auf der Schale verteilt waren und eine Form hatten wie… Sie blinzelte, um besser sehen zu können, aber es half nichts; bei Gebilden dieser Größe beziehungsweise Winzigkeit versagte selbst ihr Adlerblick. Also holte sie eine Lupe, und mit deren Hilfe fand sie bestätigt, was sie vermutet, aber nicht hatte glauben wollen: Die Sprenkel waren geometrische Figuren, völlig regelmäßige fünfzackige Sterne, mit haarfeinen Linien gezogen: Pentagramme.
Aha, dachte Frau Plaschke, da haben wir es also gar nicht mit einem Naturprodukt zu tun, sondern mit einem von Menschenhand geschaffenen Objekt. Aber wer tat so etwas, und warum, und wie hatte der Künstler es geschafft, diese feinen Linien zu zeichnen? Denn haarfein traf es nicht einmal; die Linien waren dünner als das zugegeben ungewöhnlich kräftige eigene Haar, das sie nun unter die Lupe hielt. So feine Linien konnte man noch nicht einmal mit einem 0,1mm-Isographen zeichnen, außerdem verstopften die Teile immer, wie sie aus leidvoller Erfahrung wusste.
Während sie darüber nachsann, wie und zu welchem Zweck der unbekannte Künstler das Ding hergestellt hatte — Schwermetallkern, vermutlich mit Latex überzogen, aber offenkundig keine Perle, da ohne Bohrung — und auf welche Weise es in ihren Garten gelangt war, wurde ihr plötzlich bewusst, wie staubig und unaufgeräumt das Zimmer war. Sie wollte gerade den Staubsauger holen, als ihr Blick auf die Wanduhr fiel. Um Himmels Willen, ich komme noch zu spät zur Arbeit, wenn ich hier weiter rumtrödele, dachte sie. Sie suchte nach einem geeigneten Platz, an dem sie das Ei deponieren könnte, fand aber auf die Schnelle nichts Besseres als den Eierbecher, der noch mit dem restlichen Frühstücksgeschirr auf dem Tisch stand. Rasch kippte sie die Schalen auf den Teller, legte das Ei in den Eierbecher — irgendwie sinnig, fand sie — und streifte ihre Jacke über. Zwei Minuten später hörte man sie auf ihrem Mofa durch die Siedlung knattern.
Frau Plaschke teilte sich anderthalb Planstellen in der Stadtbücherei mit ihrer Kollegin Frau Döring. Da ihr Berufsleben weder nennenswerte Höhen noch Tiefen aufwies, brauchen wir hier nicht näher auf es einzugehen. Die Arbeit machte ihr, wie den meisten Arbeitnehmern, mal mehr, mal weniger Spaß und verschaffte ihr, nun, da sie keine Miete mehr zahlen musste, ein solides Auskommen. Mit Frau Döring verstand sie sich gut, aber außer der Arbeit gab es kaum Gemeinsamkeiten: Frau Döring interessierte sich für Mode, Frau Plaschke nicht. Frau Plaschke las gern Fantasy-Romane, Frau Döring bevorzugte sogenannte Frauenliteratur, Frau Döring fuhr einen kleinen roten Flitzer, Frau Plaschke hätte nicht einmal sagen können, von welchem Hersteller er war, Frau Döring speiste gern in eleganten Fischrestaurants, Frau Plaschke aß lieber Hausmannskost…
Vielleicht hatten diese unterschiedlichen Interessen oder die Tatsache, dass sie nur wenige Stunden pro Woche gleichzeitig in der Bücherei verbrachten, dazu geführt, dass sich die beiden nach inzwischen zwölf gemeinsamen Jahren immer noch siezten und an dieser Form des Umgangs auch nichts zu ändern beabsichtigten.
Am „Sie“ lag es also nicht, dass Frau Döring erstaunt die Augen aufriss, als Frau Plaschke sie mit den Worten begrüßte: „Ein schickes Kostüm, das Sie da anhaben. Neu?“ Das Kostüm war in der Tat neu, aber Frau Döring hätte niemals damit gerechnet, dass ausgerechnet Frau Plaschke das bemerken würde. Und dass es ihr zu gefallen schien, war ebenso verwunderlich. Wahrscheinlich nur eine Floskel, dachte sie, konnte sich aber doch nicht verkneifen zu erzählen, wo und wie unwahrscheinlich günstig — Markenartikel, Lagerverkauf — sie es erstanden hatte. Und Frau Plaschke hörte zu, nickte und ließ sich die Adresse geben, für alle Fälle.
Als sie an diesem Tag gegen halb drei wieder ihre Wohnung betrat, war Frau Dörings Kostüm allerdings vergessen. Denn niemand hatte zwischenzeitlich staubgesaugt und aufgeräumt. Also machte Frau Plaschke sich voller Energie an die Arbeit. Zuerst die Küche, entschied sie. Denn dort stand nicht nur das Frühstücksgeschirr auf dem Tisch, es stapelten sich weitere Teller und Tassen in der Spüle. Sie gab heißes Wasser und Spülmittel dazu, befreite den Teller von Krümeln und Eierschalen, doch erst in dem Augenblick, als sie auch den Eierbecher ins Wasser tunken wollte, fiel ihr ein, dass er noch das Ei enthielt. Das seltsame Ding sollte ich lieber nicht waschen, dachte sie, sonst gehen womöglich die Pentagramme ab, und das wäre schade. Oder ich finde es in dem trüben Wasser nicht mehr und es verschwindet auf nimmer Wiedersehen in der Abflussleitung. Das wäre auch schade. Also beschloss sie, es in ihr Schmückkästchen zu legen (sie besaß tatsächlich ein Schmuckkästchen, das die kleine Sammlung von Amuletten und Silberringen enthielt, die sie im Lauf der Jahre auf Mittelaltermärkten erstanden hatte).
Das Ei war gewachsen! Nicht viel, aber deutlich sichtbar. Es hatte jetzt fast die Größe eines Taubeneis. Frau Plaschke stutzte. Und schluckte. Dann ließ sie sich schwer auf einen Stuhl fallen. Sie wusste nicht, was sie von dieser Entwicklung halten sollte und ob sie sich jetzt gruseln müsste. Normal war das jedenfalls nicht.
Erst Minuten später wagte sie, das Ding anzufassen; immerhin ergab die haptische Prüfung keine Veränderung, die Oberfläche fühlte sich nach wie vor ledrig oder latexartig an. Das Ei oder wie immer man das Objekt nennen wollte schien ihr auch schwerer geworden zu sein, aber da mochte sie sich täuschen. Doch tatsächlich zeigte die Briefwaage zehn Gramm mehr an als am Morgen. Normal ist das nicht, wiederholte Frau Plaschke in Gedanken. Aber sie hatte schließlich auch noch anderes zu tun, als sich über unnatürliche, eiartige Gegenstände den Kopf zu zerbrechen. Also legte sie das Gebilde zu einer ihrer Kakteen in den Topf. Es hatte schließlich auf Erde gelegen, dort müsste es sich wohlfühlen, würde vielleicht sogar Wurzeln schlagen und eines Tages eine wundersame Blume hervorbringen. Warum auch nicht? Eiern, die mit Pentagrammen verziert waren und wuchsen, war alles zuzutrauen.
Das Ei bildete keine Wurzeln aus, aber es wuchs weiter. Schon nach wenigen Tagen konnte Frau Plaschke die roten Pentagramme mit bloßem Auge erkennen. Sie war gerade mit dem Fensterputzen fertig geworden und nun dabei, die Zimmerpflanzen ordentlich auf der Fensterbank aufzureihen, als sie es bemerkte. Wahrscheinlich liegt es nur daran, dass es plötzlich so hell im Zimmer ist, sagte sie sich, wusste aber, dass sie sich mit solchen Worten nur selbst zu beruhigen versuchte. Das heißt, sie horchte in sich hinein, sonderlich beunruhigt war sie eigentlich nicht. Schließlich tat das Ei nichts Böses, sonderte weder giftige Dämpfe ab noch ließ es den Kaktus verdorren. Es wuchs einfach still vor sich hin.
Auch wenn sie beschlossen hatte, das Datum zu ignorieren — es war ihr fünfzigster Geburtstag. Daher verzichtete Frau Plaschke nach minutenlangem innerem Kampf darauf, die Bücherregale auszuräumen und sämtliche Bücher gründlich abzustauben, wie sie es sich eigentlich vorgenommen hatte. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagte sie sich, und schließlich ist heute mein fünfzigster beziehungsweise sechsundvierzigster Geburtstag, da sollte ich mir vielleicht etwas Gutes tun. Außerdem scheint die Sonne so warm und herrlich, ist es da nicht eine Sünde, den Tag mit Putzarbeiten im Haus zu verbringen? Also zog sie ihre Jacke an, holte das Mofa aus der Garage und fuhr los, durch die Siedlung und dann die Hauptstraße entlang, die zur Innenstadt führte. Doch ohne ein bestimmtes Ziel.
Erst als sie ihr Mofa vor der Boutique abstellte, deren Namen Frau Döring schon des öfteren erwähnt hatte, wurde Frau Plaschke klar, womit sie sich an ihrem Ehrentag beschenken wollte. Im Schaufenster hing ein marinefarbener Blazer, jugendlich-beschwingt, aber doch elegant, den wollte sie haben. Zwar musterte die Verkäuferin sie zunächst ein wenig irritiert, dann aber, als Frau Plaschke sich mit dem Blazer vor dem Spiegel drehte, versicherte sie, gerade dieses Modell kleide eine Dame mit so zierlicher Figur wie der ihren ganz vorzüglich. Das fand auch Frau Plaschke, trotzdem lehnte sie ab, als die Verkäuferin ihr vorschlug, den Einkauf mit einem schicken Rock oder einer modischen Hose abzurunden.
Wieder daheim galt ihr erster Blick dem Ei. Sie wusste selbst nicht, warum sie den Blazer — sie hatte ihn gleich anbehalten und sich die Lederjacke in die Tüte packen lassen — nicht ablegte; es war sehr warm im Haus. Wollte sie etwa dem Ei ihre Neuerwerbung vorführen, da es sonst niemanden gab, von dem sie sich hätte bewundern lassen können? Der Gedanke war so abwegig, dass sie laut lachen musste. Dennoch glaubte sie, das Ei aufleuchten oder aufglänzen zu sehen, als sie näher herantrat. Aber natürlich handelte es sich um eine Sinnestäuschung.
Auf keiner Sinnestäuschung hingegen beruhten Wachstum und Gewichtszunahme des Eis — beides ließ sich schließlich leicht überprüfen. Schon Mitte Mai war es größer als ein Gänseei, und Mitte Juni hatte es ein Straußenei deutlich überrundet. Als es Anfang Juli über Fußballgröße geschwollen war und mittlerweile sechs Kilo wog, beschloss Frau Plaschke, es im Garten weiterwachsen zu lassen. Es war nun selbst für ihren größten Blumentopf — nur mit Erde gefüllt, ohne Zimmerpflanze darin — zu groß geworden. Was ihr ein wenig Sorgen bereitete bei ihrem Vorhaben, waren die Nachbarn. Sie hatten das Ei bisher nicht gesehen, und was sollte sie ihnen erzählen, wenn sie es im Garten entdeckten und neugierige (aber, wie sie fand, durchaus berechtigte) Fragen stellten?
Dass bisher niemand in der Siedlung etwas von dem Ei wusste, lag nicht nur an Frau Plaschkes mangelnden Kontakten, die es ihr unmöglich machten, ein so heikles Thema anzuschneiden, sondern vermutlich auch an den hübschen Vorhängen, mit denen sie in den letzten Wochen ihre zuvor gardinenlosen Fenster geschmückt und ihre Wohnung vor unbefugten Blicken geschützt hatte: niedliche Bistro-Gardinen in der Küche und duftige, strahlend weiße Stores im Wohnzimmer, so wie sie es bei den meisten Nachbarhäusern gesehen hatte. Doch nun würde sich ihr seltsamer Fund wohl nicht mehr lange verheimlichen lassen. Da sie nicht wusste, in welchem Tempo und bis zu welcher Größe das Ei noch wachsen würde, hatte sie entschieden, dass sie mindestens einen Geräteschuppen, wenn nicht gar ein Gartenhäuschen im Garten würde aufstellen müssen, wollte sie ihm ein ruhiges Wachstum ermöglichen und es zugleich vor Wind und Wetter schützen.
Mitte Juli wurde die schmucke Laube geliefert und von den jungen Männern, die sie brachten, auf Frau Plaschkes Wunsch hin gleich aufgebaut, obwohl sich dadurch die Kosten fast verdoppelten. Da sie sich für einen Platz nicht zu nahe an der Grundstücksgrenze entschieden hatte, wurde die Neuerung von den Nachbarn überwiegend wohlwollend aufgenommen. „Ah, ein Geräteschuppen! Da will sie sich wohl demnächst einen Satz ordentlicher Geräte zulegen. Vielleicht schafft sie es dann endlich, den Garten auf Vordermann zu bringen“, sagten sie. (Die verstorbene Großcousine hatte Frau Plaschke außer einem kümmerlichen Grabpflegeset keine Gartengeräte hinterlassen, da sie aufgrund ihres Alters und ihrer Gebrechlichkeit den Garten von einem Gärtner hatte pflegen lassen.)
Dass sich der Grimm der Nachbarn in den letzten Wochen zwar nicht verflüchtigt, aber doch deutlich gemildert hatte, hier und da sogar einer abwartend neutralen Haltung gewichen war, hatte Frau Plaschke nicht nur dem Umstand zu verdanken, dass sie sich zumindest ein paarmal bemüht hatte, die Gierschplage ein wenig einzudämmen (zu intensiver Gartenarbeit fehlte ihr momentan einfach die Zeit, sie war zu sehr mit der Pflege und Verschönerung ihres Heims beschäftigt), sondern auch den Gardinen, vor allem aber ihrer Erscheinung. In ihrer Bikerjacke war sie nach dem Blazerkauf nicht mehr gesehen worden, statt dessen hatten sich zu dem Blazer zwei weitere gesellt sowie drei Röcke in ihrem Alter angemessener Länge, zwei dunkle Hosen von zeitlosem Schnitt (sämtliche Artikel aus dem von Frau Döring empfohlenen Lagerverkauf) und drei Paar modische Schuhe mit unterschiedlich hohem Absatz. Die alte Lederjacke aber hing in ihrer Tüte am Garderobenhaken, und nur ganz selten dachte Frau Plaschke: Dich könnte ich eigentlich auch mal wieder anziehen, tat es jedoch nicht.
Auch das Ei hatte sich verändert. Es war nicht nur gewachsen, sondern seine Färbung hatte sich, entgegen Frau Plaschkes Erwartung, nicht aufgehellt wie beim Luftballon, der um so blasser wird je mehr man ihn aufbläst, sondern vertieft. Das gelbliche Grün des Fundtages war um einige Nuancen dunkler geworden und hatte einen Stich ins Bläuliche erhalten. Auffälliger jedoch war die Veränderung der Zeichnung, die Frau Plaschke schon seit längerem problemlos ohne Lupe erkennen konnte. Die roten Linien, mit denen die Pentagramme gezogen waren, erwiesen sich mit der Zeit (und das zu entdecken, hatte es zunächst doch wieder der Lupe bedurft) als aus einem Gewirr noch feinerer Linien gebildet, einer Verflechtung, um genau zu sein, die an keltische Hechtornamentik erinnerte, aber alles, was Frau Plaschke an keltischer Flechtornamentik kannte, bei weitem übertraf. Ihre Amulette vom Mittelaltermarkt, Repliken altirischen Schmucks, wie man ihr versichert hatte, wirkten plump und grob dagegen.
Hatte sie das Ei zunächst dem Pflanzenreich zugeordnet, danach dem Tierreich und es wiederum später für ein von Menschenhand geschaffenes Objekt gehalten, so war sie inzwischen einzig davon überzeugt, es nicht mit einem pflanzlichen Gebilde zu tun zu haben. Aber ob es sich um etwas Organisches handelte (Tierreich) oder etwas Anorganisches (Menschenwerk), konnte sie nicht entscheiden. Gelegentlich, aber wirklich nur gelegentlich, verspürte sie, wenn sie gerade mit Putzen beschäftigt war oder damit, ihre Garderobe zu ordnen, einen Anflug von Ekel, der sie denken ließ: Ich sollte das Ding wegschaffen, weit weg. Aber diese Anwandlungen verflogen ebenso schnell wie sie gekommen waren. Denn eigentlich war sie froh und dankbar, ein so seltenes Objekt beherbergen, beobachten und pflegen zu dürfen.
Zusammen mit dem Gartenhäuschen hatte Frau Plaschke sich vier Säcke Blumenerde und, wie die Nachbarn vermutet und gehofft hatten) einen Satz Gartengeräte liefern lassen — Spaten, Hacke, Grabegabel, Rechen, Laubbesen — ‚ denn auf dem Mofa hätte sie die sperrigen Gegenstände schlecht transportieren können. Irgendwann werde ich ein Auto brauchen, dachte sie, als sie die Geräte in den Schuppen trug. Anschließend schleppte sie eine große Zinkwanne, die sie im Keller entdeckt hatte, hinein und zum Schluss hängte sie Gardinen vor die beiden kleinen Fenster. Die Nachbarn beobachteten ihr Treiben mit verhaltenem Wohlwollen (wenn auch der eine oder andere fand, dass sie ein wenig übertreibe und jetzt von einem Extrem ins andere falle). Und dass sie eine halbe Stunde, nachdem sie die Blumenerde in den Schuppen geschafft hatte, diesen mit vier leeren (!) Säcken verließ, trübte dieses Wohlwollen nur wenig.
Seit einiger Zeit, wann es angefangen hatte, wusste sie nicht mehr, ertappte Frau Plaschke sich manchmal dabei, dass sie mit dem Ei sprach. Aber das mochte man einer alleinstehenden Dame vorgerückten Alters, die ein komisches Ding in ihrem Blumentopf liegen hatte, wohl durchgehen lassen, fand sie. Als sie sich nun, erschöpft von der körperlichen Arbeit, in einen Sessel fallen ließ und dem Ei erklärte, heute werde es umziehen, sie habe nur noch nicht entschieden, ob gleich, bei hellem Tageslicht, oder besser in der Nacht, denn so oder so würden die Nachbarn den Umzug wohl bemerken und schwer zu beantwortende Fragen stellen, glaubte sie eine Reaktion zu bemerken — ein leichtes Ruckeln, ein kaum hörbares Geräusch —, die sie einen Moment lang an ihrem Seh-, Hörund Urteilsvermögen zweifeln ließ. Dann wiederholte sie entschlossen und ein wenig lauter ihre Rede und schloss mit den Worten: „Ich hoffe, es wird dir in deinem neuen Domizil gefallen.“
Das Ei bewegte sich, diesmal gab es keinen Zweifel. Und ein ganz schwacher Ton, wie ein Klopfen, war zu hören. Frau Plaschke sprang auf. Das Stethoskop! Zu Großcousine Lohmanns Erbmasse gehörte neben anderem medizinischen Gerät auch ein Stethoskop (sie war Ärztin gewesen), und dieses Stethoskop würde sie, Frau Plaschke, nun holen und sich Gewissheit verschaffen!
Als sie mit klopfendem Herzen das Stethoskop an das Ei hielt und aus dessen Inneren recht schnelle, aber gleichmäßige Töne drangen, wie Herzklopfen, glaubte sie zunächst, ihren eigenen Herzschlag zu hören. Aber der Vergleich ergab, dass ihr eigenes Herz wesentlich lauter und sogar noch ein wenig schneller schlug. „Unglaublich“, murmelte sie, das Stethoskop wieder an das Ei gepresst. „Also, wenn du ein mechanisches oder elektronisches Ding bist, so eine Art Super-Tamagochi, dann — dann lass ich mir die Haare schneiden. Frau Döring meinte neulich, eine Frisur, wie Hillary Clinton sie trägt, würde auch mir gut stehen. Ich glaube, sie findet meine Zöpfe irgendwie exzentrisch, oder kauzig. Na ja. Und wenn du ein Vogel bist oder, aber das glaube ich eher nicht, ein Reptil, dann kommen eigentlich nur Vogel Rock, Vogel Greif oder Drache in Frage, die es ja nicht gibt, wie wir beide wissen. Aber wenn doch, lass ich mir auch die Haare schneiden.“
Da das Ei, wie erwartet, nicht antwortete, allenfalls wieder kaum merklich ruckelte, trat sie an die Terrassentür, schob den Vorhang zur Seite und spähte hinaus. Kein Nachbar war zu sehen. Nun gut, dachte sie, warum nicht jetzt? Das Ding fangt an, mir unheimlich zu werden, da will ich es nicht mehr so nah bei mir haben. Außerdem muss ich in Ruhe über alles nachdenken, und das kann ich am besten, wenn ich allein bin. Allein? wiederholte sie. Ich bin doch auch jetzt allein, oder nicht? Sie ging aber der Frage nicht weiter nach, sondern packte entschlossen das schwere Gebilde — Vorsichtig! Bloß nicht stolpern, ermahnte sie sich — und trug es in den Schuppen. Dort bettete sie es in die Wanne, strich die Blumenerde glatt und betrachtete zufrieden ihr Werk. Doch statt nun ins Haus zu gehen, um in Ruhe nachzudenken, wie sie es sich vorgenommen hatte, kam ihr eine andere Idee. Ich könnte eigentlich die neuen Geräte einmal ausprobieren, sagte sie sich. Außerdem wird die körperliche Arbeit mich beruhigen und die unangenehmen Gefühle vertreiben.
So geschah es auch. Frau Plaschke machte sich über die Gierschplantage am Zaun her, der ihr Grundstück von dem der Familie Heisterkamp trennte. Die Leute waren ihr nicht sonderlich sympathisch, weder die Eltern noch die beiden halbwüchsigen Söhne, aber das spielte keine Rolle; sie jätete ja nicht, um den Heisterkamps eine Freude zu bereiten. Eines aber musste sie zugeben, als sie mit der Grabegabel, die sich als besonders nützliche Anschaffung erwies, dem Giersch zuleibe rückte: Die bleichen Wurzeln wucherten nicht nur in Richtung Zierrasen (soweit von Zierrasen noch die Rede sein konnte), sondern bohrten sich ebenfalls unter dem Zaun hindurch in den heisterkampschen Garten. Da konnten die Heisterkamps schön ärgerlich werden, das sah sie ein.
Spät am Abend dieses Tages verspürte Frau Plaschke den Wunsch, noch einmal nach dem Ei zu sehen. Sie machte sich ein wenig Sorgen, ob es im Schuppen wohl gut aufgehoben sei. Sicherheitshalber nahm sie außer einer Taschenlampe auch das Stethoskop mit, um zu überprüfen, ob sie mittags tatsächlich ein Klopfen gehört hatte beziehungsweise ob es weiterhin unter der Schale klopfte.
Das Ei lag ruhig in seiner Wanne, leuchtete prächtig grün und rot, und aus seinem Innern drangen gleichmäßige leise Töne. „Was bist du nur für ein seltsames Ding?“ sagte Frau Plaschke. „Und was soll einmal aus dir werden?“
„Ich bin ein Basilisk“, antwortete das Ei, „und in gut fünf Monaten werde ich schlüpfen.“
Bei diesen Worten entglitt Frau Plaschke die Taschenlampe und ihr wurde für einen Moment schwarz vor Augen, aber nicht, weil die Taschenlampe zerbrochen wäre (sie leuchtete auf dem Schuppenboden liegend weiter friedlich vor sich hin) oder wegen der erschütternden Information, deren Sinn erst viel später in ihr Bewusstsein drang. „Du kannst sprechen?“ murmelte sie, als sie sich wieder halbwegs gefasst hatte. „Hast du tatsächlich gerade gesprochen?“ Zwar glaubte sie ein Geräusch zu hören, das man mit ein bisschen gutem Willen als „ja“ hätte interpretieren können, aber das mochte auch von der Schuppentür herrühren, deren Klinke sie schon gedrückt hielt, denn nun hatte sie es eilig, ins Haus zu kommen.
Eine Stunde und drei Gläser Wein später war Frau Plaschke so weit, das Stichwort „Basilisk“ im Lexikon nachzuschlagen. Zwar war sie in dem einen oder anderen ihrer Fantasy-Romane schon auf Basilisken gestoßen, konnte sich aber nicht mehr so recht erinnern, was es mit diesen Kreaturen auf sich hatte. Die Erklärung befriedigte sie wenig: Fabelwesen, dessen Blick tötet, wird meist als Hahn mit Schlangenschwanz dargestellt. Daher, und weil sie sich nicht mehr ganz nüchtern und aufnahmefähig fühlte, beschloss sie, eine gründlichere Suche auf den nächsten Tag zu verschieben.
Was sie fand, als sie die Fantasy-Abteilung der Bücherei durchforstete, erfüllte sie mit grimmiger Freude. Das Ei hatte gelogen, und das würde sie ihm so bald wie möglich unter die Nase reiben beziehungsweise vor Augen führen vielmehr ihm vorhalten und es zur Rede stellen.
Auf dem Weg zum Schuppen hielt sie kurz inne, um ihr Werk vom Vortag zu begutachten, als Herr Heisterkamp an den Zaun trat. Er lobte ihren Arbeitseinsatz, schmähte den Giersch als wahre Pest und fragte unvermittelt, was denn das für ein Ding gewesen sei, dass sie da gestern Nachmittag ins Gartenhäuschen getragen habe.
„Das ist ein Basiliskenei“, antwortete Frau Plaschke ohne zu zögern, „und Ende Dezember wird der Basilisk schlüpfen.“ Sie lachte herzlich, und Herr Heisterkamp stimmte ein. „Guter Scherz“, sagte er, „doch nun zu etwas anderem.“ Mit dem anderen meinte er das hübsche Schöllkraut, das üppig in Frau Plaschkes Garten wuchs, immer noch in Blüte stand und sich, wie Herr Heisterkamp es ausdrückte, ebenfalls zur Plage entwickeln könne, auch in seinem, dem heisterkampschen Garten, Stichwort Samenflug. Außerdem sei der Pflanzensaft giftig, schloss er seine Ausführungen.
„Und gut gegen Warzen und Hühneraugen“, erwiderte Frau Plaschke schnippisch, gab Herrn Heisterkamp aber im Stillen recht; sie würde sich in den nächsten Tagen um das Schöllkraut kümmern. Wenn sie es gleich täte, oder morgen, sähe es ja so aus, als würde sie dem blöden Heisterkamp gehorchen, und das ging nun wirklich zu weit. Außerdem wollte sie zu ihrem Ei.
Frau Plaschke kam gleich zur Sache, nachdem sie die Schuppentür geschlossen und sich mit einem Blick durch die Fenster vergewissert hatte, dass Herr Heisterkamp nicht mehr zu sehen war. Trotzdem sprach sie leise; er mochte sich außerhalb ihres Blickfeldes im Garten aufhalten und sie belauschen. Dem Burschen war alles zuzutrauen.
„Du behauptest also, ein Basilisk zu sein“, sagte sie streng (soweit es eben möglich ist, der Stimme beim Flüstern Strenge zu verleihen). „Das ist gelogen. Ich habe mich nämlich sachkundig gemacht. Ein Basilisk entsteht, wenn eine Kröte ein Hahnenei ausbrütet. Ich sehe hier aber keine Kröte, habe noch nie eine auf dir hocken sehen. Und ein Hahnenei ist das“ — sie zeigte auf das Ei — „bist du auch nicht.“
Ein Geräusch wie ein Räuspern drang aus dem Ei. Dann eine Stimme, klar und deutlich: „Weißt du, wie ein Hahnenei aussieht? Weißt du, auf welche Weise und wie lange eine Kröte brütet?“
„Nicht so laut!“ flüsterte Frau Plaschke, eher um Zeit zu gewinnen, denn sonderlich laut hatte das Ei nicht gesprochen. Sie musste sich eingestehen, dass sie auf beide Fragen keine Antwort wusste. Ein Hahnenei sah natürlich nicht wie ein Hühnerei aus! Peinlich, dass sie es sich so vorgestellt hatte. Und eine brütende Kröte, ein wechselwarmes Tier, ein Tier mit kaltem Blut, das brütete — das konnte sonstwie brüten. „Dann bist du also doch ein Basilisk?“
„Ja“, sagte das Ei. Eine Weile schwiegen beide. Schließlich ergriff Frau Plaschke das Wort. „Eigentlich müsste ich dich jetzt vernichten. Oder weit, weit wegschaffen, nach Garzweiler eins oder zwei, falls dir das was sagt. Jedenfalls in eine menschenleere Gegend. Denn, und da sind sich alle Quellen einig, du bist so ziemlich das gefährlichste Wesen, das es gibt. Dein Blick ist tödlich, und das Gebiet, in dem du dich aufhältst, kilometerweit verseucht. Aber wem erzähle ich das.“
Das Ei antwortete nicht. Denkt es nach? fragte sich Frau Plaschke. „Sag was!“ zischte sie schließlich. „Sonst nehme ich den Spaten und hau dich entzwei.“ Das war zwar eine leere Drohung — etwas so Brutales, Unappetitliches und Gefährliches hätte sie niemals über sich gebracht —, aber sie zeigte die gewünschte Wirkung.
„Dazu ist es zu spät. Ich bin schon zu weit entwickelt. Doch du brauchst keine Angst zu haben. Dir wird nichts geschehen, wenn du mir deinen Namen verrätst.“
„Plaschke“, sagte Frau Plaschke. Aber das Ei wollte den Vornamen wissen, und unter Erröten und Kritik an der elterlichen Wahl gestand Frau Plaschke, dass sie Alma heiße.
„Alma ist doch ein schöner Name. Und nun wirst du meinen erfahren. Merk ihn dir gut! Denn wenn du mich beim Namen nennst, sobald ich geschlüpft bin, wird mein Blick dir nicht schaden. Also, ich heiße Herbert.“
„Herbert?“ wiederholte Frau Plaschke fassungslos. „Seit wann heißen Basilisken Herbert?“ Sie hatte einen Namen mit mindestens zwei Apostrophen und einem Accent circonflexe erwartet. Außerdem war Herbert kein Name, den sie sich merken musste, Herbert brauchte sie nicht auswendig zu lernen. „Aha, Herbert“, sagte sie noch einmal. „Ja, so heiße ich.“
„Und was ist mit den anderen Leuten? Soll ich jetzt durch die Siedlung laufen und allen erzählen: ‚Mein Basilisk heißt Herbert, seid nur recht nett zu ihm und sprecht ihn mit seinem Namen an, dann wird euch nichts passieren.’?“
„Ich werde darüber nachdenken und mir etwas einfallen lassen. Doch jetzt muss ich ruhen und mich weiterentwickeln.“
Zwar hätte Frau Plaschke sich gern noch ein Weilchen mit dem Basilisken unterhalten — zum Beispiel wollte sie wissen, wie er nach dem Schlüpfen aussehen werde, ob tatsächlich wie ein Hahn mit Schlangenschwanz oder, das hatte sie in einer anderen Quelle gelesen, wie eine feiste Schlange mit einer goldenen Krone auf dem Kopf —, aber sie respektierte seinen Wunsch und verließ leise den Schuppen.
Zehn Tage später war Frau Plaschkes Garten schöllkrautfrei, und der Basilisk hatte sich, wie versprochen, einfallen lassen, auf welche Weise die Nachbarn vor