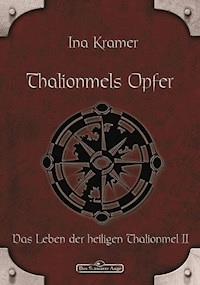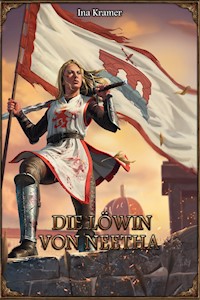Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Wir schreiben das Jahr 2010. Die dreizehnjährige Amber, ein Scheidungskind, ist gerade von der Haupt- zur Förderschule zurückgestuft worden. Sie lebt bei der Mutter, die den Tod von Ambers älterem Bruder Paul auch nach fast sieben Jahren noch nicht verwunden hat; Paul ist allgegenwärtig. Er war ein hübsches, liebenswertes, hochmusikalisches Wunderkind, Amber hingegen empfindet sich als unattraktiv, unintelligent und unmusikalisch. Was keiner weiß, auch ihr selbst ist es nicht bewusst: Sie besitzt eine ausgeprägte zeichnerische Begabung ... Umbra heißt Schatten ist zwar ein Jugendroman, aber er richtet sich auch an Erwachsene, die ein Interesse an jungen Menschen haben: Eltern, Lehrer, Erzieher ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ina Kramer wurde in Mülheim an der Ruhr geboren, machte Abitur in Essen, studierte Freie Kunst und Künstlerisches Lehramt an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf, unterrichtete vier Jahre lang Kunst an einem Duisburger Gymnasium, malte und nahm an einigen Gruppenausstellungen teil, assistierte Ulrich Kiesow beim Erstellen des Regelwerks für das Fantasy-Rollenspiel Das Schwarze Auge, trug durch Texte, darunter vier Romane, und zahlreiche Illustrationen zur Ausgestaltung der Spielwelt Aventurien bei, betreute als freie Lektorin diverse Romanprojekte, schrieb und schreibt Prosa und Gedichte. Sie lebt und arbeitet in Düsseldorf.
Bisher erschienen:
110 Gedichte
Die Albtraumgruppe und andere Erzählungen
Frau Plaschkes Abenteuer – Roman in drei Teilen
Vorletzte Betrachtungen – Gedichte Band 2
INHALT
Prolog
Kapitel,
in dem wir Amber kennenlernen, die gerade mit der S-Bahn zu ihrem Vater fährt
Kapitel,
in dem wir Ambers Vater und seiner Freundin Thea begegnen und ein Geburtstagsgeschenk angekündigt wird
Kapitel,
in dem Amber einen seltsamen Traum hat und ihn in ihr geheimes Notizbuch zeichnet
Kapitel,
in dem Amber im Bus einen netten Jungen sieht, ihre neue Klasse kennenlernt und in ein Fettnäpfchen tritt.
Kapitel,
in dem Amber Geburtstag hat, ihre Mutter mit dem Kellner flirtet und ein Computer installiert wird
Kapitel,
in dem Amber die Bekanntschaft des neuen Musiklehrers macht und im Internet auf das Wort Umbra stößt
Kapitel,
in dem Amber im Kunstunterricht etwas zeichnet, das nur Jenny gefällt
Kapitel,
in dem Amber und Jenny Vibraphon spielen, Kräuterschnaps trinken und sich von ihren Brüdern erzählen
Kapitel,
in dem Amber einen Manga findet, den netten Jungen kennenlernt und einen Künstlernamen erhält
Kapitel,
in dem Amber sich die Haare färbt, Zeichnen übt und einen Entschluss fasst
Kapitel,
in dem Amber und Jenny im Kunstunterricht eine gute Idee haben
Kapitel,
in dem Paul, der nette Junge, Amber ein Buch schenkt und ihr von einem Manga-Wettbewerb erzählt
Kapitel,
in dem Amber wegen einer Lüge zu spät zur Musikstunde kommt und abermals lügt
Kapitel,
in dem Amber eine Zeichnung entdeckt, die Jenny und sie zu einer eindrucksvollen Kunstarbeit inspiriert
Kapitel,
in dem Amber mit Paul an ihrem Wettbewerbsbeitrag arbeitet und eine kleine Schwester petzt
Kapitel,
in dem Amber erfährt, dass ihre Mutter Jenny Vibraphon-Unterricht erteilt
Kapitel,
in dem Ambers und Jennys Aufsätze vorgelesen werden, Amber von Hartmut, dem Freund ihrer Mutter, erfährt und von Paul besucht wird
Kapitel,
in dem Amber Paul ein Geständnis macht, Hartmut kennenlernt und mit Pauls Hilfe ihren Manga vollendet
Kapitel,
in dem Jenny verschwindet, wir vom Ausgang des Manga-Wettbewerbs erfahren, Amber einen Brief erhält und auf einer neuen Schule angemeldet wird
Epilog
Vorbemerkung
Wir schreiben das Jahr 2010. Damals waren Smartphones noch recht neu und daher viel weniger verbreitet als heute. Was es aber häufiger gab als heute, da es dank der Inklusion inzwischen fast gar nicht mehr anzutreffen ist, waren Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen.
Eine solche Schule besucht Amber, die Heldin unserer Geschichte.
Prolog
In der Mitte geht Paul, er schiebt den Kinderwagen. Die Eltern, rechts und links von ihm, halten sich hinter seinem Rücken bei den Händen. Sie blicken einander lächelnd an, dann Paul, dann das Baby im Kinderwagen, dann wieder einander. Sie sind sehr glücklich, das sieht jeder.
Paul ist sieben. Die dunkelbraunen Locken fallen ihm in die Stirn und über die Ohren, die großen blauen Augen werden von langen gebogenen Wimpern beschattet. Er konzentriert sich ganz aufs Wagenschieben, deshalb schaut er so ernst, fast ein wenig streng. Aber nein, streng ist er nicht. Er ist nur darauf bedacht, den Wagen sanft über alle Unebenheiten hinweggleiten zu lassen. Denn wenn der Wagen irgendwo aneckt, könnte das Baby sich erschrecken. Das will Paul vermeiden, er will es gut machen.
Das Baby ist jetzt sechs Monate alt. Durch feinen Flaum, zart wie ein Spinnweb, schimmert sein kahler Kopf. Die Farbe des Flaums kann man nicht erkennen, nur erraten. Hellbraun vielleicht, oder dunkelblond? Eben ist das Baby aufgewacht. Wovon? Das weiß man nicht. Vielleicht hat ein Sonnenstrahl es gekitzelt, vielleicht hat ein Vogel ihm ins Ohr gezwitschert, vielleicht hat es Mamas Blick gespürt. Oder Pauls? Es gähnt. Das Mündchen formt ein rosiges Oval, das länglicher und länglicher wird, und aus den fest zusammengekniffenen Augen dringen seitlich zwei Tränen. Nun spitzt es die Lippen, prustet Spuckebläschen, die zerplatzen und als glänzende Fäden zum Kinn rinnen. Gleich wird es lachen.
Das denkt Paul, der das kleine Schauspiel aufmerksam beobachtet. Ach, er hätte besser auf den Weg achten sollen, denn nun passiert es: Der Wagen stößt an einen Abfallkorb.
Ein Ruck, der das Baby ein wenig empor hebt, und der Wagen kommt zitternd zum Stehen. Gleichzeitig ein Geräusch, das bis in die Haarwurzeln und Zähne zieht: Die Metallfüße des Abfallkorbs schrammen über die Bürgersteigplatten.
Das Baby reißt die Augen auf. Es staunt, das Mündchen öffnet sich. Dann hebt es die Händchen, als wolle es winken, führt sie aber zu den Ohren. Und plötzlich, von einer Sekunde auf die nächste, verwandelt es sich. Das kleine Gesicht legt sich in Falten, wird rot und dunkel, immer dunkler, es scheint zu schwellen. Aus Ritzen zwischen den Wülsten der Lider quellen Tränen. Der Mund zieht sich in die Breite, die Winkel nach unten. Wie eine traurige Banane sieht er jetzt aus. Nein, wie eine Wunde. Wie eine merkwürdig geformte, nasse rote Wunde.
Das Baby schreit. Es brüllt. Das schreckliche Geräusch ist verklungen, der Wagen steht, und das Baby schreit. Es fuchtelt mit den Ärmchen und strampelt mit den Beinchen. Und brüllt. Es bekommt kaum noch Luft vor lauter schreien.
Paul ist ganz erschrocken. Was hat er da angerichtet? Er kann den Blick nicht von dem Baby wenden und kann doch kaum ertragen, was er sieht. Wie das Baby sich quält! Wie es nach Luft schnappt! Auch Paul schnappt nach Luft, hat Mühe zu atmen. Wenn das Baby nun erstickt? Was, wenn es erstickt? Dann ist das seine Schuld. Und wie hässlich es aussieht in seiner Qual, so rot und nass und runzlig! Auch das ist seine Schuld. Was soll er nur tun? Er ist starr vor Verzweiflung. Er wird noch blasser als er ohnehin ist, die großen blauen Augen füllen sich mit Tränen, die Haut unter den Augen nimmt einen bläulichen Schimmer an.
Paul beugt sich vor und streckt die Arme nach dem Baby aus. Nicht weinen, bitte! Hör auf zu weinen, bitte! Da spürt er den Atem der Mutter im Nacken: Du bist nicht schuld, es ist nichts passiert, gar nichts, das Baby schreit halt gern.
Der Vater lacht: So ein dummes kleines Baby! Pass auf, gleich kitzele ich es und lasse es durch die Luft fliegen, dann hört es auf zu weinen.
Ein Schatten wandert über den Wagen, vom Fußende zum Kopfende. Das Baby spürt ihn, verstummt augenblicklich. Es öffnet die Augen und blickt dorthin, von wo der Schatten kommt, ganz nach oben. Es ist nicht der Vater, der den Schatten wirft, auch nicht die Mutter, auch nicht Paul. Es ist etwas am Himmel. Die Eltern beachten den Schatten nicht, es wird wohl eine Wolke sein. Deshalb schauen sie nicht nach oben. Die Mutter tröstet Paul, der Vater macht du-du-du und ei-ei-ei, um das Baby zum Lachen zu bringen.
Das Baby zeigt zum Himmel, wo das Ding, das den Schatten wirft, seine Kreise zieht. Mutter und Vater denken, das Baby winke, und winken zurück. Jetzt lacht das Baby und strampelt fröhlich. Die Eltern freuen sich, sie lachen auch, nur Paul lacht nicht. Er atmet weiter in kurzen flachen Zügen, es klingt wie hecheln, er wird immer blasser.
Das Baby beobachtet, wie das Ding tiefer und tiefer kreist. Das ist spannend, das ist lustig. Der Vater macht weiter ei-ei-ei und du-du-du und kommt zum Wagen, die Mutter löst sich von Paul und kommt auch zum Wagen. Aber das Baby bemerkt sie nicht, es muss das Ding beobachten. Das fliegt nun so tief, dass sein Schatten alles bedeckt. Wo will es nur hin? Zum Baby? Zu Paul? Plötzlich legt es die Flügel an, fährt die Krallen aus, schießt herab und schnappt sich Paul.
Wusch, weg sind sie.
1
Von überbordender Vorfreude war in den letzten drei Jahren nur noch selten die Rede, wenn Amber zu Robert fuhr. Sie besuchte ihn ein- bis zweimal im Monat, je nachdem, wie er Zeit und sie Lust hatte. Diesmal hielt sich die Vorfreude noch mehr in Grenzen als sonst.
Amber hatte die Augen halb geschlossen und ließ ihre Gedanken treiben. Sie war die Strecke schon so oft gefahren, dass es nichts Neues mehr zu entdecken gab. Die Stöpsel steckten zwar im Ohr, aber sie hatte den MP3-Player nicht eingeschaltet. Sie wollte nur den Eindruck erwecken, Musik zu hören, denn wer Musik hört, den quatscht man nicht an. Und in ein blödes Gespräch verwickelt zu werden, darauf konnte sie im Moment bequem verzichten. Der Junge auf der anderen Seite vom Gang hatte ein paarmal zu ihr rübergeglotzt, jetzt guckte er wieder.
Amber drehte den Kopf zum Fenster. Die S-Bahn unterquerte gerade eine Autobahn, und für den kurzen Augenblick von Dunkelheit sah sie ihr Spiegelbild in der Scheibe: ein etwas zu dickes dreizehnjähriges Mädchen mit schmalen Lippen, dunkelblonden glatten Haaren, einem Glitzerstein im Nasenflügel und sorgfältig geschminkten Augen.
Der Nasenstecker war neu, Robert kannte ihn jedenfalls noch nicht. Aber die Diskussion darüber würde keine fünf Minuten dauern. Mama hat es erlaubt, würde Amber behaupten. Dass Mama es keineswegs erlaubt, vielmehr getobt und gedroht hatte, den Piercer wegen Körperverletzung anzuzeigen, würde Robert noch früh genug erfahren (falls er es nicht schon wusste). Jetzt war es eh zu spät, der Nasenflügel war durchstochen.
Ein Graureiher erhob sich mit schweren Flügelschlägen aus dem mit Unrat übersäten Waldstreifen neben den Gleisen. Ein paar Augenblicke lang flog er parallel zum Zug, dann hatte die S-Bahn ihn überholt und er war nicht mehr zu sehen.
Sie würde Robert als erstes von dem Reiher erzählen, dachte Amber. Er schätzte es, wenn sie die Augen offenhielt und Dinge beobachtete. Dass sie in der Lage war, einen Graureiher zu identifizieren, würde ihn regelrecht begeistern. Vielleicht war sie doch nicht die totale Niete, für die alle sie hielten, würde er denken, vielleicht würde doch noch mal was aus ihr werden.
Fast hätte Amber laut gelacht. Sie würde wieder die Schule wechseln, das war es, was aus ihr wurde. Aber nicht in Richtung Realschule oder gar Gymnasium. Nein, diesmal hatte sie die unterste Stufe der Leiter erreicht: Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen. (Sollte Lernen nicht der Schwerpunkt an allen Schulen sein? ging es ihr durch den Kopf.) Ihr machte das nichts aus, sie freute sich sogar schon ein bisschen auf die neuen Deppen, mit denen sie bald den Unterricht verschlafen würde. Bescheuerter als die Wichser und Zicken aus ihrer alten Klasse konnten die nicht sein. Außerdem gab es an der neuen Schule richtig putzige Unterrichtsangebote: Trommeln, Reiten, Tanzen, Klettern ... Das hatte die Schulleiterin bei der Anmeldung voller Stolz erzählt.
Trommeln! Tanzen! Amber konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. Sie schaute zu dem Jungen. Der stand gerade auf, schulterte seinen Rucksack und warf ihr, bevor er den Wagen verließ, einen frechen Blick zu.
Armer Robert, dachte Amber. Förderschule! Von dem Schock würde er sich nicht so bald erholen. Es sei denn, Mama hätte ihn schon eingeweiht. Das war gut möglich. Sie hatte zwar versprochen, es nicht zu tun, aber sie vergaß ziemlich oft, was sie versprach.
Robert war Ambers Vater. Er war Lehrer, Oberstudienrat, um genau zu sein, Englisch und Geschichte, und seit Amber Probleme in der Schule hatte, litt er. Ist ja auch peinlich für einen Lehrerpapa, wenn sein Töchterchen in der Schule nicht mitkommt, dachte Amber. Sie fragte sich, wann ihre Schulprobleme eigentlich begonnen hatten. Vor drei Jahren? Vor sechs? Hatte es je eine Zeit ohne Schulprobleme gegeben? Sie wusste es nicht. Sie erinnerte sich auch nicht, wann sie aufgehört hatte, ihren Vater Papa zu nennen. Aber Robert erinnerte sich: Als sie ihn das erste Mal nach seinem Auszug in der neuen Wohnung besuchte, habe sie plötzlich Robert zu ihm gesagt, behauptete er. Damals habe die neue Anrede etwas Trotziges oder Patziges gehabt, Amber habe sich fast dazu zwingen müssen.
Wie auch immer, Amber fand es cool, ihren Vater beim Vornamen zu nennen. Es passte irgendwie, war lässig, leicht distanziert und ein kleines bisschen respektlos.
Ihre Eltern hatten sich getrennt, als Amber fünf Jahre alt war. Sie hatten Pauls Tod nicht verkraftet, daran sei ihre Beziehung gescheitert. So lautete Mamas Version. Robert behauptete, Monika, also seine Ex, Ambers Mutter, habe sich in ihren Kummer regelrecht hineingewühlt, habe nur noch für ihren Schmerz gelebt, habe ihn gepflegt wie ein Kind, wie das Kind, dass sie verloren hatte. Und das habe er eines Tages eben nicht mehr ausgehalten.
Paul war Ambers großer Bruder. Sie hatte ihn nie kennengelernt, nicht wirklich jedenfalls. Als er starb, war sie noch ein Baby gewesen. Aber sie wusste, wie er ausgesehen hatte: wunderhübsch, wie ein Engel! Dunkelbraune Locken, strahlend blaue Augen mit langen gebogenen Wimpern. Wie sollte sie es auch nicht wissen, wo es in der Wohnung, Mamas und ihrer Wohnung, kaum ein Plätzchen ohne ein Foto von ihm gab. Auf dem heiligen Klavier standen gleich drei. Sie zeigten ihn mit vier, bei seinen ersten Spielversuchen, mit fünf, wieder am Klavier, und mit sieben, ein paar Monate vor seinem Tod. Da war er nicht mehr ganz so hübsch, weil die Brauen und Wimpern fehlten und er wegen der Glatze eine Mütze trug. Aber die blauen Augen leuchteten wie zuvor. Er hatte in seiner Altersklasse den ersten Preis im Klavierspielen gewonnen, einen kleinen goldenen Flügel, den er lachend in die Kamera hielt. Paul war nämlich ein Wunderkind gewesen.
Vielleicht hatten sich die Eltern, als sie Paul gemacht hatten, so sehr verausgabt, dass für sie nicht mehr allzu viel übrig geblieben war, dachte Amber. Das hatte sie sich schon des öfteren überlegt. Aber solche Gedanken laut zu äußern, kam nicht gut an, bei beiden nicht. Davon wollten weder Mama noch Robert etwas hören. Darin waren sie sich ausnahmsweise einig.
In Roberts Wohnung gab es keine Fotos von Paul, das war das Gute an seiner Wohnung. Natürlich besaß Robert auch Fotos von seinem Sohn, davon war auszugehen, aber sie hingen oder standen nicht überall herum wie bei Mama und ihr zu Hause.
Amber starrte in die Landschaft, die am Fenster vorüberzog, straffte sich schließlich und sah auf die Uhr. Noch siebzehn Minuten. Dann würde Robert sie mit dieser bekümmerten Miene empfangen, die er immer aufsetzte, wenn sie es verbockt hatte. Und diesmal hatte sie es wirklich abgrundtief gründlich verbockt.
Natürlich wusste Robert Bescheid. Alles andere war Quatsch. Mama und er teilten sich schließlich das Sorgerecht, da war Mama verpflichtet, ihn über alles zu informieren, das mit ihr, Amber, zu tun hatte. Und das Versprechen, ihm nichts zu sagen, war entweder einer von ihren Aussetzern oder eine pädagogische Maßnahme: Soll das Kind mal ruhig selbst erzählen, was es wieder für einen Mist gebaut hat, und kleine Brötchen backen. So in der Art.
Scheiße! Vielleicht wäre es das Beste, Robert anzurufen und den Besuch abzusagen. Ach Quatsch, so schlimm war es nun auch wieder nicht. Sie würde Robert anrufen und ihm erzählen, wie seeehr sie sich auf den Besuch freue.
Kaum dachte sie ans Telefonieren, da klingelte auch schon ihr Handy. Es klingelte wirklich, wie ein richtiges Telefon, so hatte sie es eingestellt. Von den albernen Klingeltönen, mit denen die Klassenzicken versuchten sich gegenseitig auszustechen, hielt sie nichts.
Robert war dran. „Hallo, Amber, Schatz, Papa hier. Du, ich bin noch in der Schule, die Konferenz dauert länger, tut mir Leid. Thea wird dich abholen. Aber sobald ich hier wegkann, fliege ich nach Hause. Und dann bringe ich Pizza mit und wir machen uns einen netten Abend. Okay? Ich habe auch eine Überraschung für dich. So, ich muss wieder rein. Also, bis gleich dann. Tschüss.“
„Bis gleich, tschüss“, sagte Amber und stopfte das Handy in die Tasche zurück. Von einem Augenblick zum anderen sackte ihre ohnehin nicht sonderlich gute Laune um weitere fünf Striche auf der Laune-Skala nach unten. Sie war plötzlich richtig sauer. Warum? Weil Robert wieder versucht hatte, sie zum Papasagen zu animieren, indem er sich selbst wie ein Dreijähriger als Papa bezeichnete? Vielleicht. Weil Robert sie nicht abholte und statt dessen Thea schickte? Weil Thea den Abend mit ihnen verbringen würde? Weil sie Robert mit Thea teilen müsste? Vielleicht auch das, ja, schon eher.
Wie immer, wenn Amber sauer war, verspürte sie einen Drang zum Kritzeln. Sie holte einen kurzen, abgenagten Bleistift und ein Notizbuch aus der Innentasche ihrer Jeansjacke, wo sie griffbereit steckten.
Man sah dem Büchlein an, dass es oft benutzt wurde. Der Einband war krumm und abgewetzt, die meisten Seiten hatten Eselsohren und waren über und über mit Kritzeleien bedeckt. Viel Text fand sich nicht auf ihnen, nur hier und da einzelne Namen, darunter auch Robert, Amber und Paul; Schreiben war nicht gerade Ambers Stärke und Lieblingsbeschäftigung. Lesen auch nicht.
Amber ließ die Seiten durch die Finger gleiten, bis sie eine freie Stelle gefunden hatte. Darauf begann sie nun ein Gesicht zu zeichnen: ein abgerundetes Dreieck als Kontur, darin schmale, schräggestellte Augen unter finster zusammengeschobenen Brauen, eine kleine spitze Nase, der Mund geöffnet mit nach unten gezogenen Winkeln. Amber füllte ihn ganz mit schwarzem Graphit. Dann folgten die Haare, wilde Striche und Zacken, die vom Kopf abstanden. Amber kritzelte immer heftiger und unkontrollierter, bald bedeckten die Bleistiftstriche das halbe Gesicht. Thea, schrieb sie daneben, klappte das Büchlein zu und steckte es in die Jackentasche zurück.
Thea war Roberts Freundin und der Grund, warum Amber sich seit drei Jahren weniger auf die Besuche bei Robert freute. Denn vor genau drei Jahren hatten die beiden sich kennengelernt und verliebt, und seitdem wusste Amber nie, ob sie nicht Thea in Roberts Wohnung antreffen würde, oder ob Robert, kaum dass sie zu ihm ins Auto gestiegen war, freudestrahlend verkünden würde: „Thea kommt auch gleich.“ Thea und Robert hatten nämlich getrennte Wohnungen. Noch, musste man sagen. In letzter Zeit war hin und wieder von Zusammenziehen die Rede gewesen. Wenn das geschähe, würde sie ihre Besuche drastisch einschränken, dachte Amber, soviel stand fest. Zwar fand sie Thea nicht wirklich unsympathisch, aber wenn sie Robert schon mal sah, dann wollte sie ihn auch für sich haben. Außerdem ging ihr die Frau auf die Nerven. Das war von Anfang an so gewesen. Weil Thea sich immer so krampfhaft bemühte, locker zu sein. Weil sie gelegentlich auch dann für Amber Partei ergriff und Robert widersprach, wenn der eindeutig Recht hatte. Ein leicht durchschaubares, doofes Manöver! Weil sie, wie sie sagte, für Amber so etwas wie eine Freundin sein wolle oder eine große Schwester.
So ein Quatsch! Wer hat schon Freundinnen oder Schwestern, die sechsundzwanzig Jahre älter sind?
Schon bei der Einfahrt in den Bahnhof sah Amber Thea auf dem Bahnsteig stehen. Sie selbst blieb unentdeckt, Thea schaute in die entgegengesetzte Richtung. Als Amber ihr auf die Schulter tippte, zuckte sie zusammen, drehte sich um und ordnete ihre Gesichtszüge blitzschnell zu einem strahlenden Lächeln.
„Hallo, Amber, schön, dich zu sehen! Was ist denn das? Ein Piercing? Ein echter Nasenstecker? Sieht hübsch aus. Steht dir gut.“
2
Noch bevor sie Theas Auto erreicht hatten, war Amber klar, dass Thea vom Wechsel zur Förderschule wusste. Das schloss sie aus Theas hektischer, irgendwie unnatürlicher Munterkeit. Und daraus, dass sie das Thema Schule regelrecht vermied. Normalerweise erkundigte sie sich nämlich immer als Erstes, was in Ambers Schule so lief. Nicht, dass sie das wirklich interessierte, das tat es nicht, davon war Amber überzeugt. Aber da Thea sich nun einmal auf die Rolle der großen Schwester und mütterlichen Freundin versteift hatte, empfand sie es wohl als ihren Job, Anteilnahme zu zeigen. Und die äußerte sich in den bescheuertsten Fragen, die man sich denken konnte.
Zum Beispiel: „Wie steht es denn mit der Liebe? Hast du inzwischen einen Freund?“
Oder: „Was macht ihr denn zur Zeit im Kunstunterricht? Collagen? Das ist sicher interessant. Ich habe Collagen immer gern gemacht, weil man da der Phantasie freien Lauf lassen kann und es nicht so kleckst wie beim Malen, ha ha ha.“
Thea erkundigte sich also nicht, wie es in der Schule gewesen sei, und das war gut. Es ersparte Amber, entweder zu lügen oder wahrheitsgemäß zu bekennen, dass sie geschwänzt hatte. Das war bisher erst zwei-, dreimal vorgekommen, aber diesmal eine absolute Notwendigkeit gewesen. Wieso Mama darauf bestanden hatte, dass sie selbst heute, am letzten Tag an ihrer alten Schule, den Unterricht besuchte, war ohnehin nicht nachzuvollziehen. Ihr Zeugnis hatte sie bereits, und mit dem Wechsel war alles geregelt. Erwartete Mama etwa, dass Amber sich brav von den Lehrern verabschiedete, denen sie die Rückstufung zu verdanken hatte? Oder dass sie ein letztes Mal wehmütig Hauptschulluft schnupperte? Nein danke. Darauf war sie genauso wenig scharf wie auf die hämischen Blicke der Zicken und Wichser, die vermutlich alle Bescheid wussten. Und so war sie ein paar Stunden lang durch die Stadt geschlendert, hatte sich auf der Kaufhaustoilette die Augen geschminkt und die knapp schulterlangen Haare hochgesteckt, weil sie fand, dass sie das älter oder erwachsener aussehen ließ. Anschließend hatte sie die Auslagen der Boutiquen begutachtet, bis es Zeit war, in die S-Bahn zu steigen. Falls sie jemand gefragt hätte, warum sie nicht in der Schule sei, hätte sie gesagt: „Heute gibt es Halbjahreszeugnisse, da haben wir früher frei.“ Es fragte sie aber keiner.
Statt nach der Schule erkundigte sich Thea nach dem Nasenstecker. Ihn hielt sie wohl für ein unverfängliches Thema, an das sie sich klammern konnte.
„Und deine Mutter hatte nichts dagegen?“
„Nö.“
„Sie hat das sofort erlaubt?“
„Jau.“
„Super, das finde ich cool. Meine Mutter hätte einen Aufstand gemacht, wenn ich ihr gesagt hätte, ich wollte mir den Nasenflügel durchstechen lassen. Ich musste ja schon bei den Ohrlöchern wochenlang betteln, und da war ich sechzehn. Hat das nicht sehr weh getan?“
„Nö.“
„Und der Stein, ist das ein echter Saphir?“
„Nö, Glas, glaube ich.“
„Kann sich das nicht leicht entzünden, wenn du Schnupfen hast, oder so?“
„Keine Ahnung.“
So ging das noch eine Weile weiter. Nach dem Nasenstecker kam Ambers Outfit an die Reihe, das Thea auch cool fand, obwohl es ganz normal war, danach die hochgesteckten Haare. Amber beantwortete alle Fragen mürrisch und einsilbig, sie hatte einfach keine Lust, mit Thea zu reden. Klar, Thea meinte es gut und gab sich Mühe, aber hatte sie irgendjemand darum gebeten? Nein, niemand. Deshalb genoss es Amber fast, sie so kurz angebunden abzufertigen.
In Roberts Wohnung angekommen, schnappte Amber sich gleich die Fernsehzeitung und vertiefte sich in die Lektüre des Programms. Das heißt, sie las gar nicht wirklich, schaute sich nur die Fotos an, und auch das ohne wirkliches Interesse. Hoffentlich kommt Robert bald nach Hause, dachte sie.
Endlich kam er, beladen mit Schultasche und drei Pizzakartons. Nachdem er sich von seiner Last befreit und Thea einen flüchtigen Kuss gegeben hatte, schloss er Amber in die Arme. Bevor er sie aus der Umarmung entließ, hielt er sie ein paar Sekunden lang bei den Schultern gefasst und schaute ihr forschend in die Augen. Sein kummervoller Blick verriet alles: Mama hatte ihm nicht nur von dem Schulwechsel, sondern auch von dem Nasenstecker erzählt. Aber er wollte wohl nicht als erstes auf die Neuerwerbung, die er vermutlich eher als Verstümmelung oder Verunstaltung empfand, zu sprechen kommen, um nicht schon gleich zu Beginn die Stimmung zu versauen. Und das Thema Förderschule sollte wohl ebenfalls noch ein bisschen aufgeschoben werden. Also erkundigte er sich beim Pizzaessen zunächst nach Ambers Mutter.
„Und, wie geht es Mama?“
„Danke, super.“
„Super? Wirklich? Was macht sie denn so?“
„Einmal die Woche geht sie zum Friedhof, aber da muss ich inzwischen Gott sei Dank nicht mehr mit, und einmal im Monat zur Selbsthilfegruppe. Das tut ihr unheimlich gut und bringt ihr unheimlich viel, sagt sie. Ansonsten ist sie ziemlich schusselig, das ist aber nicht Alzheimer, sondern kommt von den Psychopillen. Den Haushalt und ihren Job kriegt sie aber trotzdem so einigermaßen auf die Reihe.“
„Du hilfst ihr doch bei der Hausarbeit, oder?“
„Ich? Nö. Wieso? Ist doch ihr Haushalt. Außerdem will Mama das auch gar nicht. Ich soll lieber Schularbeiten machen.“
Robert wollte etwas einwenden, aber Thea kam ihm zuvor.
„Es ist heute nicht mehr üblich, dass die Kinder bei der Hausarbeit helfen. Zu deiner Zeit war das noch so, aber selbst ich musste kaum noch mit anpacken. Ab und zu mein Zimmer aufräumen, klar, und das fand ich schon ätzend genug.“
Amber grinste. Thea war so leicht zu durchschauen. Tat so, als ob sie und Amber ungefähr derselben Generation angehörten. Dabei war sie mit ihren neununddreißig Jahren altersmäßig viel näher am Robert dran. Für Amber machten die elf Jahre Unterschied zwischen den beiden keinen großen Unterschied, fünfzig fand sie alt, neununddreißig fand sie ziemlich alt, und Mama mit ihren sechsundvierzig war auch schon ganz schön alt. Wenn sie das Alter dieser drei Personen nicht gekannt hätte, sie hätte es nicht schätzen können. Bei diesen Mittel- oder Obermittelalten fiel ihr das schwer. Genauso, wie zu entscheiden, ob sie hübsch oder hässlich waren. Dick, hager, unmöglich angezogen, beschissene Frisur – so etwas sah sie. Aber darauf, dass zum Beispiel Robert „ein gut aussehender Mann“ war, Mama „eine aparte Erscheinung“ und Thea „jugendlich“, wäre sie von selbst nie gekommen.
„Heute Abend läuft eine Casting-Show im Fernsehen, das hast du ja sicher eben schon entdeckt. Die mit den Top-Models meine ich. Sollen wir die gucken?“ unterbrach Thea Ambers Gedankengang.
„Nein danke.“
Die Zicken aus Ambers Klasse waren ganz scharf auf diese Sendungen, nicht nur auf Top-Models, auch auf Superstars, Popstars, Popbands und was es sonst noch alles gab. Das war für Amber Grund genug, solche Shows nicht zu gucken. Sie hatte es aber doch einmal getan, zusammen mit Mama, und obwohl sie Mama ungern recht gab, hatte sie deren vernichtendem Urteil über die Möchtegern-Models und ihre Dompteuse nicht widersprochen.
Amber warf Thea einen finsteren Blick zu, doch plötzlich hellte sich ihre Miene auf.
„Isst du das nicht mehr?“ fragte sie und zeigte auf den Pizzarest auf Theas Teller.
„Weil, wenn du das nicht mehr willst, esse ich es noch.“
„Du solltest vielleicht ...“ begann Robert, aber Amber unterbrach ihn.
„Ich weiß, ich sollte ein bisschen auf meine Figur achten und nicht so viele Kalorien in mich reinstopfen. Aber erstens ist heute ein besonderer Tag, weil ich bei dir zu Besuch bin, und da soll ich sicher nicht fasten. Zweitens sind in meiner Klasse ziemlich viele Dicke, und ich soll mich doch anpassen, sagst du immer. Und drittens sind an meiner neuen Schule noch mehr Dicke, das habe ich schon mitgekriegt, und dann passt es ja, wenn ich noch ein bisschen zulege. Ach ja, ab Montag besuche ich die Förderschule. Aber das wisst ihr natürlich schon.“
Robert nickte und Thea senkte den Blick. Irgendwie schuldbewusst, wie Amber fand. Sie hatte gar nicht vorgehabt, das Thema Förderschule anzuschneiden. Es war einfach passiert. Doch jetzt, wo er heraus war, fühlte sie sich seltsam erleichtert. Sie biss ein großes Stück von Theas Pizza ab und kaute genüsslich.
„Wieso?“ fragte Robert nur. Er schüttelte den Kopf. „Wie konnte das nur passieren?“
Amber schluckte, bevor sie antwortete. Wie bemitleidenswert Robert aussah, wenn er einen so bekümmerten Blick aufsetzte! Gar nicht wie eine Respektsperson, die er als Lehrer doch war oder zumindest sein sollte.
„Tja“, sagte Amber, „es hat sich leider herausgestellt, dass ich zu blöd für die Hauptschule bin. Mein Halbjahreszeugnis ist unter aller Sau, und da ich schon einmal sitzengeblieben bin, wie du weißt, und mit Sicherheit wieder sitzenbleiben würde, haben die Lehrer entschieden – oder empfohlen, das weiß ich nicht genau –, dass ich in Zukunft die Förderschule besuchen soll. Aber es gibt einen kleinen Trost: In Kunst habe ich eine Drei plus und in Sport eine glatte Drei. Erstaunlich, nicht? Wo ich doch so dick bin.“
„Du bist nicht dick, ein bisschen pummelig vielleicht, aber nicht dick“, sagte Thea.
Amber beachtete sie nicht. „Um sicher zu gehen, haben sie mich auch noch einen IQ-Test machen lassen. Mein IQ ist leider ebenfalls unter aller Sau, dreiundneunzig, glaube ich. Das ist für Förderschule zwar ziemlich gut, aber für die Hauptschule reicht es nun mal nicht. Dazu kommt, ich bin bekanntlich Legasthenikerin und ich leide an Dyskalkulie. Dyskalkulie ist aber noch nicht anerkannt als Macke und gilt somit als Blödheit. Außerdem bin ich unangepasst, kann mich schlecht konzentrieren ...“
„Du bist nicht blöd! Wer hat denn diesen bescheuerten IQ-Test durchgeführt? Mit dem würde ich gern mal ein Wörtchen reden. Hast du dich überhaupt angestrengt oder einfach nur irgendwas hingekritzelt, das dir gerade so in den Sinn kam?“
„Diese IQ-Tests sind ja inzwischen ziemlich umstritten“, sagte Thea. Robert warf ihr einen schwer deutbaren Blick zu. Amber fand, er sah aus wie: Halt du dich da raus! Aber da mochte sie sich auch irren.
„Aber Robert, ich strenge mich doch immer an. Das weißt du“, sagte sie.
„Und was hast du in Musik? Du bist ja musikalisch, in Musik hattest du doch bisher auch immer eine ganz gute Note. Diesmal etwa nicht?“
Falsche Frage, dachte Amber. Ganz, ganz falsche Frage. Seit anderthalb Jahren hatte sie keinen Musikunterricht mehr, weil es nur einen einzigen Musiklehrer an der Schule gab. Das wusste Robert, das hatte sie ihm erzählt, das musste er wissen.
„Wir haben bekanntlich keinen Musikunterricht“, antwortete sie schroff. „Lehrermangel. Und wie kommst du darauf, dass ich musikalisch bin? Ich glaube, du verwechselst da was. Mein großer Bruder, Paul, du wirst dich an ihn erinnern, der war musikalisch. Der war sogar ein Wunderkind, hat Preise gewonnen und wäre bestimmt ein weltberühmter Pianist geworden, wenn er nicht...“
Amber biss sich auf die Lippe. In ihrem Ärger war sie zu weit gegangen. Am Zucken von Roberts Lid sah sie, wie sehr sie ihn mit ihrer Bemerkung über Paul verletzt hatte. Natürlich erinnerte er sich an seinen Sohn! Und, das wurde Amber plötzlich klar, er trauerte noch, immer noch. Sie fand das seltsam, unpassend, es war ihr irgendwie unangenehm, denn sie hatte gedacht, nach all den Jahren müsste er langsam drüber weg sein.
„...gestorben wäre“, vollendete Robert ihren Satz. „Aber wir reden hier nicht über Paul, sondern über dich. Du besuchst also ab Montag die Förderschule. Nun ja, ein Beinbruch ist das nicht, du scheinst es ja auch ziemlich locker zu nehmen, und wenn du von dort gute Noten nach Hause bringst, wovon ich ausgehe, dann kannst du wieder auf die Hauptschule zurück, sagt deine Mutter.“