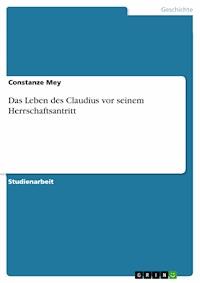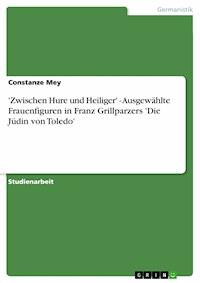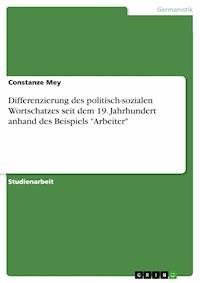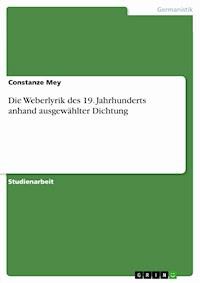Frauen und der Linksterrorismus. Wie aus der Journalistin Ulrike Meinhof eine Terroristin wurde E-Book
Constanze Mey
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Terrorismus ist allgegenwärtig. Analog und digital wird über Anschläge berichtet und werden Möglichkeiten der Terrorbekämpfung diskutiert. Rechts- oder Linksterrorismus, religiöser oder nationalistischer Terrorismus – gleich welcher Art, Gewalt bleibt Gewalt. Warum werden Menschen aus unserer Gesellschaft zu Terroristen? Und sind es tatsächlich nur Männer, die bereit sind, zu Waffen zu greifen? Ulrike Meinhof (1934-1976) war eine deutsche Journalistin, die sich im Laufe ihres Lebens immer weiter radikalisierte. Sie war Gründungsmitglied der „Roten Armee Fraktion“ (RAF), einer linksextremistischen Vereinigung in der Bundesrepublik Deutschland. Doch sie war auch Ehefrau, Mutter und überzeugte Pazifistin. Welche Umstände führten dazu, dass sie keine andere Wahl sah, als in den terroristischen Untergrund zu gehen? Diese Fragestellung lenkt den Blick auf die Rolle von Frauen im Terrorismus und bildet die Grundlage für den vorliegenden Band. Aus dem Inhalt - Weibliche Wege in den Linksterrorismus - Der Weg einer Journalistin in den Terrorismus - Gewaltbereitschaft von Frauen - Analyse der Sprache von Ulrike Meinhof unter dem Aspekt ihrer Radikalisierung - Meinhof und Ensslin als Mitglieder der RAF
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Lektorat: Funda Kaplan
Copyright © 2016 ScienceFactory
Ein Imprint der GRIN Verlag GmbH
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: wikimedia.org
Frauen und der Linksterrorismus
Wie aus der Journalistin Ulrike Meinhof eine Terroristin wurde
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis. 3
Frauen und Terrorismus am Beispiel der RAF und der Bewegung 2. Juni5
Vorwort6
Stellung der Frauen in den 60er und 70er Jahren. 8
Frauen in der RAF. 10
Gründe für den Terrorismus. 14
Lebenslauf einer typischen Terroristin der RAF und der Bewegung 2. Juni18
Darstellung der Terroristinnen in den Medien. 19
Schluss. 20
Literaturverzeichnis. 21
Frauen in der „Roten Armee Fraktion“. Weibliche Wege in den Linksterrorismus am Beispiel von Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin. 22
Einleitung. 23
Außerparlamentarische Oppositionsbewegungen in der BRD.. 33
Frauen in der BRD.. 40
Geschichte der „Roten Armee Fraktion“. 45
Erklärungsversuche für Wege in den Linksterrorismus. 55
Weibliche Wege in den Linksterrorismus. 71
Fazit118
Literaturverzeichnis. 122
Ulrike Meinhof. Der Weg einer Journalistin in den Terrorismus. 131
Einleitung. 132
Familiärer Hintergrund. 133
Studienzeit in Marburg. 134
Studienzeit in Münster oder „Kampf dem Atomtod“. 136
Kommunistin - Eintritt in die KPD.. 139
Beginn einer journalistischen Karriere. 140
Chefredakteurin. 142
Notstandsgesetze. 143
Rotbuch II und DFU.. 146
„Hitler in Euch“. 147
Hochzeit148
1. Mai-Kundgebung 1962 und die neue Linke. 149
Probleme mit dem Arbeitgeber150
Geburt und Hirntumor151
Die deutsche Vergangenheitsbewältigung. 152
Hörfunk- Ein neues Medium.. 154
Der Schah und Benno Ohnesorg. 156
Rudi Dutschke. 157
Gewalt in der Diskussion. 159
Ein Kaufhausbrand und seine Folgen. 161
Gefangenenbefreiung oder der Anfang vom Ende. 163
Rote Armee Fraktion. 165
Fazit167
Literaturverzeichnis. 169
„Sie hätten nicht die Macht, wenn sie nicht die Mittel hätten, die Schweine.“ Eine diachronische Analyse der Sprache von Ulrike Meinhof unter dem Aspekt ihrer Radikalisierung. 171
Einleitung. 172
Theorie und Methode. 174
Zeithistorischer Kontext182
Analyse der zentralen Texte. 185
Auswertung. 200
Fazit und Ausblick. 202
Literaturverzeichnis. 204
Anhang. 209
Einzelbände. 211
Frauen und Terrorismus am Beispiel der RAF und der Bewegung 2. Juni
Yvonne Diewald, 2012
Vorwort
Die Regierung zu dieser Zeit unterdrückte die parlamentarische Opposition, verabschiedet Notstandsgesetze und die Angst vor einem erneuten NS-ähnlichen Staat griff vor allem in den Kreisen der Studenten um sich. Die Konflikte zwischen der „Nazi-Generation“ und der Jugend waren schier unüberbrückbar. Während die Generation des 2.Weltkrieges nach Ruhe und Ordnung strebte und das Erlebte zu vergessen versuchte, kämpfte die Jugend mit aller Kraft gegen die Unterdrückung des Erlebten. Sie strebte nach politischer und gesellschaftlicher Veränderung. Hauptsächlich Studenten gingen auf die Straßen, um gegen die Ungerechtigkeit in ihrem Land, aber auch die in der ganzen Welt zu demonstrieren. Doch wurden diese Demonstrationen immer öfter mit Polizeigewalt niedergeschlagen. Die Angst vor einem Polizeistaat wurde größer!
Am 2. Juni 1967 wird der Student Benno Ohnesorg bei einer Demonstration von einem Polizisten erschossen. Ob absichtlich oder aus Notwehr bleibt jedoch weitgehend ungeklärt. Dies war der Beginn der außerparlamentarischen Opposition, welche die Unterlegenheit der parlamentarischen Opposition kritisierte, die zustande gekommen war, da die zwei größten Parteien eine Koalition gegründet hatten.
Aus dieser außerparlamentarischen Opposition gründeten sich nach kurzer Zeit die radikaleren linksterroristischen Gruppen, unter welchen die Bedeutendsten die RAF und die Bewegung 2. Juni waren. Ihre Überzeugung, „dass der Kapitalismus ein Werkzeug zur Ausbeutung und Unterdrückung der Schwachen und damit ein Grundübel der Menschheit sei“[i], war so stark, dass sie hauptsächlich in der RAF viele Jahre überdauerte. Insgesamt kämpfte die Rote Armee Fraktion 28 Jahre lang, in drei Generationen, gegen die Regierung. Dabei schlossen sich nicht nur Männer, sondern auch erstaunlich viele Frauen dieser Gruppen an. Dieses Phänomen war der Bundesrepublik Deutschland zu dieser Zeit völlig neu. In Palästina gab es schon ähnliche Gruppen, wie die terroristische Vereinigung um Abu Hani, welche auch später Kontakte zur RAF hatte. Die Entführung des Flugzeuges „Landshut“ am 13. Oktober 1977[ii] war ein Resultat aus diesen Kontakten. Dabei waren unter den vier palästinensischen Entführern zwei Frauen, die ebenso, wie ihre männlichen Genossen bewaffnet waren und ihre Waffen bei der Befreiungsaktion durch die GSG 9 einsetzten. In Irland kämpften Frauen an der Seite der Männer in der Irisch-Republikanischen Armee und mordeten ebenso brutal und effektiv wie diese.[iii]
Diese Seminararbeit beschäftigt sich dabei allein mit den Frauen der RAF und der Bewegung 2. Juni, da sie eine Besonderheit zu ihrer Zeit waren. Die Frage dabei ist: Warum engagierten sich plötzlich so überdurchschnittlich viele Frauen in terroristischen Vereinigungen, welche Vorteile aber auch Nachteile zogen sie daraus?
Stellung der Frauen in den 60er und 70er Jahren
Gesellschaftliche Stellung
Nach Ende des zweiten Weltkrieges, besaßen die Frauen in der BRD eine tragende Rolle. Ihre Männer waren zum Teil im Krieg gefallen, verletzt oder schwer traumatisiert. Während viele Soldaten noch etliche Jahre in russischer oder französischer Gefangenschaft verbrachten, begannen die Frauen, ihr Deutschland wieder aufzubauen. Schon während des Krieges hatten die Frauen Teile der Männerwelt übernommen. Aus Arbeitermangel ersetzten die Frauen ihre Männer in den Fabriken. Trotzdem wurden sie von ihren Männern und der Gesellschaft in ein Rollenbild gesteckt, in welches sie sich zu fügen hatten. Eine arbeitende Frau wurde nicht gern gesehen, schon gar nicht, wenn sie Ehefrau und Mutter war. Die Fabrikarbeiterinnen kehrten jedoch nach Ende des zweiten Weltkrieges still und protestfrei an den heimischen Herd zurück. Vergessen waren die aufopfernden Jahre am Fließband und der Männerarbeit. An eine erneute Frauenbewegung, wie es sie Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben hatte und die gewaltsam durch die Verfolgung und Ermordung ihrer Verfechter geendet hatte, war nicht mehr zu denken. Es ging darum, Deutschland wieder aufzubauen und dabei sah die Bevölkerung keinen Platz für den erneuten Kampf um die Gleichstellung und Anerkennung der Frau. In der 1948 gegründeten Verfassung hieß es zwar in Artikel 3 des Grundgesetzes: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, die eigentliche Gleichberechtigung unter Aufsicht des Gesetzes wurde jedoch erst 1994 durch den Zusatz „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“[iv] gesichert.
Inge Viett, ein Mitglied der Bewegung 2. Juni, welche später zur RAF überlief beschrieb die damaligen Verhältnisse als „gesellschaftlichmoralische[…] Zwänge“ die sie selbst als „erdrückend“ wahrnahm.[v] Wer diesen Maßstäben nicht entsprechen wollte oder konnte und sein Leben anders gestaltete, als es die Gesellschaft von ihm verlangte, dem würde sein Fehlverhalten vor Augen geführt werden.[vi] Eine Frau hatte nur bestimmte Berufe auszuüben, wie Kinderpflegerin oder ähnliche im Sozialwesen verankerte Beschäftigungen.[vii] Nicht nur in der Arbeitswelt wurden dem weiblichen Geschlecht Rollenbilder vorgeschrieben, auch in der Ehe und Familie galt die Frau als dem Mann untergeordnet. So hat demnach der Prototyp Mann in den 50er und 60er Jahren von seiner Frau „absoluten Gehorsam und Unterordnung abverlangt […] und dies für den ihm selbstverständlich gebührenden Respekt [gehalten]“[viii]. Frauen war es zwar rein rechtlich erlaubt, zu studieren, aber das Vorurteil, sie würden die Universität nur aus dem Grund besuchen, einen wohlhabenden Heiratskandidaten ausfindig machen zu können, verhinderte, dass sie wirklich ernst genommen wurden.[ix] Erst ab 1970 begann die Zeit der Frauen, in der sie sich endlich durchsetzten konnten und sich das Bild der Frau in der Öffentlichkeit endlich zu wenden begann. In Berlin wurde das erste Frauenzentrum eröffnet und auch in anderen Städten wurden Vereine zur Unterstützung von Frauen gegründet.[x]
Politische Stellung
Die politische Stellung der Frau war nur die Folge aus ihrer gesellschaftlichen Stellung heraus. Als fürsorgliche Frau, die dem Willen ihres Mannes ihre höchste Aufopferung entgegen zu bringen und für warme Mahlzeiten und die Kindererziehung zu sorgen hatte, kam es gar nicht erst in Frage, dass sich Frauen an politischen Entscheidungen beteiligten. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung waren in den 60er Jahren 27 Prozent der Männer für eine Beteiligung von Frauen an der Politik. Doch kann man nicht allein den Männern Vorwürfe machen, da ein großer Teil der Frauen sich in das ihnen vorgegebene Rollenbild fügte und nur 32 Prozent der weiblichen Befragten für Frauen in der Politik stimmten.[xi] Diese Aussage spiegelt den Zustand der von Männern dominierten Politik wieder. Von den 65 stimmberechtigten Mitgliedern des parlamentarischen Rates waren gerade einmal vier Frauen darunter: Frieda Nadig, Helene Wessel, Elisabeth Selbert und Helene Weber.[xii] Ihnen war es zu verdanken, dass Artikel 3 des Grundgesetzes verabschiedet wurde, in welchem die Gleichberechtigung von Mann und Frau vorgeschrieben wird. Trotz diesem Artikel war es den Frauen bis Ende der 70er Jahre nicht möglich, die tatsächliche Gleichberechtigung in der Gesellschaft durchzusetzen. Frauen, welche sich politisch engagierten, wurden gesellschaftlich geächtet.[xiii] Frauen hatten in der Politik nichts zu suchen. Sie wurden missachtet und belächelt.
Dies zeigt auch die Reaktion der Medien auf das ausschließlich weibliche Präsidium des Deutschen Bundestages im März 1966. Die Bielefelder „Freie Presse“ beispielsweise beschrieb die Situation folgendermaßen: „Schmunzelnd und dann mit offener Heiterkeit beugten sich gestern die männlichen Abgeordneten im Bundestag weiblicher Vorherrschaft“.[xiv]
Frauen in der RAF
Frauenanteil in der RAF und der Bewegung 2. Juni
Ein überaus großer Anteil an RAF-Terroristen waren Frauen. Allein 1977 nach der Ermordung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback und dem Vorstandssprecher der Dresdner Bank Jürgen Ponto wurden sechzehn Terroristen mittels Fahndungsplakaten gesucht und davon waren allein zehn Frauen.[xv] Dabei war das Ponto-Attentat von sechs Mitgliedern geplant und von vier direkt ausgeführt worden. Die Gruppe setzte sich aus Peter-Jürgen Boock, Christian Klar, Brigitte Monhaupt, Sieglinde Hofmann, Elisabeth von Dyck und Susanne Albrecht zusammen, wobei die eigentliche Tat von Susanne Albrecht, Brigitte Monhaupt und Christian Klar ausgeführt wurde[xvi]. In den Nachrichten am Abend nach der Tat wurden ausschließlich Frauen als gesuchte Terroristen gezeigt.[xvii] Das zeigt die deutliche Präsenz der Frauen innerhalb der RAF. Insgesamt wirkten mehr Frauen als Männer bei den Anschlägen im Jahr 1977 mit. Allein nach dem „deutschen Herbst“ (Mitte 1977), welcher die Entführung und Ermordung Hans-Martin Schleyers beinhaltet hatte, waren von 18 gesuchten Terroristen 13 Frauen.[xviii] Dieses Phänomen galt auch für die Bewegung 2. Juni. Diese entführte 1977 den österreichischen Industriellen Walter Palmers, wobei unter den Tatverdächtigen hauptsächlich Frauen waren: Gabriele Rollnik, Juliane Plambeck, Inge Viett, Ina Siepmann, Gabriele Kröcher-Tiedmann, Ingrid Barbas, Klaus Viehmann, Christian Möller und der österreichische Staatsbürger Thomas Gratt.[xix]
Stellung der Frauen innerhalb der RAF
Obwohl es innerhalb der Gruppe kein bestimmtes Oberhaupt gab, fungierten doch einige Persönlichkeiten als solches. Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof, Andreas Baader und Jan-Carl Raspe waren die Gründer der RAF und hatten somit eine spezielle Rolle inne, die ihnen automatisch den Respekt der anderen Mitglieder verschaffte. Dabei fanden keinerlei Unterscheidungen zwischen den Geschlechtern statt. Eine Frau wurde mit ebensoviel Respekt behandelt wie ein Mann. Ein Grund dafür war sicherlich der gemeinsame Kampf gegen die Übermacht des Staates. Innere Streitereien und Machtkämpfe, die die Gruppe schwächen würden, konnte sich keiner leisten. Die Unterordnung der Frau kam nicht in Frage, da jeder gebraucht wurde. Allerdings konnte während des Bestehens der RAF beobachtet werden, dass sich Frauen nicht nur gleich mit den Männern stellten, sondern dass sie zusätzlich eine immer markantere Stellung einnahmen. Zu Gudrun Ensslin und Brigitte Monhaupt als zwei von vier Gründungsmitgliedern gesellte sich alsbald Brigitte Monhaupt, die noch in der zweiten Generation nach ihrer Haftentlassung als Oberhaupt der Gruppe fungierte. Beweise sind dafür ihre enge Beziehung zu den Inhaftierten in Stammheim, als sie selbst dort einsaß und zu denen sie engen Kontakt hatte, da diese sie kurz vor ihrer Entlassung auf ihre zukünftigen Aufgaben in der Gruppe vorbereiteten.[xx] Außerdem war sie es, die die Verhandlungen mit Abu Hani, welcher eine Gruppe terroristischer Palästinenser anführte, zu führen, zwecks der Entführung der Lufthansa Maschine „Landshut“.[xxi] Josef Horchem, der Leiter des Hamburger Verfassungsschutzes vertrat bereits 1976 die Ansicht, dass die personelle Zusammensetzung der RAF und ähnlicher Gruppen beispiellos zu dieser Zeit war. Er begründete diese Aussage damit, dass Frauen nicht nur als Helfer, Kundschafter und Informanten den bewaffneten Widerstand unterstützten, sondern selbst zur Waffe griffen.[xxii] Dies war beispiellos zu dieser Zeit, da die Frau, wie schon zuvor analysiert, nur als Hilfsmittel zum Widerstand fungierte und nicht als ausführende Revolutionäre. Beispiele für die Richtigkeit der Aussage von Josef Horchem gibt es in der Geschichte der RAF zur Genüge. Beispielsweise erwähnte der Spiegel in einer Ausgabe von 1977 einen Banküberfall auf die National-Bank in Essen, bei welchem eine Frau die Anführerin war und ihren Genossen Anweisungen gab.[xxiii] Somit hatten sich die Frauen aus den ehemaligen Studentenbewegungen weiterentwickelt. Wie im Folgenden noch näher in den „Beitrittsgründe[n] der RAF-Frauen“ erwähnt, wurden Frauen auch dort nicht mehr geachtet als in der Gesellschaft. Das war in terroristischen Vereinigungen wie der RAF und der Bewegung 2. Juni anders. Sie waren für alle Aufgaben eingeteilt, die erfüllt werden mussten. Frauen schrieben Bekennerschreiben und gaben, sofern sie nicht selbst dem Untergrund angehörten, den Terroristen in ihren Wohnungen Asyl. Allerdings bauten sie ebenso Bomben, wirkten an Banküberfällen mit und platzierten Sprengstoffkörper an den ausgewählten Zielorten.
Andreas Baader wurde während seiner Haft 1970 von fünf Genossen befreit. Darunter waren allein vier Frauen: Brigitte Meinhof, Gudrun Ensslin, Irene Goergens und Ingrid Schubert.[xxiv] Die Frauen waren dabei eindeutig die ausführenden Kräfte. Hans Jürgen Bäcker, der fünfte Befreier Baaders, war nur der Fahrer des Fluchtautos. Das zeigt die zahlenmäßige Überlegenheit der weiblichen Mitglieder in der RAF. Doch nicht nur in dieser terroristischen Vereinigung war dieses Phänomen zu finden. Auch in der Bewegung 2. Juni waren Frauen in der Überzahl. Zuletzt, vor der Vereinigung mit der RAF, bestand sie sogar ausschließlich aus Frauen.
Psychologen beschäftigen sich seit der 70er Jahre mit dem „Warum“ dieser Tatsache. Warum konnten sich urplötzlich die Frauen so durchsetzten? Warum überließen die Männer ihnen ohne großen Widerstand die Führungsebene, oder gab es einen Widerstand, von dem die Öffentlichkeit nur nichts mitbekam? Der Kölner Soziologe Erwin K. Scheuch begründete diese Fragen damit, dass Frauen meist die intellektuell und charakterlich stärkeren Figuren wären.[xxv] Auch die weiblichen Mitglieder selbst erkannten ihre Überlegenheit. Gabriele Rollnik, ein Mitglied der Bewegung 2. Juni, gab selbst zu, dass sie und ihre Genossinnen in einigen Gebieten ihren männlichen Mitstreitern überlegen waren. Sie hätten sich den Notwendigkeiten der Illegalität besser anpassen können und wären mit schwierigen Situationen besser zurechtgekommen als die Männer.[xxvi] Auch andere terroristische Gruppen sahen diese Überlegenheit. Arabische Guerillas, welche die RAF-Terroristen im Guerillakampf trainierten, befanden Gudrun Ensslin als „really militant“, also als sehr kämpferisch, während sie die Männer eher als verachtend ansahen (unter anderem Andreas Baader als „a coward“, also als einen Feigling).
Gewaltbereitschaft der RAF-Frauen
„Dieser faschistische Staat ist darauf aus, uns alle zu töten. [...] Wir müssen Widerstand organisieren. Gewalt kann nur mit Gewalt beantwortet werden.“[xxvii] Dieses Zitat von Gudrun Ensslin macht deutlich, mit welcher Überzeugung sie gegen die Staatsgewalt vorging. Allein in dem letzten Satz lässt sie keinerlei Zweifel, dass auch sie als Frau zu Gewalttaten gegen den Staat und seine Befürworter bereit ist. Diese Überzeugung veranlasste Ensslin ebenso wie Ulrike Meinhof sogar dazu, ihre Kinder zu verlassen, welche sie Zeit ihres Lebens nicht mehr gesehen haben. Frauen, welche sich zuvor in den Studentenbewegungen lediglich um banale Aufgaben wie Plakate kleben und Kinderhüten beschäftigt hatten, ließen ihr altes Leben und ihre Familien hinter sich und griffen nun zur Waffen, womit sie zu ebenso gefürchteten Gegnern wie ihre männlichen Mitkämpfern wurden, wenn nicht noch gefährlicher als diese. Das Gerücht, nachdem es einen Befehl beim Bundeskriminalamt gab, zuerst auf die Frauen zu schießen, hält sich seit Jahrzehnten hartnäckig. Das Kuriose dabei ist, dass das BKA selbst dies zwar nie bestätigt, aber somit auch nie abgestritten hat.[xxviii] Diesen Befehl soll es nicht nur beim BKA gegeben haben, sondern auch von Interpol an andere europäische Einheiten erteilt worden sein.[xxix] Ein Grund, der für die Richtigkeit dieses Befehls spricht, ist, dass Frauen der terroristischen Vereinigungen, tatsächlich als gewaltbereiter als die Männer der Gruppen galten. Christian Loche, Leiter einer Verfassungsschutzabteilung zur Zeit der RAF, unterstütze diese Aussage, da seiner Erfahrung nach die Terroristinnen einen stärkeren Charakter, mehr Durchsetzungskraft und mehr Energie hätten. Es gäbe Beispiele dafür, dass Männer einen Moment zögerten, ehe sie schossen, während Frauen sofort abdrückten.[xxx] Diese Äußerung lässt sich perfekt auf die Frauen der RAF und der Bewegung 2. Juni übertragen. Ihre Präsenz bei der Befreiung von Andreas Baader bewies das, doch war das erst der Anfang. Bei der geplanten Entführung von Jürgen Ponto (welche aufgrund von enormer Gegenwehr Pontos mit dessen Erschießung endete), dem Vorstandssprecher der Dresdner Bank, trafen sich Susanne Albrecht, Brigitte Monhaupt, Elisabeth von Dyck, Sieglinde Hofmann, Christian Klar und Peter-Jürgen Boock.[xxxi] Dabei waren die dominierenden Mitglieder wieder einmal Frauen. Eine besonders brutale Rolle kam dabei Susanne Albrecht zu, die mit Jürgen Ponto gut bekannt war, da er ein Freund der Familie und seine Tochter eine Freundin von Albrecht war. Nur aus diesem Grund konnte das Eindringen in die Villa von Ponto gewährleistet werden. Diese Tat versetzte die Gesellschaft in Angst und Schrecken, welche der Spiegel passend mit den Worten „Wer käme schon auf den Gedanken, sich zum Meuchelmord mit Blumen anzusagen?“ betitelte.[xxxii] Sieglinde Hofmann bewies ihren Willen zum Kampf bei der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer, bei welcher sie von insgesamt 119 abgegebenen Schuss 39 aus ihrer Waffe abgab.[xxxiii]
Gründe für den Terrorismus
Vorbilder
Inge Viett zählt in ihrem Buch „Nie war ich furchtloser“ etliche Vorbilder der Bewegung 2. Juni auf, worunter sich eine Vielzahl von Revolutionären befand. Neben den allgemein bekannten Revolutionären wie Thomas Müntzer, Fidel Castro und Che Guevara nennt Viett auch die revolutionäre Politikerin Rosa Luxemburg, welche eine der führenden Theoretiker der revolutionären sozialistischen Partei Polens Ende des 19. Jahrhunderts war.[xxxiv] Diese Frau war besonders für Inge Viett ein Vorbild. Ihr Geburtsdatum war ihr unbekannt, da sie in einem Waisenhaus aufgewachsen war und so nannte sie den 15. Januar als ihren Geburtstag, da es der Todesstag Rosa Luxemburgs war.[xxxv] Sie identifizierte sich mit ihr.
Vorbilder waren sehr wichtig für die Guerillakämpfer, da sie ihnen Kraft gaben und den Mut, um ihren Kampf bis zum Ende fortzuführen, obwohl man schon Monate vor dem Ende der Bewegung 2. Juni und auch lange Zeit vor der Auflösung der RAF deren Scheitern erkennen konnte. Ob ihr unbändiger Kampfeswille, der sie die drohende Niederlage nicht mehr erkennen ließ, am Ende nun von Vorteil war oder ihnen nur unnötige Kämpfe mit der Polizei und somit auch unnötige Opfer auf beiden Seiten bescherte, darüber verliert selten ein ehemaliges Mitglied ein Wort.
Das Besondere bei den Vorbildern der RAF und der Bewegung 2. Juni war aber, dass sie andere terroristische Vereinigungen nie als solche nannten. Die im Vorwort genannten Gruppen waren zwar ähnlich aufgebaut und hatten auch ähnliche Beweggründe für ihren Kampf, und trotzdem identifizierten sich die deutschen Terrorgruppen nicht mit ihnen. Inge Viett nannte in ihrer Biografie etliche Vorbilder für die Bewegung 2. Juni, doch waren dies stets einzelne Persönlichkeiten und keine Vereinigungen. Der Grund könnte darin liegen, dass eine einzelne Person, die gegen ein ganzes Imperium kämpft, viel mehr Potenzial zu einem Vorbild hat als eine Gruppe, die aus mehreren Persönlichkeiten unterschiedlichen Charakters besteht. Viett führte unter anderem auch Robin Hood auf.[xxxvi] – eine Romanfigur, von der nicht bekannt ist, dass sie jemals gelebt hat, die jedoch mehr Potenzial bietet, als so mancher existierende Politiker. Er repräsentiert den Kampf für die unterdrückte Masse. Sein Leben gab er auf, um sich an den Reichen zu rächen und gleichzeitig die Armen zu unterstützen. Dies spiegelte in gewisser Weise auch die Absichten der Bewegung 2. Juni und der RAF wieder, welche, zahlenmäßig ebenso unterlegen, als eine Minderheit gegen die übermächtige und in ihrer Sicht falsch handelnde Regierung kämpften.
Beitrittsgründe der Frauen
Es gab für Frauen spezielle Gründe, sich dem Kampf gegen den, aus ihrer Sicht kapitalistischen, Staat anzuschließen. Einen Grund für den Terrorismus nannte Inge Viett in ihrer Biographie. Die „soziale Kälte einer herzlosen Kriegsgeneration“[xxxvii] führte nicht nur sie in die Illegalität, sondern auch Brigitte Meinhoff, welche schon in ihrer Zeit vor der RAF die gesellschaftlichen Missstände anklagte.[xxxviii] Die zuvor genannte soziale und politische Unterdrückung ließ den Frauen zu dieser Zeit nur die Wahl der gewaltsamen Gehörverschaffung. Die 68er Revolutionen ließen zwar auch weibliche Demonstranten zu, allerdings nur dem Schein nach. Innerhalb der Studentenbewegungen waren die Frauen nur aus einem Grunde heraus geduldet: Sie mussten die üblichen ihnen zugeschriebenen Aufgaben übernehmen. Für das leibliche Wohl der Männer sorgen und sich um die Kinder kümmern, während die Studenten zu ihren Protestaktionen gingen, waren exakt die gleichen Vorgaben, die ihnen die Gesellschaft auch außerhalb der Revolution vorschrieb. Der einzige Unterschied war nur, dass sie es zur Unterstützung des Widerstandes taten. So hatten die Frauen genau genommen keine andere Wahl. Wollten sie sich Gehör verschaffen, so ging das im Grunde nur durch die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung. Weiter die Unterdrückung durch Staat und Gesellschaft dulden kam für viele nicht in Frage. In ganz Deutschland konnten sie sich somit nur auf diesen Weg politisch engagieren. Gisela Diewald-Kerkmann, eine Historikerin an der Universität Bielefeld, die sich seit einiger Zeit mit dem Phänomen der weiblichen Terroristen beschäftigt, stützt diese These mit der Begründung, dass Frauen grundsätzlich weniger zu verlieren hätten als Männer.[xxxix] Es galt sich politisches Gehör zu verschaffen, sich den Vorgaben der Gesellschaft zu widersetzen und ein eigenständiges Leben aufbauen zu können, völlig frei von irgendwelchen Zwängen. Die Frauen hatten genau genommen nicht viel zu verlieren. Der Gefängnisaufenthalt entsprach für viele dem exakten Gleichnis ihres vorherigen Lebens, lediglich verpackt in ein weniger schönes Erscheinungsbild. Mussten sie zu Hause dem Ehemann gehorchen, so mussten sie dies im Gefängnis eben dem Wärter usw.
Allerdings war die Emanzipation der Frauen innerhalb terroristischer Gruppen nur ein notwendiger Nebeneffekt. Trotzdem wurde den Frauen der Bewegung 2. Juni und der RAF immer wieder vorgeworfen, ihr einziger Grund zur bewaffneten Revolution sei, die Emanzipation der Frau mit Waffengewalt durchzusetzen. Der ehemalige Verfassungsschutz-Chef Günther Nollau wertete das Verhalten der terroristischen Frauen als „Exzeß[sic!] der Befreiung der Frau“[xl]. Das sahen die Frauen selbst allerdings anders. Inge Viett äußerte sich in einem Interview dazu:
„Wir sind alle nicht aus der feministischen Bewegung gekommen. [...] Wir haben nicht bewusst so einen Frauenbefreiungsprozess für uns durchleben wollen. [...] Es war für uns keine Frage Mann-Frau. Das alte Rollenverständnis hat für uns in der Illegalität keine Rolle gespielt“[xli].
Und die Gesellschaft fand noch weitere Thesen, mit welchem sie unter allen Umständen widerlegen wollten, dass Frauen tatsächlich freiwillig und aus vollster politischer Überzeugung Gewalttaten begingen. Ganz oben auf der Liste der Motive stand die sexuelle Hörigkeit. Die Frauen wurden von einem Terroristen verführt, welcher sie schlussendlich zu den Gewalttaten zwang oder sie in dem Maße beeinflusste, dass sie es freiwillig für ihn taten. Damit waren alle Probleme gelöst: Die Männer waren letztendlich die Attentäter, die Frauen nur Opfer ihrer eigenen, überemotionalen Schwäche. Wieder spielten sie in den Augen der Gesellschaft ihre untergeordnete, hörige Rolle.[xlii] Manche Psychologen ließen die Emanzipation aber tatsächlich zur Sprache kommen. Allerdings interpretierten sie sie auf ihre eigene Art und Weise. Emanzipation galt in ihren Augen nicht als Kampf für die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung von Männern und Frauen, sondern lediglich als der Versuch der Frauen, männlicher zu wirken. „Nur mit der Waffe, dem klassischen Symbol der Männlichkeit, und nur mit besonderer Härte hätten die weiblichen Gruppenmitglieder die Vorstellung verwirklichen können, gänzlich emanzipierte Frauen zu sein“[xliii]. Mit diesen Worten wird der Psychoanalytiker Friedrich Hacker 1977 vom Spiegel zitiert. Dies war ein weiterer Versuch, die Terroristinnen nicht direkt als Frauen sehen zu müssen. Letztendlich war dies der selbst gebildete Schutz der Gesellschaft vor den weiblichen Terroristen.
Gemeinsamkeiten von Terroristinnen und Terroristen
Nicht nur die Vorbilder fungierten hauptsächlich für beide Geschlechter, auch bei den Beitrittsgründen gibt es viele Übereinstimmungen. Wie Inge Viett zuvor schon zitiert wurde, handeln Frauen der gleichen Überzeugung heraus, wie ihre männlichen Mitkämpfer. Das Entsetzen über den von der US-Regierung brutal geführten Vietnamkrieg und das Schah-Regime in Persien trieb die Menschen massenweise auf die Straßen. Durch die oft gewaltsamen Niederschlagungen der Demonstrationen sahen sich einige, vor allem junge und politisch engagierte Demonstranten gezwungen, ebenfalls mit Waffengewalt der Übermacht der Polizei entgegenzutreten. Der Tod des Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 gilt als die Geburtsstunde der gleichnamigen Bewegung 2. Juni und der RAF, die ab diesem Tag den bewaffneten Kampf gegen das, aus ihrer Sicht, kapitalistische Staatsgebilde ansagten. Waren diese terroristischen Bewegungen bis dorthin nur von einer geringen Größe (ca. 20 Mitglieder), erfreuten sie sich nach dem Hungertod von Holger Meins großem Zuwachs. Über sieben Wochen Nahrungsverweigerung ließen den 1.83 Meter großen RAF-Terroristen auf nur noch 39 Kilogramm abmagern, obwohl er zwangsernährt worden war.[xliv] Für die RAF, Bewegung 2. Juni und die Sympathisanten der Stadtguerilla-Gruppen war der Fall klar: Holger Meins wurde doch von der Justiz umgebracht. Sie gaben zwar zu, dass er zwangsernährt worden war, jedoch wurde ihm nur ein Bruchteil der benötigten Kalorienzahl zugeführt, sodass er letztendlich sterben musste. Sieben Wochen Nahrungsverweigerung zeugte von einer übermenschlichen Selbstbeherrschung. „Es sei das schlechte Gewissen gewesen – der da gibt sein Leben, und ich amüsiere mich –, das sie in die Arme der RAF trieb“[xlv]. Mit diesen Worten zitierte Die Zeit Silke Maier-Witt, die sich nach dem Tod von Holger Meins der RAF angeschlossen hatte und als Illegale in den Untergrund ging. Ohnmächtig, mitansehen zu müssen, wie ein Genosse sein Leben für seine Überzeugung gab, veranlasste viele Zweifler zum endgültigen Bruch mit der Gesellschaft und ihrem alten Leben. Dabei gab es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau.
Lebenslauf einer typischen Terroristin der RAF und der Bewegung 2. Juni
Das Besondere an den RAF-Frauen war und ist immer noch, dass sie sich im Großen und Ganzen sehr ähnelten. Nicht aufgrund ihrer Überzeugungen und Gewaltbereitschaft, sondern aufgrund ihres Lebenslaufes. So stellte der US-Politologe Richard Clutterbuck fest, dass neun von zehn Guerilla-Führern eine überdurchschnittliche Ausbildung genossen hätten.[xlvi] Genau dies lässt sich auch auf die RAF-Frauen übertragen. Ein Großteil von ihnen absolvierte zum Beispiel ein Studium. Gabrielle Rollnik, eine führende Persönlichkeit in der Bewegung 2. Juni hatte vor ihrer Entscheidung, sich einer terroristischen Vereinigung anzuschließen, an der Universität in Berlin Sozialarbeit studiert und hatte sogar eine Diplomarbeit geplant.[xlvii] Monika Berberich als eines der Gründungsmitglieder der RAF war ausgebildete Juristin und geriet über ihre Stelle bei Horst Mahler, ebenfalls ein frühes Mitglied der RAF, in die Illegalität. Auch Silke Maier-Witt besuchte eine Universität, an der sie Medizin und Psychologie studierte, bevor sie ihre Lebensplanung änderte.[xlviii] Diese drei Frauen sind nur ein Bruchteil derer, die sich der RAF oder der Bewegung 2. Juni angeschlossen hatten, nachdem sie mit ihrem bisherigen Leben unzufrieden waren. Natürlich hatten nicht alle weiblichen Mitglieder studiert, jedoch überragt die Zahl (in der BRD kämpfenden Untergrundorganisationen) auffallend stark. Viele der Frauen stammten zudem aus gutem Hause. Vor allem die Köpfe der RAF, wie Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof, genossen in ihrer Kindheit die Privilegien einer finanziell gesicherten und sozial stabilen Familie. Ensslin wuchs als Tochter eines Pfarrers in Baden-Württemberg auf, während Meinhof von einer sehr religiösen Pflegemutter aufgezogen wurde.[xlix] Somit kann man der Allgemeinheit dieser Frauen keine psychische Störung aufgrund einer lieblosen oder verwahrlosten Kindheit vorwerfen. Sie erhielten meist eine überdurchschnittlich gute Erziehung und Ausbildung als Töchter von Managern, Rechtsanwälten, Offizieren, Architekten oder Kaufmännern und entsprachen somit den Voraussetzungen der Gesellschaft.[l] Warum gerade gebildete Frauen sich der RAF anschlossen, begründete der Soziologe Erwin Scheuch mit der Aussage: „Je ethisch anspruchsvoller die Elternhäuser, je stärker die Sensibilisierung für Ungerechtigkeiten, um so extremer und vor allem um so plötzlicher der Ausbruch.“[li]
Darstellung der Terroristinnen in den Medien
Die plötzliche Beteiligung von Frauen an terroristischen Vereinigungen versetzte die deutsche Bevölkerung in einen Schockzustand. Eine Frau, die damals als liebevolle und zarte Ehefrau und Mutter galt, zeigte sich plötzlich als harte, kämpfende und skrupellose Kreatur. Das war kaum vorstellbar und brach mit allen bis dahin bekannten Regeln der Gesellschaft. Eine Welle der Panik erfasste das Volk, denn nun war niemand mehr sicher. Wer konnte versichern, dass die Frau neben einem im Bus keine Terroristin war und schon den nächsten Bombenanschlag plante? Terroristen galten bis dorthin als eiskalte Killer, doch eine Frau und Terrorismus – das passte nicht zusammen. Die Gesellschaft konnte und wollte es nicht verstehen und daher wurden die Terroristinnen als „Abnormalitäten“ dargestellt, die sie in deren Augen waren. Sie wurden von der Zeitschrift Der Spiegel als „Flintenweiber“ beschimpft und die Welt fasste die allgegenwärtige Angst in Worte, indem sie befürchtete, dass jeder Bürger in Zukunft damit rechnen müsse, dass ihm „der Tod in Gestalt eines jungen Mädchens gegenübertritt[!]“.[lii]
Allerdings wurde die Angst auch bekämpft, indem man die Tatsachen herunterspielte. Die gefährlichen Frauen wurden zu „Möchtegernheldinnen“ herabgestuft. Sie wurden verspottet und als träumende Mädchen dargestellt, die die Welt verbessern wollten. Der Spiegel beispielsweise bezeichnete Die RAF-Frauen als „weibliche Supermänner“[liii] und „Amazonen“[liv].
Dabei kämpften sie an zwei Fronten: Einerseits mit ihren männlichen Genossen gegen die Unterdrückung des Staates. Andererseits gegen die Gesellschaft, welche sie in eine Rolle stecken wollte, in die die Frauen nicht länger hineingedrängt werden wollten. Dieser Kampf machte sie zu stilisierten, rätselhaften, wilden und auf eine gewisse Weise sogar erotischen Heldinnen.[lv]Allerdings sahen das die Gegner der RAF und der Bewegung 2. Juni nicht so. Diese Frauen galten als die Verkörperung des Teufels. Sie wurden von der Gesellschaft nicht länger als Frauen wahrgenommen. Sie wurden als psychisch gestört dargestellt und meist auch als lesbisch. Anstatt über ihre Gräueltaten zu berichten, beschäftigten sich die Boulevardzeitungen mit der Sexualität der Terroristinnen oder ihren psychischen Problemen, welche sie zu ihrem „abnormalen“ Verhalten trieb. So titelte der Spiegel 1977 „Frauen im Untergrund: Etwas Irrationales“[lvi] und dient somit als Paradebeispiel für die Auffassung der Gesellschaft von weiblichen Terroristen.
Schluss
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Frauen der RAF und der Bewegung 2. Juni, aber auch jeder anderen terroristischen Vereinigung in den 60er und 70er Jahren, sich diesen Gruppen hauptsächlich aus dem Grund der politischen Ohnmacht angeschlossen haben. Sie wollten sich wie ihre männlichen Genossen politisches Gehör verschaffen und empfanden die Politik des Staates als ungerecht, unterdrückend und grundlegend falsch. Sie sahen zu dieser Zeit keine andere Möglichkeit, als den bewaffneten Kampf. Diese Seminararbeit soll jedoch keinesfalls die Taten der Terroristen rechtfertigen. Sie soll ausschließlich die besondere Position der Frauen in diesen Rollen herausarbeiten. Bis heute wird behauptet, dass es keine Unterschiede zwischen den Beweggründen von Frauen und Männern gab, einer terroristischen Vereinigung beizutreten. Doch gibt es diese eben doch, wie zuvor ausführlich analysiert wurde, auch wenn sie vielleicht von den Frauen selbst nicht als die Hauptgründe genannte werden.
Es wurde im Vorhergehenden deutlich gezeigt, dass Frauen durchaus zur Waffe greifen können und genauso brutal, ja teilweise brutaler als ihre männlichen Genossen, für ihre Überzeugungen kämpfen. Sie übernahmen Führungsrollen, ließen ihre Familien und sogar Kinder zurück. Wollte die Gesellschaft dies auch noch so sehr verbergen, sie mussten früher oder später zugeben, dass Frauen nicht länger die Rolle des braven Hausmütterchens spielen würden. Unfreiwillig halfen die Frauen der RAF und der Bewegung 2. Juni, die neue Frauenbewegung zu starten.
Literaturverzeichnis
Monografien
McDonald, Eileen: „Erschießt zuerst die Frauen!“, Die weibliche Seite des Terrorismus, Stuttgart 1994.
Pflieger, Klaus: Die Rote Armee Fraktion, 14.5.1970 bis 20.4.1998, 3.erweiterte und aktualisierte Auflage, Baden-Baden 2011
Viett, Inge: Nie war ich furchtloser, 2. Auflage, Österreich 1997
Frauen in der „Roten Armee Fraktion“. Weibliche Wege in den Linksterrorismus am Beispiel von Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin
Constanze Mey, 2006
Einleitung
„Keiner von uns ist als Terrorist geboren worden.“[lvii]
(Klaus Jünschke, ehemaliger Terrorist der „Roten Armee Fraktion“)
Wer sich mit dem Terrorismus der „Roten Armee Fraktion“ (RAF) beschäftigt, an die von der RAF verübten Anschläge denkt, ist, angesichts der Grausamkeit dieser Aktionen, häufig nicht mehr in der Lage oder gewillt, sich mit den Bedingungen des Linksterrorismus auseinanderzusetzen. Man will nicht mehr nach dem „Warum“ fragen, sondern die Menschen, die solche Verbrechen begangen haben, in ein „Gut-Böse-Schema“ einordnen und verurteilen. Doch die Terroristen stammen aus unserer Gesellschaft, sind in ihr sozialisiert worden und Teil dieser. Es stellt sich die Frage nach einem angemessenen Umgang mit Terrorismus in unserer Gesellschaft. Terrorismusbekämpfung durch die Exekutive ist sicherlich eine notwendige Antwort auf Terrorismus, aber für sich allein nicht ausreichend. Ergiebiger, mit Blick auf die Zukunft, scheint mir ein präventiver Ansatz zu sein, dessen Grundlage, Antwortversuche auf die Frage, warum Menschen aus unserer Gesellschaft zu Terroristen werden, bilden müssen. Nur wer die Bedingungen kennt, unter denen Terrorismus entsteht, kann jenseits von polarisierenden Klassifikationen auf diese Probleme eingehen. Hier könnte Geschichtswissenschaft wichtige Aufklärungsarbeit leisten.
Erschwert wird ein sachlicher Zugang durch die Zugehörigkeit der Geschichte der RAF zur Zeitgeschichte. Zeitgeschichte ist, wie Sabrow/Jesse/Große Kracht feststellen, häufig Streitgeschichte, d.h. Gegenstand nicht nur wissenschaftsinterner, sondern auch in der Öffentlichkeit geführter Debatten mit hohem Erregungspotential. Im Verlauf der vergangenen 30 Jahre wurde das Thema „RAF“ von Wissenschaft, Politik, Publizistik, Kunst und Gesellschaft nie völlig aus den Augen verloren. Immer wieder wurde dieses Thema mit hoher Erregtheit und häufig mangelnder Souveränität behandelt, was zu einem erheblichen Teil in dem genuin politischen Charakter des Phänomens „Terrorismus“ begründet lag. Wissenschaftler, die sich diesem Thema zuwandten, bemerkten, dass es sich dabei um keinen „normalen“ Forschungsgegenstand handelte, da ihre Untersuchungen in einem Feld politischer Polarisierung stattfanden, in dem es schwierig war, differenzierten Standpunkten und Denkweisen Geltung zu verschaffen. Die Position des Verstehens kann in einer derartigen Situation aus der Sicht vieler nur den Sinn einer Entlastung der Terroristen haben und rückt diejenigen, die versuchen zu verstehen, in Sympathisantennähe. Verständnis muss keine Rechtfertigung oder Verharmlosung der Taten implizieren. Dass, wer auf Erkenntnis nicht von vornherein verzichten will, die Perspektive von Terroristen rekonstruieren muss und dies nur durch Einfühlung und Identifikation erreichen wird, wird zwar von Eckert erwähnt, aber sonst regelmäßig übersehen.[lviii] Es ist also, wie auch Wittke bemängelt, eine schon viel zu lange in erheblichen Teilen der wissenschaftlichen Literatur aus Gründen einer „pflichtbewußten Pauschalverdammnis des Terrorismus“[lix] versäumte Notwendigkeit, die Terroristen nicht zu dämonisieren, sondern sich in sie „hineinzuversetzen“. Diese mangelnde Souveränität beklagt auch Kraushaar, wenn er sich mit den Reaktionen auf die 2003 bekannt gewordenen Pläne zur Kunstausstellung „Zur Vorstellung des Terrors. Die RAF“[lx] beschäftigt. Kraushaar urteilt über die heutige Situation meines Erachtens zu Recht: „Eine überaus neurotische Grundreaktion bleibt offenbar bestimmend.“[lxi] Davon bleibt man beim Abfassen einer Arbeit über die RAF nicht unbeeindruckt, so dass Selbstreflexion helfen kann, inmitten einer stark emotionalisierten, polarisierten Auseinandersetzung, sich der eigenen Position, aber auch Standortgebundenheit bewusst zu werden und nach dem Verstehen wieder eine kritische Distanz zum Forschungsobjekt herzustellen.
In meiner Arbeit werde ich mich anhand ausgewählter Beispiele mit den weiblichen Wegen in den Linksterrorismus der RAF beschäftigen. Die Beteiligung von Frauen am RAF-Terrorismus hat von Anfang an besonderes Interesse in Publizistik und wissenschaftlicher Forschung hervorgerufen, und dies wohl nicht zuletzt aus dem Grund, dass Frauen als Terroristinnen anscheinend aus dem tradierten Frauenbild herausfielen. Sie konterkarierten in verschiedener Hinsicht die gesellschaftlichen Erwartungen, u.a. weil ihre Beteiligung am Linksterrorismus mit zwischen 33%[lxii], 50%[lxiii] und 60%[lxiv] veranschlagt wird, der Anteil weiblicher Täter an der allgemeinen Kriminalität in der BRD in den Jahren 1967 bis 1977 im Unterschied dazu aber nur 11,3% bis 14,9% betrug[lxv]. Die RAF ohne Frauen ist nicht nur für Koenen unvorstellbar.[lxvi] Sie prägen das öffentliche Bild von der RAF. Ihre „glatten Mädchengesichter“[lxvii] auf den Fahndungsplakaten irritierten viele. Die Suche nach Antworten auf die Frage, warum Frauen Terroristinnen werden, trieb teilweise abstruse und diffamierende Blüten. Die publizistischen, aber auch vermeintlich wissenschaftlichen Reaktionen fallen häufig dementsprechend aus. „Der Spiegel“ titelte z.B. 1977 „Frauen im Untergrund: Etwas Irrationales“[lxviii] und der Soziologieprofessor Erwin Scheuch wies nicht als einziger darauf hin, dass „den Führerinnen der Baader-Meinhofs [...] lesbische Neigungen nachgesagt“[lxix] wurden. Da in dieser Arbeit kein Raum für eine umfassende Untersuchung aller weiblichen Wege in den Linksterrorismus der RAF oder auch nur die der Ersten Generation[lxx] ist, werde ich mich auf die Wege Ulrike Meinhofs und Gudrun Ensslins beschränken. Ich habe mich aus verschiedenen Gründen für diese beiden Frauen entschieden. Beide gehörten zur Gründergeneration, so dass sie trotz ihres Altersunterschiedes ähnliche gesellschaftspolitische Sozialisationserfahrungen machen konnten. Sie waren führende Gruppenmitglieder und sind auch heute noch die bekanntesten Frauen der RAF. Sie werden häufig miteinander verglichen und mindestens einen Berührungspunkt bildet dabei das Problem, zu verstehen: Wie konnten diese beiden aus gutbürgerlichen Verhältnissen stammenden, intelligenten, gebildeten und sozial engagierten Frauen, die etablierte Journalistin Meinhof und die Pfarrerstochter und Studentin Ensslin Terroristinnen werden? Außerdem wurde die Gruppe unter der von verschiedener Seite verwandten Bezeichnung „Baader-Meinhof-Gruppe“[lxxi] bekannt, wobei Peters und Aust anmerken, dass, hätte der Name die tatsächlichen Führungsverhältnisse reflektieren sollen, die Gruppe „Baader-Ensslin-Gruppe“ hätte genannt werden müssen.[lxxii] Für eine Untersuchung Meinhofs spricht auch die gute Quellenlage, da sie in ihrer über zehnjährigen Tätigkeit als politische Journalistin weit über 100 Texte verfasst hat, die zur Analyse herangezogen werden können. Außerdem wurde über Meinhof im Vergleich zu allen anderen RAF-Terroristinnen am meisten Literatur publiziert. Auf Seiten der RAF-Frauen folgt ihr hinsichtlich der vorteilhaften Literatursituation Ensslin – zwar mit einigem Abstand, aber immer noch umfassender erforscht, als die Biografien der anderen RAF-Frauen.
Wer sich mit der RAF beschäftigt, stößt unweigerlich auf ein weiteres Problem: die Mythisierung der RAF, insbesondere der Gründergeneration, und zwar hier v.a. Baader, Meinhof und Ensslin. Diese Mythen, erzeugt durch die RAF selbst, ihre Sympathisanten, Medien, Politik und Öffentlichkeit zu untersuchen, dürfte ein lohnendes Forschungsvorhaben darstellen. Schon Aust hat darauf hingewiesen, dass die RAF oftmals als Projektionsfläche für Wünsche und Hoffnungen, Ängste und Hassgefühle diente. Für mich folgt aus der Mythisierung vor allem eine Konsequenz: erhöhte Vorsicht im Umgang mit den Bildern anderer, von Meinhof und Ensslin und der RAF im Allgemeinen. Auch Krebs weist auf den Umstand hin, dass er bei der Beschäftigung mit Meinhof das Gefühl hatte, es eher mit einer durch die Erinnerung überhöhten und von den Medien kreierten Figur als mit einem realen Menschen zu tun zu haben.[lxxiii]
Nicht zuletzt, um diesem „Mythos RAF“ meine eigene Erfahrung entgegensetzen zu können, aber auch um besser zu „verstehen“, um nicht nur von Unbeteiligten über die RAF zu lesen, sondern von einer Beteiligten direkt etwas über ihren persönlichen Weg zu erfahren, habe ich mich bemüht, ein Zeitzeugengespräch mit der ehemaligen RAF-Terroristin Astrid Proll zu arrangieren, was mir jedoch leider nicht gelungen ist. A. Proll gab an, nicht jeden Interviewwunsch erfüllen zu können und meinte: „Zeitzeugen sind Menschen und keine Maschinen, sie sind nicht immer willig und abrufbar, wenn sie zur journalistischen und historischen Darstellung gebeten werden.“[lxxiv] Außerdem empfahl sie mir, meinen Titel zu überdenken: „Wege in den Linksterrorismus klingt emotionslos, ist aber aktuell hochgefährlich.“[lxxv] Die Erfahrung der Schwierigkeit, die Gesprächsbereitschaft ehemaliger RAF-Terroristen zu wecken, ist offensichtlich nichts Singuläres. Wunschik und Straßner berichten Ähnliches, was bedauerlich ist, da der über terroristische Organisationen forschende Wissenschaftler in besonderem Maße auf Zeitzeugenaussagen angewiesen ist, versuchen diese Organisationen doch besonders konsequent ihr Innenleben gegenüber der Umwelt abzuschirmen. Straßner weist auf das Misstrauen Inhaftierter, aber auch ehemaliger RAF-Terroristen gegenüber dem Wissenschaftsbetrieb hin. Analysen aus diesem Bereich würden des Öfteren als ideologisch gefärbte Propaganda mit dem Ziel, die RAF auf dem „Kehrichthaufen der Geschichte“ (Trotzki) abzuladen, abgekanzelt.[lxxvi] Die Befürchtung, der Linksterrorismus könne auf diesem „Kehrichthaufen“ abgeladen werden, das Ringen um die Bedeutung der eigenen „Mission“ – trotz A. Prolls persönlicher Abkehr von der RAF – scheint mir auch in Prolls Worten durchzuscheinen. Backes/Jesse weisen daraufhin, dass in der gegenwärtigen Situation der Linksterrorismus an Boden verliert, der Rechtsterrorismus möglicherweise an dessen Stelle rückt. Die Zahl der Gewalttaten mit linksextremistischem Hintergrund ist seit 1993 rückläufig.[lxxvii] Zudem ist spätestens seit dem 11.09.2001 die Gefahr, die von religiös-fundamentalistischem Terrorismus ausgeht, in den Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. A. Prolls Hinweis auf die aktuelle Brisanz des Linksterrorismus erscheint mir vor diesem Hintergrund als nicht ganz zutreffend.
Die Erforschung des Terrorismus hat demnach mit einer Fülle von Problemen zu tun, die sich zwangsläufig in der Literatur niederschlagen. Kraushaar spricht auch die sogenannten „weißen Flecken in der Geschichte des bundesdeutschen Terrorismus“[lxxviii], z.B. im Zusammenhang mit der Gründung der RAF, an und weist damit auf den nach wie vor lückenhaften Forschungsstand hin. Auch Neidhardt erwähnt die Rekonstruktionsprobleme in Bezug auf die innere Entwicklung der Beteiligten in den Monaten vor der Baader-Befreiung.[lxxix] Christoph Stölzl, der ehemalige Direktor des Deutschen Historischen Museums, irrt meines Erachtens, wenn er meint,
„was Geschichtswissenschaft und Publizistik, was Theater, Film, [...] Fernsehspiel klären und erklären können, ist bereits getan [...]. Alles Neubefragen wird nichts daran ändern, dass bei der RAF der Anteil des schieren Verbrechens so überwältigend war, dass alles Hin- und Herwenden der abstrusen ‚politischen’ Legitimierungsversuche im Nichts endet.“[lxxx]
Meiner Ansicht nach ist es vielmehr so, dass sich die Geschichtswissenschaft bisher vor einer Beschäftigung mit dem RAF-Terrorismus gescheut hat und dass auch aus diesem Grund kaum geschichtswissenschaftliche Publikationen zu diesem Thema vorliegen. In geschichtswissenschaftlichen Überblicks-darstellungen[lxxxi] werden Linksterrorismus und RAF zwar häufig behandelt, aber die Literaturangaben führen meist aus dem Bereich geschichtswissenschaftlicher Publikationen heraus. Kielmannsegg, der die RAF in „Der lange Weg nach Westen“ zwar berücksichtigt, zieht sich dann auf einen meiner Ansicht nach zu engen Geschichtsbegriff zurück, wenn er schreibt, dass die Beschäftigung mit der Frage, wie es zu dem Umschlagen ursprünglich moralischer Impulse in Unmenschlichkeit kommen konnte, „nicht mehr das Feld des Historikers“[lxxxii] sei. Die bisherigen Publikationen stammen aus den verschiedensten Fachrichtungen (v.a. der Politikwissenschaft) und sind häufig eher interdisziplinär ausgerichtet. Eine multiperspektivischen Ansprüchen genügende Geschichte der RAF steht nach Kirsch noch aus.[lxxxiii]